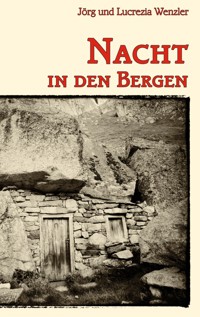
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein heftiger Schneesturm in den winterlichen Pyrenäen zwingt an einem Weihnachtsabend fünf völlig verschiedene Menschen dazu, in einer einfachen Schutzhütte Zuflucht zu suchen. Ein junges Paar und drei zwielichtige, düstere Männer verbringen eine gemeinsame Nacht nicht nur mit dem Erzählen von Geschichten ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JÖRG WENZLER ist eine Art »Hans Dampf in allen Gassen« des Theaterbetriebs. Studiert hat er in Hannover (Sozialwissenschaften, abgebrochen) und Berlin (Gesang/Musiktheater), eine Schauspiel- und Bühnenregieausbildung absolvierte er in New York, war Mitinhaber einer Schule für Bühnentanz und Theater in Straßburg und kehrte von dort vor Jahren in seine Heimat am Rande des Schwarzwalds zurück. Hier war er lange Zeit in vielen Funktionen am Theater tätig und leitete mehrere Chöre. Er gibt Gesang- und Schauspielunterricht, schreibt Musikkritiken und anderes und genießt mit Frau und Tochter das nicht immer einfache Dasein eines Mehrfachbegabten.
LUCREZIA WENZLER geht mittlerweile (Nov. 2023) in die zehnte Klasse der Schwenninger Waldorfschule: „Ich lese für mein LEBEN gern und habe schon früh angefangen, mir Geschichten auszudenken und aufzuschreiben. Außerdem spiele ich Klavier und Orgel, betreibe Judo und verbringe gerne (sic!) Zeit mit meinen Eltern.“
Für Claudia
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Nachwort
I
Schwer atmend, mit rasendem Herzklopfen blieb er stehen. O là là, den Weg durch die Berge hatte er sich einfacher vorgestellt. Nein, in Bestform war er wirklich nicht mehr. Zum Glück hatte er vor einem guten Jahr aufgehört, zu Rauchen, sonst hätte er es sicher nicht einmal bis hierher geschafft. Nur langsam beruhigten sich Atem und Herzschlag. Er drehte sich um und blickte den Weg zurück, den er gekommen war. Weiß. Alles war weiß. Merde. Wer hätte auch ahnen können, dass das Wetter so schnell umschlagen würde? Na, er auf jeden Fall nicht. Die Berge waren absolut nicht seine Welt, und mit ihren Gesetzmäßigkeiten kannte er sich nun einmal nicht aus. Noch an diesem Morgen war es lediglich trübe und kalt gewesen. Und dann war innerhalb weniger Stunden überraschend der Winter eingebrochen. Und was für ein Winter! Er seufzte. Im tiefen Schnee konnte er die beinahe schnurgerade Linie seiner Fußstapfen erkennen, die sich weiter unten im Dunst verlor. Die Berge, diese verdammten Berge hatte er ganz gewaltig unterschätzt. Der Aufstieg entlang des Gave d’Arrens hatte sich als wesentlich steiler erwiesen, als es von unten den Anschein gehabt hatte. Selber schuld. Er hätte den Weg ja vorher einmal gehen können, dann wäre er besser vorbereitet gewesen. Oder zumindest hätte er eine Vorstellung davon gehabt, was ihn erwartete.
Die Tragriemen seines Rucksacks drückten schwer auf seine Schultern. Auch ein Problem, dass er nicht hatte vorhersehen können. Ja, gut, der Tipp von Louis war wie gewohnt ganz ausgezeichnet gewesen. Im Tresor der Banque Populaire in Pau hatten sich tatsächlich zwei Millionen Euro befunden, die er nur hatte einpacken müssen. Dummerweise hatte Louis ihm nicht gesagt, dass diese zwei Millionen aus zu handlichen Paketen abgepackten Hundertern und Fünfziger bestanden, und die machten sich nun mit ihren gut dreißig Kilo Gewicht auf seinem Rücken deutlich bemerkbar.
Außerdem hatte er längst keine Ahnung mehr, wo genau er sich überhaupt befand. Lediglich das zu seiner Rechten markant und gewaltig aus dem nebligen Dunst emporragende Balaïtous-Massiv zeigte ihm, dass er noch immer in die richtige Richtung marschierte. Gut, eigentlich müsste es ja einfach sein, den Weg zu halten, denn schließlich befand er sich am Grund eines Einschnitts, der direkt auf die Passhöhe des Port de la Peyre Saint-Martin zuführte. Zumindest hatte er sich das so gedacht. Dummerweise verlief der Weg, wenn er in diesem verdammten Schnee denn überhaupt einmal zu erkennen war, eben nicht am Talgrund, sondern oft auf halber Höhe am Berghang. Zumindest fühlte es sich so an, denn zu sehen war ja nun wirklich nicht viel. Letztendlich war das, was er hier durchlitt, eine einzige Schinderei im knie- bis hüfthohen Schnee, während gleichzeitig der Wind kalt und schneidend durch die einsame Bergwelt pfiff. Wenigstens hatte er bei seinen Vorbereitungen daran gedacht, sich mit warmer Kleidung zu versehen, sonst wäre er sicher längst erfroren.
Er seufzte, rückte seine gefütterte Kapuze zurecht, dann ging er weiter. Nach wenigen Minuten wurde der unaufhörliche Tanz der Schneeflocken im Wind wieder dichter. ›Gut‹, dachte er, ›das wird hoffentlich die Spuren verwischen.‹ Und tatsächlich: Als er sich noch einmal umdrehte, waren seine Spuren kaum noch zu erkennen. Dummerweise sah er aber auch kaum weiter als zwanzig Schritte, und die Mischung aus dichtem Schneetreiben, weiß verschneiter Landschaft und einsetzender Dämmerung sorgte zuverlässig dafür, dass er innerhalb kürzester Zeit vollständig die Orientierung verlor.
Zu allem Unglück gab plötzlich der Schnee unter ihm nach, und mit Karacho sauste er den Hang hinab, durchschlug eine Eisdecke und landete mit einem gewaltigen Platsch in eisigem Wasser. Sein Atem stockte, als die stechend kalte Nässe durch seine Kleidung drang und seine Haut berührte. Jacques Benoît aus Nîmes, bekannt für seine ausgeklügelten Bankeinbrüche (zuletzt überaus erfolgreich in die Hauptstelle der Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique in Pau), die er grundsätzlich mit Hilfe minutiös geplanter und professionell ausgeführter Tunnel durchführte, wofür er in einschlägigen Kreisen unter dem Namen Jacqot le taupe bekannt war, hatte sich nicht nur in der wilden Gebirgswelt der Pyrenäen verirrt. Er war obendrein im größeren zweier Bergseen namens Lacs de Remoulis eingetaucht und bis auf die Haut durchnässt.
Prustend und bibbernd kletterte Jacques aus dem Wasser und setzte sich in den Schnee. Glücklicherweise war der See nicht besonders tief, sonst hätte der schwere Rucksack ihn höchstwahrscheinlich hinabgezogen und ertränkt. Doch durchnässt wie er war, drohte er nun, zu erfrieren. Er musste dringend einen Unterschlupf finden, sonst war es aus mit ihm. Jacques zitterte, als er mühsam aufstand und sich den Hang hinaufarbeitete. Zurück konnte er nicht, denn der Weg, den er genommen hatte, führte durch nichts als einsame Bergwelt. Er musste weiter, in der Hoffnung, eine Hütte oder so etwas zu finden, wo es warm und trocken war. Auf jeden Fall musste er in Bewegung bleiben, um nicht zu erfrieren. Schlotternd vor Kälte raffte Jacques sich auf und stapfte durch den Schnee, immer weiter, der Passhöhe entgegen.
II
Josep betrachtete Mireia voller Sorge. Sie schlief sehr unruhig, atmete schwer, stöhnte immer wieder, und ihr Gesicht war nass vom Schweiß. Was sollte er nur tun? Er konnte sie unmöglich zurückbringen, über den Pass, auf keinen Fall, nicht bei dem Schneesturm, der dort draußen tobte. Er blickte sich in dem kleinen Raum um. Es war eine einfache Schutzhütte, wie sie hier in den Pyrenäen häufig anzutreffen waren. Eigentlich eher so etwas wie künstliche Höhlen, dienten sie ursprünglich Hirten als Unterstand, wenn das Wetter umschlug. Beinahe wie ein Hünengrab sah dieser abri von außen aus. Mit gewaltigen aufeinandergeschichteten Monolithen und grob gemauerten Wänden. Sonst nichts. Gut, wenn man es recht bedachte, war ihre Zuflucht erstaunlich komfortabel ausgestattet, mit einer einfachen, klapprigen Holztür und einem rostigen, aber funktionsfähigen Ofen mit einem Rauchabzug. Sogar ein Stapel Holz hatte bereit gelegen, und so hatte Josep sofort ein Feuer gemacht. Inzwischen roch es in dem steinernen Raum zwar ziemlich nach Rauch, denn der Sturm pfiff immer wütend durch den krummen Kamin, was den Rauchabzug stark beeinträchtigte. Aber dafür, dass sie sich in einer primitiven Schutzhütte im Gebirge auf über zweitausend Metern Höhe inmitten eines Schneesturms befanden, war es beinahe angenehm warm. Es gab nun einmal Situationen, da mussten alle Ansprüche zurückgeschraubt werden.
Immer wieder, wenn ein heftiger Windstoß gegen die Wände anblies, also eigentlich dauernd, klapperte die Holztür, als würde sie gleich zusammenbrechen. Doch sie hielt, und Josep fühlte sich beinahe sicher und geborgen. Nur Mireia machte ihm Sorgen. Warum nur hatte er ihr nachgegeben und war mit ihr in ihrem Zustand auf den Pass gestiegen? Allein der Gedanke war schon Wahnsinn: hochschwanger im Gebirge herumzuwandern. Er hätte sie zurückhalten müssen, hätte sie davon überzeugen müssen, wie gefährlich ihr Vorhaben war. Doch wenn Mireia sich irgendetwas vorgenommen hatte, war nichts und niemand imstande, sie davon abzubringen. Sie hatte den Dickschädel und das Durchsetzungsvermögen eines dieser kleinen zähen Esel, die sogar heute noch in den Gebirgsdörfern der Pyrenäen als zuverlässige Arbeitstiere benutzt wurden. Und sie hatte eben genug davon gehabt, in diesem refugio, dieser Berghütte für Wanderer auf der spanischen Passseite festzusitzen, die sie den Winter über bewirteten, oder eigentlich eher bewachten, denn bisher war noch kein Gast in die Einsamkeit der winterlichen Bergwelt vorgedrungen. Deswegen hatte es Mireia eben nach draußen gedrängt, an die frische Luft. Sie wollte »die Freiheit atmen«, wie sie es nannte.
»Stell dich doch nicht so an, meu amor«, hatte sie gesagt. »Es ist lediglich ein kleiner Spaziergang, und das Wetter ist herrlich.«
War es ja auch gewesen, das Wetter. Herrlich, ja. Zunächst einmal. Drüben, auf der anderen Seite. Die Sonne hatte geschienen. Aber hier, in França, waren sie dann urplötzlich von einem Schneesturm überrascht worden. Zu allem Unglück war Mireia gestürzt, hatte sich am Knöchel verletzt, und sie konnten nicht mehr zurück. Glücklicherweise hatte der alte Joan, der dritte Hüttenwächter, ihnen, bevor sie losgegangen waren, von dieser Schutzhütte erzählt.
»Joan, was bist du für ein elender Angsthase«, hatte Mireia ihn verspottet. »Wir gehen einfach nur mal so kurz über den Pass und kommen dann sofort wieder zurück. Ein, zwei, vielleicht drei Stunden, länger dauert das nicht. Sei ehrlich: Wozu brauchen wir da eine Schutzhütte?«
Jetzt war zumindest er heilfroh über die Geschichten und Ratschläge des Alten. Er, Josep, kam aus Barcelona, er war ein Stadtmensch, durch und durch. Vom Leben im Gebirge und den damit verbundenen Gefahren hatte er nicht die geringste Ahnung. Woher auch?
Mireia hingegen stammte aus Villanúa, einem kleinen Pyrenäennest mit gerade mal ein paar hundert Einwohnern. Eine echte »Gebirgsziege«, eine cabra de muntanya, wie sie sich nannte. Sie war im Gebirge groß geworden, sie wusste über die Lebensumstände Bescheid, und wenn so jemand sagte: »Hoch zum Pass und wieder runter, das schadet mir nicht, auch wenn ich schwanger bin. Stell dich nicht so an, ich weiß, was ich tu« ... déu meu, was hätte er dem entgegensetzen können?
Und jetzt saßen sie hier in diesem Loch und kamen nicht mehr weg. Ein Mobiltelefon hatten sie auch nicht dabei. Aber das hätte ihnen ohnehin nichts genützt, denn hier oben gab es Berge, Schnee, Wind und Wetter, alles, nur eben kein Netz.
Josep zuckte zusammen, als Mireia laut stöhnte. Was, wenn sie ihr Kind hier oben, in dieser Andeutung einer Schutzhütte zur Welt bringen würde? Kein Arzt, keine Hebamme, er allein als einzige Unterstützung? Er, der schon in Ohnmacht zu fallen drohte, wenn sich jemand in seiner Gegenwart in den Finger schnitt. Eine Katastrophe wäre das. Ein absolutes Desaster!
Wenn nur Joan mitgekommen wäre. Als alter Veteran der Bergwacht, der rescat de muntanya, wüsste er sicher, was zu tun wäre, wie man Mireia trotz verletztem Knöchel wieder nach drüben in ihr Winterquartier bringen könnte. Joan wusste wirklich alles, was für das Leben in den Bergen wichtig war, und wenn man seinen Erzählungen trauen konnte, hatte er sogar schon mehr als ein Kind unter den abenteuerlichsten Bedingungen zur Welt gebracht. Zumindest behauptete Joan das regelmäßig nach dem sechsten, siebten oder achten Glas Anis.
Plötzlich ruckelte es an der schiefen, klapprigen Holztür. Jemand versuchte ganz offenbar, hereinzukommen. Josep sprang auf und zog kräftig am Griff, woraufhin die Tür dann auch nachgab und sich mit laut protestierendem Quietschen nach innen öffnete. Ein kalter, von Schneeflocken erfüllter Windstoß drang in den abri ein und vertrieb in Sekundenschnelle die von dem kleinen Feuer so mühsam erzeugte Wärme. Gleichzeitig drängte sich ein mittelgroßer, in vor Nässe triefender Kleidung gehüllter, am ganzen Leib zitternder Mann in den kleinen Raum.
»Bonsoir«, sagte er mit heiserer Stimme, während er begann, den Schnee von seinem Körper abzuklopfen. »Mein Name ist Jacques, und ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich mich bei euch ein klein wenig aufwärme.«
III
Unentwegt stapfte Pol durch den tiefen Schnee. Er war wütend, richtig sauer war er. Na ja, so sauer, wie Pol eben sein konnte, denn eigentlich verfügte er über einen äußerst gutmütigen und ausgeglichenen Charakter. Wobei er gleichzeitig von eher robustem, beinahe bedrohlichem Äußeren war, letzteres vor allem dann, wenn man ihm in der Dämmerung im Wald begegnete: Groß und breit, mit wild wucherndem, dunklem Haar und einem zottigen Bart, der bis auf seine Brust reichte, glich er einem wilden, höchst gefährlichen Waldmenschen. Seine Stimme war entsprechend tief und brummig, was auch daran liegen mochte, dass er sie eher selten benutzte, denn als ausgeprägter Einzelgänger mied er den Umgang mit anderen Menschen und beschränkte diesen auf ein wirklich unumgängliches Minimum. Dennoch geschah es hin und wieder, dass er bei diesen seltenen Begegnungen enttäuscht wurde. Und so war es auch dieses Mal wieder gewesen, mit diesem francès. Dieser Idiot hatte Felle bei ihm bestellt, dazu ein Zwölfender-Hirschgeweih. Was Pol etwas befremdlich vorgekommen war, denn eigentlich war ein Hirschgeweih doch eine Jagdtrophäe, die sich ein Mann dadurch verdiente, dass er den Hirsch aufspürte, verfolgte, stellte und eigenhändig tötete, um schließlich das Geweih stolz als Zeichen seiner Männlichkeit zu präsentieren. Diese Sichtweise mochte vielleicht etwas archaisch sein, auch wenn Pol nicht gewusst hätte, was dieses Wort bedeutet – Worte waren ohnehin nicht seine besten Freunde –, doch für Pol war sie selbstverständlich, und er hatte keinerlei Schwierigkeiten, sie gutzuheißen. Aber eine solche Jagdtrophäe zu kaufen und sie dann womöglich im Salon einer protzigen Villa aufzuhängen, um mit der unverdienten Trophäe zu prahlen – allein den Gedanken fand Pol absurd. Ganz davon abgesehen, dass es verdammt sperrig war, dieses Geweih, wenn man es über verschneite Gebirgspfade zu tragen hatte. Er hatte es auf den Rücken geschnallt, um die Hände frei zu haben. Ständig zog es ihn nach hinten, schlug gegen seinen Kopf, stach ihn mit den Spitzen der Enden. Pol war sich gar nicht bewusst gewesen, wie spitz diese Geweihenden sein konnten!
Und dann hatte dieser Kunde es so entsetzlich eilig gehabt und auf ›schnellste Erledigung seines Auftrags‹ gedrängt. Aber wer war dann zum vereinbarten Treffen gar nicht erst aufgetaucht? Gut, Pol hatte keine Probleme damit, wenn sich so ein Geschäftspartner verspätete. Er war nun einmal in einer Branche tätig, die es mit sich brachte, regelmäßig von Polizei, Wildhütern oder Zöllnern behindert zu werden, da war es völlig selbstverständlich, dass nicht alle Abläufe immer vorhersehbar waren. Natürlich wurde unter diesen Voraussetzungen Pünktlichkeit zu einem sehr dehnbaren Begriff, aber dieser francès hatte sich nicht einfach so verspätet, nein, er war gar nicht erst aufgetaucht! Pol war kurz vor der vereinbarten Uhrzeit am Treffpunkt angekommen, und zwar als Erster, denn die frische Schneedecke war absolut unberührt. Also hatte er gewartet. Drei geschlagene Stunden lang. Und nein, er hatte grundsätzlich keine Schwierigkeiten zu warten. Bei der Jagd brauchte er auch viel Geduld, denn nur allzu oft kam es vor, dass er stundenlang auf dem Ansitz saß.
Aber auch nach diesen endlosen, eiskalten drei Stunden war der francès nicht aufgetaucht, und langsam musste Pol daran denken, wieder zurückzukehren auf die spanische Seite der Berge. Mittlerweile war das Schneetreiben immer dichter geworden, so dicht, dass er keine zehn Meter weit sehen konnte und es eigentlich nicht sehr ratsam erschien, den Pass zu überqueren. Aber er war in den Bergen geboren und aufgewachsen, hatte sie niemals für längere Zeit verlassen. Er kannte sich hier aus, wusste, was er wagen konnte. Darum dachte Pol nicht lange nach, sondern packte sein Bündel mit Fellen und Geweih und ging den Weg zurück, den er drei Stunden zuvor gekommen war.
***
Pol gab auf. Nein, dieser Steig war sogar für ihn unpassierbar, dazu blies der Wind zu stark und die Schneeverwehungen waren bei Weitem zu hoch. Und der wirklich schwierige Anstieg lag noch vor ihm. Nein, er musste umkehren und den Weg über den Peyre Saint-Martin nehmen, alles andere war undenkbar. Ja, natürlich war das ein Umweg, und er würde es niemals bis nach Hause schaffen, aber am Peyre Saint-Martin gab es einen vergleichsweise gut ausgestatteten abri, dort konnte er übernachten und dann am anderen Morgen weitergehen. Bis dahin, hoffte er, sollte sich das Wetter beruhigt haben. Außerdem musste er dieses verflixte Hirschgeweih loswerden. An seinem Rückweg hinunter zum Abzweig, der hinauf zum Peyre Saint-Martin führte, gab es eine kleine gruta, eine Grotte, wo er es verstecken konnte. Pol stieß ein brummiges Lachen aus. Verstecken vor wem? Erstens kannte kaum jemand diesen Steig, zweitens würde in diesem Winter ohnehin niemand hier entlang gehen. Und drittens: Wer hatte schon Verwendung für ein Zwölfender-Geweih, das er nicht eigenhändig erjagt hatte?
Er drehte um und stieg denselben Weg wieder hinunter, den er gerade eben gekommen war. Verdammter Mist. Der Schnee fiel so dicht, dass seine Fußspuren schon wieder zugeschneit waren. Also musste er sich einen neuen Pfad bahnen. Hoffentlich fand er in diesem Schneetreiben die gruta,





























