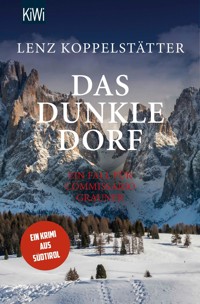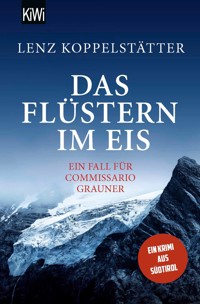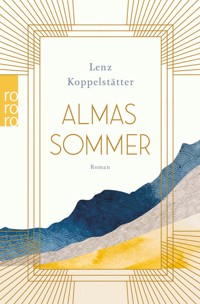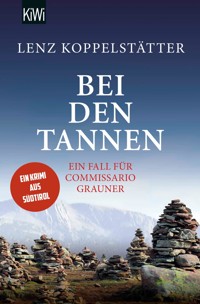9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Grauner ermittelt
- Sprache: Deutsch
Im Schatten der Südtiroler Alpen ermittelt Commissario Grauner in seinem persönlichsten Fall. Am sagenumwobenen Brennerpass, inmitten der Alpenidylle zwischen Südtirol und Österreich, müssen Commissario Grauner und sein neapolitanischer Kollege Saltapepe einen grausamen Mord aufklären. Ein alter Mann wurde an ein Pferd gebunden zu Tode geschleift. Er lebte zurückgezogen, spielte manchmal mit seinen schweigsamen Freunden aus Jugendtagen eine Partie Karten. Als diese befragt werden sollen, verschwindet einer von ihnen spurlos. Die Ermittlungen führen den Commissario bis in die dunkelsten Abschnitte der Südtiroler Geschichte. Und ein alter Koffer birgt Hinweise darauf, dass der Fall mit der tödlichen Tragödie auf dem Hof von Grauners Eltern zusammenhängen könnte. Für die er auch heute, nach so vielen Jahren, keine Erklärung hat. Am Brenner, dort, wo einst Staatsmänner, Schriftsteller, Händler und Weltenbummler Station machten, ist die Ruhe der Nacht trügerisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Lenz Koppelstätter
Nachts am Brenner
Ein Fall für Commissario Grauner
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Lenz Koppelstätter
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Lenz Koppelstätter
Lenz Koppelstätter, Jahrgang 1982, lebt nach über zehn Jahren in der deutschen Hauptstadt heute wieder in Südtirol, wo er geboren und aufgewachsen ist. Nach dem Studium der Politik in Bologna und der Sozialwissenschaften in Berlin absolvierte er in München die Deutsche Journalistenschule. Als Autor und Medienentwickler arbeitet er für zahlreiche renommierte Verlage, Magazine und Zeitungen. Die Kriminalreihe um Commissario Grauner ist ein großer Erfolg bei Lesern und Presse.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein in die Jahre gekommener Sehnsuchtsort, eine Betonkuppel inmitten der Alpenidylle zwischen Südtirol und Österreich: Der Brenner, kein Ort zum Verweilen. Ausgerechnet hier müssen Commissario Grauner und sein neapolitanischer Kollege Saltapepe einen grausamen Mord aufklären. Das Opfer: ein alter Mann. Er lebte zurückgezogen, spielte täglich mit seinen schweigsamen Freunden aus Jugendtagen eine Partie Karten. Als diese befragt werden sollen, verschwindet einer von ihnen spurlos. Und ein alter Koffer birgt Hinweise darauf, dass der Fall mit der tödlichen Tragödie zusammenhängen könnte, die sich vor vielen Jahren auf dem Hof von Grauners Eltern zutrug. Eine Tragödie, für die er auch heute, nach so vielen Jahren, keine Erklärung hat.
Währenddessen folgt Ispettore Saltapepe rätselhaften Zeichen, die ein Unbekannter am Fundort der Leiche hinterlassen hat, und gerät dabei selbst in Gefahr. Dort, wo einst Staatsmänner, Schriftsteller, Händler und Weltenbummler Station machten, ist die Ruhe der Nacht trügerisch.
»Erstklassiger Krimistoff« SWR
»Koppelstätters Krimi ist so spannend, dass man die Nacht durchliest.« Freundin
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und -Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
https://www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-nachts-am-brenner
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Prolog
13. August
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
14. August
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
15. August
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
16. August
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Epilog
Danke
Leseprobe »Was der See birgt«
Personen und Handlung dieses Romans sind frei erfunden.
Die Schrecken des Krieges sind es nicht.
Sie müssen uns ein Mahnmal sein – für immer.
Wir dürfen nicht vergessen.
In Bezug auf manche Ortsbeschreibungen nimmt sich das Buch kleine Freiheiten heraus.
Prolog
Im Dunkeln gibt es keine Schatten. Die Nacht macht alle Menschen gleich. Ob du gut bist oder böse, ob du stark bist oder schwach, ob Gauner oder Gottesmann, wurscht! Das Dunkel der Nacht macht keinen Unterschied, es verdeckt, es umhüllt, es macht Geschehenes ungeschehen, Gesehenes ungesehen.
Nicht die Nacht ist es, die uns Angst macht. Nein, vor der Nacht fürchten wir uns nicht, sagen die Bahnhofsangestellten am Brenner. Ihr Dunkel ist wohlig und warm, sagen sie. Ihre Geräusche beruhigend und sanft. Nur ein leises Rauschen tönt von der Autobahn her. Die Weichen am Bahnhof stehen still. Nur der eine, letzte Nachtzug kommt noch, aus der Ferne sind die gelben Lichter schon zu sehen, die groß und größer werden und bald blenden wie Sonnen. Dann bremst er, der Zug, und beim Bremsen quietscht es, die Bahnbeamten hören ein Schnaufen und Zischen, obwohl da gar nichts mehr schnauft und zischt bei den neuen Zügen der Ferrovie dello Stato. Eingebrannte Nostalgie.
Niemand steigt aus. Alle schlafen in den Liegewaggons. Trotzdem muss der Zug halten. Weil in diesem Niemandsland zwischen Italien und Österreich zwar keine Grenzkontrollen mehr stattfinden, aber die Lok immer noch von Gleichstrom auf Wechselstrom umgestellt wird.
Nur der Lokführer hüpft heraus, er nimmt den heißen Kaffee gerne an, den ihm der Bahnvorsteher reicht. Er zieht an der Zigarette, die beiden wechseln nicht viele Worte, ein Handschlag, dann rollt der Zug, der sich grad noch von Sterzing hochgekämpft hat, schon wieder runter nach Innsbruck.
Es ist nicht die Nacht, die das Unheil bringt, sondern ihr Verschwinden, sagen die Lokführer, die Zugführer, die Bahnvorsteher, die Gleisarbeiter am Brenner. Weil dann alles zum Vorschein kommt, was die Nacht verdeckt hat. Weil sie eisig daherkommt, diese Höllenstund’, in der das dunkle Schwarz und das helle Blau um den Himmel ringen.
Minus zwei Grad zeigt das Thermometer am Bahnsteig an. Im Ofen in der Stube ist das letzte Scheit längst verglüht, nur beißender Rauch steigt noch auf. Da reicht das eine dünne Laken nicht, auch jetzt nicht, im Hochsommer, wenn die Sonne tagsüber ihre schweren Strahlen gegen die Felsen knallt, die den Brenner umzingeln. Jetzt, zu Ferragosto, wenn sich weit unten in den Tälern die Leut’ nachts in der Hitze schlaflos wälzen, wenn ihnen Mücken um die Nasen tanzen, wenn sie genervt das Licht anmachen, um mit dem Kissen die kleinen, summenden, nervigen Viecher zu jagen, wenn die weiße Wand zum blutroten Schlachtfeld wird.
Nicht am Brenner. Am Brenner überlebt keine Mücke. Am Brenner gibt es keinen Sommer. Am Brenner ringen immerfort alle Jahreszeiten miteinander. Jede Stund’, jeden Tag, jede Woch’ – das ganze Jahr über, immer schon. Hier oben, am Brenner, wo die Nacht besonders schwarz, wo das Morgengrauen besonders grausam daherkommt.
Giuseppe Bertoldo hatte den Mantelkragen hochgeschlagen und lief von den alten Bahnarbeiterwohnungen in Richtung des Dorfes und des Bahnhofs. Er brauchte für diese Strecke kaum zehn Minuten. Wenn er Frühschicht hatte, lief er sie im Halbschlaf. Weit vor ihm tauchte die Polizeistation auf, ein graues Monster aus Beton, dahinter befand sich die kleine Kapelle, dem heiligen Valentin gewidmet. Sie war umzingelt von den wenigen Häusern der Ortschaft, ein paar Geschäften, verfallenen Hotels, der Brennerbar, wo tagsüber die Carabinieri, Polizisten und Finanzer, der ein oder andere Lkw-Fahrer und der Wirt ein Gläschen zusammen tranken und eine Partie Karten spielten. Am Ende des Dorfes lag das Outlet-Center im Dunkeln.
Früher hatte Bertoldo sein Schicksal verflucht, heute machte er das nicht mehr. Längst hatte er sich ausgesöhnt mit dem, was ihm sein Leben bereitgehalten hatte. Das ist das Wichtigste, sagte sich Bertoldo, wenn er über Grundsätzliches, über Gott und die Welt nachdachte: nicht zu viel wollen. Wer zu viel will, ist nie zufrieden. Das annehmen, was das Leben einem bietet. Nicht mehr erwarten.
Vor langer Zeit, da hatte er sich verbrannt an diesem Mehr und an der Liebe. Damals, als er noch jung gewesen war. Als er als Capotreno, als Zugführer, immerfort von Lecce zum Brenner hoch- und zurückgefahren war. Als ihm die jungen Touristinnen aus bella Germania in den Abteilen noch lustvoll hinterhergeschaut hatten. Als er noch ein junger, fescher Mann gewesen war. Als er sich in diese junge Südtirolerin verliebt hatte, die in Verona immer mit ihm eine Zigarette geraucht hatte, bevor sie nach Bologna weitergefahren war. Die er sich eines schönen Tages getraut hatte zu fragen, ob er sie in eine Osteria einladen dürfe. Die er geheiratet hatte, in Brixen, obwohl ihr Vater ihm nicht getraut hatte – ein Italiener! Ein Pugliese! –, ihre Mutter aber hatte ihn sofort in ihr großes Herz geschlossen.
Er war zu seiner Frau gezogen, in dieses Südtirol, in diese bergige Provinz, in der die Menschen ein klobiges Italienisch und ein unverständliches Deutsch sprachen.
Zu schön, zu perfekt war das wohl gewesen. Je schöner das Leben, desto tiefer der Abgrund, der sich vor einem auftut. Diesen Abgrund, in den der liebe Gott ihn da hatte fallen lassen, den würde er ihm nie verzeihen.
Seit seine Frau gestorben war, die Susanne, abgestürzt am Hochfeiler, mit dem Kind im Bauch, hatte er kein Gebet mehr gesprochen, in keine Kirche mehr einen Fuß gesetzt, kein Weihwasser die Haut benetzen lassen. Und nie wieder hatte er einen Wunsch an das Leben geäußert, nie wieder ein bisschen Glück zu erhoffen gewagt. Er hatte beschlossen, nichts mehr zu wollen. Um nichts mehr zu verlieren.
Bertoldo hatte sich in den Innendienst versetzen lassen. Als sein Vorgesetzter ihn gefragt hatte, wohin er denn wolle, sicher doch zurück nach Apulien, zurück nach Lecce, um alles zu vergessen, das ließe sich organisieren, da hatte er nur die Schultern gehoben und gesagt, er möge doch dahin versetzt werden, wohin kein anderer wolle. Egal, hatte er gesagt. Und wenn ihr mich auf den Brenner versetzt. Auf den dunklen, kalten, bösen Brenner. Von mir aus auch auf Lebenszeit.
Rechts der Straße tauchte der Bahnhof auf, hinter dem die Autobahn verlief. Sie lag um diese Uhrzeit da wie tot. Kein Handelsreisender. Kein Lkw. Kein Tourist, der nach Süden wollte.
Frühmorgens, auf dem Weg zur Arbeit, während dieser lautlosen Momente, kamen Bertoldo die immergleichen Gedanken: Was, wenn die Menschheit stillstünde und nur ich es nicht bemerkte? Was, wenn alle weg wären, der Welt abhandengekommen, nur ich nicht?
Schnellen Schrittes ging er weiter. Die Kälte ließ seinen Atem weiß werden. Der Schotter des Straßenrands knirschte unter seinen Schuhen. Er hatte den Eingang des Bahnhofsgebäudes beinahe erreicht, da sah er etwas im Licht der orangefarbenen Laternen blinken, da lag etwas auf der Straße. Eine Münze vielleicht, nein, eher ein glänzender Kieselstein. Bertoldo ging näher heran, bückte sich, und hob das Ding hoch.
Er hielt es nah vor die Augen, drehte und wendete es. Es war ein Stück Zahn. Er schaute sich um, fragte sich, was damit zu machen sei. Zurücklegen? In den Straßengraben werfen? Einstecken? Zu einem Fundbüro bringen? Gab es denn noch Fundbüros? Vielleicht sollte er das Stück im Outlet-Center oder in der Brennerbar abgeben? Blödsinn!
Würde ein Mitarbeiter des Outlet-Centers um zehn Uhr, wenn die Tore öffneten, sich etwa das Mikrofon schnappen und über die Lautsprecher verkünden: »Ein Stück Zahn gefunden! Wer einen Zahn vermisst, der hole ihn bitte am Info-Point ab«?
Würde der Wirt der Brennerbar einen Zettel mit einem Foto des gefundenen Stücks an die Tür kleben?
Bertoldo schaute noch einmal zu Boden. Da, wo der Zahn gelegen hatte, war der Asphalt dunkel gefärbt. Er sah, dass der Fleck in eine Spur überging. Er folgte ihr, sie führte die Hauptstraße entlang, den Weg, den er gegangen war, wieder zurück in Richtung Süden. Mal verschwand der dunkle Streifen, mal war er deutlich zu sehen. Bertoldo war etwa dreihundert Meter gelaufen, weiter vorne tauchte schemenhaft die Bahnarbeitersiedlung auf, da sah er auf der Straße wieder etwas liegen. Es glich einer Wattekugel. Er musste vorhin, im Halbschlaf, daran vorbeigetrottet sein.
Bertoldo ging noch ein paar Schritte heran. Von Nahem sah die Watte aus wie Erbrochenes. Hatte einer der Lkw-Fahrer die Meraner Würstchen vorne am Würstlstandl gestern Abend mit zu viel Bier ersoffen? Erst als der Bahnbeamte sich bückte, sah er, was es war.
Er hielt die Luft an, kurz wurde ihm übel. Mit zitternder Hand berührte er die schwammige Masse. Sie war noch warm.
13. August
1
Grauner spürte, wie sich die Schweißperle löste. Erst kam sie nur stockend voran, wie eine Badehose auf einer trockenen Wasserrutschbahn. Dann nahm sie Fahrt auf, sprintete den Rücken hinab und kitzelte ihn an den untersten Wirbeln. Der Commissario fuhr sich mit den Händen übers Gesicht und die Arme, doch es half alles nichts. Er war völlig verschwitzt.
Die Luft war dick, es schien, als könnte man sie mit den Händen fassen, zu Knödeln formen. Die Fensterläden der Questura waren geschlossen, doch die Hitze drang durch jede Ritze des morschen Holzes. Schon seit Jahren forderten die Mitarbeiter der Polizia di Stato eine Klimaanlage, doch da war nichts zu machen.
Grauner schnappte sich die Wasserflasche, beim Berühren des Plastiks spürte er, dass der Inhalt teewarm war. Er schleppte sich auf den Gang, schleppte sich zu den Toiletten, hielt den Kopf in das Waschbecken und drehte den Hahn auf. Kaltes Gebirgsnass. Wie gut das tat.
Es gab Tage, da hätte Johann Grauner, der im Hauptberuf Commissario in Bozen war und nebenher Viechbauer, sein Leben am liebsten mit dem einer seiner Milchkühe getauscht. Mit der Mara, der Mitzi oder der Olga. Besonders im Sommer überkam ihn dieses Verlangen. Jetzt, da seine Kühe auf den Wiesen eines befreundeten Almbetreibers standen. Die frische Sommerkühle in der Früh, der Duft des aufgeheizten Grases, der Klee, die Glockenblumen, die Vergissmeinnicht, die Bienen und Hummeln, die sich arglos mit einem Schwanzschwenker verscheuchen ließen, die frischen Kuhfladen, die über der Baumgrenze ganz anders rochen als unten im Stall. Würziger. Wie Delikatessen. Ein himmlischer Duft, der mit jedem kräftigen Bergkäse mithalten konnte.
Nur eines würde er als Kuh auf der Alm vermissen: seine geliebten Mahler-Sinfonien, die er immerfort zu hören pflegte, im Stall, im Auto, in der Stube auf der Ofenbank.
Grauner summte auf dem Weg zurück ins Büro die ersten Takte von Mahlers Lied von der Erde vor sich hin, als ihm der Ispettore entgegenstürzte. Auch Claudio Saltapepe schwitzte, und Grauner spürte, wie sich die Schadenfreude in ihm ausbreitete. Sein Kollege aus Neapel, der sich tagein, tagaus über die für seinen Geschmack zu niedrigen Temperaturen in dieser Alpenprovinz beschwerte, über die eiskalten Winter, die ihm nicht behagten, weil er bislang weder auf Skiern noch auf Schlittschuhen gestanden hatte, weil er noch nie einen Schneemann gebaut hatte oder in eine Schneeballschlacht verwickelt gewesen war.
Saltapepe schwitzte und keuchte, als er bei Grauner ankam, sodass er die ersten Worte nur halb und unverständlich herausbrachte.
»Gerade hat jemand angerufen. Vom Brennero. Von der Staatsgrenze. Der örtliche Commandante der Polizei. Er … er … Wir sollen hochfahren.«
Grauner blieb ganz ruhig. Die vielen Jahre als Commissario hatten ihn gelehrt, dass man noch lange nicht irgendwo hinzueilen hatte, nur weil jemand aufgeregt in der Questura anrief. Man musste diese Aufgeregtheit an sich abperlen lassen. Sonst machte man sich verrückt. War ja klar, dass jemand, der hier anrief, aufgeregt war. Schließlich war die Polizeistelle keine Pizzeria, bei der man sich nach den Öffnungszeiten erkundigte, kein Kino, bei dem man Karten reservierte, keine Radiostation, bei der man sich sein Lieblingslied wünschte.
Jeden Tag wurde in der Questura der Polizei oder in der Kaserne der Carabinieri aufgeregt angerufen. Um den Nachbarsbauern anzuschwärzen, weil der die Granny Smith vom eigenen Moos geklaut habe. Um sich über die Polizeistreife zu beschweren, die abends nach dem Feuerwehrfest eine Alkoholkontrolle durchgeführt hatte. Das sei ja eine Unverschämtheit, ausgerechnet nach dem Feuerwehrfest, warum nicht morgens, nach der Messe? Und warum waren der Bürgermeister und der Feuerwehrhauptmann, die auf dem Fest stundenlang am Schnapsbudl gezecht hatten, nicht kontrolliert worden?
Viele riefen auch einfach nur an, um sich zu entrüsten. Über irgendetwas. Über das Wetter, über den Landeshauptmann, der es nicht für nötig gehalten hatte, zum letzten Almabtrieb ins Passeiertal zu kommen. Über das laute Sirenengeheul letzte Nacht in Gfrill, wo Grauners Leute zwei um die Gunst einer Magd streitenden Bauern davon abgehalten hatten, mit zerbrochenen Blauburgunderflaschen aufeinander loszugehen. Der ganz normale Provinzpolizistenwahnsinn.
Eigentlich liebte Grauner sie ja, diese Anrufe. Wenn er sich die Probleme anderer Leute anhörte, kamen ihm die eigenen so klein und nichtig vor. Solange nichts Schlimmeres passierte, war doch alles in bester Ordnung, hier, in diesem beschaulichen Südtirol, wo der Himmel blauer strahlte, wo der Gipfelschnee des Ortler, des König, des Klockerkarkopf weißer schien, wo der Kalkfels der Dolomiten abends röter glühte als andernorts, wo der Vernatsch einen fröhlich machte und der Speck satt.
Solange kein Mord passierte, hier, an diesem wunderschönen Fleckchen Erde, so lange hörte sich Grauner diese Anrufe gerne an, geduldig, durch nichts aus der Ruhe zu bringen, so, wie seine Mara, seine Mitzi, seine Olga das Heu zu kauen pflegten. Solange er sich nicht um eine Leiche kümmern musste, besonders bei der schwülen Hitze, so lange war die Welt für ihn in Ordnung.
»Grauner!«
Saltapepe riss den Commissario aus den Gedanken.
»Ja, Claudio, warum sollen wir denn an den Brenner kommen? Gibt’s eine Leiche, denn wenn es keine Leiche gibt, dann …«
»Ja, es gibt wohl einen Toten«, unterbrach ihn der Ispettore. »Zumindest Teile davon. Die haben da Stücke von Zähnen gefunden – und Gehirnmasse. Mitten auf der Straße. Sieht alles nach einem schrecklichen Verbrechen aus.«
2
Die Blechkolonne der Polizeiwagen zog sich über die Autobahn durch das felsige Eisacktal. Commissario Grauner saß bei Saltapepe im Alfa, das Blinken der Blaulichter spiegelte sich in den Fenstern der Autos, die sich, von den Sirenen erschrocken, zwischen den Lkw in der rechten Spur einreihten.
Die Autobahn verlief auf hundert Meter hohen Betonsäulen, sie verschwand in orange erhellten Tunneln. Irgendwo da auf dem Berg stand auch Grauners Bauernhof, da oben war das Paradies, man konnte nicht hinuntersehen in die tiefe Schlucht, durch die schon die Römer ihrerzeit gen Norden gezogen waren.
Am Berg war alles grün, von Grauners Bauernhof aus war der Blick auf den Schlern unverstellt. Unten war alles dunkel und grau. Die Autobahn kreuzte die rostbraunen Gleise der Zugstrecke und die blauen Wirbel des Eisacks, der sich über Jahrtausende in den Felsen gegraben hatte. Diese Strecke war die pulsierende Hauptschlagader des Landes, durch die man in die verästelten Täler und zu den idyllischen Postkartenorten zwischen den Bergen gelangte.
Saltapepe drückte aufs Gaspedal. Es waren nur hundertzehn Stundenkilometer erlaubt, der Tacho zeigte hundertsechzig an. Grauner verstand diese Hektik nicht, diese Eile, das hatte er noch nie getan. Die Leiche würde bleiben, wo sie war, und ja, man musste geschwind zu ihr eilen, weil erste Spuren, erste Zeugenreaktionen immer das Wichtigste waren, um Fälle zu lösen. Aber es ging doch nicht um Sekunden.
Grauner verdrehte die Augen, als Saltapepe einen deutschen Urlauber mit Kanu auf dem Dach und zwei Fahrrädern am Heck seines polierten silbernen C-Klasse-Mercedes nach rechts hupte. Eigentlich mochte der Commissario die Autobahn. Dank ihrer Hässlichkeit erschien seine Heimat drumherum noch schöner. Außerdem gab ihm die Betonspur das Gefühl, immer wegfahren zu können, wenn er es wollte. Bisher hatte er es allerdings noch nie gewollt.
Man muss sich die Welt anschauen, um zu verstehen, dass es zu Hause doch am schönsten ist.
An diesen Spruch hatte Grauner noch nie geglaubt. Hier war es schön genug, mehr musste er nicht wissen. Er schaute sie gerne an, diese Autobahn, er sah zu, wie sie alle hin- und herfuhren, und es wunderte ihn, wie viele Menschen hin- und hermussten, selbst sonntags, selbst zu Weihnachten. Er war froh, keiner von ihnen zu sein.
Er mochte die Autobahn, wenn er mit etwas Abstand den Verkehr darauf beobachten konnte. Er mochte sie nicht, wenn er selbst darauf unterwegs war. Dann war sie ihm nicht geheuer. Vom freien Fall auf das Gestein und in den Eisack nur durch eine Leitplanke getrennt.
Saltapepe fuhr zu schnell in eine der Kurven, er musste abbremsen, zurückschalten. Grauner warf es zuerst nach links, dann nach vorne, der Sicherheitsgurt hielt ihn zurück.
»Scusami«, entschuldigte sich der Ispettore und schaltete wieder in den Fünften.
Bei Brixen wurde das Land etwas flacher, das Wipptal löste das Eisacktal ab, Sterzing war aufgetaucht und wieder im Rückspiegel verschwunden, kaum merklich zog die Steigung nun an, der Alfa tat sich schwer, er war für ebene Autobahnstrecken zwischen Mailand und Modena gemacht, nicht um zum Pass der Pässe zu gelangen. Zu diesem niedrigsten und doch widrigen Übergang der Alpen. Zu diesem Nadelöhr Europas.
3
Normalerweise, wenn Grauner und seine Männer zu einem Tatort kamen, hatte sich da schon eine Menschenmenge versammelt. Ein Toter, insbesondere ein Ermordeter, das sprach sich schnell herum in den Dörfern Südtirols, das erzählte der Bäcker frühmorgens den Frauen, mittags, bei Speckknödeln und Gulasch, wurde bereits spekuliert, wer es wohl gewesen sei, und nachmittags traf man sich im Gasthaus oder auf den Kirchenbänken, um in großer Runde zu besprechen, was nun zu tun sei, um zu beklagen, dass das ausgerechnet im eigenen Dorf … dass man das von dem Verdächtigen nie erwartet … dass man sich immer schon gedacht habe, dass grad mit dem etwas nicht stimme.
Normalerweise war es Grauners erste Aufgabe, den Tatort freizuhalten, die Neugierigen zu vertreiben, die Flut von Gerüchten und Anschuldigungen zu kanalisieren und Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Doch als sie den Brenner erreichten, war da keine Menschenmenge zu sehen. Es war alles wie an jedem anderen gewöhnlichen Sommertag.
Drüben auf der Autobahn rauschte der Verkehr in beide Richtungen. Am Straßenrand reihten sich vom Bahnhof bis zum Outlet-Center die Touristenautos aneinander.
Zwei deutsche Familien hievten Einkäufe in die Kofferräume ihrer Autos. Designerjeans von Armani und Diesel; eingeschweißte Speckhammen, kiloschwer; Dreierkartons Wein, Vernatsch, Lagrein und natürlich den süßen Gewürztraminer. Schokolade, XXL-Tafeln aus Ferrara; Parmesan aus der Provinz Reggio Emilia; Holunderblütensirup; unzählige Packungen Kaffeepulver von Lavazza und ein paar Äpfel aus dem Unterland – für unterwegs. Einer der Familienväter hatte die neu gekaufte Lederhose bereits über die dicken schneeweißen Waden gezogen, jede Sekunde drohte das Kunstleder zu platzen, an einem Plastikhirschgeweihkopf, der neben ihm auf dem Boden lag, hing noch das Preisschild: 39,90 statt 89,90.
Eine Gruppe Rennradfahrer schlängelte sich an einer Touristenhorde vorbei. Sonnenverbrannte Unterarme, Leibchen der Giro-d’Italia-Idole: Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Marco Pantani. Kaum Schweiß auf der Stirn. Der Brenner mit seinen 1370 Höhenmetern war ein Klacks auf dem Weg zu den richtig hohen Alpenpässen.
Die Touristen schlenderten die Marktstände und kleinen Geschäfte entlang. Einst war der Brenner ein florierender Handelsort gewesen. Aus Österreich waren sie gekommen, um auf italienischer Seite billige Zigaretten zu kaufen. In Österreich waren dafür die Bananen günstiger zu haben.
Die ausgeblichenen Rollläden eines Gemischtwarenladens waren geschlossen. Vendesi stand darauf. Zu verkaufen.
Was einst ein Dorf gewesen war, war nur noch ein Abklatsch der Vergangenheit mit angebautem Einkaufstempel. Die Berge untertunnelt von monströsen Bohrmaschinen, irgendwann würde dort der Güterverkehr durchrasen. Die meisten Dorfbewohner waren weggezogen in den vergangenen Jahren. Weil es sich ohne Grenze an diesem Ort nicht mehr zu leben lohnte. Nur ein paar wenige Polizisten waren geblieben, und einige Bahnbeamte. Der Handel war zum Erliegen gekommen, nur der Schmuggel florierte nach wie vor. Keine Bananen und kein Tabak wurden mehr illegal über die Wasserscheide gebracht, aber nach wie vor Drogen, Waffen und Menschen.
An einem Kreisverkehr standen sich die italienischen Finanzer und die österreichische Grenzgendarmerie gegenüber. Sie winkten die wenigen Autos durch, die über die Staatsstraße zum Pass kamen. Das Winken, ein Reflex, in der DNA von Grenzpolizisten verankert. Nicht wegzubekommen, auch wenn die Grenze offen war. Die monströsen Maschinengewehre, die sie jahrzehntelang im Anschlag gehalten hatten, verstaubten in den Kasernen. Sie waren Reliquien einer Zeit, in der Italien und Österreich noch ihren eigenen kleinen Kalten Krieg inszenierten.
Auf einem Parkplatz zwischen dem Bahnhof und dem Outlet-Center wartete schon der Polizeikommandant der Brenner-Station. Er lehnte an der Fahrertür eines dunkelblauen Panda und rauchte. Neben ihm stand ein hochgewachsener unscheinbarer Kollege. Sie unterhielten sich mit einer älteren Dame. Sie musste so um die sechzig sein. Auch ein Mann in der Uniform der Beamten der Ferrovie dello Stato stand dabei.
Die Autos der Staatspolizei aus Bozen hielten nebeneinander. Grauner und Saltapepe stiegen als Erste aus. Der Commissario atmete die Brennerluft ein. Obwohl die Abgase nur wenige Meter weiter auf der Autobahn aus den Auspuffen gepumpt wurden, obwohl die Tankstellen den Sauerstoff mit Benzin und Diesel versetzten, war die Luft klar und kalt. Eine Wohltat an diesem heißen Augusttag.
»Grüß Gott«, sagte Grauner in die Runde. »Commissario Grauner von der Polizia di Stato in Bozen. Sie haben uns gerufen. Ein Mord?«
Der Polizeikommandant ging einen Schritt auf den Commissario zu, reichte ihm die Hand und musterte ihn dabei misstrauisch. Der Mann war einen Kopf kleiner als Grauner, seine Uniform spannte um den Bauch, im spiegelblank polierten, kniehohen rechten Stiefel klemmte eine Verkehrskelle.
»Ich, äh, Ispettore Superiore Paolo Ceccanti mein Name, eigentlich ging ich davon aus, ich würde die Leitung inne…«
Das geht ja gut los, dachte Grauner. Seine Miene verfinsterte sich. Ihm war bekannt, dass die wenigen am Brenner stationierten Polizisten mehr oder weniger ein sinnbefreites Eigenleben führten. Als im Zuge des Schengener Abkommens die Grenzen geöffnet wurden, hätte man sie abkommandieren müssen, sie waren aber im Wirrwarr der italienischen Polizeikompetenzen in Vergessenheit geraten.
Wenn die Grenze wegen eines politischen Ereignisses geschlossen wurde, spielten sich die verbliebenen Beamten groß auf. Wenn eine Gruppe Flüchtlinge es von Lampedusa bis an den Brenner schaffte und die Presse davon Wind bekam, holten sie die alten Panzerwagen aus der Garage – und durften sich für ein paar Stunden und Tage wieder so wichtig fühlen wie früher.
Klar, dachte Grauner, dass dieser Brenner-Kommandant so einen Mord als Chance begriff, sein Selbstwertgefühl aufzupeppen. Klar, dass ihm ein Commissario aus Bozen dabei nicht gelegen kam.
»Hören Sie, Ceccanti«, sagte Grauner, um einen Machtkampf im Keim zu ersticken, »wir sind im Auftrag der Staatsanwaltschaft unterwegs. Staatsanwalt Dr. Martino Belli hat mir die Ermittlungen zugewiesen. Er selbst wird auch bald vor Ort sein. Wir sind nicht hochgekommen, um den Verkehr zu regeln.« Er schaute herablassend auf den Stiefel des Kommandanten. Grauner spielte sich nicht gerne auf, aber nur das würde helfen. »Ich bin hier, weil es einen Mord gegeben haben soll. Also, wo ist die Leiche?«
»Äh, beh, das ist … das kann ich nicht …« Dieses beh bedeutete so viel wie: Ich kann nichts dafür! Der Kommandant blickte erst verlegen zu Boden, dann hilfesuchend zu der Frau, die nun ebenfalls herangetreten war.
»Wie?« Grauner war nun laut geworden.
Einige der Passanten, die von den geparkten Autos zum Outlet-Center strömten, schauten zu der eigenartigen Versammlung rüber. Ein Teenager machte bereits Selfies mit den Polizeiwagen im Hintergrund.
Die Frau räusperte sich.
»Mein Name ist Katharina Wieser. Der Bahnvorsteher, Herr Giuseppe Bertoldo …«, sie zeigte auf den Mann in Eisenbahneruniform, »… hat heute im Morgengrauen Stücke von Zähnen auf der Straße gefunden, außerdem Blut. Erst dachte er, es sei vielleicht Motoröl, dann aber fand er noch ein Stück Gehirn …«
»Im Morgengrauen!«, schrie Grauner. Das war ihm alles zu verrückt. Normalerweise kam man als Commissario an einen Tatort, da lag irgendwo eine Leiche, die gerade gefunden worden war, man schaute sich die Leiche an, der Chef der Spurensicherung, die in Südtirol Scientifica genannt wurde, unterrichtete einen über die Todesursache, erwürgt, erschossen, ertränkt, erstochen, was auch immer, dann verhörte man die Augenzeugen, es kristallisierten sich erste Verdächtige heraus, die Ermittlungen begannen. Aber hier?
»Im Morgengrauen? Warum, um Gottes willen, haben Sie uns dann erst mittags verständigt?«
Die beiden Polizisten und der Bahnbeamte wichen einen Schritt zurück. Nur die Bürgermeisterin hielt Grauners Gebell stand und antwortete kühl.
»Herr Bertoldo hat zuerst mich und den Kommandanten angerufen. Ich wohne unten in Gossensass, ich bin also hochgekommen und habe mir die … äh … Fundstücke angeschaut. Wir waren ja noch gar nicht sicher, ob das die Zähne und das Gehirn eines Menschen waren. Daran wollten wir zunächst gar nicht denken. Ich vermutete, das stamme von einem Tier, einer Kuh oder einem Hirschen. Deshalb haben wir erst einmal weitergesucht.«
Grauner atmete nun tief ein und aus, er versuchte vergeblich, seinen Ruhepuls zu finden. Das hatte ihm der Viechdoktor geraten, der den Kälbern seiner Kühe auf die Welt half und auch ihn manchmal untersuchte. Aber wie genau man das anstellte, das hatte Grauner noch nicht herausgefunden.
»Und dann haben Sie eine Leiche entdeckt und uns verständigt«, sagte der Commissario mit immer noch bebender Stimme. »Also zeigen Sie uns diese Leiche, sofort!«
Wieder traten die beiden Polizisten und Bertoldo einen Schritt zurück. Wieder antwortete die Bürgermeisterin unerschrocken.
»Nein. Wir haben die Straße und die nähere Umgebung abgesucht. Eine Leiche haben wir nicht gefunden, aber etwas anderes.«
Sie drehte sich um und ging zum Panda der beiden Polizisten vom Brenner.
Nun erst bemerkte Grauner das weiße Tuch, das auf der Motorhaube des Autos lag. Neben dem linken Vorderreifen stand eine Kühlbox, wie sie Campingurlauber zu ihrer Ausstattung zählten.
Sie versammelten sich um den Wagen, dann warf der unscheinbare lange Polizist einen Teil des Tuchs zurück.
Da lagen mehrere Stücke von Zähnen und die Fetzen einer Jeans. Sie waren mit dunklen Flecken versehen.
Einer der Polizisten hievte nun die Kühltruhe hoch, öffnete sie und bedeutete Grauner hineinzuschauen.
In der Truhe lagen zwei Plastiktüten, in der einen befand sich eine schwabbelige, rosafarbene Masse. Er hatte so etwas schon des Öfteren gesehen. Menschliches Gehirn an Tatorten. Das Gehirn einer Kuh auf dem Schlachthof. Sie ließen sich auf den ersten Blick nicht voneinander unterscheiden.
Der Commissario nahm die zweite Plastiktüte in die Hand. Er erkannte nicht sofort, was darin lag. Eine Kugel, eine runde Frucht. Als er den weichen Gegenstand drehte, fuhr er erschrocken zurück.
Eine waldgrüne Iris starrte ihm entgegen. Es war ein Auge. Das war nicht das Auge einer Kuh oder eines Hirsches. Das war das Auge eines Menschen.
Grauner fasste sich schnell wieder. Seine Gedanken hämmerten im Takt eines stotternden Traktormotors gegen die Kopfwand. Gemeinsam mit dem Ispettore ging der Commissario zu seinen Leuten zurück und erklärte die Lage.
»Was ist das für ein Ort, Grauner?«, fragte Saltapepe und blickte sich um. Der Commissario konnte sich ausmalen, wie unwirklich die Szenerie um sie herum dem Kollegen aus Neapel erscheinen musste. Wie eine unpassende Filmsequenz inmitten eines Heimatstreifens.
»Das ist der Brenner«, antwortete Grauner, nicht ohne Wehmut in der Stimme. »Kaputter Sehnsuchtsort für die deutschen und holländischen Wohnwagentouristen auf dem Weg in den Süden. Einstige Schmerzensgrenze für uns Südtiroler. Ein bisschen Österreich, ein bisschen Italien, ein Fleckchen europäisches Durcheinander, eine Betonkuppel inmitten unserer Alpenidylle. Kein Ort zum Verweilen. Lass uns diesen komischen Fall klären und verschwinden. Über den Brenner fährt man drüber, da bleibt man nicht. Den lässt man hinter sich.«
4
Es hatte sich herumgesprochen, dass die Polizei am Brenner eine große Suchaktion gestartet hatte. Das Geflüster war über das Örtchen Brennerbad runter nach Gossensass gewandert, von dort nach Sterzing, Brixen, Bozen und auf der anderen Seite der Grenze runter nach Innsbruck. Journalisten waren an den Pass gekommen, sie waren mit Schreibblöcken, Fotoapparaten und Kameras durch die Gässchen des Ortes geschlichen und hatten vermeintliche Augenzeugen ausgequetscht. Auf den Parkplätzen hatten die großen Sender ihre Übertragungswagen abgestellt und ihre Korrespondenten vor dem Bahnhofsgebäude in Stellung gebracht.
Inzwischen waren auch die Männer der Scientifica eingetroffen und hatten unter Anleitung ihres Chefs, Max Weiherer, mit der Arbeit begonnen. Die Fundorte wurden weiträumig abgesperrt, auch wenn Grauner ahnte, dass sie wahrscheinlich zu spät kamen. Viele Spuren waren von Autoreifen platt gedrückt, verschleppt, von Passanten und Schaulustigen totgetreten, vom Speichel, vom Schweiß der vielen Menschen mit fremder DNA kontaminiert.
Es war kurz vor vierzehn Uhr, als der Suchtrupp, bestehend aus Grauners Kollegen, vor Ort stationierten Polizisten und Carabinieri sowie einigen Männern der freiwilligen Feuerwehr von Gossensass die Suche auf die umliegenden Wälder ausweitete. Mit Drogenspürhunden der Polizei und mit Lawinenhunden der Bergrettung.
Um Viertel nach vier lag die Westseite des Brennerpasses bereits im Schatten. Im Osten ließ die Sonne das Laub des Mischwaldes golden erstrahlen, als einer der Polizisten keuchend und verschwitzt aus dem Wald gerannt kam. Er lief auf den Parkplatz zu, wo Grauner und Saltapepe gerade zwei Speckbrötchen zur Stärkung verschlangen. Sofort schwenkten die Kameras in ihre Richtung, Saltapepe gab sich alle Mühe, die Mikrofone der Journalisten auf Abstand zu halten. Der Polizist sah sich gezwungen, die Neuigkeit seinem Vorgesetzten ins Ohr zu flüstern.
»Wir haben ihn. Er liegt im Wald.«
5
»Das ist der Voltinger Jakob«, sagte die Bürgermeisterin und schaute auf den Toten hinab. Zumindest auf das, was von ihm zu sehen war, denn die Leiche war mit Laub, Erde und Moos bedeckt. So, als habe sie jemand mehr schlecht als recht verstecken wollen.
Grauner ging um die Leiche herum. Sie lag auf dem Bauch. Der Commissario war froh darüber. Er mochte sich das Gesicht des Mannes nicht vorstellen, wenn da überhaupt noch ein Gesicht zu erkennen war. Die Bürgermeisterin sprach weiter.
»Der ist aus der Gegend. Er hat einen Hof, unten, kurz vor Brennerbad, auf der anderen Talseite, jenseits der Autobahn. Er ist verwitwet. Er lebt alleine.«
Nun ergriff einer der Feuerwehrmänner das Wort: »Er … ich weiß nicht, welches Monster so etwas macht. Der Jakob war siebenundachtzig Jahre alt. Der hat nie irgendjemandem …« Die letzten Silben gingen in Schluchzen über.
Nachdem die Spurensicherung den Fundort inspiziert hatte, winkte Grauner Saltapepe heran, packte Weiherer am Ärmel und zog die beiden ein paar Schritte weg, weiter in den Wald hinein.
Von hier aus, über der Talsohle, war durch die Blätter und Äste hindurch das Geschehen des Passes optimal zu überblicken: Die sattgelben Lampen des Bahnhofes leuchteten bereits, obwohl die Dämmerung noch lange auf sich warten lassen würde. Die Lichter der Tankstellen blinkten in bunten Farben wie bei einem überdimensionalen Flipper.
»Was ist mit diesem Mann geschehen?«, fragte Grauner den Chef der Scientifica, als sie weit genug weg waren, um von den anderen nicht mehr gehört zu werden.
Weiherer sprach die folgenden Sätze, als würde er von einem Sonntagsausflug zur Seiser Alm erzählen. Grauner war vieles gewohnt, aber die an Zynismus grenzende Nüchternheit vieler Kollegen im Angesicht eines Ermordeten – auch wenn sie dem eigenen Schutz diente –, konnte er auch nach all den Jahren nicht nachvollziehen.
»Dieser Mann ist allem Anschein nach heute Nacht über die Brennerstraße geschleift worden. Sein Gesicht ist bis zur Unkenntlichkeit aufgeschürft. Fast alle Zähne sind aus dem Mund gerissen, die Kleidung ist zerfetzt und die Wunden sind voller Dreck. Wir haben an den Hand- und Fußgelenken Plastikfetzen gefunden. Er war wohl mit einem Klebeband gefesselt.«
Grauner atmete tief aus. Hilflos knetete er die kribbelnden Hände, um das Blut zurück in die äußersten Gliedmaßen zu pumpen.
Er sah zu Saltapepe, der gelangweilt einen Kaugummi zerkaute. Diese Haltung, sie ärgerte ihn, aber Grauner sagte nichts. Er ahnte, was er zu hören bekommen würde. Eine Auflistung aller schrecklichen, menschenverachtenden Mordmethoden, die der Ispettore während seiner Jahre bei der Antimafia-Spezialeinheit in Neapel zu sehen bekommen hatte.
Grauner schluckte seine Wut hinunter und wandte sich wieder Weiherer zu.
»Durch die Straße geschleift. Das ist also die Todesursache?«
»Sieht danach aus«, antwortete der Chef der Scientifica.
»Aber Genaueres muss die Gerichtsmedizin klären. Wir versuchen nun, den Weg anhand der Schleifspur zu rekonstruieren. Und wir versuchen herauszubekommen, was für ein Gefährt ihn hinterhergezogen hat.«
Weiherer musste Grauners fragenden Blick richtig interpretiert haben.
»Mithilfe der Reifenspuren könnte das klappen. Auto, Traktor oder Motorrad, mal sehen.«
Der Commissario brummte zustimmend. Auch wenn die Art Weiherers ihm nicht immer behagte, er schätzte sich glücklich, ihn an der Seite zu haben. In Gedanken sortierte er bereits die Aufträge, welche er schnellstmöglich zu vergeben hatte: Zusätzlich zu diesem Giuseppe Bertoldo mussten weitere Dorfbewohner befragt werden, er wollte eine Liste mit den Namen derer haben, die in der Nacht am Brenner gewesen waren, und er wollte wissen, ob eine dieser Personen irgendetwas mitbekommen hatte.
Jemand musste Kontakt zur österreichischen Gendarmerie aufnehmen. Die sollten auf ihrer Seite der Grenze Ermittlungen in die Wege leiten. Das würde schwierig werden. Der Tote war Südtiroler, er lag auf italienischem Boden. Die Österreicher würden sich nicht ihrer Ruhe berauben lassen. Schon gar nicht von einem italienischen Commissario. Grauner konnte es ihnen kaum verübeln. Umgekehrt würde er sich von einem österreichischen Gendarmen auch nichts sagen lassen. Er würde sich zumindest gehörig bitten lassen.
Er beschloss, Sovrintendente Piero Marché die Rolle des Bittstellers aufzuerlegen. Staatsanwalt Belli musste in der Zwischenzeit am Brenner angekommen sein. Grauner wollte ihn abfangen, bevor er mit irgendwelchem Halbwissen vor die Kameras trat. Am liebsten wäre es ihm, Belli würde vorerst überhaupt nicht mit der Presse sprechen, aber er vermutete, dass ihm dieser Wunsch nicht gewährt werden würde.
6
Die Bürgermeisterin war nicht mehr am Brenner und telefonisch nicht zu erreichen. Sie musste in den Hauptort Gossensass zurückgekehrt sein. Der Commissario und der Ispettore fuhren in Saltapepes Alfa die Brennerstraße hinunter, um sie zu finden. Einige von Weiherers Männern folgten ihnen. Katharina Wieser sollte ihnen den Hof des Toten zeigen. Den Lärm, das Blinken, den Beton hatten sie bald hinter sich gelassen, die Pfeiler und Fahrspuren der Autobahn waren hinter dem Grün der Bäume verschwunden, schon nach wenigen Minuten zeigte sich Südtirol wieder von der idyllischen Seite.
Weiter vorne erblickte Grauner die Hausanhäufung eines Örtchens, Gossensass, mittendrin überragte ein barocker Kirchturm die Dächer. Im Südosten schoss ein Stück Autobahn aus dem Wald heraus und auf der anderen Seite des Tälchens wieder in den Wald hinein, weit genug entfernt, um die Trasse bei flüchtigem Blick mit einem römischen Viadukt verwechseln zu können.
Saltapepe kurvte durch die engen Gassen des Dorfes, die holprigen Pflastersteine malträtierten die Stoßdämpfer. Auf der Terrasse der Bar gegenüber der Kirche saßen einige Dorfbewohner, Rotwein in den Gläsern. Ein paar Wandertouristen mit prall gefüllten Rucksäcken und Bergschuhen liefen die Gassen entlang, ein Brunnen plätscherte, eine getigerte Katze schlüpfte unter einem Holztor hindurch. Auf diesem Plätzchen war die Dorfbevölkerung versammelt. Eine Menschentraube hatte sich um Wieser gebildet. Die Bürgermeisterin sprach, wild gestikulierend. Saltapepe hielt, Grauner stieg aus, ging zu ihr hin.
»Frau Wieser, bringen Sie uns bitte zum Hof des Toten.«
Die Bürgermeisterin nickte und bewegte die Hände, als wollte sie Katzen verscheuchen. Das Grüppchen um sie löste sich auf, die Menschen verschwanden murmelnd in den Gässchen, hinter Ecken, hinter Haustüren. Wieser ging zu einem alten klapprigen Renault Quattro, stieg ein und fuhr los. Grauner und Saltapepe ebenso. Die Bürgermeisterin gab Vollgas. Ihr Auto verschwand immer wieder hinter der nächsten Ecke, während der Ispettore wiederholt bremste, weil er befürchtete, der Alfa würde nicht durch die schmalen Straßen passen.
Wieser lenkte ihr Auto aus dem Dorf hinaus, hoch Richtung Brenner, parallel der Autobahntrasse folgend, irgendwann bog sie in einen kleinen Schotterweg ab, ein dunkler Tunnel führte unter der Autobahn hindurch, auf der anderen Talseite fiel rechts eine von der Sommersonne verdorrte Wiese steil bergab, links säumten Ahornbäume den Weg. Weiter oben am Hang war dichtes Grün zu sehen.
Die Bürgermeisterin hielt am Straßenrand, etwas unterhalb stand ein altes Bauernhaus, mit einem hölzernen Stadel daneben. In der Talsohle rauschte der Verkehr. Obwohl Grauner die Autotür noch nicht geöffnet hatte, hörte er bereits böses Hundegebell. Der Hof sah auf den ersten Blick unbewohnt aus.
Das Fell des Köters war dunkelbraun, drei der vier Pranken schimmerten grau, die Augen waren schwarz und die Zähne so weiß, als wären sie einer Hundezahnpastawerbung entsprungen. Der Schäferhund bellte nicht, er kläffte und knurrte wie das Donnergrollen eines Sommergewitters. Die Zunge hing ihm zur Schnauze hinaus, dickflüssiger Speichel platschte auf den staubigen Boden.
Das Tier zerrte an der Kette, die an der Hundehütte zwischen dem Eingang zum Hof und dem Stadel befestigt war. Mal legte sich die Kette wie eine eiserne Schlange auf den Sand, dann war sie wieder schnurgerade gespannt.
Weiherers Männer schlüpften in Ganzkörperanzüge und reichten auch den Ermittlern und der Bürgermeisterin weiße Handschuhe und Überschuhe. Dann gingen Grauner und Saltapepe, Wieser und die Spurensicherer ein paar Schritte zur Seite, sie versuchten an der linken Hauswand entlang zur Tür zu gelangen, aber die Kette reichte so weit, dass sich der Hund davor postieren konnte. Die Gruppe machte einen Rückzug.
»Soll ich?«, fragte Saltapepe.
Der Commissario verstand erst nicht, dann sah er, dass der Ispettore bereits die Beretta gezogen hatte. Grauner schüttelte angewidert den Kopf. Man konnte nicht alles erschießen, wovor man sich fürchtete. So funktionierte das Leben nicht. Er stellte sich in die Nähe der Tür, so, dass der Hund bis auf einen Meter an ihn heranreichte. Das Biest zerrte, kläffte, zerrte weiter. Grauner imponierte immer wieder, mit welcher Energie so ein Tier das eigene Haus verteidigte, er wusste aber auch, irgendwann würde die Erschöpfung einsetzen. Es war nur eine Frage der Zeit, diese Hunde waren starke Tiere, sie konnten einen Menschen zerfleischen, sie waren instinktgeleitet, treu, doch die Evolution hatte ihnen nicht beigebracht, sich die Kräfte einzuteilen.
Grauner sah dem Hund in die Augen und schmunzelte. Das Tier würde zerren und kläffen und schließlich todmüde zusammenbrechen. Dann würde er aus dem Trog, den er an der Scheune entdeckt hatte, etwas Wasser schöpfen und es dem Schäferhund hinstellen. Dieser würde die Flüssigkeit gierig in sich hineinschlecken und es würde ihn keine Sekunde mehr kümmern, ob die Besucher in das Haus gingen oder nicht.
»Wir können ums Haus herumlaufen«, schlug die Bürgermeisterin vor. Sie schrie gegen das Gekläffe an.
»Nein«, erwiderte Grauner. »Wir warten, erzählen Sie uns in der Zwischenzeit alles, was Sie über den Toten wissen.«
»Ich weiß nicht viel über den Jakob«, schrie Wieser weiter. Ihre Wangen leuchteten dabei wie Jonagold.
Wie viele Sommer auf der Alm mochten diesen Wangen ihre Farbe gegeben haben, fragte sich Grauner.
»Er … äh … war … Es gibt die, die viel reden und die, die viel schweigen. Er war einer von den Schweigsamen.«
»Hatte er Familie?«
»Was?«
Die Frage war im Lärm untergegangen, doch der Commissario hatte bemerkt, dass das Bellen bereits von immer längeren Passagen des Keuchens und Gurgelns unterbrochen wurde.
»Ob er Familie hatte, der Tote?«
»Nein, nicht dass ich wüsste. Nicht in der Gegend. Er lebte alleine auf dem Hof. Seinen Sohn hat sich der Herrgott viel zu früh geholt. Er ist in jungen Jahren mit dem Traktor verunglückt. Hier auf der Wiese.«
Grauner und Saltapepe schauten gleichzeitig den steilen Hang hinab. Der Commissario wurde auf keinem noch so steilen Gebirgsgrat von Schwindel oder Höhenangst befallen, nun aber wankten ihm die Knie.
»Auch Jakobs Frau ist bereits vor über fünfzehn Jahren gestorben. Seitdem lebt er alleine auf dem Hof. Er hat auch eine Tochter. Aber die ist ausgewandert. Zuerst runter nach Innsbruck, zum Studieren, heute lebt sie in Barcelona, soviel ich weiß.«
Saltapepe kritzelte seinen Schreibblock voll.
Grauner fragte weiter. »Wer kann uns etwas über den Alten erzählen?«
»Wenn überhaupt, dann seine Wattkollegen.«
»Seine … was?«, fragte Saltapepe.
Wieser schaute ihn verwirrt an.
»Der kommt aus Neapel«, klärte Grauner sie auf. Dann drehte er sich dem Ispettore zu, »Wattkollegen. Watten. Erinnerst du dich nicht mehr, Saltapepe? Das Kartenspiel, das wir Südtiroler spielen. Du hast es doch selbst einmal ausprobiert – im Ultental. Der Guate, der Rechte, Farbe, Schlag, Trumpf, die Drei bieten, heben, gehen …«
Saltapepe nickte. Grauner schaute wieder zur Bürgermeisterin und bedeutete ihr fortzufahren.
»Der alte Jakob saß jeden Tag unten in Gossensass im Goldenen Rössl mit seinen drei Wattkollegen. Dem Simon, dem Luis und dem Einarmigen.«
»Dem Einarmigen?«
»Ja, dem Einarmigen. Dem haben sie im Krieg einen Arm weggeschossen, in Russland, erzählt man sich. Fragen Sie mich aber nicht, wie der in Wirklichkeit heißt.«
Grauner kannte das. Fast jeder in den Dörfern Südtirols hatte Spitznamen. Oft wurde man mit dem Namen des Vaters gerufen, mit der Bezeichnung des Handwerks, das der Urgroßvater einst ausgeübt hatte, oder mit dem Namen des Ortes, in dem die Familie einst gewohnt hatte. So war es nicht selten, dass jemand, der ganz anders hieß, Schmied, Fischer, Maurer, Schuster, Professor oder Studierter gerufen wurde. Oder Schneckenthaler, Sarner, Pseirer, Vinschger. Nicht wenige trugen sogar mehrere Spitznamen, je nachdem, wie gut man jemanden kannte, wie sehr man jemanden mochte, wählte man eine freundschaftliche, intime oder abschätzige Variante.
Dieses Geflecht aus echten Namen und Kosenamen war für Fremde ein undurchdringlicher Code, für Dorfbewohner aber ein Mittel der vielschichtigen Kommunikation.
»Wann sind die drei im Goldenen Rössl anzutreffen?«, fragte Grauner.
»Jeden Tag. Nach der Kirche. Die Messe hört bei uns immer etwas später auf. Erst kurz nach halb zehn. Weil wir einen alten Pfarrer haben. Der kann nicht mehr so schnell beten. Er ist schwach auf den Beinen. Früher hat er dreimal am Tag seine Messe gehalten. Zweimal in Gossensass, einmal oben am Brenner. Zum Pass fährt er nicht mehr hoch. Jakobs Wattkollegen spielen Karten, vormittags bis Punkt zwölf. Abends kommen sie stets noch mal vorbei, ab fünf. Da können Sie die Uhr nach stellen.«
Der Commissario bemerkte, dass eine angenehme Stille wie Balsam seine Ohren beruhigt hatte. Er schaute sich um, die Kette war zu einem losen Bogen geformt, das Tier in seiner Hundehütte verschwunden, nur die schwarze Schnauze lugte hervor. Grauner ging zum Trog, schnappte sich einen Fressnapf, der da lag, füllte ihn mit Wasser und stellte ihn dem Hund hin.
»Kommen Sie«, sagte er zur Bürgermeisterin und winkte auch Saltapepe heran.
Die Haustür war unverschlossen, sie quietschte beim Öffnen.
Das Haus war menschenleer, doch nicht unbelebt. Ameisen krabbelten in Kolonnen den dunklen Holzboden entlang, aus der Küche gackerte es, es roch nach Fäkalien und faulen Eiern. Saltapepe hielt sich den Ärmel seines Sakkos vor die Nase, er atmete das Parfüm ein, das er sich morgens auf die Handgelenke gesprüht hatte, doch das seichte Wässerchen von Dolce & Gabbana konnte den penetranten Gestank von Hühnerscheiße nicht verdrängen.
Seitdem sie mittags von der Questura losgefahren waren, hatte ihn ein seltsames Gefühl beschlichen. Normalerweise hatten sie es bei diesen Südtiroler Ermittlungen mit Bozner Kleinganoven zu tun, die Fälle in den Dörfern waren meist Familienfehden, Streit um eine Magd, den Hof, die Vorherrschaft im Gasthaus. Dieser Fall aber, so wenig sie bislang auch darüber wussten, schien anders zu sein. Mächtiger, brutaler. Obwohl Saltapepe von Bergen umzingelt war, von Wiesen und Gletschern, kam es ihm so vor, als wäre er in die eigene Ermittlervergangenheit zurückkatapultiert worden. Irgendetwas an dieser Szenerie erinnerte ihn an die Einsätze, die er als Teil des Antimafia-Kommandos im Hinterland von Neapel erledigt hatte.
Vielleicht war es der Beton des Brennerpasses. Vielleicht die Kargheit des Hofes, den sie gerade begutachteten. Wahrscheinlich war es die Kaltblütigkeit der Tat, die sie aufzuklären hatten. Ein Mensch, zu Tode geschleift, das war nicht irgendein Mord, keine Tat im Affekt, wie es so oft vorkam, keine unüberlegte Kurzschlusshandlung, die jemand für den Rest seines Lebens bereute. Dieser alte Mann war hingerichtet worden. Geplant, grausam, unmenschlich.
Da war es jemandem nicht genug gewesen, diesem Jakob Voltinger das Leben zu nehmen. Ihn aus dem Weg zu räumen. Da wollte jemand ein Revier abstecken. Zurückschlagen. Rache üben. Was war der Grund dafür? Warum musste dieser Mensch sterben? Was hatte er getan? Was hatte er gewusst?
Die Glühbirne im Flur zersprang beim Betätigen des Schalters, zwei Meter weiter vorne schien Licht aus einem Raum ins Dunkel. Es war die Küche. Eine Henne war auf den Tisch gesprungen und pickte Nüsse aus einer Schale. Daneben stapelten sich alte Bücher mit vergilbten Einbänden. Tiroler Sagen. Herodots Historien, Sokrates, Platon, Aristoteles.
Dieses Haus wirkte nicht so, als hätte hier gestern noch jemand gewohnt. Oder zumindest so, als hätte der, der darin gehaust hatte, sein Leben schon längst hinter sich gelassen gehabt. Nur noch vor sich hinvegetiert, wartend, auf das Ende.
Die Fenster waren von einer Fettschicht verklebt, zwischen dem Kreuz und den hölzernen Armen des Gottessohnes im Herrgottswinkel spannten sich wollige Spinnweben. Dicke, gesättigte Fliegen zappelten darin. Im Spülbecken türmte sich dreckiges Geschirr, daneben lag verdorrte Petersilie, eine angeschnittene, schwitzende Speckschwarte und zu Kristallen erstarrter, geriebener Parmesankäse.
Saltapepe sah wieder zu Boden, er sah einen Schatten hinter der Ecke verschwinden, zu groß für eine Ameise, zu klein für eine Hauskatze. Er schaute zur Bürgermeisterin. Frauen hatten oft Angst vor Ratten, aber diese schien sich nicht zu fürchten. Überhaupt schien sie ihm eigenartig gefühlskalt auf die Vorfälle in ihrem Gemeindegebiet zu reagieren.
Der Ispettore folgte Grauner wieder auf den Flur hinaus. Sie gingen weiter nach hinten, vorbei an einer Garderobe, die Jacken rochen nach Wald, Treibstoff und Spritzmittel. An der rechten Seite der Wand hing ein altes Telefon mit Drehscheibe. Saltapepe überlegte, wann er zum letzten Mal ein solches Exemplar gesehen hatte. Es gab da diese alte Bar im Hafen seiner Heimatstadt, in der so ein Telefon hinter der Theke baumelte, daneben, an die Wand, hatte der Besitzer die Nummern der Mädchen gekritzelt, die er, als er noch zur See gefahren war, in den Häfen dieser Welt zurückgelassen hatte.
Grauner und Saltapepe erreichten das Badezimmer. Im Klosett und in der Wanne wies eine grüne Schimmelspur den Weg in den Abfluss. Sie machten wieder kehrt, links ging es ins Schlafzimmer. Es war dunkel darin, der Staub juckte den Ispettore in der Nase. Der Commissario ging zum Fenster, öffnete es und stieß die Fensterläden auf.
Das Bett war aus dunklem Holz und am Kopfende mit geschwungenen Schnitzereien verziert. Es war ungemacht, das Leinentuch lag halb auf dem Boden. Über den Kissen hing ein Muttergottesbild an der Wand. Sie hielt das Jesuskind in den Armen und schaute zum Himmel, wo sich dunkle Wolken wölbten. Der Rahmen war vergoldet.
Auf dem Nachtkästchen stand eine Lampe mit einem beigen Schirm. Wieder alte Bücher. Die Bibel. Dantes La Divina Commedia. Goethes Faust, die Italienische Reise und der West-östliche Divan. Daneben lagen Unterlagen in Mappen. Einige waren zu Boden gefallen. Die Bürgermeisterin verharrte im Türrahmen. Die Männer von der Scientifica hatten sich in der Zwischenzeit in der Küche zu schaffen gemacht. Saltapepe wusste, dass sie es nicht gerne hatten, wenn die Ermittler vor ihnen die Räume betraten, aber da Weiherer selbst nicht vor Ort war, sondern noch am Fundort der Leiche beschäftigt, trauten sie sich nicht, den Commissario zurechtzuweisen.
Grauner stand direkt am Bett, er schaute auf die am Boden liegenden Zettel. Hatten sie etwas zu bedeuten, standen darauf letzte Worte? Saltapepe wollte herantreten, da knipste der Commissario schon das Lämpchen an und bückte sich. Er schob zwei Blätter auseinander, fixierte eine Visitenkarte, die dazwischenlag, griff nach ihr, zögerte, drehte sich verstohlen um. Er wirkte für einen kurzen Moment wie ein Schuljunge, der beim Bonbonklau im Gemischtwarenladen sichergehen wollte, von der Verkäuferin und anderen Kunden nicht beobachtet zu werden.