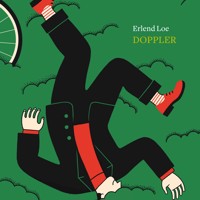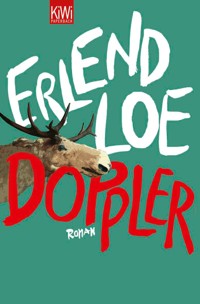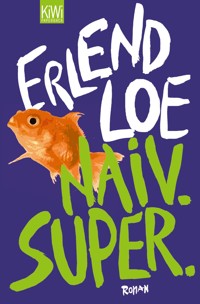
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Nach zwei erfolgreichen Büchern von Erlend Loe nun auch sein erster Roman als KiWi: Naiv. Super. Der erste Roman von Erlend Loe, 1998 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, gilt mittlerweile in Skandinavien als Klassiker. Mit dieser kleinen Geschichte über die großen Dinge des Lebens erschließt uns Erlend Loe auf humorvolle und komische Weise die Welt, in der für seinen jungen Helden die Dinge nicht immer so laufen, wie sie sollen.Manchmal genügen die kleinen Anlässe, um einen aus der Bahn zu werfen. Als der ältere Bruder ihn beim Krocket besiegt, gerät der Ich-Erzähler, ein 25-jähriger Student, in eine Lebenskrise. Er schmeißt alles hin, lebt in den Tag hinein und beginnt nachzudenken – über sich, über das Leben, über das, was er hat, und das, was ihm fehlt, beispielsweise eine Freundin. Und ob die Dinge besser oder schlechter werden.Entschlossen, dem Leben neu zu begegnen, tauscht er Faxe mit einem Freund aus, kauft einen Volvo, korrespondiert mit einem weltberühmten Chaosforscher, freundet sich mit einem Jungen an, besucht seinen Bruder in New York und findet endlich auch ein Mädchen, das seine Freundin werden könnte.Erlend Loe erschließt uns die Welt auf humorvolle und unterhaltsame Weise. Er erzählt von der Suche nach dem großen Zusammenhang – leicht, voller Wortwitz und Situationskomik. Und doch liegen hinter jeder Zeile die Traurigkeit und das Glück einer ganzen Welt.»Loes Roman dokumentiert die Lebenswelt der 20- bis 30-Jährigen, den Spiel-Charakter der neuen Kommunikationstechnik, die weltbeherrschende Macht des Marketing. Schon wahr. Oder: Naiv. Super.« Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Ähnliche
Erlend Loe
Naiv. Super.
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Erlend Loe
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Erlend Loe
Erlend Loe, geboren 1969 in Trondheim, Studium der Literaturwissenschaften in Oslo, später an der Dänischen Filmschule in Kopenhagen und an der Kunstakademie in Trondheim. Lebt als Schriftsteller, Drehbuchautor und Übersetzer in Oslo. Naiv. Super. erschien unter dem Titel Die Tage müssen anders werden. Die Nächte auch. 1998 bei Kiepenheuer & Witsch.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Nach zwei erfolgreichen Büchern von Erlend Loe nun auch sein erster Roman als KiWi: Naiv. Super.
Der erste Roman von Erlend Loe, 1998 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, gilt mittlerweile in Skandinavien als Klassiker.
Mit dieser kleinen Geschichte über die großen Dinge des Lebens erschließt uns Erlend Loe auf humorvolle und komische Weise die Welt, in der für seinen jungen Helden die Dinge nicht immer so laufen, wie sie sollen.
Manchmal genügen die kleinen Anlässe, um einen aus der Bahn zu werfen. Als der ältere Bruder ihn beim Krocket besiegt, gerät der Ich-Erzähler, ein 25-jähriger Student, in eine Lebenskrise. Er schmeißt alles hin, lebt in den Tag hinein und beginnt nachzudenken – über sich, über das Leben, über das, was er hat, und das, was ihm fehlt, beispielsweise eine Freundin. Und ob die Dinge besser oder schlechter werden.
Entschlossen, dem Leben neu zu begegnen, tauscht er Faxe mit einem Freund aus, kauft einen Volvo, korrespondiert mit einem weltberühmten Chaosforscher, freundet sich mit einem Jungen an, besucht seinen Bruder in New York und findet endlich auch ein Mädchen, das seine Freundin werden könnte.
Erlend Loe erschließt uns die Welt auf humorvolle und unterhaltsame Weise. Er erzählt von der Suche nach dem großen Zusammenhang – leicht, voller Wortwitz und Situationskomik. Und doch liegen hinter jeder Zeile die Traurigkeit und das Glück einer ganzen Welt.
»Loes Roman dokumentiert die Lebenswelt der 20- bis 30-Jährigen, den Spiel-Charakter der neuen Kommunikationstechnik, die weltbeherrschende Macht des Marketing. Schon wahr. Oder: Naiv. Super.« Die Welt
Inhaltsverzeichnis
Motto
Die Wand
Der Ball
Der Baum
Die Zeit
Radfahren
Der Meister
Leben
Der Wald
Die Tiere
Vier
Das Brett
Vakuum
Der Vogel
Das Mädchen
Der Weltraum
Crazy Love
Freundinnen
Der Papst
Fahrstühle
Paul
Der Regen
Kuss
Unheimlich
Zusammenhang
Der Arm
Form
Röntgen
Sinn
Flugblatt
N
Die Stadt
Der Hund
Hopi
1-800-Parks
Die Bibliothek
Der Park
Dümmer
Nah
Miezekätzchen
Der Helm
Der Zettel
Vieles
Empire State Building
Bäume
Reise
Die Antwort
Dank
»Anybody who rides a bike is a friend of mine.«
Gary Fisher
Die Wand
Ich habe zwei Freunde. Einen guten und einen schlechten. Außerdem habe ich einen Bruder.
Er ist vielleicht nicht so sympathisch wie ich, aber so weit ganz okay.
Ich bekomme die Wohnung von meinem Bruder, wenn er verreist ist. Eine hübsche Wohnung. Mein Bruder hat ganz gut Geld. Gott weiß, woher, ich habe das nicht so mitgekriegt. Er kauft oder verkauft irgendwas. Und jetzt ist er verreist. Er hat mir erzählt, wohin. Ich habe es auch aufgeschrieben. Vielleicht nach Afrika?
Er hat mir eine Nummer auf einem Zettel dagelassen, und dass ich ihm Post und Nachrichten nachfaxen soll. Das ist jetzt mein kleiner Job. Einfach, machbar.
Als Gegenleistung kann ich hier wohnen.
Das finde ich sehr gut.
Genau das, was ich brauche.
Ein bisschen Zeit, um Ruhe zu finden.
Mein Leben ist in der letzten Zeit ziemlich merkwürdig gewesen. Von einem Tag auf den anderen habe ich das Interesse an allem verloren.
Passiert ist es vor ein paar Wochen, an meinem 25. Geburtstag.
Mein Bruder und ich waren zum Abendessen bei unseren Eltern. Gutes Essen. Und Kuchen. Wir haben über dies und das geredet. Plötzlich, ich war selbst ganz überrascht, habe ich meinen Eltern vorgeworfen, dass sie mich nie dazu bewegt haben, Hochleistungssport zu treiben.
Das war absolut ungerecht.
Ich redete lauter blödsinniges Zeug, von wegen, heute könnte ich Profisein, in Topform. Viel Geld könnte ich haben, und immer unterwegs sein. Idiotischerweise behauptete ich, es sei ihre Schuld, dass ich es nie zu etwas gebracht habe und dass mein Leben so leer und langweilig ist.
Hinterher habe ich mich entschuldigt.
Das war aber erst der Anfang.
Am selben Abend haben mein Bruder und ich Krocket gespielt. Das machen wir nicht oft. Die alten Krocketschläger lagen verfault hinter dem Geräteschuppen im Garten. Wir haben es bei jeder Menge Tankstellen versucht, bis wir neue gefunden hatten. Mein Bruder hat sie mit einer von seinen Kreditkarten bezahlt. Wieder im Garten unserer Eltern, schritten wir die Abstände ab und steckten Tore und Stäbe in die Erde. Ich nahm Rot, mein Bruder Gelb. Ich weiß nicht, ob wir diese Farben auch immer hatten, als wir klein waren. Daran erinnere ich mich nicht.
Wir fingen an zu spielen, und eine Zeit lang ging es gut. Ich kam rasch durch die ersten Tore, erzielte Zusatzschläge und spielte weiter. Ich hatte Vorsprung. Lange vor meinem Bruder war ich einmal durch und durfte jetzt seine Kugel wegkicken. Ich legte meine Kugel hinter einen Baum, wartete da auf ihn, lachte ihn aus und machte Witze. Ziemlich übermütig.
Mein Bruder war jetzt auch einmal durch und durfte meine Kugel wegkicken. Er fand das Ganze schon seit mehreren Minuten gar nicht mehr komisch, als er zum Gebüsch schaute.
Ich konnte ihm ansehen, was er vorhatte.
Das muss doch nicht sein, sagte ich.
Aber mir war schon klar, da kannte er nichts. Er legte seine Kugel neben meine, stellte den rechten Fuß darauf und richtete sie so aus, dass sie möglichst viel Schaden anrichten würde. Er zielte gründlich auf den Rand des Gartens. Dahin, wo der Garten zu Ende war. Wo das Gras aufhörte, Gras zu sein, und nur noch Moos war. Vorsichtig holte er ein paarmal probeweise aus, um richtig Schwung in den Schlag zu legen und um nicht seinen Fuß zu treffen. Das wäre schließlich das Allerpeinlichste. Dann kickte er mit seiner Kugel meine in den großen Busch. Verflucht tief in den Busch rein. Mitten in die Mitte.
Dahin, wo niemals die Sonne scheint.
Eigentlich ein Superschlag. Ich mache ihm auch keine Vorwürfe. Ganz sicher hätte ich es genauso gemacht.
Aber dann meine Reaktion. Die hat mich total kalt erwischt.
Mein Plan war klar gewesen, die ganze Zeit schon – er war einfach und ziemlich feige. Ich wollte im Zielbereich liegen und harmlos tun, und dann würde ich seine Kugel aber so was von weit wegkicken, wie er es nie für möglich gehalten hätte. Falls ich danebenhauen würde, auch kein Problem, denn er war noch nicht mit seiner Runde durch. Aber wenn ich treffen sollte, dann würde ihn das ungespitzt in den Boden hauen, vor allem, weil ich ihm außerdem die Revanche verweigern würde.
All das konnte ich jetzt vergessen.
Ich hatte einmal zu viel danebengehauen. Mein Bruder hatte mich rausgekickt, und meine Kugel lag im Busch.
Ich ließ nicht locker. Wollte mich nicht geschlagen geben. Ich hatte vor, seine Kugel unter das Auto zu schießen. Das war das Einzige, was mich noch aufrechthielt. Blut und Wasser sollte er schwitzen. Irgendwie würde ich es schon hinbekommen, dass sich seine Kugel unter dem Auto verklemmte. Auf allen vieren würde er kriechen müssen, auf dem Bauch, im Dreck, fluchend.
Aber jetzt musste ich erst mal meine Kugel aus dem Busch holen. Ich hob die Äste an und bog sie beiseite. Dann leuchtete ich mit einer Taschenlampe hinein, tief in den großen Busch. Ganz hinten konnte ich die Kugel erkennen. Man sah nicht mal mehr, dass sie rot war, aber ganz klar, es war meine Kugel. Mein Bruder lachte sich natürlich halb tot.
Ich nahm die Taschenlampe in den Mund und kroch ins Gebüsch. Es war feucht und kalt, wahrscheinlich gerade mal ein paar Grad über null. Diesen Busch habe ich gehasst, seit ich denken kann. Gleich würde ich zuschlagen. Ich zielte. Das würde klappen. Ich war überzeugt, in ein paar Sekunden würde ich wieder vorn liegen.
Den wollte ich abmeiern, meinen Bruder, diesen Mistkerl.
Aber ich brauchte drei Schläge, um aus dem Busch rauszukommen. Und während ich noch dastand und mir Blätter und Erde abklopfte, immer noch die Taschenlampe im Mund, kriegte mich mein Bruder wieder dran und schoss meine Kugel in den Busch zurück.
Das ist einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass er tief drinnen möglicherweise weniger sympathisch ist als ich. Ich hätte seine Kugel nie zweimal in den Busch geschossen. Einmal schon. Aber doch nicht zweimal.
Ich schaltete die Taschenlampe an und kroch wieder in den Busch. Als mein Bruder mich zum dritten Mal wegkicken wollte, haute er daneben, und ich konnte zur Revanche seine Kugel wegschießen. Aber als ich sie unter das Auto kicken wollte, traf ich nicht richtig, und der Schuss misslang. Wahrscheinlich hatte ich mir einfach zu viel Mühe gegeben.
Danach machte er kurzen Prozess. Er kickte meine Kugel an den Startstock, das Spiel war vorbei, ich hatte verloren. Das gab Zoff. Ich fand, er hätte geschummelt, wir sahen in den Regeln nach und zofften uns weiter. Ich sagte ein paar Sachen, die ziemlich daneben waren.
Schließlich fragte mein Bruder, ob irgendwas nicht in Ordnung sei. Was ist mit dir los?, fragte er. Ich wollte schon sagen, nichts, aber da spürte ich, wie es in mir hochkam. Überwältigend und widerlich. So etwas hatte ich noch nie erlebt, und ich konnte nicht mehr sprechen. Stattdessen setzte ich mich ins Gras und schüttelte den Kopf. Mein Bruder kam zu mir her und setzte sich neben mich. Er legte mir die Hand auf die Schulter. So hatten wir noch nie nebeneinandergesessen. Ich fing zu weinen an. Seit Jahren hatte ich nicht mehr geweint. Offenbar hat das meinen Bruder überrascht. Es tat ihm leid, dass er so brutal gespielt hatte.
Alles kam mir so sinnlos vor, ganz plötzlich.
Mein eigenes Leben, das Leben der anderen, das Leben von Tieren und Pflanzen, die ganze Welt. Alles war so zusammenhanglos.
Das erzählte ich meinem Bruder. Er hatte allerdings nicht die Voraussetzungen, das zu begreifen. Also stand er einfach auf und sagte, reiß dich zusammen, shit happens, wird schon wieder. Er versuchte, mich hochzuziehen, knuffte mich brüderlich in den Bauch und feuerte mich ein bisschen an. Er hat früher Bowling gespielt. Mein Bruder versteht sich auf Anfeuern. Ich sagte, bleib cool. Mein Bruder setzte sich hin und blieb cool.
Wir redeten miteinander, ich völlig durcheinander. Keiner von uns beiden verstand besonders viel von dem, was ich sagte. Aber mein Bruder nahm mich ernst, das muss man sagen. Ich konnte sehen, dass ich ihm leid tat. Er hatte mich noch nie in so einem Zustand gesehen.
Er sagte, ganz sicher kämen jeden Tag Tausende Menschen so beschissen drauf. Den meisten geht es erst mal eine Zeit lang dreckig, aber bald wieder besser. Mein Bruder ist ein Optimist. Er wollte mir helfen.
Ich dachte, tiefer runter konnte es nicht gehen, und fürchtete, ich könnte den Lebensmut verloren haben und nie wieder Freude empfinden.
Und dann sagte mein Bruder, er müsse verreisen, in ein paar Tagen, für zwei Monate. Er bot mir seine Wohnung an. Ich sagte Danke, und dann saßen wir da und sagten gar nichts mehr, bis mein Bruder auf die Uhr schaute und feststellte, dass die Sportschau schon lief. Er fragte, ob es mir recht sei, wenn wir reingingen. Außerdem hätte ich doch Geburtstag und es sei noch Kuchen übrig.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, spürte ich: So konnte es nicht weitergehen. Ich blieb liegen und dachte nach.
Das Problem war nicht das Krocket. Da war ich ganz sicher.
Krocket war was Kleines, und das hier war was Großes. Ziemlich bald dämmerte mir, womit die Sache zu tun hatte: Ich war fünfundzwanzig geworden, und das machte mir einfach zu schaffen.
Älter werden hat mich schon immer beunruhigt.
Auf Raum pfeife ich mehr oder weniger, aber mit Zeit habe ich Probleme.
Beim Anziehen wurde mir klar, dass ich diesen Tag auf gar keinen Fall verbringen durfte, wie ich die Tage sonst verbrachte.
Die Tage mussten anders werden.
Die Nächte auch.
Eine Zeit lang schaute ich aus dem Fenster.
Dann traf ich eine Entscheidung.
Ich fuhr mit dem Fahrrad zur Uni hoch und sagte, ich sähe mich außerstande, mein Studium weiterzuführen. Die Sekretärin im Immatrikulationsbüro fragte, ob was nicht stimmen würde und ob sie was für mich tun könnte. Ich fand ihre Fürsorglichkeit rührend, hatte aber keine Lust zu reden. Also dankte ich kurz für ihre Freundlichkeit und beantwortete ihre erste Frage mit ja, die zweite mit nein.
Danach radelte ich in die Stadt zurück und wickelte den Rest meines alten Daseins ab. Bei der Zeitung, für die ich ab und zu schrieb, sagte ich Bescheid, eine Weile würde von mir erst mal nichts mehr kommen, vielleicht auch gar nicht mehr. Dann kündigte ich meine Bude, das Telefon und das Zeitungsabonnement. Außerdem verkaufte ich meine Bücher. Und den Fernseher.
Meine restliche Habe passte in den Rucksack und zwei Pappkartons. Die Kartons stellte ich bei meinen Eltern auf den Dachboden, den Rucksack schulterte ich und fuhr in die Wohnung meines Bruders.
Da saß ich dann und schwitzte.
Ich hatte eine echte Handlung vollbracht.
Das war was Reales.
Nicht bloß irgend so eine Seifenoper.
Der Ball
Ein paar Wochen später.
Ich sitze in der Wohnung von meinem Bruder.
Einmal täglich gehe ich raus und kaufe etwas zu essen. Wenn Post kommt, mache ich sie auf und faxe sie meinem Bruder. Eine unglaublich lange Faxnummer. Ich bin mir immer sicherer, dass er in Afrika ist. Den Zettel, auf dem ich seine Adresse notiert habe, habe ich aber nicht mehr gefunden.
Abgesehen davon tue ich so gut wie nichts.
Ich blättere in Zeitungen oder liege auf dem Sofa und gucke in die Luft.
Pläne habe ich keine.
Immer noch herrscht dieses Gefühl vor, dass das meiste sinnlos ist.
Nicht gerade inspirierend. Ich habe das Tempo total runtergefahren. Auf null.
Ich denke, dass ich von vorn beginnen muss. Bloß: Wie macht man das?
Gestern habe ich eine Liste geschrieben, was ich habe und was nicht.
Das hier habe ich:
ein hübsches Fahrrad
einen guten Freund
einen schlechten Freund
einen Bruder (in Afrika?)
Großeltern
einen hohen Kredit fürs Studium
eine bestandene Zwischenprüfung
einen Fotoapparat
eine Handvoll Geld (geliehen)
ein Paar so gut wie neue Joggingschuhe
Und das habe ich nicht:
Pläne
Begeisterung
eine Freundin
das Gefühl, dass die Dinge zusammenhängen und dass am Ende alles gut wird
ein gewinnendes Wesen
eine Uhr
Die paarmal, als ich mir heute die Liste angesehen habe, konnte ich feststellen, dass die Haben-Seite mehr Punkte enthält als die Nicht-Haben-Seite. Ich habe 11 Sachen. Mir fehlen 6. Man könnte fast optimistisch werden.
Bei genauerem Hinsehen wird mir aber klar, dass die Rechnung ziemlich unausgewogen ist. Sie geht nicht auf. Einiges von dem, was ich habe, ist wohl entbehrlich, und etliches von dem, was ich nicht habe, scheint mir absolut notwendig, um so zu leben, wie ich es gern will.
Zum Beispiel würde ich jederzeit meinen schlechten Freund gegen ein bisschen Begeisterung eintauschen. Oder gegen eine Freundin.
Jederzeit.
Aber es ist sonnenklar, dass das so nicht funktioniert.
Ich hab ein bisschen mit den Zahlen herumgespielt.
11 + 6.
Macht 17. Eine ziemlich hohe Zahl, wenn es um die Grundausstattung im Leben eines Menschen geht. Ein paar Sekunden lang war ich richtig stolz. Aber das ganze ergibt überhaupt keinen Sinn. Sachen, die man hat und nicht hat, zusammenzuzählen, ist idiotisch, sonst gar nichts. Außerdem sind manche davon eben nicht unentbehrlich. Die Uhr zum Beispiel. Ich hätte gern eine Uhr, aber ich würde nicht behaupten, dass sie wesentlich ist. Ich habe nur einfach Lust darauf, eine zu haben. Damit ich besser mit der Zeit gehen kann. Wie gesagt, ich komme nicht besonders gut mit der Zeit klar, und ich glaube, es ist besser, man stellt sich seinen Problemen, als dass man ihnen ausweicht. Aber ob eine Uhr wesentlich ist? Nee.
Mit den Joggingschuhen ist es dasselbe. Die sind auch nicht wesentlich, aber ich habe welche. Vielleicht kann man ja sagen, dass sich die Uhr und die Joggingschuhe gegenseitig aufheben? Dann bleibt noch 10+5. Macht 15. Auch noch schön groß in dem Zusammenhang, diese Zahl. Aber leider unbrauchbar und genauso sinnlos wie 17.
Ich muss versuchen, an was anderes zu denken.
Wie ich gerade auf dem Sofa liege und döse, höre ich, dass ein Fax kommt. Ich warte, dass der Apparat es ausspuckt und abschneidet. Dauert vielleicht eine Minute. Dann fällt das Fax auf den Boden, und ich stehe auf, es holen.
Es ist von Kim.
Kim ist mein guter Freund. Ich kenne ihn seit ein paar Jahren. Er ist ein netter Kerl, und er wird gerade Meteorologe. Er ist zu einem Praktikum oder so was auf einer Insel oben im Norden. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist er auf der Insel allein. Er liest ein paar Messgeräte ab und rechnet irgendwas aus. Außerdem ruft er ein paarmal täglich im Meteorologischen Institut in der Uni in Oslo an. Ich glaube, er fühlt sich da oben ein bisschen einsam.
Er schickt mir unablässig Faxe. Bei diesem Tempo kann ich schlecht mithalten. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich ihm nicht so oft faxen kann wie er mir. Er sagt, das ist in Ordnung, aber trotzdem, ich weiß, er versauert so langsam auf seiner Insel. Wir haben es nicht im Einzelnen besprochen, aber unsere Regel lautet in etwa, dass er mir faxen kann, so viel er will, aber ich brauche nur zu antworten, wenn ich mich dazu in der Lage fühle. Mit dieser Regel kann ich leben.
Kim faxt mir, dass er schwedisches Fernsehen gesehen hat, einen kommerziellen Unterhaltungskanal. Er schreibt mir auf Schwedisch:
Kündige
Verreise
Schaff dir neue Freunde an
Ich habe Kim erzählt, wie es mir zur Zeit geht. Er versucht, mir zu helfen. Sympathisch.
Unter dem Schreibtisch von meinem Bruder steht eine Schachtel, auf die ich »Kim« geschrieben habe. Da kommen all seine Faxe rein. Die Schachtel ist schon fast voll. Seit Kim mitgekriegt hat, dass ich an einem Ort bin, wo es ein Fax gibt, steht das Ding nicht still.
Ich lege mich wieder aufs Sofa. Es muss etwas passieren. Nicht unbedingt gleich etwas Großes. Irgendwas eben. Ich beschließe, rauszugehen und etwas zu kaufen, das mich auf nette Gedanken bringt, oder noch besser: zum Lächeln.
Ich gehe in mehrere Geschäfte, finde aber nichts, worauf ich Lust kriege.
Vielleicht definiere ich mal ein paar Kriterien, wonach ich suche?
Aus irgendeinem Grund finde ich das mit den Listen eine gute Sache. Listen sind klasse. Wahrscheinlich werde ich in der nächsten Zeit viele machen. Zum Beispiel jetzt gleich. Kurz nachgedacht, und schon ist klar, dass ich nach einem Gegenstand suche,
der so groß ist, dass ich ihn leicht tragen kann
der nicht mehr kostet als hundert Kronen
den man viele, viele Male benutzen kann
den man sowohl drinnen als auch draußen benutzen kann
den man allein und zusammen mit anderen benutzen kann
der mich in Bewegung bringt
der mich die Zeit vergessen lässt.
Ich setze mich auf eine Bank und schaue mir die Liste genau an. Lange. Eine ehrliche Liste ist das. Ich bin zufrieden mit ihr. Vielleicht gibt es so ein Ding, vielleicht auch nicht. Nicht so wichtig. Wichtig ist die Liste. Die ist eine Entdeckung für mich. Sie ist wertvoll.
Ich sitze da und grübele, was für ein Gegenstand das sein könnte.
Wahrscheinlich mehrere. Ich will aber nur einen.
Auf einmal geht mir auf, dass ich einen Ball haben will.
Schlicht und einfach. Ich spüre eine Welle der Begeisterung.
Lange her, dass ich an Bälle gedacht habe. Schön, dass ich darauf gekommen bin! An solche Dinge muss ich denken. Das ist der richtige Weg. Jetzt brauche ich nur noch einen Ball zu finden. Wie sucht man einen Ball aus?
Die Welt ist voller Bälle. Unablässig werden sie von den Leuten benutzt. Zu Spiel und Sport und bestimmt noch vielem anderen. Jetzt kommt es drauf an, den passenden zu finden.
Ich gehe in ein Sportgeschäft.
Eine überwältigende Auswahl an Bällen haben die. Hübsche, teure Bälle. Aus Leder und anderen, haltbaren Materialien. Ich befühle sie, aber sie kommen mir zu anspruchsvoll vor. Wenn ich so einen Ball kaufe, setzt der mich am Ende unter Leistungsdruck. Für einen Profiball ist die Zeit noch nicht reif. Alles, was mit Konkurrenz zu tun hat, muss ich in meinem Leben derzeit möglichst meiden. Erholung, so lautet jetzt die Parole.
Ich brauche einen ganz schlichten Ball. Am besten einen aus Plastik.
Also weiter, in einen Spielzeugladen. Hier ist die Auswahl etwas übersichtlicher, zum Glück nur eine Handvoll Bälle, in wenigen Farben und Größen. Ich wiege einige davon in der Hand und lasse sie auf dem Boden hüpfen. Am Ende mache ich es mir leicht und nehme einen roten Plastikball, mittelgroß. Knapp fünfzig Kronen kostet er.
Für den Transport gibt man mir eine Tüte. Dann radele ich nach Hause.
Ich faxe Kim: Bessere Laune als seit Langem. Habe mir roten Ball gekauft.
Ich lege mich aufs Sofa und lasse den Ball auf meiner Brust ruhen. Jetzt warte ich, dass es Abend wird.
Wenn es dunkel ist, gehe ich in den Hinterhof und werfe den Ball an eine Wand. Darauf freue ich mich schon.
Der Baum
Inzwischen habe ich den Ball mehrere Abende hintereinander an die Wand geworfen.
In der Regel gehe ich nach den Abendnachrichten im Fernsehen runter und stelle mich in eine Ecke, wo keine Fenster sind. Eine Stelle, wo wenig Leute durchkommen, beleuchtet von einer nackten Glühbirne.