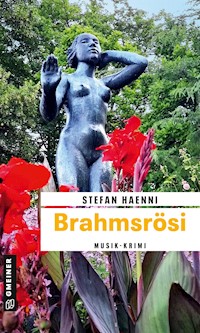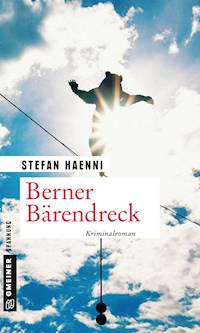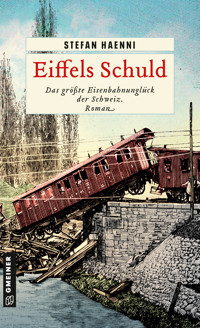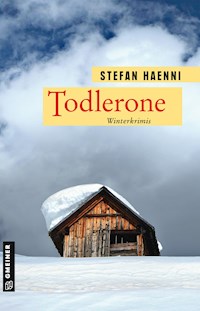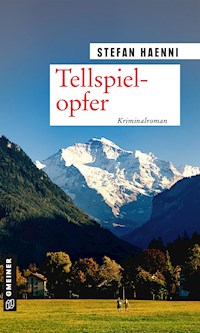Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Feller
- Sprache: Deutsch
Thun, am Rande des Berner Oberlandes. Ein grausamer Mord droht den Frieden der Schweizer Kleinstadt zu zerstören: Ausgerechnet der „Fulehung“, die Leitfigur des jährlichen Stadtfestes, wird tot in einer Schule aufgefunden. Erschlagen mit dem eigenen „Schyt“ - dem hölzernen Schlagstock der beliebten Narrenfigur. Um einen Skandal zu verhindern und die Hintergründe der Bluttat möglichst unauffällig aufzuklären, wird Privatdetektiv Hanspeter Feller mit dem Fall betraut. Der verfolgt bereits eine heiße Spur, als es einen weiteren mysteriösen Todesfall zu beklagen gibt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan haenni
Narrentod
Kriminalroman
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2009 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Stefan Haenni
ISBN ISBN 978-3-8392-3014-5
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist unbeabsichtigt und rein zufällig. Wirklich.
1
»Jetzt ist es passiert.«
»Hallo?«
»Hanspudi, es hat ihn erwischt.«
»Wen? Wer spricht da? Ich versteh nicht recht. Moment.«
Die Turmuhr der Stadtkirche schlägt 17 Uhr. Ich erhebe mich, schließe mit einer Hand das offene Fenster und presse mit der anderen das Handy ans rechte Ohr.
»Entschuldige«, antwortet der Anrufer. »Ich bin’s, der Rolf.«
»Oho, der Stadtpräsident persönlich! Ciao, Rüfe. Was ist los?«
»Der Fulehung ist tot!«
»Wie meinst du das?«
»Wie ich’s sage.«
»Erzähl keinen Chabis, Rüfe. Der Fulehung kann nicht sterben.«
»Doch. Jemand hat Beat Dummermuth umgebracht«, bekräftigt der Stapi, den Tränen nahe.
So emotional habe ich Rolf von Siebenthal noch nie erlebt. Mitten im dreitägigen Ausschiesset, dem wichtigsten Stadtfest der Thuner Bevölkerung, scheinen Rüfes Nerven blank zu liegen. Was ich mitbekommen habe: Dummermuth, der einmal pro Jahr in ein teuflisches Narrenkostüm steigt und die sagenumwobene Figur des burgundischen Hofnarren mimt, scheint etwas zugestoßen zu sein. Etwas Endgültiges.
»Willst du sagen …?«
»Genau. Er wurde ermordet. Darum rufe ich dich an. Du musst mir helfen.«
»Warum gehst du nicht zur Polizei?«
»Bin ich doch. Aber keiner kennt unser Städtchen und seine Pappenheimer besser als du. Die Kantonspolizei Bern ist damit einverstanden, dass ich dich als Privatdetektiv beauftrage, die Angelegenheit so diskret und so rasch als möglich aufzuklären. Die Beamten tun selbstverständlich ihre Arbeit. Die Kapo besteht lediglich darauf, dass du ihre Ermittlungen nicht behinderst, die Gesetze respektierst und ihnen keine Informationen vorenthältst, wenn du etwas herausfindest«, sagt Rolf von Siebenthal.
»Wenn? Falls ich etwas herausfinde«, berichtige ich.
»Ich habe volles Vertrauen und zähle auf dich. Und ganz wichtig: Die Sache bleibt absolut geheim! Nichts darf raus. Die Festfreude unserer Bevölkerung darf unter keinen Umständen getrübt werden. Es reicht, wenn die Öffentlichkeit dann nächste Woche ins Bild gesetzt wird.«
»Hm, ich denke, am besten komme ich im Rathaus vorbei. Du bist doch jetzt in deinem Büro, oder?«, frage ich.
»Ja, ja. Danke, Hans-Peter, danke. Und bitte beeil dich.«
Hans-Peter? Welche Ehre. Seit wann nennt mich Rüfe Hans-Peter? Gerade war ich noch der Hanspudi. Die Lage muss wirklich sehr ernst sein.
2
20 Minuten später stehe ich bereits im Rathaus.
Der sichtlich aufgewühlte Stapi hat ganz vergessen, mir einen Stuhl anzubieten, und tigert hinter seinem Schreibtisch hin und her. Der Stadtvater dürfte um die 175 Zentimeter messen und kaum unter 100 Kilogramm wiegen. Er trägt eine karminrote Krawatte über einem weißen Hemd, das in einer beigen Bundfaltenhose steckt. Der dazugehörende dunkelblaue Kittel hängt verknittert über der speckigen Rückenlehne eines gepolsterten Bürosessels. Mit seinen 64 Jahren vertritt Rolf von Siebenthal, nach Meinung einer Mehrheit, die Interessen der ansonsten SP-lastigen Stadt auch als konservatives SVP-Mitglied einigermaßen unabhängig. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt im Schatten des Niesen auf dem Strättlighügel, mit Blick über den See, auf die sonnige Goldküste gegenüber und zum Alpenpanorama des Berner Oberlandes mit Eiger, Mönch und Jungfrau.
Ungefragt setze ich mich schräg auf die präsidiale Schreibtischkante und erkundige mich: »Gibt es erste Vermutungen?«
»Nur wilde. Nichts Konkretes.«
»Dann sag mir die wilden«, fordere ich Rüfe auf.
»Es könnte als Angriff auf Tradition und Beständigkeit unseres schönen Garnisonsstädtchens verstanden werden. Der Weisse Block könnte die Finger im Spiel haben. Aber wie gesagt, reine Vermutung.«
Ich habe meine Zweifel an dieser Hypothese und gebe zu bedenken, dass Mord und Totschlag bisher nicht zum Repertoire dieses Chaotentrupps gehörten.
Rolf von Siebenthal senkt seine Mundwinkel und hebt gleichzeitig die Schultern. Dann meint er: »Ja, ich weiß. Trotzdem dürfen wir nicht davor zurückschrecken, auch anarchistische Motive ins Auge zu fassen.«
»Warum dann nicht gleich terroristische?«, frage ich.
»Ach komm, Hanspudi, das dann doch eher nicht«, wehrt Rüfe ab. »Eine ganz andere Möglichkeit sehe ich darin, dass Beat Dummermuth schwerwiegende private oder berufliche Probleme gehabt haben könnte.«
»Das scheint mir schon wahrscheinlicher. Aber warum wird er dann ausgerechnet in seiner auffälligen Kostümierung getötet? Übrigens, wie wurde er eigentlich ermordet?«
»Er wurde erschlagen. Mit dem Schyt.«
»Shit!«, rutscht es mir heraus. »Mit dem eigenen Schyt?«
Ich fass es nicht. Das Schyt ist ein hölzerner Schlagstock und stellt eine der beiden Waffen dar, mit denen sich der Fulehung Respekt verschafft. Die andere besteht aus einem Strauß Schweineblasen, den Söiplatere, die wie lachsfarbene Luftballons mit Schnüren verknotet an einem armlangen Holzstecken baumeln.
Ich erkundige mich weiter: »Wann und wo ist es passiert?«
Der Stapi wischt sich erst mit einem grün karierten Nastuch über die schweißnasse Stirn und schüttelt anschließend wortlos den Kopf. Nach einer kurzen Pause erst gibt er Auskunft.
»Gefunden hat man ihn kurz nach 16 Uhr, oben in der alten Schlossbergschule.«
»Aha. Dort hat sich doch die Handelsmittelschule eingemietet.«
Da ich in Thun selbst mal als Lehrer gearbeitet habe, kenne ich mich im hiesigen Schulwesen einigermaßen aus. Ich habe meiner pädagogischen Berufung als Deutsch- und Geschichtslehrer an der Oberstufenschule Progymatte, in der Bevölkerung kurz als Progy oder Prögu bezeichnet, während Jahren mit vielen guten Absichten und einigen negativen Einsichten nachgelebt.
»Eingemietet?«, wiederholt Rolf von Siebenthal. »Stimmt. Die HMS. Warum?«
»Was hat ein Narr in der HMS verloren?«
»Ach so. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. In der Schule wird neuerdings sein Kostüm aufbewahrt. Darum zieht er sich jeweils auf dem Schlossberg um. Es gibt im Keller einen separaten Garderobenraum«, erklärt Rüfe.
»Hm. Dennoch merkwürdig. Gehört die ganze Ausrüstung nicht dem Kadettenverein?«
»Doch. Wieso?«, fragt der Stapi.
»Nun, der Verein pflegt seine engsten Kontakte eher mit dem Progyals mit der HMS. Warum werden die ganzen Heiligtümer dann nicht dort verwahrt?«, wundere ich mich.
»Keine Ahnung. Vielleicht weil der Aktionsradius des Fulehungs auf die Altstadt beschränkt ist. Er wird froh sein, im Schulhaus oben seinen Ausgangspunkt gefunden zu haben«, vermutet Rüfe. »Zudem war das Progy früher in der Schlossbergschule beheimatet.«
Meine Blicke schweifen aus dem Fenster, über die Altstadtdächer und verlieren sich im Wellenspiel der Aare. Dann wende ich mich wieder dem Stadtpräsidenten zu.
»Wer hat Zugang zum Gebäude?«
»Wie alle Schulhäuser auf Gemeindeboden sind die Anlagen quasi halb öffentlich und können während der Unterrichtszeiten mehr oder weniger frei betreten werden.«
»Aha. Das erklärt vermutlich das rätselhafte Verschwinden von diversen Laptops und mobilen Beamern.«
»Ja, hör mal, Hanspudi. Wo kämen wir hin, wenn wir vor allen Schulhäusern einen Sicherheitsdienst aufzögen?«
»Dem Fulehung hätt’s jedenfalls geholfen.«
Rolf von Siebenthal setzt sich, atmet zwei-, dreimal tief ein und aus und brummt: »Nachher ist man bekanntlich immer klüger.«
Ich nicke bloß. »Gut, dann werde ich mir mal die Schüler- und Lehrerlisten der HMS sowie die Personalien des Putzpersonals besorgen.«
»Ja, aber beeil dich. Es wäre gut, wenn du die Täterschaft so rasch als möglich klären könntest.«
»Was heißt das?«
»Möglichst noch vor dem nächsten Auftritt«, antwortet Rüfe.
»Auftritt von wem? Vom Mörder?«
»Auch. Aber vor allem von unserem verblichenen Spaßmacher.«
»Dieser Auftritt dürfte soeben vor dem heiligen Petrus stattgefunden haben«, wende ich ein.
»Morgen Vormittag soll der Fulehung traditionsgemäß den Schlussumzug durch die Innenstadt anführen.«
»Und wie soll er das anstellen? Im motorisierten Sarg?«
»Quatsch. Ich habe natürlich einen Ersatzmann aufgeboten«, informiert der Stapi etwas unwirsch.
»Aha. Wen?«
»Fabian Eichenberger.«
»Den Sportlehrer?«
»Genau. Kennst du ihn? Er unterrichtet am Progy«, sagt Rolf von Siebenthal.
»Ja, klar. Wie kommst du gerade auf ihn?«
»Warum nicht? Die Stadt arbeitet seit Jahren mit einer Doppelbesetzung. Es könnte immer mal einer krankheitshalber ausfallen. Ein Ausschiesset ohne Fulehung?«
»Unmöglich«, stimme ich zu.
»Eben. Darauf sind wir vorbereitet. Allerdings frage ich mich, ob Eichenberger in der momentanen Situation nicht ebenfalls gefährdet sein könnte.«
»Du meinst, auch er könnte zum Opfer werden?«
»Ja, das ist denkbar. Wir haben Eichenbergers Leibgarde sicherheitshalber auf vier Mann erhöht. Zu den beiden jugendlichen Beschützern stoßen noch zwei Personenschutzprofis dazu. Das sollte nach Meinung der Polizei ausreichen.« Und der Stapi gibt noch zu bedenken: »Stell dir vor, der zweite Darsteller würde ausgerechnet während des Festumzugs vor den Augen einer entsetzten Hundertschaft exekutiert.«
Ich beiße mir auf die Unterlippe. »Wie viel Zeit habe ich?«
Der Stadtpräsident schiebt die Manschette seines linken Hemdsärmels zurück und schaut auf seine klobige Armbanduhr.
»Jetzt haben wir 17.15 Uhr. Morgen um 11.30 Uhr startet der Umzug. Du hast also genau 18 Stunden und 15 Minuten Zeit, Dummermuths Mörder zu finden.«
»Und wie soll ich das schaffen?«
»Wie gesagt, arbeitest du mit der Polizei zusammen«, beruhigt mich Rüfe.
»Trotzdem. Es ist beinahe unmöglich, in so kurzer Zeit den verzwickten Fall zu klären. Das muss dir doch auch klar sein, Rüfe. Wenn ich Glück habe, kann ich vielleicht herausfinden, in welche Richtung das Tatmotiv weist. Dann können wir zumindest die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Anschlags für Morgen besser abschätzen.«
»Das wär ja auch schon was wert«, sagt der Stapi und lehnt sich in die gepolsterte Lehne zurück. Ich schaue ihn an und nicke ohne weiteren Kommentar. Darauf erhebt er sich von seinem Sessel, rückt die Krawatte zurecht und meint: »Hanspudi, find den Sauhung, der den Fulehung auf dem Gewissen hat!«
»Ich tu mein Bestes.« Dazu bin ich allerdings allein nicht in der Lage. Fürs Beste muss mein Bester her. Ich klaube das Handy aus der Hosentasche und wähle die Nummer von Jürg Lüthi, meinem Assistenten.
3
Endlich werde ich erhört.
Mein Assistent gibt sich die Ehre und nimmt nach satten elf Klingeltönen endlich den Anruf entgegen. Wie hält er das bloß aus?
Quak! Quak! Quak …
Elfmal Froschgequake? Wer kennt einen noch nervigeren Klingelton? Bitte bei Jüre melden.
»Lüthi. Was hab ich gewonnen?«
Macht wieder auf obercool, der Held.
»Hallo Jüre. Es ist nur mich. Ich brauche deine Unterstützung.«
»Hanspudi. Wieder mal im Seich?«
»Im Zeitdruck«, korrigiere ich.
»Okay. Ich komme. Wo bist du?«
»Jetzt noch im Rathaus. Aber ich will gleich hinauf auf den Schlossberg ins Schulhaus. Dort liegt eine Leiche. Du wirst staunen.«
»Mach’s nicht spannend. Wen hat’s erwischt?«
Das gefällt mir, wenn ich Jüre auf die Folter spannen kann. Schade, dafür ist jetzt wenig Zeit.
»Ich informiere dich oben. Mach vorwärts. In zehn Minuten.«
»Bist du wahnsinnig? Zehn Minuten? Ich bin mit dem Velo unterwegs, das weißt du genau. Die Leiche läuft uns schon nicht davon. Ich komme so rasch, wie es meine fabelhafte Kondition erlaubt.«
»Das kann ja dauern. Weißt du überhaupt, wie man Kondition buchstabiert?«
Klick. Leitung unterbrochen. Jüre findet meine Witzchen selten passend.
Ich verabschiede mich vom Stapi und verlasse das Rathaus. Um zu verhindern, dass mein Assistent als Erster den Tatort erreicht, beeile ich mich besonders. Den Triumph gönnte ich ihm nicht. In der Frage nach der besseren Kondition bleiben wir Gegner eines bisher unentschiedenen Wettkampfes. Ich verzichte sogar auf den Schirm, der zuunterst in meiner Umhängetasche liegt und mich vor dem Platzregen geschützt hätte, der sich ausgerechnet jetzt über der Altstadt ergießt. Er wäscht mir innert Minuten das teure Gel aus den Haaren und fließt mir als parfümiertes Rinnsal in den halb offenen Mund. Speiend und hechelnd renne ich über das glitschige Kopfsteinpflaster.
Glücklicherweise gibt es in der oberen Hauptgasse ein paar wettergeschützte Lauben. Dorthin haben sich eine Reihe von Fußgängern geflüchtet. Ich meine, im Vorbeihetzen Alfred Weibel, einen ehemaligen Arbeitskollegen, erkannt zu haben. Danach trete ich in die verregnete Gasse hinaus und stürme erneut los. Nach einem kurzen Sprint Richtung Lauitor biege ich nach dem Zunfthaus zu Schmieden links ab und rette mich unter das Holzdach der Kirchentreppe. Sie führt geradewegs auf den Schlossberg. Nach über 100 Stufen verbreitert sie sich unter einem achteckigen Treppenpavillon zu einer kleinen Plattform. Darüber entfaltet sich der sogenannte Thuner Himmel, eine Deckenmalerei des Künstlers Roman Tschabold. Der Pavillon steht unterhalb der Stützmauer des angepeilten Schulhauses.
Ich hebe den Kopf. Ein Detail der Malerei erregt meine Aufmerksamkeit. Ich bleibe stehen. Und das trotz meiner Eile. Wer grinst mir da entgegen? Nein, nicht mein Assistent, der jetzt vermutlich unser Rennen gewinnen wird. Es ist die Maske des Fulehungs. Bereits hier, nur wenige Meter vom Tatort entfernt, werde ich von der Fratze begrüßt, die ihrem Träger heute offenbar kein Glück gebracht hat.
In kubistischer Malart ist ein merkwürdig blauäugiger Narr in rosarotem Gewand vor hoffnungsvollem Grün dargestellt. Der Künstler hat sich gegenüber der originalen Farbigkeit jede erdenkliche Freiheit genommen. Von links umflattert denFulehungder Engel des Gerichts, und von rechts wird er durch den Minnesänger Heinrich von Strättligen mit einer Harfe belästigt. Ein sonderbares Trio. Das übermächtige Geflügel hält dem verunsicherten Idol ein weißes Spruchband entgegen, auf dem in grauer Schrift das geflügelte Wort SIC TRANSIT GLORIA MUNDI zu lesen ist. Auf dem Holzbalken darunter wird es für das Fußvolk mit So vergeht die Herrlichkeit dieser Welt übersetzt. Über die Herrlichkeit des Narren könnte man noch diskutieren. Seine Vergänglichkeit hat mit dem heutigen Tag mit Sicherheit ein trauriges Exempel gefunden.
Drei Wege führen weiter vom Pavillon zum Schulhaus hinauf. Drei Möglichkeiten, ein Entscheid. Ich setze meinen Fuß auf die erste Stufe jener Treppe, die links von der Stützmauer hinaufführt. Es scheint mir der kürzeste Weg zu sein. In dem Moment taucht ausgerechnet dort eine Stadthostess auf, mit einer asiatischen Reisegruppe im Schlepptau, und verunmöglicht jegliches Durchkommen.
»Sis is sö feimös Kirchentreppe, läik wi sei«, erklärt sie der aufmerksamen Herde. Mich schaudert’s. Ihre Schafe scheinen für diese Erklärung aber dankbar zu sein. Ein älterer Chinese mit feldgrauem Tirolerhütchen wiederholt andächtig: »Kilchentleppe«, und der Rest der Gruppe kichert.
Ich kenne die sprachgewandte Hostess in ihrer zinnoberroten Uniform aus der Lokalpresse. Jetzt steigt die zielsichere Fremdenführerin strammen Schrittes die Stufen herunter, noch bevor ich mich abwenden und in den Aufgang rechts der Mauer retten kann.
»Guten Tag, Frau Murer«, grüße ich, mehr aus Verlegenheit denn aus Höflichkeit.
Sie schaut mich überrascht an und erwidert den Gruß fast tonlos. Sie dürfte um die 40 sein, ist mit auffällig großen Ohren und einem mädchenhaften Sommersprossengesicht gesegnet. Frau Murer hat sich letzte Woche in einer Kolumne des Thuner Tagblattes vehement dafür eingesetzt, dass der Fulehung den hölzernen Schlagstock gegen eine weniger schmerzhafte Waffe eintauscht. Sie hat vorgeschlagen, dass sich der Stadtnarr mit einem der quietschenden Plastikhämmer ausrüstet, wie sie am Berner Zibelemärit mindestens so verbreitet wie verpönt sind. Damit hat sie sich selbst zum Narren gemacht, finde ich. Dem Zeitungsartikel war Frau Murers Porträt angefügt. Dummheit hat so definitiv ein Gesicht bekommen.
Außer Atem erklimme ich die letzten paar Treppenstufen und steuere endlich auf den Tatort zu. Vor der kassettierten Holztüre stehen zwei uniformierte Polizisten wie Zierzypressen.
»Ist geschlossen«, schnauzt der eine.
Der andere ergänzt: »Tut uns leid. Sie dürfen da jetzt nicht rein.«
»Ich bin aber mit Hauptmann Geissbühler verabredet«, halte ich dagegen.
»Moment«, antwortet der höflichere der beiden Uniformierten und verschwindet im Eingang. Kurz darauf kehrt er zurück, schwenkt seinen Kopf zur Tür und meint: »Sie können.«
»Sie mich auch«, brumme ich, leise genug.
4
Im Schulhaus riecht es eigenartig. Wonach bloß?
Ich trete in die Eingangshalle, öffne die Knöpfe meines Regenmantels, hebe ihn am Kragen hoch und schüttle das Wasser ab. Die Tropfen fallen auf den rötlichen Klinkerboden, der sich nach der pudelgrauen Schmutzschleuse meinen nassen Sohlen präsentiert. Links an der Wand steht eine einsame Holzbank unter einem Feuerlöscher. Daran anschließend folgt eine dunkelrote Türe, die mit Klasse H2A angeschrieben ist. Gegenüber der Holzbank befindet sich ein Stauraum. Dort liegt Schulmaterial in offenen Schränken wild durcheinander. Handelt es sich dabei um Kampfspuren? Ergibt es allfällige Hinweise auf den Tathergang? Kaum.
Immerhin entdecke ich im Chaosraum einen Kaffeeautomaten. Das wär was: Jetzt einen heißen Fertigkaffee aus einem Pappbecher schlürfen. Aber die weißen Gestalten der Spurensuche schubsen mich weg. Die Eingangshalle ist L-förmig angeordnet. Geradeaus steht ein Tischchen mit einem großen Blumenstrauß. Neben den Blumen liegen Fulehungs Söiplatere. Von dort rührt auch der gewöhnungsbedürftige Geruch. Der süße Duft der Tigerlilien mischt sich mit dem Gestank der Schweineblasen. Links und rechts vom Blumentisch befinden sich zwei weitere Schulzimmer. Aber wo liegt eigentlich die Leiche?
»He da, aufpassen!«, werde ich angeschnauzt.
»’tschuldigung.« Muss mir die Burschen von der Polente warmhalten. Von wegen ersprießlicher Zusammenarbeit.
»Wo ist er?«, will ich fragen und strauchle schon wieder über einen Koffer des Kriminaltechnischen Dienstes.
»Mann. Passen Sie doch auf!«
»’tschuldigung.« War kein guter Auftritt. »Wo ist Hauptmann Geissbühler?«, frage ich, um abzulenken.
»Der kommt gleich zurück«, antwortet ein Polizist und lässt mich warten. Ich schau mich um. Im abgewinkelten Teil des Raumes befindet sich eine Sandsteintreppe. Ihre Stufen führen mit einer eleganten Rechtskurve in den ersten Stock. Auf halber Höhe zeigt sich ein verbreiterter Treppenabsatz, von wo aus die Herrentoilette durch eine dunkelrote Holztüre zu erreichen ist. Nach unten schwingt die Treppe mit großzügiger Geste zum Kellergeschoss. Hier endlich entdecke ich das Opfer. Es liegt unter einer schwarzen Folie in der Linkskurve. Zwei Beamte knien auf der Treppe und hantieren mit Pinzetten. Nach der Kurve öffnet sich ein heller Garderobenraum mit drei Langbänken, einem Lavabo mit Spiegel und einem leeren Seifenspender.
Auf der Türschwelle zur Garderobe liegt die Maske des Narren. Ein sonderbarer Anblick. Die verdeckte Leiche mit der Maske daneben macht fast den Eindruck, als handelte es sich hier um ein Opfer mit abgetrenntem Kopf. Ich steige ein paar Stufen hinunter, bemüht, dem Kriminaltechnischen Dienst nicht in die Quere zu kommen, und schaue mir, so gut es geht, die goldfarbene Fratze an. Sie ist mit schwarzem, zottigem Schaffell umrandet. Im Fell klebt Blut. Auf dem Kopf stechen zwei schwarze, spitze Teufelshörner durch den Pelz. An jeder Hornspitze baumelt eine Schelle. Darum wird er hin und wieder auch als Glögglifrösch verspottet.
Seine traurigen Augen sind weiß umrandet. Ein markanter Zinken mit leuchtend roter Nasenspitze endet über einem halb offenen, schmerzverzerrten Mund. Dabei entblößt er zwei Reihen schneeweißer Zähnchen. Wie von einem Hundegebiss. Die Oberlippe ist rabenschwarz. Die Unterlippe dagegen zinnoberrot. Rot prangen ebenfalls die runden Apfelbäckchen, die so gar nicht in das traurige Gesicht passen wollen.
Ich erinnere mich, dass eine braune Stoffkapuze den Hinterkopf bedeckt, die jetzt nicht zu erkennen ist. Vermutlich gibt es Blutspuren im Gewebe.
Wo bleibt nur Hauptmann Geissbühler? Und wo ist Jüre? Der mit seiner Kondition. In dem Moment tauchen die beiden Vermissten gleichzeitig auf.
»Hallo, Hanspudi«, grüßt mein Assistent.
»Herr Feller?« Der Polizist.
»Tag zusammen«, sage ich, reiche erst Herrn Geissbühler und dann Jürg Lüthi die Hand. Der Hauptmann vom Dezernat Leib und Leben dürfte um die 35 Jahre alt sein, wirkt viril und präsentiert auf dem kurz geschorenen Schädel erste Lichtungen. Er trägt schwarze Jeans, ein dunkelblaues Hemd mit offenem Kragen, einen schwarzen Lederblouson und einen beigen Trenchcoat. Soviel ich weiß, ist Anton Geissbühler verheiratet und wohnt in der Gegend. Ich habe ihn an Wochenenden jedenfalls bereits öfters mit seiner Frau durch die städtische Einkaufsmeile Bälliz promenieren sehen.
»Der Stadtpräsident …«, will ich mich entschuldigen. Aber Geissbühler ist bereits informiert und fällt mir ins Wort.
»Klar. Was müssen Sie wissen?«, fragt er mich unumwunden.
»Wer hat ihn gefunden?«
»Die Putzfrau. Frau Signorelli.«
»Kann ich mit ihr reden?«
»Ja, aber nicht hier. Ich hab sie bereits nach Hause geschickt.«
Ich lasse meinen Assistenten ihre Adresse notieren.
»Gibt es weitere Zeugen? Schüler? Lehrer? Passanten?«
»Müssen wir noch abklären«, meint der Hauptmann und ergänzt: »Montags findet ab 16 Uhr kein Unterricht mehr statt. So steht’s jedenfalls auf dem Stundenplan, da, neben der Zimmertür.«
»Können Sie mir bitte mal die Maske umdrehen, Herr Geissbühler?«
Der Beamte zupft ein paar Latexhandschuhe aus dem Kittel, schlüpft umständlich in die widerspenstigen Pfotenpräser, bückt sich und hebt endlich die Maske hoch. Jetzt erst wird auch Jürg Lüthi klar, wer daneben unter der Plache liegt.
»Das ist ja …«, beginnt er.
Und der Hauptmann ergänzt: »… der Fulehung.«
»… der Supergau«, beendet Jüre seinen Satz.
»Tatsächlich«, bekräftigt Geissbühler.
»Tatsächlich«, stelle ich fest, »am Hinterkopf prangt ein dunkler Blutfleck.«
Hauptmann Geissbühler nickt. »Vermutlich Schädelbruch.«
»Was meinen Sie? Trug er die Maske noch, als er erschlagen wurde?«, frage ich.
»Eher ja. In der Maske hatte Dummermuth ein eingeschränktes Sehfeld. Dem Täter wurde der Angriff dadurch erleichtert«, erklärt Geissbühler.
Ich versuche, mir den Tathergang vorzustellen: Der Fulehung tritt ahnungslos ins Haus, deponiert in aller Ruhe Schyt und Söiplatereauf dem Blumentischchen und wendet sich dann nach rechts, um die Treppe zur Garderobe hinunterzusteigen. In dem Moment tritt der Täter aus einem der Schulzimmer von hinten an ihn heran. Er schnappt sich das Schyt vom Tischchen, holt aus und schlägt zu. Der arglose Narr wird völlig überrumpelt. Nach mehreren harten Hieben geht er zu Boden. Unglücklicherweise stürzt er dabei vornüber und fällt die Steintreppe hinunter. Fragt sich jetzt nur: Waren bereits die Schläge tödlich oder bricht er sich beim Sturz das Genick? Der Gerichtsmediziner wird es uns sagen. Der Mörder macht sich anschließend keine Mühe, die Tatwaffe verschwinden zu lassen, sondern lässt sie einfach zu Boden fallen und haut unerkannt ab.
Oder wird er allenfalls doch gestört? Gibt es eventuell Zeugen? Ist zur Tatzeit sonst noch jemand im Haus? Entsprechende Abklärungen sind unumgänglich.
»Und das Schyt?«, erkundige ich mich weiter.
»Ist ziemlich sicher die Tatwaffe«, antwortet der Hauptmann.
»Ja, ich weiß. Aber, wo befindet es sich jetzt?«
»Bereits im Labor.«
»Aha. Was denken Sie, Herr Geissbühler? Braucht es viel Kraft, um mit diesem Holzstock jemanden zu töten?«
»Nein. Wenn man dumm preicht, nicht. Jeder könnte damit einen Menschen erschlagen.«
»Hm. Und mit so was jagt unser Stadtidol seit Menschengedenken die lieben Kinderlein?«
»Bisher gab es meines Wissens keine ernsthaften Verletzungen«, entgegnet der Hauptmann.
»Der Holzstock ist aber schon umstritten. Haben Sie Frau Murers Artikel im Tägu gelesen?«
»Pha, diese Hostess. Die kann man doch nicht ernst nehmen. Die braucht Publicity für die nächsten Stadtratswahlen. Das ist alles«, ereifert sich Geissbühler.
5
Ich mache eine kurze Denkpause und schaue zu Jürg Lüthi, der die ganze Zeit wortlos danebengestanden hat. Der strohblonde Hüne mit den blauen Augen und der gut proportionierten Figur erinnert an ein schwedisches Fotomodell. Beneidenswert. Das Gejammer über seine Kondition: rein akademisch. Er trägt Bluejeans, weiße Turnschuhe, ein enges weißes T-Shirt mit V-Ausschnitt und einen schwarzen Leinenkittel. Er gehört glücklicherweise zu jenen Männern, die sich nichts auf ihr Äußeres einbilden. Seit sieben Jahren prallen die schmachtenden Blicke der hiesigen Frauenwelt von ihm ab. Seit ebenso vielen Jahren hält er treu zu seiner lieben Gattin. Bei so viel Treue und Perfektion ist man geradezu darauf erpicht, doch irgendwo einen Makel zu entdecken. Bisher allerdings ohne Erfolg. Bei Jüre sucht man vergeblich nach verschwiegenen Seitensprüngen, heimlichen Abenteuern und halbseidenen Episoden.
Er steht einfach da. Ganz bescheiden und unauffällig. Unter dem linken Arm trägt er eine schwarze Kunstledermappe mit Notizblock wie ein Jusstudent im dritten Semester. In der rechten Hand hält er einen billigen Kugelschreiber, dessen Schreibmine er ab und zu heraus- und hineinschnellen lässt. Trotz dieses Klickens und der eindrücklichen Körpergröße des Verursachers passiert es mir regelmäßig, dass ich vergesse, Jüre in die Gespräche einzubeziehen. Ihn scheint das weniger zu stören als mich. Jetzt weist er wortlos mit dem Kopf zur Leiche und schaut mich dazu fragend an.
Ich wende mich an den Hauptmann: »Können Sie uns bitte einen Blick auf die Leiche werfen lassen?«
»Kein Problem. Wachtmeister Stucki, entfernen Sie bitte die Folie.«
Der Angesprochene steigt die Treppe hinunter, bückt sich, packt die Plache und zieht sie mit einem einzigen, eleganten Ruck hoch, wie ein Matador die rote Muleta. Und da liegt das Opfer in einer Blutlache. Ein eigenartiger Anblick. Ein berührender Augenblick. Stille herrscht.
Jetzt verstehe ich Rüfes Rührung, als er mir am Telefon den Vorfall geschildert hat. Auch Jüre schluckt leer. Nicht nur unser Fulehung, nein, ganz Thun liegt am Boden!