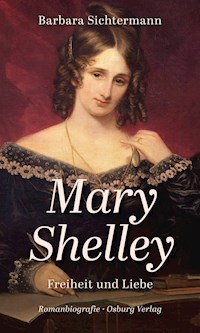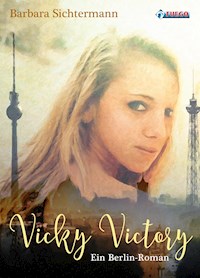9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Drama, das sich da abspielt, verlangt ernst genommen zu werden. Die deutsche Erziehungstradition hat es mit Überheblichkeit behandelt. Schon das Wort «Trotz-Phase»! «Trotz» ist abwertend – Phase klingt nach «Augen zu und durch». Angeregt durch die Erfahrungen mit ihrem eigenen Kind ist Barbara Sichtermann dem Problem nachgegangen. Behutsam und mit vielen Beispielen versucht sie zu klären, woher der Zorn kommt, warum er im Kleinkindalter so oft eine heftige, ausbruchsartige Form annimmt und welche Probleme bei den Eltern damit einhergehen. Einfühlung beim trotzenden Kind fällt – anders als beim trauernden, enttäuschten oder versagenden Kind – oft sehr schwer. Die Autorin zeigt, wie Eltern und Kinder in solchen Situationen miteinander umgehen. Solche Bearbeitungsweisen, halbfertige, versuchsartige, geben Anregungen und machen Mut, sich einem Problem zu stellen, das allzu gern mit der Decke des Verschweigens überdeckt und so der Diskussion und damit einem vernünftigen Umgang entzogen wird. Dieser Ratgeber ist für Eltern und alle an praktischen Problemlösungen Interessierte geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Barbara Sichtermann
«Nein, nein, will nicht!»
Was tun, wenn Kinder trotzen?
Ihr Verlagsname
Mit Radierungen von Burkhardt Söll
Über dieses Buch
Das Drama, das sich da abspielt, verlangt ernst genommen zu werden. Die deutsche Erziehungstradition hat es mit Überheblichkeit behandelt. Schon das Wort «Trotz-Phase»! «Trotz» ist abwertend – Phase klingt nach «Augen zu und durch».
Angeregt durch die Erfahrungen mit ihrem eigenen Kind ist die Autorin dem Problem nachgegangen. Behutsam und mit vielen Beispielen versucht sie zu klären, woher der Zorn kommt, warum er im Kleinkindalter so oft eine heftige, ausbruchsartige Form annimmt und welche Probleme bei den Eltern damit einhergehen. Einfühlung beim trotzenden Kind fällt – anders als beim trauernden, enttäuschten oder versagenden Kind – oft sehr schwer.
Die Autorin zeigt, wie Eltern und Kinder in solchen Situationen miteinander umgehen. Solche Bearbeitungsweisen, halbfertige, versuchsartige, geben Anregungen und machen Mut, sich einem Problem zu stellen, das allzu gern mit der Decke des Verschweigens überdeckt und so der Diskussion und damit einem vernünftigen Umgang entzogen wird.
Über Barbara Sichtermann
Barbara Sichtermann, Jahrgang 1943, studierte Volkswirtschaftslehre und Soziologie, arbeitet seit 1978 als freie Autorin (u. a. schrieb sie «Leben mit einem Neugeborenen», 1980, und «Vorsicht, Kind», 1982).
Inhaltsübersicht
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
«ich zitterte, ich hatte das Gefühl, die Haare müßten mir zu Berge stehen. Ein tiefes Mitleid mit mir selbst überkam mich. Ich wollte gerade zu weinen anfangen, als Jesper die Bürste, die ihm entfallen war, aufhob und mir damit gegen das Knie schlug. Da griff ich von der Flurgarderobe meine Pelzmütze und schleuderte sie nach Jesper.» – Szenen eines immer wiederkehrenden Dramas – «Trotz».
Gegen-Trotz, Ärger, Zorn, Wut und auch handgreifliche Aggression, Erschrecken vor sich selber, schlechtes Gewissen, Hilf- und Ratlosigkeit – die oft wie aus heiterem Himmel herniederfahrenden Trotzanfälle machen die Eltern, insonderheit die Mütter, zu unfreiwilligen Teilnehmern an einem «Drama der Leidenschaften».
Zwei Frauen, die Hausfrau und ihre berufstätige Cousine Betty, beide von trotzenden Kindern gepeinigt, versuchen, in Gesprächen, zu denen sie auch andere hinzuziehen, den Trotz ihrer Kinder zu begreifen und mit ihm umzugehen: Lehrgespräche, sokratische Dialoge, an denen die Leser ihre eigene Phantasie entfalten und ihre Gegenargumente probieren können.
Und immer wieder brechen «die kleinen Wilden» mit ihrem Trotz, aber auch ihrem Kleinmut und ihrer Verletzlichkeit in die Gespräche ihrer Mütter und Eltern ein.
Da in diesem Buch ganz neue Wege gegangen werden, Fragen zu einem wichtigen Problem des Umgangs zwischen Eltern und Kindern zu bearbeiten, wäre ich als Herausgeber sehr daran interessiert, von Ihnen zu erfahren, ob und wie diese Form Sie angesprochen hat. (Meine Adresse finden Sie auf S. 2 unten.)
Auf Ihre Post freue ich mich!
Horst Speichert
Kapitel 1 Das Ende der selbstverständlichen Harmonie
«Du hättest Milena erleben sollen, als sie so anderthalb Jahre alt war. Ein freundliches, lachlustiges Püppchen. Unser Vater nannte sie immer ‹Miss Grübchen›. Und die Bäckersfrau sagte morgens: ‹Nun muß sie ja scheinen, die Sonne, was, muß sie doch, sonst setzt unsere Milena sie ab. Die kann’s ja bald besser, was?› Mit Händen und Füßen konnte sie lachen, die Kleine. Und sie steckte alle an, sogar Max von gegenüber, ein schüchternes, ernstes Gör, gerade in die Schule gekommen. Wenn er Milena mit mir auf der Straße traf, widerstand er nicht, ließ sich an der Hose zupfen und griente: ‹Na, du …›»
Betty sah mich an. Ich versuchte, es mir in ihrem Sessel bequem zu machen. Die Kaffeemaschine gurgelte.
«Sie konnte auch energisch werden, meine Tochter», fuhr Betty fort, «wie alle Kleinkinder: wenn sie eine Tür nicht aufbekam oder wenn der Deckel nicht auf die Dose passen wollte, dann schnaufte, schimpfte, schrie sie – aber sie war sofort versöhnt, wenn man ihr half. Wenn ich Essen machte, fuchtelte sie mit den Armen und rollte ihre großen, runden Augen – aber sie konnte schon früh warten. Weißt du, es war so, daß man mir zu diesem Kind gratulierte: nichts wunderbarer als ein heiteres Baby. Wenn ich was hörte von Kindern, die nachts stundenlang schrien, nicht essen wollten – kannte ich alles nicht. Ich glaubte schließlich selbst, ich hätte mit Milena ein unverdientes – jedenfalls ein seltenes Glück gehabt.»
Betty stand auf, ging ein paar Schritte hin und her, knotete ihr Halstuch auf und lächelte mir zu.
«Bis eines Tages …» setzte ich fort.
«Bis eines Tages – ich weiß noch genau, was das für ein Tag war: ein Sonntag im letzten August, kurz vor Milenas zweiten Geburtstag – bis also an diesem Sonntag mir die Kleine das Mittagessen: Kartoffeln, Gemüse, Hackfleisch, bis sie mir das in ihren Bäckchen nach Hamsterart gespeicherte Mittagessen – ich hatte gar nicht bemerkt, daß sie es nicht schluckte –, bis sie mir also das gekaute Mittagessen ins Gesicht spuckte. Es war eine ganze Menge. Ich protestierte, wich zurück, tastete unter Flüchen nach einem Wischtuch, sie spuckte und prustete weiter, lief rot an dabei, gab einen heiser-trompetenartigen Ton von sich und versprühte dabei Feinzerkautes über Tisch, Stuhl und mich. Dann, als sie nichts mehr zu spucken übrig hatte, sah sie mich ernst, ja fast entgeistert an.»
«Viele Kinder machen so was», sagte ich, «ich habe das jedenfalls schon öfter gehört. Du solltest es nicht über …»
«Tu ich ja gar nicht.»
Betty nahm wieder Platz und schenkte Kaffee ein.
«Du verstehst mich miß. Die Sache als solche hätte ich mit einem Lachen abtun können. Nach dem ersten Befremden, versteht sich. Nein, der Grund, warum mir dieser Sonntag in Erinnerung geblieben ist, …»
Eine Kriegserklärung
Betty hatte trinken wollen, aber sie tat es nicht. Sie stellte die Tasse ab.
«Es war ihr Blick. Ihr Gesichtsausdruck. Weißt du, das war eine Kriegserklärung!»
Da Betty nicht weitersprach, fragte ich: «Eine Kriegserklärung?»
«Ja, so würde ich es heute nennen.»
«Und damals – was empfandest du?»
«Beunruhigung, Druck – oder: ein Ende der Harmonie. Ja, das war es. Ich empfand das Ende einer Gemeinsamkeit oder auch Gefolgschaft. Vielleicht klingt das zu dramatisch, aber ich habe diesen Tag, diesen Mittag, dieses Mittagessen als einen Wendepunkt in Erinnerung, der die Zeit der unbefragbaren Gemeinsamkeit mit meinem Kind plötzlich und, ja, für mich grundlos und deshalb auch – irgendwie grausam unterbrach. Abbrach. Es war so: ich wischte ihr den Mund, wischte dann an mir und dem Tisch herum, schimpfte ein bißchen: ‹Das geht aber nicht …› ‹Was hast du dir denn dabei gedacht …› ‹Hör mal, Millie, das ist wirklich eine grobe Sauerei.› Sie guckte immer noch unverwandt, dann lächelte sie ein wenig. ‹Wo hast du denn das gelernt?› Blöde Frage, aber ich hab sie gestellt. ‹Schmeckt dir das Essen nicht?› ‹Essen schmeckt gut›, sagt Milena. ‹Also dann.› Ich bin erleichtert, mache ihr einen Löffelvoll zurecht, füttere sie. Ich achte wieder nicht darauf, ob sie runterschluckt oder nicht, schließlich hat sie das bis heute immer getan. Ich sehe sie kauen und komponiere den nächsten Löffelvoll: ein bißchen hiervon, ein bißchen davon. Sie sperrt das Schnäbelchen auf, ich füttere sie.»
Betty lehnte sich zurück, senkte die Stirn und sah mir in die Augen.
«Und sie prustete wieder alles aus», sagte ich nach einer kleinen Pause.
«Ja. Einen feinzerkauten Brei. Zum zweitenmal.»
«Vielleicht war sie ganz einfach satt?»
«Unsinn. Ich meine: großen Hunger hatte sie bestimmt nicht mehr. Aber sie spuckte das Essen nicht deshalb aus, weil sie satt war. Im Gegenteil: weil sie Hunger hatte. Auf Zwist.»
«Ich glaube nicht, daß Kinder von sich aus Streit wollen. Wenn sie aggressiv werden, dann deshalb, weil wir, die Erwachsenen, ihnen zu viele Einschränkungen zumuten oder sie falsch behandeln –»
«Hör bloß mit diesen Sprüchen auf. Wenn ich das schon höre: zumuten, falsch behandeln … Als neulich unsere Garagentür kaputt war, sagte der Schlosser: da liegt ein Bedienungsfehler vor. Verstehst du, wir hatten den Türgriff falsch rumgedreht, deshalb hatte sich ein Zapfen verbogen. Daran muß ich denken, wenn ich so oberschlaue Leute höre: Sie behandeln Ihr Kind falsch. Wenn Ihre Tochter aggressiv ist, so liegt ein Bedienungsfehler vor. Du liebe Zeit! Mein Kind ist keine Garagentür, und ich bin nicht jemand, die sie wie einen Apparat bedient.»
Betty stand auf, nahm die Kanne: «Willst du noch Kaffee?»
Ich schüttelte den Kopf. «Aber wenn du einen Cognac hättest –» Während Betty ins Nebenzimmer ging, redete sie mit erhobener Stimme weiter.
«Entschuldige, daß ich heftig geworden bin. Ich lebe im Moment mit sehr viel Heftigkeit. Du wirst das alles auch noch durchmachen.»
«Und wie ging die Sache mit dem rausgeprusteten Essen zu Ende?»
«Gar nicht.»
Betty gab mir ein Gläschen und schenkte Cognac ein. Als sie die Flasche abdrehte, flüsterte sie: «Weißt du, daß ich einen ganz hübschen Verbrauch habe zur Zeit?»
Sie nahm einen Schluck aus der Flasche. «Also, die Sache ging überhaupt nicht zu Ende. An diesem Mittag prustete Millie jeden weiteren Löffel raus, und sie nimmt sich die Freiheit, durchgekautes Essen rauszuprusten, wann immer ihr danach ist. Obwohl – oder vielleicht: weil? – sie weiß, daß ich es abscheulich finde, daß es mir viel Arbeit macht, daß es schade um das Essen ist. Sie macht es wohl in einem Zustand unkontrollierbaren Übermuts, einer Art rotzfrecher Provokationslust.»
«Hast du – mit ihr über die Sache gesprochen?»
«Natürlich. Immer wieder. Ruhig und vernünftig. Und auch mal weniger ruhig.»
«Hast du sie bestraft?»
Betty seufzte. Sie nahm noch einen Schluck aus der Flasche, sie sah auf die Uhr.
«Auch das habe ich getan. Ich habe sie bestraft –»
«Wie?»
«Ich habe ihr einen Zirkusbesuch verweigert. Und ich habe ihr gedroht. Beides widerstrebt mir im Grunde – wie dir sicher auch. Natürlich hatte ich fest vor, auf Drohungen und Strafen zu verzichten. Jaja, man ist sehr klug in diesen Fragen, solange man selbst keine Kinder hat und immer nur die ‹Fehler› sieht, die die anderen machen.»
Betty zog die Knie auf ihren Sessel hoch und machte die Augen zu. Sie sah erschöpft aus wie eine Pazifistin, die man ins Feld gezwungen hat und die nun von ihren Niederlagen berichtet.
«Das Schlimmste», sprach sie, ohne die Augen zu öffnen. «Ich habe Milena geschlagen.»
«Nein!»
«Doch. Habe ich.»
«Öfter?»
«Ein paarmal.»
«Heftig?»
«Ach – nicht allzu heftig, hoffe ich.»
«Wohin?»
«Einmal auf die Hände. Und seitlich auf den Po. Niemals ins Gesicht, nein, das hätte ich nicht gekonnt.»
«Und hattest du nachher Gewissensbisse?»
«Klar hatte ich Gewissensbisse. Ich habe mich bei Milena entschuldigt, und ich bin gar nicht sicher, ob das richtig war. Ich habe abends im Bett geheult – und mir geschworen, nie wieder die Hand gegen Millie zu erheben. Ich habe den Schwur gebrochen, ich habe fast reflexartig zugehauen, als ich mal wieder die Frisur voll durchgekautem Essen hatte. Jetzt bin ich am Ende … Deshalb habe ich dich angerufen.»
Herzklopfen, Schweißausbrüche: Probleme auf der ganzen Linie
Ich schenkte mir vom Cognac nach, schlürfte davon, ehe ich antwortete.
«Ich will dir gern helfen. Nur: mir fehlen eigene Erfahrungen. Jesper ist ein so liebenswürdiges Kind –»
Betty öffnete die Augen, hob die Brauen und guckte mir so lange mitten ins Gesicht, bis wir beide lachen mußten. Ich fühlte mich nicht behaglich.
«Jeden Moment kommt Millie mit Theo nach Hause», sagte Betty. «Ich will deshalb schnell das Wichtigste erzählen. Das Essen-Prusten blieb nicht die einzige Provokation. Sie fing plötzlich an, aus Jux aufs Sofa zu pinkeln oder auf die rote Brücke in Theos Arbeitszimmer. Sie tat das nicht regelmäßig, aber immer wieder, wenn sie, scheint’s, Lust hatte, mir eins zu verpassen. Das Anziehen zum Ausgehen wurde eine Quälerei. Ich brauche nur die Mütze vom Haken zu nehmen, da fängt sie an zu türmen; zwei-, dreimal durch die Wohnung, und wenn ich sie dann erwischt hab, gibt’s ein Gezappel und Getrappel, daß du eine Meisterin an Geschicklichkeit sein mußt, um dieses mit allen Gliedern zuckende, schlackernde Gör anzuziehen. Wenn ich schimpfe, treibt sie es um so toller – dabei singend, plappernd, kein Ohr für meine Vorhaltungen. Ach, Kämpfe gibt’s um die nichtigsten Anlässe. Plötzlich will sie nicht aus dem Haus. Aber ich muß zum Fleischer. Sie zetert, plärrt, tobt. Schmeißt mit ihren Stiefeln und trampelt so, daß bei den Leuten unter uns der Kronenleuchter wackelt. Am heikelsten ist’s aber immer noch mit dem Essen. Es ist so weit gekommen, daß ich mich davor fürchte, mich mit Millie an den Tisch zu setzen. Und das – das war früher unser Schönstes. Ich decke den Tisch mit Herzklopfen und fülle das Essen auf unter Schweißausbrüchen. Ich denke bei mir: Womit hab ich das verdient? Warum muß ich so leiden? Meine autoritäre Großmama fiel mir ein, ein viereckiges Weib mit gewaltigem schwarzgrauen Knoten, streng, aber gerecht, gefürchtet und geliebt von uns Kindern. Sie hätte einer prustenden Millie einfach eine runtergehauen und gleich darauf tief aufgelacht. Ich versuchte, wie meine Großmama zu sein – laut, entschieden, humorig – aber ohne jene Backpfeifen-Konsequenz. Ich denke da wie du: daß Schläge gegen Kinder von einer neuen Moral nicht mehr toleriert werden, daß wir selbst, du, ich und viele andere junge Eltern diese Moral übernommen, ja: mit gebildet haben – das halte ich für einen Fortschritt. Ich will nicht dahinter zurück. Gibt es einen schrecklicheren Ton als das Geheul eines geschlagenen Kleinkindes? – Ohne ihre ‹lockere Hand› war meine Großmama als Idee, als Gestalt unvollständig, ‹unwahr›, nicht mehr zum Leben zu erwecken. Sie war, merkte ich, tatsächlich tot, als Idee und Gestalt von gestern. Ich mußte es mit Milena als eigenes Ich schaffen, ohne Anleihen bei abgelebten Autoritätsfiguren. Also versuchte ich es auf meine Art: mit Reden, Vernunft, Einfühlung, Ablenkung. Mit Geduld, Ruhe, Zuspruch. Es ging schief.
Marion, es ging schief. Ich bin gescheitert. Diese neue Kinder-Partner-Figur, die ich abgeben soll, die ich ja selbst gern sein will: sie ist auch unvollständig. Sie ist noch unausgebildet. Irgend etwas fehlt an ihr. Sie ist der Wirklichkeit, der harten Wirklichkeit mit einem trotzenden Kind nicht gewachsen. Die Idee ist gut, aber es mangelt an Praktikabilität. Laß uns gemeinsam rausfinden, was da fehlt. Es muß einen Weg geben: so umzugehen mit dem trotzenden, provozierenden, zornentbrannten, um sich schlagenden Kleinkind, daß weder das Kind noch wir selbst allzuviel zusetzen an Selbstvertrauen und körperlich-seelischer Integrität …»
«Kann … kann Theo dir nicht helfen?»
«Wenig.» Betty wandte den Kopf, ging ans Fenster und sah hinaus. «Ich hatte richtig gehört. Da kommen die beiden. Weißt du», sagte sie und trug die Cognacflasche ins Nebenzimmer zurück, «bei Theo ist Milena ein anderes Kind: freundlich, ansprechbar, manchmal bockig, aber nie sehr lange und nie sehr schlimm. Er hat auch mehr Geduld mit ihr, weil er viel seltener mit ihr zusammen ist. Das bedeutet für mich, daß mir Gespräche mit Theo nicht so viel bringen. Ich brauche jemand, die ebenso ‹drinsteckt› wie ich. Ich hatte gehofft, daß du …»
Betty ging zur Tür. Vom Flur her hörten wir Milenas Stimme. «Mama –» Da kam sie angestürmt, die Kleine und fiel Betty um den Hals. «Wir haben Pommes frites gegessen», berichtete sie. «Wer ist die da?»
«Das ist Marion, weißt du. Die Mutter von Jesper. Du kennst die beiden doch schon. Marion ist meine Cousine. Sie wohnt jetzt auch in unserer Stadt.»
«Du sollst keine Cousine haben.»
«Aber warum denn nicht?»
«Ich gehe jetzt nach Hause, Milena», sagte ich. «Soll ich mit Jesper mal wiederkommen?»
«Jesper ist doof», versetzte Milena, «er macht noch in die Hose.»
«Er ist ja auch viel kleiner als du.» Betty stellte ihre Tochter auf die Füße. «Als du so klein warst, hast du auch noch –»
«Gar nicht kleiner, der Jesper ist riesengroß. Und die da soll nicht wiederkommen.»
Ich winkte beiden von der Zimmertür aus zu. «Auf bald, Betty.»
«Auf bald. Grüß Rolf und Jesper.»
Jesper hat die Hosen voll
Draußen dämmerte es. Ich lief dem Märzwind davon. Dabei dachte ich an Jesper. Es war jetzt die Zeit, daß Kurt, sein Babysitter, ein freundlicher Schüler aus dem Nachbarhaus, mit ihm heimkommen müßte. Jespers Freude immer, wenn er mich wiedersah!«Mama – Arm!» Keine Streitlust, keine Weigerungen, nur selten mal eine Quengelei. Arme Betty! Ich erinnerte mich noch gut an die begeisterten Briefe, die sie mir schrieb, als Millie die ersten Worte sprach. Damals lebte ich mit Mann und neugeborenem Sohn im Ausland, hatte wenig Kontakt und freute mich über jedes Wort meiner Cousine. Auch ich hatte sie damals beglückwünscht: so eine liebe Tochter.
Nun sah alles anders aus.
Seit ein paar Wochen erst lebten wir nah beieinander, Betty und ich, und schon rief sie um Hilfe.
Waren vielleicht ihre Nervosität, ihr Ehrgeiz, ihre Jugend, war ihr – Schicksal schuld? Betty hatte gerade ein eigenes Zimmer bezogen und eine Ausbildung als Dolmetscherin begonnen, als sie schwanger wurde. Es war schwer für sie, aber sie entschied sich für das Kind. Ihr Vater, mein Onkel Theo, holte sie zurück in die gemeinsame Wohnung, die sie gerade verlassen hatte. Er bestärkte und beschützte Betty, und als das Kind auf der Welt war, übernahm er auch die Vaterrolle. Betty war glücklich. In ein paar Wochen bekommt Milena einen Kindergartenplatz, dann wird Betty ihre Ausbildung fortsetzen. Sind das nicht trotz allem normal-befriedigende Bedingungen, ist nicht Theo auch für Milena ein liebbesorgter Vater? Oder? Wer weiß, dachte ich, vielleicht bleibt ja doch etwas hängen von den Lasten und Ängsten der ersten Schwangerschaftswochen …
Ich lief die Treppen rauf, zwei Stufen auf einmal. Jesper war ein erwünschtes Kind, er hatte Mama und Papa. Ich schloß die Tür auf und trat ein, mit offenen Armen.
«Jesper?»
Ein Rumoren, dann Kurts Stimme, in Alarm:
«Deine Mutter wird ziemlich sauer sein, glaub ich.»
«Was ist los?» rufe ich über den Flur.
Kurt kommt aus dem Kinderzimmer, er ist rot im Gesicht und atmet rasch. «Jesper will sich nicht wickeln lassen. Er ist seit zwei Stunden voll, aber er wehrt sich mit Händen und Füßen, wenn ich ihm die Hose ausziehen will.»
«Das gibt’s doch nicht.»
Ich nähere mich dem Kinderzimmer, ein wenig beklommen. Da sitzt Jesper, zwischen Bauklötzen, in der Ecke neben seinem Bett, er macht ein finsteres Gesicht.
«Spätzchen –» singe ich und lächle, der Suggestion meiner Erscheinung vertrauend, «komm auf meinen Arm.»
«Kurt soll weggehen», ruft Jesper.
«Hattet ihr Streit?»
Kurt traut sich heran, über dem Arm immer noch die vergebliche frische Hose für Jesper. «Eigentlich nicht», sagt er. «Daß Jesper sich so wehrte – das kam aus heiterem Himmel.»
«Kurt soll weggehen!»