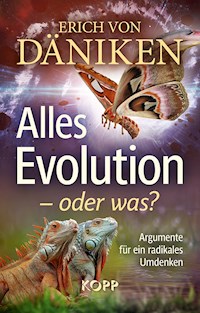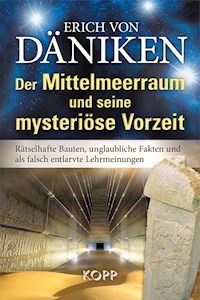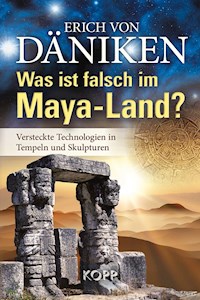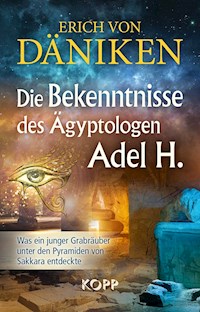8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die neuesten Zeugnisse einer uralten Wahrheit
Erich von Däniken präsentiert Ihnen in diesem Buch seine neuesten und spektakulärsten Forschungsergebnisse. Er verbindet diese neuen Indizien intelligent mit denen, die sich in mittlerweile 41 Werken von ihm niedergeschlagen haben. Dabei wird deutlich: Auch diese neuen Erkenntnisse stützen die Theorie, die der Bestsellerautor seit Langem vertritt. Vor Tausenden von Jahren kamen Außerirdische auf die Erde; sie vermittelten den Menschen bis dahin unbekannte Fertigkeiten und sorgten für einen Wissenssprung.
Der Krieg der Götter
Uralte Schriften aus Indien, Sibirien, Tahiti und vielen anderen Regionen der Erde berichten unabhängig voneinander von einem Krieg der Götter im Weltall. In der Schlacht wurden Waffen von unvorstellbarer Zerstörungskraft eingesetzt. Beim Einsatz einer dieser Waffen explodierte ein kompletter Planet.
Über Jahre regnete es Feuer vom Himmel
Überlieferungen aus allen Teilen der Erde schildern übereinstimmend und in Details die grauenhaften Auswirkungen der Schlacht im All. Über Jahre hinweg gingen endlose Meteoritenschauer auf die Erde nieder. Die Menschen der damaligen Zeit versuchten, sich davor zu schützen, und schufen so weitere Zeugnisse, die den Sternenkrieg und den Kontakt mit Wesen von anderen Planeten belegen.
Millionenstädte unter der Erde
Um vor den zerstörerischen Gesteinsbrocken sicher zu sein, gruben die Menschen kilometerlange Gänge unter der Erde; sie schafften dort auch Platz für Dörfer und ganze Städte. Erich von Däniken illustriert dies mit beeindruckenden Beispielen, die auf der ganzen Welt zu finden sind.
Die dreifingrigen Wesen von Nazca
Zu den neuen Entdeckungen, die Erich von Däniken in diesem Buch präsentiert, gehört auch ein Ereignis, das man nur als sensationell bezeichnen kann: 2017 wurde der Autor darüber informiert, dass in der Nähe des peruanischen Ortes Nazca merkwürdige mumifizierte Wesen gefunden wurden, die vor mehreren Tausend Jahren gelebt hatten, drei Finger und drei Zehen aufwiesen und außergewöhnlich lang gezogene Köpfe hatten. Einer der Mumien war - offensichtlich vor mehreren Tausend Jahren - ein Metallplättchen unter die Haut implantiert worden. Die Wissenschaftler sind sich einig:
Diese Wesen stammen nicht von der Erde!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
1. Auflage Oktober 2018 Copyright © 2018 bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Agentur Pegasus, Zella-Mehlis Covergestaltung, Satz und Layout: Stefanie Huber ISBN E-Book 978-3-86445-637-4 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-0 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Brief an meine Leser
Liebe Leserin, lieber Leser,
NEUE ERKENNTNISSE sollen vorgestellt werden. Dies aber ist ohne die vorangegangenen Erfahrungen nicht möglich. So weiß jeder Leser meiner Bücher, was ein Großdolmen ist – aber keiner hat je von den Drachenhäusern in Griechenland gehört. Tatsächlich aber sind Großdolmen und Drachenhäuser aus demselben Grund entstanden. Oder: Wir alle haben von den unterirdischen Städten in der Türkei gelesen, doch Querverbindungen zu den sogenannten Erdställen in Österreich und Deutschland hat niemand gezogen. Weshalb überhaupt buddelten sich unsere steinzeitlichen Vorfahren unter die Erde? Weltweit und millionenfach! Was war die Kraft, die sie trieb?
Zwischen Mars und Jupiter liegt der Asteroiden- beziehungsweise Planetoidengürtel. Wie entstand der eigentlich? Könnte es sich bei den Hunderttausenden von kleineren und größeren Brocken um einen explodierten Planeten handeln? Doch Himmelskörper explodieren nicht einfach so. Gibt es in der antiken Literatur Hinweise auf einen Sternenkrieg der Götter? Suchten die Menschen auf Erden deshalb Schutz vor den kosmischen Geschossen? Und wohin flüchteten die Überlebenden?
Seit Generationen sind die »deformierten Köpfe« weltbekannt. Das sind die nach hinten gezogenen »Langschädel«. Sie existieren zu Zehntausenden, und bislang konnten wir auch sauber belegen, wie sie entstanden. Doch neuerdings tauchen Schädel auf, die nicht mehr ins alte Denkschema passen. Dasselbe gilt für einige Skelette. Was gerät hier aus den Fugen?
Darum geht es in diesem Buch. Querverbindungen zu früheren Werken müssen sein. Die NEUEN ERKENNTNISSE sind das »i-Tüpfelchen« auf eine Forschung, die sich in bislang 41 Büchern niedergeschlagen hat.
Sehr herzlich!
Erich von Däniken
2. September 2018
Kapitel 1: Außerirdische Schädel
Kapitel 1
Außerirdische Schädel
23. Februar 1988. Es sollte ein unglücklicher Tag werden. Ich hatte eine Reisegruppe ins Hochland von Südamerika geführt. Wir waren von La Paz, Bolivien, aus kommend in Santa Cruz de la Sierra gelandet. Mit rund 4000 Metern über dem Meer ist La Paz der höchstgelegene Zivilflughafen der Welt, auf dem Düsenjets noch starten dürfen. Santa Cruz de la Sierra, unser Zielort, hingegen lag 3500 Meter tiefer als La Paz. Im Hochland hatten einige über Atemschwierigkeiten geklagt. Hier, auf 437 Metern über dem Meeresspiegel, war die Gruppe aufgekratzt. Jede Menge Sauerstoff. Gegen fünf Uhr nachmittags traf man sich zu einem Drink am Swimmingpool des Hotels Holiday Inn.
»Erich, hast du Rob gesehen?«, fragte mich Julia, die Gattin des Gesuchten. »Im Zimmer ist er nicht – und seine Badehose auch nicht. Er muss irgendwo da unten sein.« Julia und Rob kamen aus Holland. Ihre Reise ins ferne Südamerika hatten sie als Hochzeitsreise gebucht. Rob war eine Zwei-Meter-Gestalt. Sportlich, schlank, topfit. Oft hatte er mir von seinen ausgedehnten Radtouren berichtet. Ich stand auf, schlenderte um den Pool. Meine Augen suchten nach Rob. War er vielleicht in der Badehose vor die Hoteltüre gegangen, um an den dort stehenden kleinen Ständen etwas zu kaufen? Saß er womöglich auf einer Toilette? Zur Gruppe gehörten drei Burschen. Ich bat sie, die ganze Anlage nach Rob abzusuchen, in jede Toilette hineinzurufen. Rob blieb verschwunden.
Plötzlich schrie eine Dame vom Balkon des zweiten Stockwerks hinunter und deutete aufgeregt auf den Swimmingpool. Der war nicht »stubenrein«. Kein blaues, durchsichtiges Wasser. Dort, in zwei Metern Tiefe der grünlich schimmernden Brühe, ein menschlicher Körper mit ausgebreiteten Armen. Wir bugsierten Rob an die Oberfläche, hievten ihn aus dem Wasser. Doch jede künstliche Beatmung kam zu spät. Ein Arzt diagnostizierte einen Herzinfarkt. Ausgerechnet Rob, der Sportstyp, hatte den Höhenunterschied nicht verkraftet. Wir alle kümmerten uns um Julia, doch die zeigte sich erstaunlich realistisch und tapfer.
Abendessen vom Buffet. Die Gruppe blieb leise, alle redeten über Robs Tod. Julia wünschte, dass der Leichnam ihres Gatten nach Holland überführt würde. Ich versprach, dies zu arrangieren, obschon ich im Moment keine Ahnung hatte, wie dies möglich war und insbesondere, was das kosten würde.
Freundlich distanziert stellte sich der Hoteldirektor neben mich. Ich kannte ihn von einer früheren Reise. Eine gebildete Persönlichkeit, die auch vier Jahre in den USA studiert hatte. Mister Antonio, so nannten ihn alle, bat mich hinaus an die Rezeption. Dort stand ein Schwarzer in einem dunklen Anzug und mit weißen Handschuhen. Die Bekleidung passte nicht zum Gesicht. Ich dachte, der komme wohl von einem Begräbnisinstitut und möchte mit mir Einzelheiten über den Transport von Robs Leiche besprechen. Doch Antonio belehrte mich eines anderen. Der Mann mit den weißen Handschuhen sei ein Diener eines sehr, sehr reichen Kolumbianers. Dieser Unbekannte möchte mich unbedingt persönlich kennenlernen. Sein Diener würde mich zu ihm und später wieder zurück ins Hotel bringen.
»Aber Antonio«, erwiderte ich, »im Restaurant sitzt meine Reisegruppe. Ich kann die nicht allein lassen.« Antonio bat mich inständig, ins Auto des schwarzen Mannes mit den weißen Handschuhen einzusteigen. Ich würde es nicht bereuen, hämmerte er mir ein, und der reiche Mann sei auch ein Großaktionär des Holiday Inn. Zudem würde das Hotel für diesen Abend sämtliche Getränke der ganzen Reisegruppe übernehmen. Das war ein Angebot. »Wie heißt denn der Fremde und was macht er beruflich?«
Antonio wand sich. Er dürfe diese Fragen nicht beantworten. Im Hause des »hombre rico« (= reichen Mannes) würde ich alles erfahren. Ich ging zur Reisegruppe zurück, informierte sie und meinte, ich sei in vielleicht einer Stunde wieder an der Bar.
Draußen stand eine dunkle Mercedes-Limousine. Der Schwarze mit den weißen Handschuhen deutete auf die hintere Bank. Auf der Rückseite des Sitzes vor mir war ein Gestell angebracht. Darin drei Flaschen mit je einem exquisiten Whisky, Mineralwasser, Eis und zwei Gläsern. Ich bediente mich nicht. Langsam fuhr das Fahrzeug einen Hügel hinauf. Unten rechts die Lichter von Santa Cruz de la Sierra. Dann kurvte der Chauffeur auf eine holprige Straße ohne Belag. Wir durchfuhren ein Wäldchen, und ich begann mich zu fragen, ob das Ganze eine Entführung sei. Ich trug keinerlei Waffen bei mir und wäre meinen Häschern hilflos ausgeliefert. Dann verwarf ich meine wirren Gedanken. Schließlich wusste meine Touristengruppe im Hotel, dass ich auf Empfehlung des Direktors in den Mercedes gestiegen war. Zudem zählte ich diesen Herrn Direktor nicht zu den Gaunern und überhaupt: Wenn schon Entführung – weshalb so kompliziert und luxuriös?
Endlich ein Stopp vor einem Tor. Zwei Indios schlossen es hinter uns. Beim Aussteigen registrierte ich: Alle Männer waren bewaffnet. Vor uns ein einstöckiges Gebäude mit viel Grünzeug an den Außenwänden. Drinnen eine großzügige Halle und mehrere bildhübsche Damen mit wenig Textilien, die mich verführerisch anlächelten. War ich in einen Puff geraten? Schließlich schritt der »reiche Mann« auf mich zu.
Ein sympathischer Typ mit dunklem, krausem Haar, lebendigen Augen und einem gepflegten Schnurrbärtchen. Tadellose Zähne. Die Unterlippe etwas breiter als die Oberlippe und ein Kinn mit einem Grübchen in der Mitte. Irgendwo hatte ich mal gelesen, ein Grübchen bedeute Großzügigkeit. Der Fremde trug Jeans und ein seidenes, beigefarbenes Hemd, am linken Handgelenk eine mit Diamanten bestückte Omega-Uhr.
»Señor Erich«, begrüßte mich der Fremde mit einem starken Handschlag. Über seinen Freund Antonio aus dem Holiday Inn habe er erfahren, dass ich der Reiseleiter einer Gruppe sei, und deshalb habe er die Gelegenheit ergriffen, mich persönlich kennenzulernen. Ohne wortreiche Übertreibungen entschuldigte er sich für die ungewöhnliche »Entführung« und versicherte, ein Wort von mir genüge, um mich sofort ins Hotel zurückzubringen. Ob er mir irgendwie behilflich sein könne?
Ich informierte ihn über den unerwarteten Tod eines Reiseteilnehmers und meinte, ich wüsste nicht, wer zuständig sei für den Transport einer Leiche von Bolivien nach Amsterdam.
»Besitzen Sie eine American-Express-Kreditkarte?«, fragte er. Die trug ich stets in einer kleinen Innentasche meines Jacketts. Ich gab ihm die Nummer.
»Kümmern Sie sich nicht mehr um die Leiche«, meinte der Gastgeber. »Für den Flug nach Europa muss das Blut abgesaugt und durch Formaldehyd ersetzt werden. Das geschieht hier im Krankenhaus. Den Transport organisiert American Express.« So geschah es. Drei Tage später landete Robs Leiche in Amsterdam.
Er habe einige meiner Bücher gelesen, versicherte der quirlige Fremde, und er wolle mir etwas Einzigartiges zeigen.
Zuerst wurde kühler Champagner angeboten, und es wurden belegte Brötchen herumgereicht. Der Fremde meinte, ich solle ihn Pablo nennen und er könne meine Forschungen unterstützen. Insbesondere in Bolivien und Kolumbien, wo er recht viel Land besitze. Ich erkundigte mich nach seinem Beruf, und er meinte, er handle mit Autos und sei zudem Viehzüchter. Wir sprachen über den Besuch von Außerirdischen auf der guten, alten Erde, und Pablo umschmeichelte mich und versicherte, ich sei einer der wenigen Zeitgenossen, die die Zusammenhänge begriffen hätten. Nach einer halben Stunde machte ich ihn darauf aufmerksam, dass im Hotel Holiday Inn meine Reisegruppe warten würde. Pablo bat um einige Minuten Geduld. Dann traten zwei Indios an unsere Tafel. Sie trugen eine Art von lang gezogener Schuhschachtel mit Scharnieren und deponierten die Kiste auf unserem Tisch. Pablo klappte drei Seiten des Behälters herunter, deutete hinein. »Was meinen Sie, Señor Erich?«
»Ein deformierter Schädel«, antwortete ich baff. »Man findet sie in diversen Museen, auch im Anthropologischen Museum von La Paz.«
»Ist bekannt«, nickte Pablo. »Aber das hier ist der Kopf eines Außerirdischen.«
»Wie bitte? Wie kommen Sie darauf?«
Inzwischen hatten Diener eine tragbare Leinwand aufgezogen und einen Kodak-Diaprojektor auf dem Nebentischchen postiert. Man zeigte mir Bilder vom selben Schädel mit einem Zentimetermaß an der Seite. Vom Kiefer bis zum Scheitel 48 Zentimeter. Nicht schlecht. Dann folgten zwei gestochen scharfe Aufnahmen mit Schädeln von Kleinkindern, etwa zwei bis vier Monate alt. Pablo wies auf die Vergrößerungen der Köpfe.
»Merken Sie etwas?«
Langsam begriff ich die Ungeheuerlichkeit. Die Säuglingsschädel zeigten keine Fontanelle. Dazu muss man wissen: Das Köpfchen eines Neugeborenen besteht aus mehreren Knochen, deren Zwischenräume erst nach Wochen zusammenwachsen. Etwa zweieinhalb Monate nach der Geburt schließt sich die Verwachsung am Hinterköpfchen. Man nennt dies »kleine, hintere Fontanelle«. Der vordere Teil, die »große Fontanelle«, braucht etwa zweieinhalb Jahre, bis sie völlig verwachsen ist. Die Säuglingsschädel auf den Bildern zeigten keine Fontanelle.
Pablo sah mich triumphierend an. »Das sind keine Erdlinge, Don Erich, das sind Außerirdische. Geboren hier auf unserer Erde.«
Ich erfuhr, Pablo habe den Fundort abgesichert und die lokale Archäologie nicht informiert. Erst wenn die Schädel vollständig dokumentiert seien, würden offizielle Schritte eingeleitet. Er lade mich nach Kolumbien ein. Ich solle Kameras, zwei seriöse Schweizer Journalisten und einen Schweizer Notar mitbringen. Selbstverständlich übernehme er alle Kosten. Artig bedankte ich mich für das Angebot und versprach Pablo, mir über seine Vorschläge Gedanken zu machen. Zuallererst müsste ich meinen Zeitplan konsultieren. International erwarteten mich viele Verpflichtungen. Was auch stimmte.
Zurück an der Hotelbar, empfingen mich die Mitreisenden mit großer Ungeduld. Meine Aussagen waren nicht mehr so wichtig. Die Gesellschaft quasselte kreuz und quer durcheinander. Schließlich hatte die Hoteldirektion – oder Pablo? – alle Getränke übernommen.
Einige Wochen später. Das Anthropologische Institut der Universität Zürich präsentierte eine Ausstellung über deformierte Schädel. Bei meinem Besuch begegnete ich dem Institutsleiter. Wir kamen ins Gespräch, und völlig arglos erzählte ich ihm mein Erlebnis in Bolivien.
»Pablo hieß der Mann?«, fragte er etwas ungläubig. »Und reich soll er sein?« Er bat mich, kurz zu warten, und kehrte mit einem Zeitungsartikel zurück. Dort sah ich ein Bild von einem »Pablo«, der meinem »Pablo« verdammt ähnlich sah. Wochen und auch Jahre später erfuhr ich etappenweise die unheimliche Lebensgeschichte dieses »Pablo«. Pablo Escobar hieß mein Informant, und Pablo Escobar war damals der größte Drogendealer der Welt. Er verdiente rund 400 Millionen Dollar jeden Monat und schmuggelte tonnenweise Kokain über die Grenzen. Im Jahre 1989 rangierte Pablo Escobar auf der Liste der reichsten Männer des Forbes-Magazin auf Rang sieben. Sein Vermögen wurde auf 30 Milliarden Dollar geschätzt. Pablo Escobar galt als kaltblütiger Killer. Hunderte von Gegnern, aber auch Freunde ließ er kurzerhand ermorden. 1991 hatte er die Abgeordneten des Kongresses so weit geschmiert, dass die neue Verfassung eine Auslieferung von kolumbianischen Staatsbürgern verbot. Dann stellte er sich den Behörden – unter der Bedingung, niemals in ein anderes Land abgeschoben zu werden. Er fürchtete sich vor dem Knast in den USA. Der kolumbianischen Regierung bot er an, ihre Auslandsschulden zu begleichen. Unweit von seinem Heimatort Envigado (Kolumbien) ließ er nach seinen Wünschen ein Privatgefängnis mit Bars, Gesellschaftsräumen und Swimmingpools bauen. Die Öffentlichkeit nannte den Komplex »La Catedral«. Sein Wachpersonal hatte er selbst zusammengestellt. Bis 1992 lief alles gut. Dann, aufgescheucht durch US-Drogenfahnder, registrierte die Staatsgewalt, dass Pablo Escobar seine kriminelle Tätigkeiten auch vom Luxusknast aus weiterführte. Die Regierung musste handeln, doch Pablo wusste vorher Bescheid und floh. Am 2. Dezember 1992 umzingelte ihn eine Spezialeinheit. Pablos Sohn Juan verbreitete später, angesichts der Übermacht habe sein Vater sich selbst erschossen.
Bereits zwei Wochen nach meiner Rückkehr in die Schweiz hatte mich ein Herr Bischofsberger des Reisebüros American Express aus der Bahnhofstraße in Zürich angerufen und mich wissen lassen, dass die Bezahlung der Flüge aller Teilnehmer für meine Expedition nach Kolumbien garantiert worden sei. In Erster Klasse. Ich möge bitte die Termine festlegen und die Namen, Geburtsdaten und Passnummern der Mitreisenden übermitteln. Ich übermittelte gar nichts. Auch wenn die Lebensgeschichte von Pablo Escobar damals noch nicht zu Ende geschrieben war, wollte ich mit einem Drogenhändler nichts zu tun haben. Ich verweigerte seine Einladung und beantwortete auch keine Fragen des Reisebüros mehr. Doch meine Neugier an den deformierten Schädeln blieb hellwach. Die Bilder mit den Säuglingsköpfen ohne Fontanelle wollten nicht aus meinem Gehirn. Immerhin hatte ich seit Jahrzehnten Indizien gesammelt, die belegen sollten, dass unser Planet Erde vor Jahrtausenden von Außerirdischen besucht worden war. Indizien waren keine Beweise. Lag die Lösung bei den deformierten Schädeln? Lieferten sie den ersten, handfesten Beweis für den Besuch von ETs? Sollten auf unserem Planeten tatsächlich uralte Köpfe von Außerirdischen existieren? Und ließ sich dies mit modernen DNA-Analysen eindeutig belegen? Tatsächlich, derartige Analysen sind gemacht worden. Ich komme darauf zurück.
Doch was sind eigentlich … »deformierte Schädel«? Wo gibt es die? Wie entstehen sie? Wie alt sind sie? Was weiß die Wissenschaft darüber?
Deformierte Schädel sind ein weltweites Phänomen, und die ältesten unter ihnen sind gut und gern 9000 Jahre alt. Zuerst einmal gibt es die natürlichen Erklärungen für ihre Entstehung. Die Verformung eines Kopfes kann durch den Geburtsvorgang eingeleitet werden oder schon vorher durch Platzmangel im Mutterleib entstehen. Die Medizin kennt die verschiedensten Ursachen für Schädeldeformationen. Sie werden meistens unter dem Sammelbegriff »Syndrom« geordnet. Das Wort stammt vom griechischen syndrome her und bedeutet »zusammenkommen«, »zusammenlaufen«. Ein Syndrom ist demnach eine Mischung von mehreren Krankheitszeichen, die gemeinsam auftreten. Für Schädeldeformationen werden beispielsweise folgende Syndrome verantwortlich gemacht:
Treacher-Collins-Syndrom
Beveridge-Syndrom
Adams-Oliver-Syndrom
C-Syndrom
Sturge-Weber-Syndrom
Apert-Syndrom
Chromosom-15q-Tetrasomie-Syndrom
Chromosom-4q-Deletion-Syndrom
Triploidie-Syndrom
Chromosom-7p-Duplication-Syndrom
Ramban-Hasharon-Syndrom
Baker-Vinters-Syndrom
Kenny-Caffey-Syndrom Typ 1 + 2
Laron-Syndrom Typ 1 + 2
Froster-Iskernius-Waterson-Syndrom
Theodor-Hertz-Goodman-Syndrom
Et cetera. Diese Syndrome, die durch Wissenschaftler entdeckt wurden und deshalb ihren Namen tragen, charakterisieren Schädeldeformationen durch Fehler in den Chromosomen. Diese Chromosomen wiederum bestehen aus DNS-Abschnitten und gehören zu jeder Zelle. Sie geben die Erbinformationen weiter. Jeder Mensch verfügt über 23 Chromosomenpaare oder 46 einzelne Chromosomen. Diese Erbinformationen können durch Chromosomendefekte verändert werden, was in einzelnen Fällen zu Schädeldeformationen führen kann. Beispielsweise bei folgenden Syndromen:
Chromosom 11, Deletion 11p
Chromosom 15q, Tetrasomie
Chromosom 7, terminale 7-p
Chromosom 8, Monosomie 8p
Chromosom 9-Inversion
Neben den bereits aufgezeigten, medizinisch und genetisch festgestellten Gründen für deformierte Schädel gibt es noch die »Plagiozephalie«, bei der es sich um eine asymmetrische Abflachung des Hinterkopfs handelt. Oder die »Brachyzephalie«. Darunter versteht die Medizin einen verbreiterten Schädel. Oder die »Skaphozephalie«. Das ist der lang gezogene, schmale Schädel mit hoher Stirn.
Also existieren keine Rätsel um diese missgestalteten Köpfe? Ist sowohl medizinisch wie genetisch alles zufriedenstellend erklärbar?
Der griechische Arzt Hippokrates (460–370 v. Chr.), nach dem die heutigen Mediziner immer noch ihren »Eid des Hippokrates« schwören, schrieb im 5. Jahrhundert über ein Volk der Makrokephaloi. Seine Menschen würden ihren Säuglingen gleich nach der Geburt Bandagen um den Kopf legen, um die Knochen länglich zu deformieren. [1]
Die ältesten Funde mit deformierten Schädeln in Europa tauchten in Armenien auf und werden in das 9. Jahrtausend vor Christus datiert. [2] Doch der Kult um lang gezogene Köpfe blühte im Alten Europa über Jahrtausende hinweg. Deformierte Schädel wurden in ungarischen Friedhöfen gefunden. Aus ethnischer Sicht soll der Brauch ursprünglich von den Hunnen stammen, jenem asiatischen Reitervolk, das während des 4. und 5. Jahrhunderts von den kaspischen Steppen nach Westen zog. Der Name des Hunnenkönigs Attila, auch »der Todesreiter« genannt, ist allgemein bekannt. Doch die Hunnen können die Deformationen nicht erfunden haben. Sie sind viel älter als das 4. Jahrhundert. Welcher Gedanke steckt ursprünglich dahinter? Frau Gernot Wagner veröffentlichte ihre Diplomarbeit über deformierte Schädel in Österreich [3] und kommt zu dem Schluss, der Brauch sei durch das nomadische Reitervolk der Hunnen in unseren geografischen Raum gelangt. Nur: Woher hatten die ihn?
Der deutsche Forscher und Schriftsteller Hartwig Hausdorf, Autor einer hervorragenden Serie über rätselhafte Funde, berichtet in seinem Buch Götterbotschaft in den Genen[4] von massenhaften Schädeldeformationen in Frankreich und sogar in Deutschland. In der Kreisstadt Straubing (Bayern) machten Archäologen – so Hausdorf – »während der Ausgrabungen in einem Reihengräberfeld Ende der 1970er-Jahre eine überraschende Entdeckung. Sie fanden in zweien der Gräber Skelette mit künstlich umgeformten Schädeln, die ungewöhnlich gut erhalten waren«. Gemäß Hausdorf liegen inzwischen allein aus Bayern zwölf künstlich deformierte Schädel vor. Sie alle sollen aus einer Zeit von 450–550 n. Chr. stammen. Und: »Zu Beginn der 1930er-Jahre legte der britische Anthropologe Eric John Dingwall [5] (1890–1936) eine blitzsauber recherchierte Studie vor, in deren Mittelpunkt Deformationen in den Ländern Europas standen.« Inzwischen soll es in Deutschland über 80 Funde deformierter Schädel geben, in der Schweiz 15 und in Frankreich gleich Tausende. Isotopenuntersuchungen, mit denen der Anteil eines chemischen Elements in einer Probe gemessen werden kann, ergaben, dass die deutschen, ungarischen, österreichischen oder französischen Schädel nicht aus fernen Ländern stammten. Sie waren ortsfest. Die alte Frage blieb: Warum nur taten Eltern ihren Kindern die Qual an, die Schädelknochen über Jahrzehnte hinweg, oft bis ins Mannesalter, mit Bandagen und Brettern zu verformen? Und dies gleich weltweit?
Im Naturhistorischen Museum von Wien wird der »Turmschädel von Mannersdorf« präsentiert. Er gehörte einst einer 20-jährigen Frau, die im 5. Jahrhundert n. Chr. lebte. Von den 18 in Österreich aufgefundenen deformierten Schädeln lagen 14 auf einer Linie, die sich östlich durch Wien zog. Drei weitere tauchten im Bezirk Krems-Land an der Donau und ein anderer im Bezirk Völkermarkt in Kärnten auf. Der berühmte Wissenschaftler Rudolf Virchow (1821–1902), der als Arzt an der Charité in Berlin wirkte, vertrat die Ansicht, die frühen Menschen hätten ihre Schädeldeformationen aus »Nützlichkeitserwägungen« [6] heraus praktiziert – als »Schönheitsideal« oder als Mittel der »Abgrenzung von anderen Rassen«. Doch taten sie das gleich zu Abertausenden und weltweit, wie inzwischen feststeht? Allein schon in Europa wurden künstlich verformte Schädel von Ungarn über die Slowakei und Niederösterreich bis an die Rhone, den Genfersee und weiter in Richtung Burgund und Bordeaux gefunden. Sogar auf kleinen Inseln wie Malta. Allein in Bayern liegen »21 Belege von sieben Fundstellen vor«. [7] Und dies ist – global betrachtet – gerade einmal ein Wassertropfen auf der Erdoberfläche. Inzwischen weiß man von Hunderttausenden von deformierten Schädeln. Und jetzt sollen – es ist kaum zu fassen! – deformierte Schädel sogar in der Antarktis aufgetaucht sein. Welchem Wahn ist die Menschheit über Jahrtausende hinweg nur gefolgt? Und existieren neben den medizinisch und genetisch erklärbaren Schädeln, neben den von Menschen verursachten Verformungen auch lang gezogene Köpfe, die nirgendwo ins Schema passen? Wie eigentlich praktizierten unsere Vorfahren die Deformationen?
Aus Peru weiß man es. Den spanischen Eroberern begegneten immer wieder junge Menschen mit lang gezogenen Hinterköpfen. Man zeigte ihnen Neugeborene, die Bandagen und Schnüre um die Köpfchen trugen. Je nach Alter und Härte der Schädelknochen auch Brettchen rechts und links der Schläfen. Sogar Stirnbretter und gitterförmige Platten aus Algarrobo-Holz wurden eingesetzt. Man fand Kinderbettchen mit einer Hebelvorrichtung am Kopfende. Vor dem Schlafen wurde das Köpfchen in die Vorrichtung gezwängt. Dieses unnatürlich erscheinende Verhalten unserer Vorfahren war allerdings keine Erfindung von irgendwelchen südamerikanischen Völkern. Dasselbe wurde beispielsweise auch vom Stamm der Mangbetu im nordöstlichen Urwald der Provinz Orientale im früheren Belgisch-Kongo (heute Demokratische Republik Kongo) praktiziert. Wie kamen die Informationen über deformierte Schädel vom Herzen Afrikas an die Pazifikküste Perus? Oder umgekehrt? Heute zeigen die meisten anthropologischen Museen Südamerikas deformierte Schädel. Über eine besonders eindrückliche Sammlung verfügt das Ethnografische Museum der Universität von Buenos Aires in Argentinien. Es präsentiert verunstaltete Schädel, die von Kolumbien über Ecuador und Peru bis hinunter nach Chile gefunden wurden. Dort, in der ausgetrockneten Wüste Atacama, wo an den Hügelwänden riesige, himmelwärts gerichtete Scharrzeichnungen zu bestaunen sind, liegt auch der Ort San Pedro de Atacama mit seinem Museum »Padre Le Paige«. Gegründet vom belgischen Missionar Gustave Le Paige (1903–1980). Der war überzeugt von menschenähnlichen Außerirdischen, die im Boden unserer Erde begraben liegen. Im Keller seines Museums, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, lagern über 100 deformierte Schädel. Vor seinem Tod hatte er dem chilenischen Journalisten Juan Abarzua anvertraut, er habe Mumien gefunden, die keine menschliche Gesichtsform hätten. »Man würde mir nicht glauben, wenn ich berichten würde, was ich sonst noch in den Gräbern gefunden habe.« [8]
Der spanische Priester und spätere Bischof Reginaldo Lizárraga (1545-1615), der viele Jahre in Peru lebte und die Sprache der Eingeborenen beherrschte, war lebendigen »Langschädeln« begegnet. In seinen Description y poblacion de los Indios[9] berichtet er über Menschen mit unglaublich hohen Schädeln. Ursprünglich stammten sie von Riesen ab, schreibt er. Auch der spanische Eroberer Pedro Cieza de León (1520–1554), Autor der Cronica del Peru[10] , schreibt über Riesen, die einst mit Schiffen an Perus Küste angelandet seien. Riesen? Sind sie die Lösung für die deformierten Schädel? Gab es überhaupt je Riesen? Zumindest in den Überlieferungen existieren sie.
In der Bibel (1. Mose 6, 4) kommen sie vor: »Zu jenen Zeiten, und auch nachmals noch, als Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen sich gesellten und diese ihnen Kinder gebaren, waren die Riesen auf Erden. Das sind die Recken der Urzeit, die hochberühmten.« [11]
Im 5. Buch Moses wird sogar von einem Sarkophag berichtet, in dem die sterblichen Überreste eines Riesen lagen: »Siehe, sein Basaltsarg steht noch in der Ammoniterstadt Rabba; er ist neun Ellen lang und vier Ellen breit.« (5, 11) Da die hebräische Elle 48,4 Zentimeter maß, müsste der Sarkophag knappe fünf Meter lang gewesen sein. Allgemein bekannt ist der Kampf von David gegen Goliath, beschrieben beim Propheten Samuel. (1. Samuel, 17, 4) Auch beim Propheten Josua oder im Buch der Chronik, das Bestandteil der Bibel ist, wird von Riesen gesprochen. Doch das »Buch der Bücher« ist längst nicht die einzige literarische Quelle für Riesen. In den Texten über Die Sagen der Juden[12] ist nachzulesen: »Da waren die Emiter oder die Schrecklichen, dann die Rephaiter oder Giganten …« Und im 14. Kapitel des Buches Henoch [13] , das zu den apokryphen Texten zählt, steht lapidar: »Warum habt ihr wie die Erdenkinder getan und Riesen gezeugt?«
Auch in der altgriechischen Geschichte über die Fahrten der Argonauten spielen die Riesen eine Rolle. Da geschah es, dass die Helden arglos auf einen Berg kletterten, um sich einen Überblick zu verschaffen. Dort wurden sie von Riesen angegriffen: »Ihr Leib hatte drei Paar nerviger Hände wie Pfoten. Das erste Paar hängt an den hornigen Schultern, das zweite und das dritte Paar schmiegen sich an die scheußlichen Hüften …« [14] Die Monster tauchen auch bei Homers Odysseus auf. Der kämpfte auf der Insel der Zyklopen (auch: Kyklopen) gegen einen Riesen und brannte ihm das einzige Auge aus. Heute noch nennt man Mauern aus gigantischen Steinblöcken »Zyklopenmauern«. [15][16]
Noch älter ist das babylonische Gilgamesch-Epos [17] , das in einem Hügel nahe des Dorfes Kujundschick, dem einstigen Ninive (heute Irak), ausgegraben wurde. Auf den Tontafeln, die zur Bibliothek des assyrischen Königs Assurbanipal gehörten, ist nachzulesen, wie Gilgamesch und sein Freund Enkidu dem furchteinflößenden Wesen Chumbaba begegneten. Das hatte »Pranken wie ein Löwe, sein Leib war mit Schuppen bedeckt«.
Im Buch über den Ursprung der Eskimos ist wie selbstverständlich festgehalten: »In jenen Tagen lebten die Riesen auf Erden.« [18]
Nichts anderes steht im äthiopischen Kebra Negast (Buch des Ruhmes der Könige). Kapitel 100 meldet [19] : »Jene Töchter Cains aber, mit denen sich die Engel vergangen hatten, wurden schwanger und starben …, denn die Kinder spalteten den Leib ihrer Mütter. Als sie älter wurden, wuchsen sie zu Riesen.«
Über diese und mehr Hinweise aus der antiken Literatur berichtete ich in einem früheren Buch. [20] Glaubt man den Aussagen, so existierten diese Monster einst tatsächlich. Sogar Herodot, der »Vater der Geschichtsschreibung«, berichtete in seinem 1. Buch der Historien:
»Ich wollte hier in der Halle einen Brunnen graben und stieß beim Graben auf einen Sarg, der war sieben Ellen lang. Und weil ich dachte, die Menschen seien niemals größer gewesen als heute, öffnete ich ihn und sah, dass der Leichnam wirklich so lang war wie der Sarg. Ich habe ihn gemessen und das Loch wieder zugeschüttet.«
Schwierig wird es mit den Fakten. Über die vergangenen Jahrzehnte hinweg versicherten zwar mehrere Wissenschaftler, irgendwo Riesenknochen oder Werkzeuge von Riesen ausgegraben zu haben. Doch alle derartigen Funde sind umstritten und werden, was ihren Ursprung angeht, Gorillas oder Mutationen zugeschrieben. Noch 1944 berichteten die deutschen Paläontologen Gustav von Königswald (1902–1982) und Franz Weidenreich (1873–1948) über Knochen von Riesen, die sie in den Apotheken von Hongkong gekauft hätten. Weidenreich berichtete 1944 sogar vor der American Ethnological Society darüber. [21]
Haben Riesen vielleicht gar beim Bau der Großen Pyramide mitgewirkt? Die Frage ist berechtigt, denn vor wenigen Jahren fotografierte ein Schweizer Hobbyforscher in Ägypten Teile der Hand eines mumifizierten Riesen. Hier die Geschichte:
Gregor Spörri aus Basel zieht es seit Jahrzehnten immer wieder ins Land am Nil. Was den Bau der Großen Pyramide angeht, so kennt er sowohl die klassische wie auch die skeptische Literatur hierzu, und er hat die Pyramide auch mehrfach persönlich erforscht. Bei jedem Ägypten-Besuch tauchen Händler auf, die versuchen, den Touristen irgendwelchen Ramsch anzudrehen. Um dem zu entgehen, lässt sich Spörri am 14. April 1988 in ein Kaff namens Bir Hooker, irgendwo zwischen Kairo und Alexandria, fahren, weil er hofft, bei einem Händler dort etwas anderes als die üblichen Souvenirs zu finden. In einem mit Lehmziegeln errichteten Haus trifft er auf einen älteren Ägypter namens Nagib. Der hat keine Figürchen, Hieroglyphendarstellungen oder Papyrusblätter anzubieten, sondern echte antike Kunst. Nachdem Spörri ihm von seinen Pyramidenforschungen berichtet hat, ist Nagib bereit, seinen streng gehüteten Familienschatz zu öffnen. Dazu gehört der abgehackte Finger eines Riesen, mitsamt Fingernagel, Mittel- und Endgelenk. Alles ummantelt von einer mumifizierten Haut. Besonders interessant ist ein aus dem Grundglied herausragender Knochen. Der hellwache Schweizer weiß Fälschungen von Originalen zu unterscheiden. Der Riesenfinger kann keine Fälschung sein. Die Herstellung eines derartigen Objektes wäre viel zu aufwendig. Knochen, Gewebe, die aufgeplatzte Haut, der Fingernagel – ein scheußliches Relikt. (Bilder 1 + 2) Nichts für Touristen, nichts, womit man Geld machen könnte. Nagib zeigt dem verblüfften Besucher sogar noch ein Röntgenbild des Riesenfingers, das von einem Bekannten in einem Kairoer Krankenhaus erstellt worden sein soll. Bevor Nagib sein einzigartiges Objekt wieder verstaut, darf Gregor Spörri immerhin einige Fotos davon schießen.
Bild 1
Bild 2
Wieder zu Hause in Basel, gerät er ins Grübeln. Der Monsterfinger beschäftigt Spörri so sehr, dass er zu recherchieren beginnt und schließlich einen Paläo-SETI-Thriller schreibt, in dem der Finger eine wichtige Rolle spielt. [22] Nunmehr wurde auch Luc Bürgin, der die Zeitschrift mysteries herausgibt, auf den kuriosen Fund aufmerksam. Er widmete der »Monsterkralle von Bir Hooker« mehrere Seiten. [23] Im ausgestreckten Zustand ist der Finger immerhin 38 Zentimeter lang. Wahrhaftig ein Riesending. (Direkter Kontakt zu Herrn Spörri über www.grespo.com.)
In einem gründlich recherchierten Artikel des Magazins Nexus belegt der britische Forscher Hugh Newman die Existenz von Riesen im Alten Ägypten. [24] Dabei verweist er auf den Ägyptologen Professor Dr. Walter Brian Emery (1903–1971), der in den 1930er-Jahren maßgeblich an den Ausgrabungen in Sakkara beteiligt war. Emery hatte mehrere Knochen- und Mumienfunde von Riesen gemacht und dies auch in seinen Ausgrabungsberichten erwähnt. Diese Riesen sollen – laut Emery – Priester und »Abkömmlinge von Horus« gewesen sein. [25] Sie erreichten eine Größe von bis zu 4,6 Metern. Auch der berühmte britische Archäologe Flinders Petrie (1853–1942) fand, diesmal im Vorhof des Tempels von Abydos, Knochen von übergroßen Menschen.
Sind also Riesen der Ursprung für die deformierten Schädel? Es fehlt etwas: Angenommen, weltweit existierten eine Million deformierte Köpfe – in Wirklichkeit sind es mehr –, und weiter angenommen, 80 Prozent davon sind künstlich – durch den Menschen – entstanden, so bleiben noch 200 000 »natürliche« Schädel. Etwa die Hälfte davon sollen die Erbfaktoren von Riesen beinhalten. Wo bleiben dann aber die Skelette dieser Giganten? Massenhaft Schädel, aber keine Knochen? Die Museen der Welt präsentieren deformierte Monsterköpfe »ohne Unterbau« …
Zu Beginn der 1970er-Jahre entdeckte der britische Zoologe Dr. David Davies in Ecuador (Südamerika) einen lang gezogenen Schädel. Es war ein Zufallsfund. Aufgrund des anhaltenden Regens war Dr. Davies in die Räume einer kleinen Privatsammlung in der ecuadorianischen Stadt Cuenca geflüchtet. Dort fand er »einen großen Berg fossilen Materials, aus dem mich zwei menschliche Zähne anstarrten«. [26] Dr. Davies erkundigte sich nach dem Fundort, den er schließlich aufsuchte. Dort entdeckte er in einer zwei Meter hohen und rund zwei Kilometer langen Gesteinsschicht verschiedene Knochen von Tieren, die es in Südamerika gar nicht geben dürfte. Darunter Säbelzahntiger und Mastodons (eine Mammutart). Mich kann das nicht überraschen, denn Bilder von Mammut-ähnlichen Tieren hatte ich sowohl in der Sammlung von Pater Carlo Crespi (1891–1982) in Cuenca, Ecuador, wie auch in derjenigen von Dr. Janvier Cabrera (1924–2001) in der Stadt Ica, Peru, bestaunt. (Ich berichtete früher darüber. Siehe [27] .) Im Kunterbunt der unmöglichen Funde stieß Dr. Davies auch auf einen deformierten Schädel. Er nannte ihn »Fred«. Nach der C-14-Analyse müsste »Fred« 28 000 Jahre alt und damit der älteste Amerikaner sein. »Freds« Kopf war nach hinten verlängert, in diesem Falle eine offensichtlich natürliche Deformation. Doch gehörte er zu keinem Riesen – zumindest konnten an der Fundstelle keine entsprechenden Knochen aufgefunden werden.
Figürchen mit nach hinten verlängerten Schädeln tauchten schon 3000 v. Chr. auf. Zu bestaunen im Museum für kykladische Kunst in Athen. (Bilder 3 + 4)