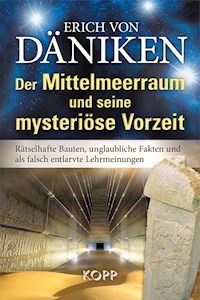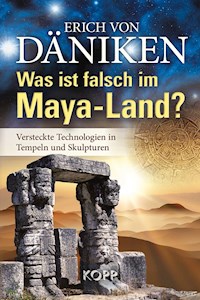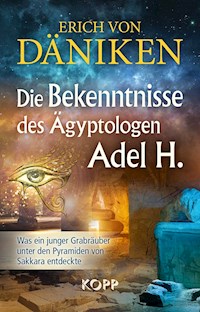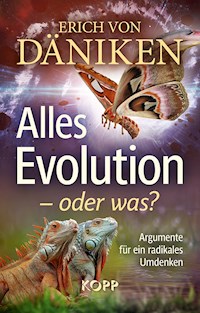
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die unmögliche Evolution:
Warum die Thesen der Darwinisten nicht länger haltbar sind
Es gab einmal ein Gedankengebäude, das nannte man Evolutionstheorie. Erdacht von klugen Menschen und bestätigt durch unzählige Wissenschaftler. Dann entdeckten die Menschen das Elektronenmikroskop. Damit ließen sich die Moleküle innerhalb der Zelle sichtbar machen, und plötzlich tauchten Fragen zur Evolution auf, die vorher nicht möglich waren. Welche Kraft bündelt eigentlich die Atome in der richtigen Reihenfolge? Was verschiebt die Molekülketten in die korrekte Position? Wie eigentlich war die erste lebende Einheit innerhalb der Zelle entstanden? Wie funktioniert die Vererbung, die Weitergabe der Informationen an die nächste Generation? Stammte der Mensch nur und ausschließlich von den Primaten ab, wie Charles Darwin und unzählige andere Geistesgrößen annahmen - oder griffen zusätzliche »Motoren« in die Evolution ein? Kräfte, von denen man bislang nichts ahnte?
Heute steht fest: Mit der bisherigen Evolutionstheorie lassen sich unzählige Fragen nicht mehr beantworten. Da gibt es eine Lebensform die nennt man »Blob« (Physarum polycephalum). Das »Ding« hat weder Augen noch Ohren, weder Mund noch Nase oder gar ein Gehirn. Trotzdem nimmt es Nahrung auf, überwindet Hindernisse auf dem kürzesten Weg und tauscht Informationen mit anderen »Blobs« aus. Der »Blob« widerspricht jedem evolutionären Gedanken, wonach sich eines aus dem anderen entwickelt. Ähnliches gilt für die »Venusfliegenfalle« (Dionaea muscipula). Dabei handelt es sich um eine fleischfressende Pflanze mit Fangblättern, die sich im Bruchteil einer Sekunde schließen. Oder die in Australien vorkommenden »Magenbrüterfrösche« (Rheobatrachus). Sie brüten ihre Jungen im Magen aus. Unmöglich in einem langsamen, evolutionären Prozess.
Überall gibt es Eigenschaften von Tieren, die nirgendwo in die Evolutionstheorie passen wollen. Und der Mensch? Sind wir tatsächlich die am besten angepasste Lebensform auf diesem Planeten? Heute melden sich immer mehr Wissenschaftler zu Wort, die der bisherigen Evolutionslehre widersprechen. Die Theorie passt zu den Veränderungen innerhalb der Arten - sie lässt sich aber nicht mehr mit dem Innenleben der Zelle vereinbaren. Irgendein anderer Einfluss, der uns bisher entgangen ist, wirkt auf die Evolution. Man nennt ihn »Intelligent Design«. Dahinter wird eine intelligente Planung vermutet. Irgendwer oder irgendwas - ein Geist des Universums? Außerirdische? - müsste hinter dieser Planung stecken.
Erich von Däniken demonstriert an unzähligen Beispielen die Unmöglichkeit des bisherigen Evolutionsgedankens. Er zitiert Wissenschaftler, die gegen die bisherige Lehre argumentieren, aber auch solche, die sie verteidigen. Alles Evolution - oder was?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
1. Auflage Oktober 2020 Copyright © 2020 bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Agentur Pegasus, Zella-Mehlis Covergestaltung: Stefanie Beth Satz und Layout: Götz Mannchen ISBN E-Book 978-3-86445-792-0 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-10 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Brief an meine Leser
Brief an meine Leser
Liebe Leserin, lieber Leser!
»An der Tatsache der Evolution besteht nicht der geringste Zweifel.« So steht es in der weltberühmten Encyclopædia Britannica, und genauso sieht es eine überwältigende Mehrheit von Experten der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Hat die Mehrheit recht?
Selbstverständlich gibt es die Evolution. Jeder Mensch kennt mehrere Hundearten und weiß, dass sie alle von einem wolfsähnlichen Urhund abstammen. Aber es gibt keine »Schweinehunde« – also Hunde mit einem Schweinskopf. So wenig wie Mischungen zwischen Giraffen und Löwen.
Doch auf unserem Planeten leben Wesen, die es nach dem evolutionären Prinzip nicht geben dürfte. Können Sie sich, verehrte Leserin, verehrter Leser, eine fleischfressende Pflanze vorstellen, deren Fangblätter im Bruchteil einer Millisekunde zusammenklappen? Dies aber erst tun, nachdem das Opfer zwei verschiedene Borsten berührt hat? Oder, noch toller, eine Froschart, die ihre Jungen in ihrem Magen ausbrütet? In demselben Magen, der doch eigentlich geschaffen wurde, um ihre Nahrung zu verdauen?
Um solche Dinge geht es in diesem Buch – und über die kontroversen Ansichten der zuständigen Wissenschaftler.
Sehr herzlich!
Erich von Däniken
Kapitel 1: Was Tierre so alles können
Kapitel 1
Was Tiere so alles können
Man stelle sich folgendes Szenario vor:
Eine Wespe steuert im Flug ihr Opfer – eine Spinne – an. Dann sticht sie ihr von hinten in den Rücken und spritzt ein Gift in die Wunde. Die Spinne ist gelähmt. Anschließend legt die Wespe ein Ei in die beschädigte Körperstelle der Spinne. Die Larve entwickelt sich im Körper der Spinne, und nach dem Schlüpfen ernährt sich das Wespenjunge von den Innereien des Wirtes. Dabei verschlingt es nach und nach zuerst diejenigen Teile seines Opfers, die für das Überleben nicht wichtig sind. Die Innereien der Spinne sollen so lange wie möglich am Leben und damit frisch bleiben.
Dieses Szenario spielt sich tagtäglich ab. In Australien kennt jedermann die sogenannte Captain Cook’s Wespe (Agenioideus nigricornis). [Bild 1] Dieses kleine, lästige Insekt pflanzt sich mithilfe einer giftigen Spinne fort: der Rotrückenspinne. Genauso wie bei der allgemein bekannten Schwarzen Witwe kann der Biss der Rotrückenspinne tödlich sein. So werden in Australien Jahr für Jahr Hunderte von Menschen mit einem Serum behandelt, nachdem sie von der Rotrückenspinne gebissen worden sind.
Bild 1
© Wikimedia Commons
Giftspinnen töten andere Lebensformen – wer aber tötet die Giftspinnen? Gemeinsam mit dem Biologen Patrick Honan vom Museum von Victoria, Australien, ging der deutsche Biologe und Insektenforscher Prof. Dr. Lars Krogmann dieser Frage nach. Die Resultate verblüfften. Sowohl die kleine Captain Cook’s Wespe als auch ihre größere Artgenossin, die Wegwespe (Pompilide), attackierten giftige Spinnen und benutzten die Spinnenleiber als Brutstätte für ihre Jungen. Diese Wespen gehören zu den Hautflüglern, und es existieren unzählige Arten davon. Die Wespen legen ihr Ei in die Spinnen und nutzen diese als lebende Brutkästen.
Mehrere Wespenarten beherrschen das Kunststück, fremde Wirte zu missbrauchen. So bringt es die Brackwespe (Dinocampus coccinellae) fertig, einen Marienkäfer zu manipulieren. Die Wespe legt ein Ei in den Hinterleib des Opfers, und die Wespenlarve ernährt sich von den Körpersäften des Käfers. Sobald die Larve eine bestimmte Größe erreicht hat, kriecht sie aus dem Marienkäfer heraus und verpuppt sich am Unterleib des Käfers. Dadurch wird der Marienkäfer bewegungslos, zuckt aber immer noch mit seinen Beinchen. Nach dem Schlüpfen der neuen Brackwespe erholt sich der Marienkäfer und kann sich sogar wieder fortpflanzen. Ganz offensichtlich hat das Reich der Wespen phänomenale Methoden entwickelt, um seine Brut zu ernähren.
Da gibt es die Juwelwespe (Ampulex compressa)[Bild 2], die Kakerlaken (Periplaneta americana)[Bild 3] auflauert. Diese Kakerlaken sind zehnmal größer als die Wespe, was sie aber nicht daran hindert, überraschend aus einem Versteck hervorzuschnellen und ihr Opfer mit einem ersten Stich zu lähmen. Der zweite Stich zielt direkt ins Nervensystem, und zwar exakt in diejenige Region, die die Flucht der Kakerlake steuert. Über einen Fühler der Kakerlake dirigiert die Wespe ihr Opfer zu einem Erdloch – und wie ein Zombie läuft die Kakerlake so auf ihren sechs Beinen zum eigenen Grab. Dort legt die Wespe ein Ei in die Kakerlake und baut anschließend um sie herum mit kleinen Steinchen. Nach 4 Wochen schlüpft eine neue Juwelwespe aus dem Gefängnis und sucht sich ihr nächstes Opfer. Die Kakerlake ist tot.
Bild 2
© Wikimedia Commons
Bild 3
© Wikimedia Commons
Ein noch perfideres Prozedere beherrscht die Schlupfwespe (Ichneumonidae). Ihr Wirt ist die allseits bekannte Radnetzspinne (Plesiometa argyre). Diese wird durch einen Stich von der Schlupfwespe gelähmt. Die Wespe legt ein Ei in den Hinterleib der Spinne. Die Larve ernährt sich von deren Innereien und wächst heran. Sobald die Larve reif zum Schlüpfen ist, spritzt die Wespe, die ständig in der Nähe bleiben muss, ein neues Gift in die Spinne, und die verändert daraufhin ihr Verhalten. Anstatt – wie angeboren – ein Radnetz zu weben, beginnt die Spinne mit ihren Fäden einen Kokon um die Larve zu wickeln. Ist dieser Kokon fertig, tötet die Schlupfwespe ihr Opfer und frisst es auf. Die Wespenlarve wächst weiter und verlässt schließlich ihren Kokon.
Apropos Radnetzspinnen: Darwins Rindenspinne (Caerostris darwini) produziert Spinnennetze mit Fäden von bis zu 25 Metern Länge. [Bilder 4+5] Wie geht das? Antwort: Die Spinne postiert sich in einem Luftzug und lässt ihren Seidenfaden durch den Wind über einen Bach oder Tümpel tragen. Dann klettert sie über ihr Konstrukt und heftet einen neuen Ankerfaden an eine Stelle daneben. Jetzt lässt sie sich in die Tiefe fallen – Spinnen-Bungee-Jumping – und vom Wind ans andere Ufer tragen. Von zwei Hauptfäden aus wiederholt sich das Spiel, bis ein gigantisches Netz entsteht, das sich über einen Bach oder Teich legt. Das Verblüffendste daran ist nicht die Größe des Netzes, sondern die Stärke der Spinnenfäden. Die sind nämlich zehnmal stärker als Kevlar. Dabei handelt es sich um Kunstfasern, aus denen nicht nur Jeans, sondern auch schusssichere Westen hergestellt werden. Die Fäden der Darwin’schen Radnetzspinnen sind das zäheste Biomaterial der Welt. Doch nicht nur das: Sie sind auch extrem leicht und dünn. Die geheimnisvolle Evolution oder der Wunsch der Spinne muss also veranlasst haben: Wenn schon riesige Fäden, dann müssen diese stärker sein als die Seiden aller anderen Artgenossen.
Bild 4
© Wikimedia Commons
Bild 5
© Wikimedia Commons
Die Fragen machen perplex: Was nur ging in der ersten Juwelwespe vor, die sich auf eine zehnmal größere Kakerlake stürzte? Woher wusste sie, dass ihr Stachel exakt diejenige Stelle des Nervensystems treffen musste, die die Flucht des Opfers steuerte? Die Wespe konnte den Aufbau des Nervensystems der Kakerlake nicht kennen. Wenn der Stich danebenging, hätte die Kakerlake die viel kleinere Wespe getötet. Und wie vererbte sich ihre Erfahrung auf die nächste Generation? Welches Chemikaliengebräu ist nötig, um das Gehirn einer Radnetzspinne derart zu verändern, dass sie statt eines Netzes einen schützenden Kokon um ein artfremdes Wesen webt? Welches Mysterium der Evolution lässt die Chemikalie im Körper der Wespe in der richtigen Mischung entstehen?
Wie verhält es sich mit den Wirtstieren? Ist das, was sie betrifft, alles normal und nichts Außergewöhnliches? »Die Natur« (darauf komme ich noch zurück) kennt schließlich unzählige Parasiten, die Wirtskörper benötigen, um ihre Brut zu ernähren. Schließlich missbrauchen alle sogenannten Neuroparasiten das Nervensystem ihres Wirtes für ihre eigenen Zwecke. Der Saugwurm (Trematoda) beispielsweise ist ein solches Ungeheuer und verfügt zudem über männliche wie auch weibliche Geschlechtsorgane. Die Würmer können sich gegenseitig wie auch sich selbst befruchten. Dabei reicht ein Wirt nicht, um ihren Lebenszyklus zu durchlaufen. Nachdem sich der Wurm an ein anderes Tier gesaugt hat, legt dieser Wirt irgendwann Eier. Diese geraten ins Wasser und aus ihnen schlüpfen Larven, die sogenannten Miracidien. Sie schwimmen so lange umher, bis sie entweder gefressen werden oder auf eine spezielle Schnecke treffen. In letzterem Falle bohrt sich das Miracidium in die Haut der Schnecke und wächst zu einem Brutschlauch. Nach mehreren Verwandlungen entstehen daraus Tochtersporozysten, und diese suchen die Mitteldarmdrüse der Schnecke heim. Dort entstehen Stablarven, die ihrerseits Schwanzlarven produzieren. Daraus wachsen schließlich Zercarien, die die Wirtsschnecke verlassen und in einen neuen Zwischenwirt eindringen.
Andere Saugwürmer benutzen Raupen als Wirte. Diese Raupen werden von Vögeln gefressen. Über den Vogelkot werden die Eier des Saugwurms verbreitet, und der Kreislauf beginnt von vorn. Alles ganz einfach – oder? Woher weiß denn aber der Saugwurm, dass die Raupe, die er als Wirt missbraucht, von einem Vogel gefressen wird und der Vogelkot das Fortbestehen seiner Art garantiert?
Wir alle haben schon vom Bandwurm (Schistocephalus) gelesen, aber wer weiß schon, dass die Larve dieses ekligen Tieres einen Vogel benötigt, um sich dort zu paaren? Schon der Kreislauf des Bandwurms beginnt gespenstisch. Ein winziger Ruderfußkrebs (Copepoda) frisst die Larven des späteren Bandwurmes. Dieser Ruderfußkrebs muss seinerseits von einem kleinen, dreistachligen Fisch der Art der Stichlinge aufgefressen werden, wobei sich der Krebs dem Stichling regelrecht zum Verspeisen anbietet. Ausschließlich in diesem Dreistachligen Stichling kann die Larve wachsen – bei einem anderen Fisch funktioniert das Ganze nicht. Und irgendwann muss die Larve in einen Vogel gelangen – eben zur Paarung.
Genauso unmöglich erscheint die Geburt des Sackkrebses (Sacculina carcini). Der gehört zur Familie der Rankenfüßer. Dieser Sackkrebs missbraucht eine Krabbe für seinen Nachwuchs. Wie das funktioniert? Am Hinterleib der Krabbe existiert ein kleiner Sack, eigentlich dazu bestimmt, die Eier der eigenen Art wachsen zu lassen. Doch der männliche Sackkrebs befruchtet diese Eier der Krabbe, und die Krabbe pflegt und behütet die fremde Brut in ihrem Sack, als ob es die eigene wäre. Dabei geschieht das nächste Wunder. Die Hormone der ursprünglich männlichen Krabbe verändern sich, und sie mutiert zum weiblichen Organismus. Hokuspokus.
Sogar Ameisen werden von Parasiten gesteuert. Für »die Natur« – was immer das sein soll – ist selbst das Unmögliche möglich. Da gibt es einen Parasiten des Namens Kleiner Leberegel (Dicrocoelium dendriticum). Der befällt Weidetiere wie Rinder oder Schafe. Über den Kot dieser Tiere werden seine Larven ausgeschieden. Schnecken ernähren sich von diesem Kot und entwickeln sogenannte Zerkarien, die in den Atmungskreislauf der Schnecken gelangen. Die Zerkarien spuckt die Schnecke in winzigen Schleimbällchen aus. Dieser Schleim wird von Ameisen gefressen, und jetzt erst wird der ursprüngliche Kleine Leberegel aktiv. Der Schleim gelangt in das Nervensystem der Ameise und verändert sie komplett. Das Tierchen postiert sich auf der Spitze eines Grashalms und wartet darauf, von einem Weidetier gefressen zu werden. Geschieht dies nicht während des ersten Tages, so kehrt die Ameise in ihren Bau zurück und wiederholt ihr Verhalten so lange, bis sie verschluckt wird.
Nun ja – Tiere eben. Doch Parasiten steuern auch Menschen. In der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft1 machte die Biologin Sabrina Schröder auf einen Parasiten aufmerksam, der den Menschen verändern kann. Das Tierchen heißt Toxoplasma gondii und wurde bereits 1907 in Tunesien entdeckt. Der Parasit löst die Krankheit Toxoplasmose aus, und die wiederum verändert das Verhalten von Mensch und Tier. Toxoplasmose ist inzwischen weltweit bekannt und wird vor allem durch den Kot von Katzen verbreitet. Nimmt ein Nagetier – zum Beispiel eine Maus – Toxoplasma gondii auf, so verliert es die angeborene Angst vor Katzen und bietet sich ihrem Erzfeind buchstäblich zum Fraß an. Neurologen vermuten, der Parasit könne bei Menschen Krankheiten wie Schizophrenie hervorrufen. Studien ergaben, dass Menschen mit der Krankheit Toxoplasmose vermehrt zu Depressionen und Selbstmord neigen. Zudem führt Toxoplasmose zu Entzündungen des Gehirns. Die Ansteckung des Menschen erfolgt über den Katzenkot.
Welche Evolutionsprozesse müssen diese (und viele andere) Tiere durchlaufen haben? Man stelle sich die erste Wespe vor, die eine hochgiftige Spinne anzufliegen versuchte. Spinnen sind raffinierte Gegner, die sich nicht nur mit ihren Klauen und dem Versuch, ihr Opfer einzusaugen, wehren, sondern auch mit ihren klebrigen Fäden. Weshalb kam – meinetwegen vor Millionen von Jahren – eine Wespe auf die lebensgefährliche Idee, eine Giftspinne anzugreifen? Es krabbelten schließlich genug andere, harmlosere Lebensformen auf dem Boden herum. Wie kam die Wespe auf den Gedanken, ihre Eier in die Wunde einer völlig fremden Art zu legen? Schließlich gehörte die Spinne überhaupt nicht zu ihrer Verwandtschaft, der man die eigene Brut anvertrauen konnte. Woher »weiß« die Wespenlarve in den Eingeweiden der Spinne, welche Innereien sie der Reihe nach anzapfen muss, damit ihr Wirt möglichst lange »frisch« und am Leben bleibt? Woher hat das Wespenjunge seine Information? Und grundsätzlich: Auf welche Weise soll dieser Kreislauf begonnen haben? Wie gelangte das erste Wespen-Ei in den Körper der Giftspinne? Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Die erste Wespe oder die erste Wespenlarve im Spinnenbauch? Und überhaupt: weshalb so umständlich? Wespen könnten doch ihre Eier überall hinlegen – warum ausgerechnet in den Körper einer lebendigen Giftspinne?
Im Laufe von Hunderten von Millionen Jahren – so schildert es die Evolutionslehre – bildeten sich rund 40000 verschiedene Spinnenarten heraus. Alle müssen von irgendeiner Urspinne abstammen und entwickelten völlig unterschiedliche Fähigkeiten. Als giftigste Spinne der Welt gilt die australische Trichterspinne (Agelenidae). Sie entwickelte ein Gift, das nur für Primaten und Insekten tödlich ist – nicht aber für Tiere wie Kaninchen oder Hühner. Wie entstand dieser seltsame Giftcocktail, der manche Tiere tötet und andere nicht? Wobei die meisten Spinnen auf unserem Globus ihre Beute durch Gift umbringen. Erst fangen – oft, aber nicht immer im Netz –, dann töten. Eine große Spinne Europas ist die Mächtige Fischernetzspinne (Segestria florentina). [Bild 6] Sie lebt vorwiegend in engen Ritzen, Felsspalten oder an Baumrinden und wird bis zu 4 Zentimeter groß. Ihr Gift ist für den Menschen schmerzhaft, aber nicht tödlich. Dasselbe gilt für die Goliath-Vogelspinne (Therzphosa blondi). Sie kann 12 Zentimeter groß und 200 Gramm schwer werden. Ein Schrecken verursachendes Ding – doch ungefährlich für den Menschen. Sie jagt auch keine Vögel – wie ihr Name suggerieren könnte –, sondern Insekten und Wirbeltiere wie Mäuse und Frösche. Dasselbe gilt für die Tarantel (Lycosa erythrognatha). Diese sieht genauso furchterregend aus wie eine Vogelspinne und kann dem Menschen schmerzhafte Bisse zufügen, die aber nicht tödlich sind.
Bild 6
© Wikimedia Commons
Spinnen … Spinnen … Spinnen mit unterschiedlichem Jagdverhalten und verschiedenen Waffen. Und alle sind untereinander verwandt. Eine Wasserspinne, auch Silberspinne (Argyroneta aquatica) genannt, atmet zwar Luft, taucht dann aber unter Wasser und trägt die Luft in einer Atemblase mit sich. Das ist evolutionstechnisch etwa so pervers wie der »Walfisch«: ein Säugetier, das im Wasser lebt. Spinnen fressen an Land. Sie sind mit Waffen aller Art ausgerüstet, um ihre Nahrung zu fangen, seien es Netze oder Gifte. Was bringt eine Spinne dazu, sich eine Luftblase anzulegen und unter Wasser zu jagen? Dort kann sie schließlich leicht von Fischen gefressen werden.
Ein in Deutschland beheimatetes, gefährliches Spinnentier ist der Dornfinger (Cheiracanthium). Dieses Mikrobiest baut kein Netz, sondern jagt seine Beute des Nachts. Sein Biss verursacht beim Menschen Schüttelfrost, Erbrechen und Kreislaufversagen.
Was soll die Aufzählung von Spinnen? Mir geht’s um ihr unterschiedliches Verhalten und ihre verschiedenen Waffensysteme, die allesamt im Lauf der Evolution entstanden sind – sagt die Theorie. Schließlich entdeckte Charles Darwin (1809 –1882) schon vor über 150 Jahren die Vielfalt der Arten und postulierte die Idee der »geografischen Variationen«. 2 Alles hat gemeinsame Vorfahren, entwickelt sich aber von Ort zu Ort anders.
Von der Schwarzen Witwe (Latrodectus tredecimguttatus) existieren unterschiedliche Formen in Europa sowie in Nord- und Südamerika. [Bild 7] Alle können für den Menschen tödlich sein. Zudem fressen viele weibliche Schwarze Witwen ihre Männchen nach dem Geschlechtsakt auf. Als Dank für die Befruchtung? Mit ihrem Gift töten sie nicht nur Käfer, sondern sogar Eidechsen. Achtung: Schwarze Witwen fühlen sich unter Brettern im Bereich von Baustellen wohl, doch auch an der Unterseite von Toilettenbrillen. Immerhin sorgte die Evolution für ein Warnsignal: Die Schwarzen Witwen tragen dreizehn feuerrote Punkte auf ihrem dunklen Körper. Damit signalisiert das Tierchen: Ich bin gefährlich! Nicht anfassen! Das meinen jedenfalls die Theoretiker. Weshalb aber trägt die tödliche Brasilianische Wanderspinne (Phoneutria nigriventer) dieses Warnsignal nicht auch?
Bild 7
© Wikimedia Commons
Als gefährlichste Giftspinne der USA gilt die Braune Einsiedlerspinne (Loxosceles reclusa). Kurioserweise verfügt dieses Tierchen nur über sechs Augen – im Gegensatz zu den acht der üblichen Spinnen. Gab sich die Evolution mit sechs Augen zufrieden? Wären acht nicht »umsichtiger« gewesen? Und dann die Brasilianische Wanderspinne (Phoneutria nigriventer). Sie zählt zu den tödlichsten Tieren der Welt. Ihr Gift ist zwanzigmal stärker als dasjenige der Schwarzen Witwe. Die Spinne kann sehr aggressiv sein und ihre Opfer mit einem Sprung angreifen. Beim Menschen führt ihr Biss zur Lähmung der Muskeln. Wie bei einem Schlangenbiss setzen die Herz- und Lungenmuskeln aus. Ein grauenvoller Tod ist die Folge.
Es ist nicht nur die unterschiedliche Giftmischung der Kreaturen, die zu Fragen berechtigt, es sind nicht nur ihre Jagdmethoden, ihr Missbrauch von fremden Tieren als Brutstätte – sondern auch ihre oft unsagbare Entstehungsart. Schmetterlinge sind ein Schulbeispiel dafür, darunter der Atlasspinner (Attacus atlas), ein Falter mit einer Flügelspannweite von bis zu 30 Zentimetern. [Bild 8] Wie die meisten Insekten besitzt der Atlasspinner Facettenaugen, die ihrerseits aus rund 8000 kleineren Äuglein bestehen. Dazu kommen noch zwei größere Einzelaugen. Seine Fühler sind leicht gespreizt. Damit riecht das Männchen ein Weibchen auf größere Distanzen. Dies ist auch dringend notwendig, denn der Atlasspinner ist auf Nachwuchs aus – er lebt nämlich nur wenige Tage und nimmt während seines ganzen Lebens keine Nahrung auf. Wie seine Artgenossen entsteht ein Schmetterling nicht einfach durch eine wie auch immer geartete »Geburt«. Vor seinem kurzen Schmetterlingsleben muss er vier Entwicklungsstadien durchlaufen: Ei – Raupe – Puppe – Falter. Und damit wird es evolutionstheoretisch sehr verwirrend.
Bild 8
© Wikimedia Commons
Aus dem Schmetterlings-Ei entsteht eine Raupe, und die ist das eigentliche Fressorgan des späteren Schmetterlings. Diese Raupe besteht aus vierzehn gleichmäßig aneinandergereihten Segmenten mit einem Kopf an der Spitze. Nach dem Schlüpfen fressen die Raupen zuerst ihre eigene Schale, später Samen, Nadeln und Blätter verschiedener Pflanzen. Raupen sind geradezu fressgierig. Einige Raupenarten machen es anders: Sie leben friedlich mit Ameisen zusammen. Bestimmte Raupen sondern eine zuckerhaltige Flüssigkeit ab, die die Ameisen anlockt. Die klettern auf die Raupe – nicht um sie zu töten oder mit ihrer Säure in die Flucht zu schlagen, sondern um an die süße Nahrung zu kommen. Schließlich schleppen die Ameisen die Raupe in ihren Bau. Dort nimmt diese den Geruch der Ameisen an. Jetzt lässt sie sich von den Ameisen füttern und produziert gleichzeitig ihren süßen Saft. Schließlich verpuppt sich das Raupentier im Ameisenbau. Dazu bugsieren die Ameisen ihren Gast in eine kleine Nische und beschützen ihn vor räuberischen Artgenossen.
Diese Puppen – übrigens die aller Insekten, nicht nur der Schmetterlinge – enthalten ein im Sinne des Wortes »wunderbares« genetisches Programm. Die Zellen der Puppe verwandeln sich total. Ein körperlicher Neuordnungsprozess läuft ab. Bei der Puppe existierten weder Beine noch Flügel, geschweige denn Augen oder Geschlechtsorgane. Um zum Schmetterling zu werden, muss ein vollkommen neuer Körper entstehen. Die gesamte Gestalt des Tieres muss sich ändern. Es wachsen 8000 kleinere Äuglein (die Facettenaugen) mitsamt den zwei separaten Augen, alle früheren Strukturen der Raupe verschwinden. Schließlich schlüpft eine neue Lebensform: der Schmetterling.
In verschiedenen Kulturen der Antike galt der Schmetterling als Symbol der Wiedergeburt, und Künstler der Christenwelt erkannten in ihm die Kraft der Auferstehung. Die Seele, die den Leichnam verlässt, wurde als Schmetterling gezeigt. Ganz offensichtlich praktizierten weise Männer schon vor Jahrtausenden ein naturwissenschaftliches Denken. Sie hatten lange Zeit beobachtet, was da geschah und wie sich aus einem Ei eine Raupe bildete und diese über den Prozess der Verpuppung zum Schmetterling wurde. Doch sie konnten nichts von Genetik wissen und sich deshalb die Fragen unserer Zeit nicht stellen: Jedes Programm zum Aufbau einer Lebensform hat seinen Ursprung in der Zelle – und in dieser Zelle steckt der berühmte DNS-Code, die Doppelspirale der Desoxyribonukleinsäure. Sie ist die Trägerin der Erbinformation. Ohne DNS geschieht in der Zelle nichts. (Ich werde darauf zurückkommen.) Doch woher soll die Information stammen, die aus der Puppe einen komplett neuen Körper entstehen lässt? Und: Diese Information muss bereits im Ei existiert haben. Was bringt »die Evolution« dazu, mittels eines derart komplizierten Weges eine Lebensform wie einen Schmetterling entstehen zu lassen, ein Tierchen zudem, das gerade einmal einige Tage lebt, ohne etwas zu fressen? Dass sich bestimmte Puppen von Ameisen füttern lassen, mag erklärbar sein. Es ergab sich eben so. Doch der genetische Ablauf, der aus einem Ei zuerst eine Raupe, dann eine Puppe und aus ihr ein völlig neues Lebewesen entstehen lässt, ist evolutionstheoretisch schwer unter einen Hut zu bringen beziehungsweise erklärbar. Die Information beim »Ablesen« des DNS-Stranges in der Zelle enthält auch »Stop and go«-Befehle. Wann – im zeitlichen Ablauf – wird die nächste Häutung der Puppe freigegeben? Wann entsteht die grobe Flügelform, wann entstehen die gelblichen Flügelspitzen, wann die leicht gefächerten Fühler? Wann wachsen die Mundwerkzeuge? Wann die Beine und die 8000 Äuglein? Wann die Sinnesorgane? (Schmetterlinge haben nicht nur Augen, sondern auch Ohren.)
Die Botschaft der Gene muss nicht nur in der richtigen Reihenfolge »abgelesen« werden, sondern auch zum exakten Zeitpunkt erfolgen, ansonsten entstehen Missbildungen. So sind beispielsweise mehrere Arten der Ölkäfer (Meloidae) trotz ihrer Flügel unfähig zu fliegen. Die Flügelchen sind zu kurz geraten. Das Stopp-Signal für das Wachstum erfolgte offensichtlich zu früh. Ölkäfer verdanken ihren Namen übrigens einer ölartigen Flüssigkeit, die an den Poren der Beingelenke des Tierchens austritt. Diese Flüssigkeit wirkt als Abwehrstoff gegen Ameisen und anderes Getier. Und wie bei den Schmetterlingen durchlaufen auch die Ölkäfer vor ihrer Geburt mehrere Metamorphosen. Ihre Larven entwickeln sich in den Nestern von bestimmten Bienenarten wie Sand- oder Pelzbienen. Aus der Larve entsteht eine Puppe und daneben – es ist nicht zu fassen (!) – eine leere Scheinpuppe. Aus der Häutung der echten Puppe kriecht schließlich ein neuer Ölkäfer. Und all dies hat – man sieht es ja! – »die Evolution« so arrangiert.