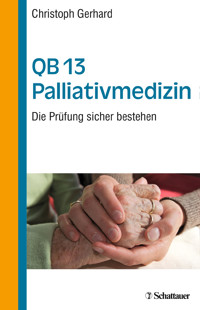47,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das interdisziplinär angelegte Praxishandbuch zur palliativen Versorgung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen bietet eine personzentrierte und ressourcenorientierte Perspektive auf die Patient*innen und zielt darauf, deren Lebensqualität und -sinn am Ende des Lebens zu fördern und zu erhalten erläutert das Grundverständnis der Palliative Care im Kontext der Versorgung neurologischer Patient*innen beschreibt, wie Symptome neurologisch beeinträchtigter Menschen systematisch erfasst und spezifisch behandelt werden können zeigt, wie die Teammitglieder mit kommunikationsbeeinträchtigten, verwirrten und bewusstseinsgestörten Menschen kommunizieren können stellt konkrete Behandlungsmöglichkeiten bei Agitation, Delir, Fatigue, Muskeltonuserhöhung, gastrointestinalen und pulmonalen Symptomen sowie Schmerzen und Schlafstörungen vor zeigt neuro-palliative Besonderheiten von Erkrankungen der Muskulatur und des peripheren Nervensystems sowie von ALS, Demenz, MS, Muskelerkrankungen, Parkinson, Schlaganfall und (wach-)komatösen Zuständen auf beschreibt ethisch schwierige Entscheidungssituationen und zeigt Möglichkeiten, um diese zu analysieren und einvernehmlich zu lösen stellt mit zahlreichen Fallbeispielen enge Bezüge zur Praxis her. Die 2. Auflage berücksichtigt aktuelle AWMF-Leitlinien aus der Palliativmedizin und Neurologie. Der Autor bietet neue Beiträge zu Advance Care Planning (ACP), Todeswunsch, Suizidbeihilfe und Sterbefasten sowie Multisystematrophien. Im Anhang finden sich zusätzliche ACP-Dokumentationsbögen und ein Modell zur ethischen Fallbesprechung (KRISE). Rezensionen Geniales Lehrbuch zu Palliativmedizin insbesondere zu den Bedürfnissen neurologischer Patienten. Matthias Thöns, Amazon
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Christoph Gerhard
Neuro-Palliative Care
Interdisziplinäres Praxishandbuch zur palliativen Versorgung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Neuro-Palliative Care
Christoph Gerhard
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
André Fringer, Winterthur; Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld; Christine Sowinski, Köln; Angelika Zegelin, Dortmund
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Palliative Care:
Christoph Gerhard, Dinslaken; Markus Feuz, Zürich
Dr. med. Christoph Gerhard. Arzt für Neurologie, Palliativmedizin und spezielle Schmerztherapie, Master und Trainer Palliative Care, Wissenschaftlicher Leiter der Niederrheinischen Akademie und der SAPV Niederrhein in Dinslaken, Hochschuldozent in Münster, Zürich und an der schweizerischen Hochschule für Gesundheit. Ehemaliger Chefarzt der Palliativmedizin am Katholischen Klinikum Oberhausen, Weiterbildungsbefugter für Palliativmedizin der Ärztekammer Nordrhein und Kursleiter der DGP.
Krengelstr. 50; DE-46539 Dinslaken
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
z. Hd. Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg, Martina Kasper, Allissa Leuthold
Redaktionelle Bearbeitung: Thomas Sonntag
Herstellung: Daniel Berger, René Tschirren
Gedichte: Dr. med. Johannes Aufgebauer
Umschlagabbildung: Getty Images
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Illustration/Fotos (Innenteil): Jürgen Georg, Schüpfen
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Format: EPUB
1. Auflage 2024
© 2024 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96270-2)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76270-8)
ISBN 978-3-456-86270-5
https://doi.org/10.1024/86270-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Widmung
Für Bettina Kraft-Gerhard,
von der ich so viel Achtsamkeit erfahren und lernen durfte.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
1 Palliative Care und Neurologie
1.1 Vorbemerkung
1.2 Palliativversorgung
1.3 Grundlagen der Palliativbetreuung
1.3.1 Geschichte
1.3.2 Was bedeutet Palliativbetreuung?
1.3.3 Heilen oder lindern?
1.4 Die Sichtweise der Neurologie
1.5 Die person-zentrierte Sichtweise
1.6 Unterschiede der Sichtweisen am Beispiel Wachkoma
2 Autonomie und Lebensqualität
2.1 Vorbemerkung
2.2 Palliativbetreuung ab Diagnosestellung
2.3 Aufklärung über die Diagnose
2.4 Vorsorgeplanung
2.4.1 Patientenverfügung
2.4.2 Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
2.4.3 Advance Care Planning
2.4.4 Die Rechtslage in Österreich und der Schweiz
2.4.5 Die Rolle des mutmaßlichen Willens
2.5 Der natürliche Wille
2.6 Integration zu einem Gesamtkonzept
2.7 Andersartigkeit der Kommunikation
2.7.1 Veränderte sprachliche Kommunikation
2.7.2 Bedürfnisse Sprachgestörter erkennen
2.8 Lebensqualität
2.9 Lebenssinn
2.10 Resilienz
2.11 Exkurs: Nahtoderfahrung
2.12 Die Rolle Angehöriger und Zugehöriger
3 Häufige Symptome
3.1 Vorbemerkung
3.2 Schmerz- und Symptomerfassung
3.2.1 Schmerzerfassungsskalen
3.2.1.1 Verbale Rating-Skala
3.2.1.2 Numerische Rating-Skala
3.2.1.3 Visuelle Analogskala
3.2.1.4 Numerische Analogskala
3.2.1.5 Smiley-Analogskala
3.2.1.6 Mehrdimensionale Skalen
3.2.2 Schmerzerfassung bei kognitiv Beeinträchtigten
3.2.2.1 Die ZOPA-Skala
3.2.2.2 Koma und Wachkoma
3.2.2.3 Demenz
3.2.2.4 Parkinson-Krankheit
3.2.2.5 Pseudobulbärparalyse
3.2.2.6 Sprachstörungen
3.2.2.7 Gesamtkonzept
3.2.2.8 Grenzen
3.3 Schmerztherapie
3.3.1 Schmerzarten
3.3.2 Schmerzursachen
3.3.3 Prinzipien der Schmerztherapie
3.3.4 Nichtopioide
3.3.4.1 Nichtsaure fiebersenkende Analgetika
3.3.4.2 Nichtsteroidale Antirheumatika
3.3.5 Opioide
3.3.5.1 Nebenwirkungen
3.3.5.2 Schwach potente Opioide
3.3.5.3 Stark potente Opioide
3.3.5.4 Opioid-Eindosierung und -Rotation
3.3.6 Koanalgetika
3.3.6.1 Antidepressiva
3.3.6.2 Antikonvulsiva
3.3.6.3 Kortisonpräparate
3.3.6.4 Invasive Verfahren
3.3.7 Problemfall „Incident Pain“
3.3.8 Nichtmedikamentöse Schmerztherapien
3.4 Lähmungen
3.4.1 Hilfsmittel
3.4.2 Querschnittlähmungen
3.5 Spastik
3.6 Sensibilitätsstörungen
3.7 Koordinationsstörungen
3.8 Depressionen
3.9 Verwirrtheit und Delir
3.10 Epileptische Anfälle
3.10.1 Diagnostik
3.10.2 Therapie
3.11 Koma und Wachkoma
3.12 Atemnot
3.12.1 Ursachen
3.12.2 Diagnostik
3.12.3 Therapie
3.13 Terminales Lungenrasseln
3.14 Übelkeit und Erbrechen
3.14.1 Ursachen
3.14.2 Erfassen und Messen
3.14.3 Therapie
3.14.3.1 Medikamente gegen Übelkeit
3.14.3.2 Das Stufenschema
3.14.3.3 Nichtmedikamentöse Maßnahmen
3.15 Obstipation
3.15.1 Definition
3.15.2 Ursachen
3.15.3 Erfassung
3.15.4 Therapie
3.15.4.1 Nichtmedikamentöse Maßnahmen
3.15.4.2 Medikamentöse Maßnahmen
3.15.4.3 Stufenschemata
3.15.4.4 Alternative Maßnahmen
3.16 Fatigue
3.17 Durst, Mundtrockenheit und spezielle Mundpflege
3.17.1 Ursachen
3.17.2 Prophylaxe, Mundpflege
3.18 Flüssigkeit und Ernährung
3.18.1 Schluckstörungen und Ernährung
3.18.2 Wann sind Flüssigkeitsgaben sinnvoll?
3.18.3 Die subkutane Infusion
3.18.4 Vorteile der Dehydratation
3.18.5 Flüssigkeit und Ernährung am Lebensende
3.18.6 PEG-Anlage ja oder nein?
3.18.6.1 PEG bei fortgeschrittener Demenz
3.18.6.2 PEG und amyotrophe Lateralsklerose
3.18.6.3 PEG und schwerer Schlaganfall
3.18.6.4 PEG ja oder nein – eine ethische Frage?
3.19 Blasenstörungen
3.19.1 Detrusorhyperaktivität
3.19.2 Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie
3.19.3 Hypokontraktiler Detrusor
3.20 Sexualität
3.20.1 Auswirkungen neurologischer Erkrankungen
3.20.2 Das PLISSIT-Modell
3.21 Juckreiz
3.21.1 Ursachen
3.21.2 Anamnese
3.21.3 Therapie
3.22 Schwindel
3.23 Schlafstörungen
3.23.1 Epidemiologie, Diagnostik und Therapie
3.23.2 Unruhige Beine – Restless-Legs-Syndrom
3.23.2.1 Symptomatik
3.23.2.2 Diagnostik
3.23.2.3 Therapie
3.24 Palliative Sedierung
3.25 Die Sterbephase
4 Ethische Fragen in der Neuro-Palliative Care
4.1 Vorbemerkung
4.2 Gewissen, Moral und Ethik
4.3 Mittlere Prinzipien nach Beauchamp und Childress
4.3.1 Respekt vor der Autonomie
4.3.2 Nutzen (Benefizienz)
4.3.3 Schaden vermeiden (Non-Malefizienz)
4.3.4 Gerechtigkeit
4.4 Philosophische Ethik
4.4.1 Die Deontologie
4.4.2 Der Utilitarismus
4.5 Ethik als Schutzbereich
4.6 Kasuistik
4.7 Ethik organisieren
4.7.1 Die ethische Fallbesprechung
4.7.2 Das Nijmegener Modell der ethischen Fallbesprechung
4.7.3 Das Modell von Rabe
4.7.4 MEFES
4.7.5 Ethikberatung nach E. H. Loewy
4.7.6 Prinzipienorientiertes Modell nach Marckmann
4.7.7 Das autonomiezentrierte Modell KRISE
4.7.8 Ethik im Alltag
4.7.9 Die Four-Topic-Methode von Jonsen
4.8 Sterbehilfe
4.9 Suizidbeihilfe
4.10 Freiwilliger Verzicht auf Flüssigkeit und Nahrung
4.11 Abstellen eines Beatmungsgeräts
5 Typische Krankheitsbilder in der Neuro-Palliative Care
5.1 Vorbemerkung
5.2 Amyotrophe Lateralsklerose
5.3 Demenz
5.4 Hirntumore
5.5 Multiple Sklerose
5.6 Parkinson-Krankheit
5.7 Atypische Parkinsonsyndrome und Chorea
5.7.1 Multisystematrophien
5.7.2 Progressive supranukleäre Blickparese
5.7.3 Kortikobasale Degeneration
5.7.4 Chorea Huntington
5.8 Schlaganfall
5.9 Wachkoma
6 Ausblick
7 Anhang
7.1 Organisation der Sterbebegleitung – Checkliste
7.2 Modell zur strukturierten Betreuung sterbender neurologischer Patienten
7.3 Dokumentationsbogen zum Advance Care Planning (erstellt vom Autor)
7.4 Modell KRISE der ethischen Fallbesprechung
7.5 Lösungen der Übungsaufgaben
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Weiterführende Literatur
Autorenverzeichnis
Palliative Care im Verlag Hogrefe
Sachwortverzeichnis
|11|Vorwort zur 2. Auflage
Seit der ersten Auflage sind nun mehr als zehn Jahre vergangen und es hat sich viel getan in der Neuro-Palliative Care. Wesentliche Strukturen der ambulanten Palliativversorgung wurden ausgebaut und versorgen nun auch zunehmend neurologisch erkrankte Menschen. Im stationären Bereich sind weitere Palliativstationen mit neurologischem Schwerpunkt (bis hin zur Station Neuro-Palliative Care an der Charité Berlin) gegründet worden. Neue Konzepte und Regelungen zu Themen, die für die Neuro-Palliative Care wichtig sind, wurden in der Zwischenzeit implementiert, so das Advance Care Planning oder neue Betrachtungen zu Todeswünschen und Suizidbeihilfe. Daher war es notwendig, komplett neue Kapitel zu diesen wichtigen Themenstellungen zu schreiben. Ebenso wurde das Werk um ein neues Kapitel zu atypischen Parkinsonsyndromen ergänzt, da zunehmend Menschen mit diesen Erkrankungen und deren Zugehörige palliativ versorgt werden. Die Evidenz zu palliativen Vorgehensweisen hat seit der ersten Auflage stark zugenommen. Mittlerweile gibt es Leitlinien zur Palliativmedizin auf S3-Niveau und sogar eine Leitlinie auf S2k-Niveau zur Palliativversorgung neurologischer Erkrankungen der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Diese erfreulichen, aktualisierten, evidenzbasierten Zusammenfassungen wurden in diese 2. Auflage eingepflegt, sodass das Buch und die entsprechenden Kapitel leitliniengerecht überarbeitet sind. Die Inhalte zu neurologischen Erkrankungen und deren Therapie wurden anhand der aktuellsten Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie auf den neuesten Stand gebracht. Durch entsprechende Kürzungen ist es gelungen, dass das Buch dennoch kaum an Umfang zugenommen hat und damit lesbar bleibt. Zur praktischen Handhabbarkeit wurden Dokumentationsbögen zum Advance Care Planning und zu einem eigens für die Palliativversorgung entwickelten Modell der ethischen Fallbesprechung (KRISE) in den Anhang genommen.
Der Autor dankt seinen zahlreichen Mitarbeitern und Weggefährten in der Abteilung für Palliativmedizin am Katholischen Klinikum Oberhausen, die er aufgebaut und bis 2020 chefärztlich geleitet hat, am Lehrbereich Palliativmedizin der Universität Essen, dem er bis 2021 vorstand, und an der Niederrheinischen Akademie sowie der SAPV Niederrhein, deren wissenschaftlicher Leiter er aktuell ist. Am allerwichtigsten waren in der Zeit der umfangreichen Überarbeitung des Werks jedoch die „besten“ Lehrer, nämlich die Patienten, ihre Zugehörigen und die zahllosen Menschen, die an den Weiterbildungskursen des Autors teilgenommen haben.
Auch in der zweiten Auflage wird aus Gründen der Lesbarkeit in der Regel die männliche Form bei Berufs-, Funktions- oder Rollenbezeichnungen verwendet. Die Angaben beziehen sich jedoch jeweils auf Angehörige aller Geschlechter.
Dinslaken, im Januar 2024
|13|Vorwort zur 1. Auflage
Es gibt mittlerweile zahlreiche Bücher zur Palliative Care. Diese Entwicklung ist sehr positiv, zeigt sie doch, in welchem Umfang sich dieses wichtige Gebiet immer weiter implementiert, organisiert und etabliert. Manche dieser Palliativlehrbücher enthalten auch kürzere Kapitel zur Palliativbetreuung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen. So findet sich in einigen Palliativlehrbüchern z. B. ein Kapitel über die palliative Versorgung von Menschen mit amyotropher Lateralsklerose. Ist angesichts dieser Situation wirklich ein eigenes Buch über die Palliativversorgung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen erforderlich? Können die Prinzipien der Palliativbetreuung, wie sie an Tumorpatienten [Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text in der Regel die männliche Form gewählt. Die Angaben beziehen sich jedoch jeweils auf Angehörige beider Geschlechter] entwickelt wurden, nicht einfach auf den „neurologischen Palliativpatienten“ übertragen werden?
Es gibt verschiedene Gründe für ein eigenes Buch zur Neuro-Palliative Care, der palliativen Versorgung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen. Die für Tumorpatienten entworfenen Prinzipien der Palliativbetreuung gehen davon aus, dass der Betroffene über seine Symptome sehr genau berichten und sie auf einer Symptomskala selbst einschätzen kann. Sie setzen außerdem in der Regel voraus, dass zusammen mit dem Betroffenen auf einer intellektuell mitunter anspruchsvollen sprachlichen Ebene seine psychosozialen und spirituellen Dimensionen bearbeitet werden können. Fortgeschritten neurologisch Erkrankte leiden häufig an kognitiven, sprachlichen und/oder neuropsychologischen Einschränkungen, die sie in ihrer Kommunikation verändern. Außerdem haben sie meist ein hohes Maß an körperlichen Einschränkungen, Lähmungen, Koordinations- und Sehstörungen, die in diesem Ausmaß bei Tumorpatienten allenfalls im Endstadium ihrer Erkrankung auftreten. Viele neurologische „Palliativpatienten“ sind von diesen Veränderungen der Kommunikation und Beweglichkeit lange Zeit gezeichnet. Es müssen daher andere, teilweise neue Wege in der Erfassung von Schmerzen und Symptomen, der Kommunikation und Begleitung beschritten werden. Der Versuch, Symptome zu erfassen, stellt sich oft wesentlich schwieriger dar. Es ist wie Spurenlesen im Sprachdschungel, wenn man versucht, die wenigen Worte, die ein Mensch mit einer Schädigung im Sprachzentrum äußern kann, zu entschlüsseln. Es ist ein extrem schwieriges und missverständnisreiches Interpretieren der Informationen, die bei einem bewusstlosen Menschen im körpernahen Dialog, etwa mittels der Basalen Stimulation, gewonnen werden. Oft müssen stellvertretende Entscheidungen getroffen werden, da der bewusstseinsgeminderte und/oder in der Kommunikation eingeschränkte Betroffene Stellvertreter braucht, die seinen Willen möglichst gut durchsetzen können. Was ist aber zu tun, wenn der gemutmaßte Wille, wie wir ihn anhand früherer Äußerungen oder Verfügungen rekonstruieren, den aktuellen körpersprachlichen Äußerungen widerspricht? Was zählt nun, der veraltete mutmaßliche oder der ungenaue und vielleicht falsch interpretierte aktuelle Wille? Zählt die gut geschriebene vor|14|letzte oder die aktuelle Auflage des Buches „Patientenwille“, auch wenn letztere aus vielen fast leeren Blättern besteht? Sie sehen, dass Fragen der Ethik in der palliativen Versorgung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen eine ganz besondere Rolle spielen. Hier gilt es Modelle der Ethikberatung und Gesprächsführung zu nutzen, um die Situation zu verbessern.
Für die Angehörigen und das gesamte Umfeld neurologischer Palliativpatienten ergibt sich eine ganz besonders schwierige Situation. Wie schwer es einerseits fallen kann, neurologisch Erkrankte in Extremsituationen zu begleiten, wie viel Lebenssinn die Betroffenen andererseits trotz der schweren Erkrankung haben können, zeigen ergreifende literarische und verfilmte Berichte, wie der Bestseller von Mitch Albom, „Dienstags bei Morrie“, über ein Leben mit fortgeschrittener amyotropher Lateralsklerose oder das ergreifende Zeugnis eines Lebens im Locked-in-Syndrom (eingeschlossen im eigenen Körper) des französischen Modejournalisten Jean-Dominique Bauby mit dem Titel „Schmetterling und Taucherglocke“. Spektakuläre Kontroversen, z. B. um das Leben im Wachkoma von Terri Schiavo in den USA, zeigen, wie Schicksale neurologischer Palliativpatienten ganze Kulturen bis hin zu Stellungnahmen des Vatikans und des Weißen Hauses in Washington beschäftigen.
Nun beschäftigt sich die Neurologie heute bereits in erheblichem Umfang mit der symptomlindernden Therapie. Ist es da wirklich notwendig, den neuen palliativen Ansatz hier zu implementieren, wo doch schon so viel Wissen vorhanden ist? Palliative Care geht mit einer anderen und umfassenderen Haltung an die Situation heran. Entsprechend dem palliativen Paradigma der radikalen Patientenorientierung müssen diese in der Neurologie implementierten symptombehandelnden Maßnahmen in ihrer Zielrichtung radikal an der Lebensqualität des betroffenen Menschen ausgerichtet werden. Wenn ein Parkinson-Betroffener z. B. einen minimalen Rigor, den der behandelnde Arzt und das Pflege- bzw. Physiotherapeutenteam gar nicht erfassen können, als schmerzhaft und störend empfindet, sollte er durch eine Dosiserhöhung der Parkinson-Medikamente behandelt werden. Oder wenn ein Betroffener seine spastische Muskeltonuserhöhung förderlich findet, weil sie ihm in seinen Bewegungen Stabilität gibt, muss die Dosis reduziert und so an seine individuellen Wünsche angepasst werden. Das palliative Paradigma, dass Schmerz das ist, was der Betroffene als Schmerz empfindet, muss auf diese anderen Symptome übertragen werden und das ist ein Paradigmenwechsel! Da viele neurologisch Kranke unter Veränderungen der kognitiven und sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten leiden, ist eine suchende Haltung notwendig. Trotz erschwerter oder unmöglicher sprachlicher Kommunikation muss dennoch nach möglichen Symptomen und deren Auswirkungen, nach Wünschen und Bedürfnissen gesucht werden, so schwer und vieldeutig das auch sein mag. Außerdem kommt die multidimensionale Sichtweise der Palliative Care, wie sie im Total-Pain-Modell von Cicely Saunders exemplarisch dargestellt wurde, zum Einsatz. Danach gibt es nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische, soziale und spirituelle Ebene, auf der der Betroffene bestmöglich versorgt werden muss.
Zur Palliativversorgung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen bedarf es daher sowohl einer sehr ausgeprägten palliativen Haltung und Expertise als auch guter neurologischer Kenntnisse. Nach Überzeugung des Autors kann diese Aufgabe daher nur von einem palliativen Team gemeinsam mit einem neurologischen Team geleistet werden. Deshalb sind Modelle der Vernetzung, Organisationsentwicklung, palliativen Beratung, des Case Managements zur Koordination der verschiedenen Behandler vonnöten.
Der Autor selbst arbeitet in einer Doppelrolle sowohl als Neurologe als auch als Palliativspezialist an einem Allgemeinkrankenhaus. An diesem Schnittpunkt engagiert er sich, die Aktivitäten des Palliativkonsiliarteams und des |15|neurologischen Behandlungsteams zu koordinieren. Er ist in ein Palliativnetzwerk, an dem neben Krankenhäusern auch zahlreiche ambulante Strukturen und Heime teilnehmen, eingebunden. Er arbeitet dort daran, die palliativen Bedürfnisse von Menschen mit neurologischen Erkrankungen in unterschiedlichen Versorgungsstrukturen zu begreifen und zu vernetzen. Im Rahmen von Palliativkursen und hausinternen Schulungen begegnet er ebenso wie in der Arbeitsgruppe Palliativmedizin für Nichttumorpatienten der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin professionell tätigen Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen und Kontexten. Ziel seiner Arbeit ist es, die palliativen Bedürfnisse der Betroffenen, wie sie sich in unterschiedlicher Weise in diesen verschiedenen Kontexten zeigen, möglichst intensiv wahrzunehmen und zu versorgen.
Der Autor dankt allen Weggefährten, Mitstreitern, Freunden, Patienten, Angehörigen, den Kursteilnehmern der zahlreichen Palliativkurse, Mitarbeitern und Studenten, ohne die dieses Buch nicht möglich gewesen wäre. Allen voran sei das Zentrum für Palliativmedizin in Bonn, namentlich Martina Kern, Monika Müller und Prof. Dr. Friedemann Nauck genannt, bei denen der Autor in Kursen zur Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, zum Master Palliative Care und zum Trainer bzw. Kursleiter Palliative Care so viel lernen durfte. Meinen Mitarbeitern im Palliativkonsiliardienst in Oberhausen, insbesondere Anna Baagt, Berthold Boenig, Manuela Galgan, Friedhelm Gores, Monja Mika, meinem Chef, Herrn Privatdozent Dr. Christoph W. Zimmermann, meinen Kollegen und Mitarbeitern in der Neurologie in Oberhausen und den Mitstreitern im Palliativnetz Oberhausen, insbesondere Michal Etges sowie den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Nichttumorpatienten der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, danke ich für die hervorragende Zusammenarbeit sowohl im Feld der Palliative Care als auch der Neurologie und für viele Projekte, die mit ihnen und durch sie erst möglich wurden.
Der Autor dankt in ganz besonderer Weise Herrn Jürgen Georg vom Hans Huber Verlag in Bern, der ihn stets unterstützt hat, selbst das seltenste Buch zu diesem bisher wenig bearbeiteten Feld aus anderen Ländern besorgte, ihm immer wieder neue Anregungen gab und stets Vertrauen in den Autor hatte. Herr Georg ist einfach der ideale Ansprechpartner in einem Verlag.
Dieses Buch wurde für einen breiten Leserkreis geschrieben. Es ist bewusst so abgefasst, dass auch der neurologisch Nichtversierte oder derjenige, der nicht mit dem palliativen Vokabular vertraut ist, es lesen kann. Dennoch soll auch der Spezialist auf seine Kosten kommen, was durch den inhaltlichen Umfang und die detaillierte Herangehensweise gefördert wird. Das Buch richtet sich an alle mit der Palliativversorgung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen Betraute, d. h. professionell Pflegende, Ärzte, Physiotherapeuten, Sprachtherapeuten, Sozialarbeiter oder Seelsorger aus dem neurologischen und palliativen Kontext, aber auch an interessierte Laien, Betroffene und Angehörige. Der Autor versucht anhand zahlreicher Fallvignetten das theoretisch Abgehandelte für dieses breite Publikum verstehbar zu machen und den Transfer in die eigene Praxis zu erleichtern. Er hat versucht, jegliches Fachvokabular sofort zu übersetzen, was der professionell Tätige oft überlesen kann. Er dankt seinen Patienten und deren Angehörigen, den Betroffenen in den Selbsthilfegruppen, bei Patientenveranstaltungen und öffentlichen Vorträgen, die ihn immer wieder an der Basis des bedürftigen Menschen, dem, was „eigentlich wesentlich“ ist, verortet und ihm so dieses Vorhaben ermöglicht haben.
Die Abschnitte werden jeweils eingeleitet durch ein Gedicht von Herrn Dr. med. Johannes Aufgebauer. Herr Dr. Aufgebauer ist Hausarzt und Palliativmediziner im Bergischen Land. Er hat in der vom Autor geleiteten Palliativkursreihe der Ärztekammer Nordrhein die Ausbildung zum Palliativmediziner absolviert und schrieb in der Auseinandersetzung mit dem Themen|16|feld diese sehr schönen Gedichte. Ihm sei herzlich gedankt dafür, dass er mir gestattete, sie in diesem Rahmen als Zeugnis palliativer Arbeit zu veröffentlichen.
Oberhausen, im April 2011
Christoph Gerhard
|18|
leidlinie
ich geb dir ein stück
meiner zerhackten zeit.
ich könnte die zukunft dir röntgen,
doch was soll uns das helfen?
ich hab in der tasche das starke zeug,
aber kram nach dem balsam.
das stachlige gespräch ist lang her.
heut kann ich dich kaum hören.
siehst du etwas im rückspiegel?
drückt dich das dunkel der nacht?
ich geb dir ein stück
meiner zerhackten zeit
oder brauchst du heut zwei?
j. aufgebauer
|19|1 Palliative Care und Neurologie
In diesem Kapitel werden zunächst die Besonderheiten fortgeschritten neurologisch Erkrankter betrachtet, um dann die Grundlagen der Palliative Care anhand ihrer Geschichte zu erörtern. Anschließend wird betrachtet, unter welcher Sichtweise derzeit überwiegend Neurologie betrieben wird. Zum Abschluss wird gezeigt, wie diese unterschiedlichen Herangehensweisen integriert werden können.
1.1 Vorbemerkung
Lässt sich Palliative Care auf neurologische Erkrankungen anwenden? Schauen wir auf die Palliative-Care-Definitionen der WHO oder der Europäischen Palliativgesellschaft (EAPC), so lesen wir, dass es in der Palliative Care um die angemessene Versorgung von Patienten mit fortgeschrittenen und progredienten Erkrankungen geht, die eine begrenzte Lebenserwartung haben (Radbruch et al., 2011). Wie wir sehen, wird in dieser Definition nichts über die Begrenzung der Palliativversorgung, vor allem auf Tumorpatienten, wie wir sie derzeit erleben, ausgesagt. Schauen wir uns nämlich unsere palliativen Strukturen in Deutschland an, so werden in Hospizen und Palliativstationen noch immer größtenteils Tumorpatienten versorgt. Zwar hat in den Teams der Palliativversorgung ein Umdenken eingesetzt, sodass sich das Tätigkeitsfeld der Palliativmedizin insbesondere in den ambulanten Strukturen seit der 1. Auflage dieses Werks immer mehr für unterschiedlichste Patientengruppen öffnete. Die Situation ist aber in Deutschland ausgesprochen heterogen (Bertelsmann Stiftung, 2015). Woran liegt diese Konzentration auf Tumorerkrankte, die immer noch vielerorts besteht? Erfüllen die Gruppen der Nichttumorpatienten, etwa diejenigen mit neurologischen Erkrankungen, in geringerem Maße die Kriterien der Palliativversorgung, wie sie oben gezeigt wurden? Im Gegenteil: Menschen mit fortschreitender oder fortgeschrittener neurologischer Erkrankung erfüllen diese Kriterien in vollem Umfang! Sie leiden nämlich an einer fortgeschrittenen und progredienten Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung. Wir können uns dies an einer Patientin mit fortgeschrittener Multipler Sklerose gut verdeutlichen (Fallbeispiel 1-1).
Fallbeispiel 1-1
Frau Reiners ist 64 Jahre alt und leidet seit 40 Jahren an Multipler Sklerose. Zu Beginn der Erkrankung hatte sie vor allem Krankheitsschübe mit Lähmungserscheinungen, Seh- oder Koordinationsstörungen. In den letzten 20 Jahren hatte sie keine Schübe mehr, sondern die Ausfälle schritten allmählich fort. Jetzt ist sie erheblich an Armen und Beinen gelähmt, hat Sehstörungen und liegt im Bett oder sitzt im Rollstuhl. Sie leidet an ausgeprägten Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Gespräche mit ihr sind nur noch über einfachste Inhalte möglich. Auf Grund der Lähmungen mit Steifheit leidet sie an Schmerzen am ganzen Körper, die sie aber schlecht mitteilen kann, da sie sich sehr schlecht ausdrücken kann und zeitweise nicht einmal auf das Wort Schmerz kommt. |20|Sie ist außer Stande, Art und Stärke ihrer Schmerzen in Worte zu fassen. Noch schwieriger wird es, wenn man sie nach anderen belastenden Symptomen fragt. Ihre Krankheitssituation wird zusätzlich erschwert durch ständige Begleiterkrankungen, wie Lungenentzündung und Harnwegsinfekt, und ständig besteht die Gefahr des Wundliegens. Mit 65 Jahren, d. h. nur ein Jahr später, verstirbt sie an einem der vielen, aber diesmal deutlich schwereren Harnwegsinfekte mit Sepsis.
Wir sehen an Fallbeispiel 1-1, in welchem Umfang die Kriterien der Palliative Care nach den oben genannten Definitionen erfüllt sind. Frau Reiners leidet an einer fortschreitenden und inzwischen fortgeschrittenen Erkrankung. Ihre Lebenserwartung ist deutlich begrenzt, denn sie stirbt bereits mit 65 Jahren. Vordergründig leidet sie an Schmerzen und kann dies schlecht mitteilen. Das heißt, Palliativbetreuung muss hier versuchen, Schmerzen auf anderen als den gewohnten Wegen zu erfassen und dann gezielt zu behandeln. Aber vielleicht hat Frau Reiners noch viele andere störende Symptome, die es trotz erschwerter Kommunikation herauszuarbeiten gilt: Vielleicht leidet sie an Spastik (Muskelsteifigkeit), vielleicht hat sie eine chronische Obstipation (Verstopfung), vielleicht gibt es noch weitere Symptome. Es ist notwendig, sich in einer suchenden Haltung so mit Frau Reiners zu beschäftigen und sich ihr dabei anzunähern, dass man ihren Weg trotz ihrer kognitiven Andersartigkeit, mit der chronischen Erkrankung und verkürzten Lebenserwartung umzugehen, aufspüren und unterstützen kann. Ebenso ist es notwendig, sich in der sensiblen Annäherung auf die Bedürfnisse und Sorgen der Angehörigen einzulassen. Vielleicht steht eine wichtige Entscheidung an, etwa die Frage, ob Frau Reiners bei einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation beatmet werden soll oder nicht. Diese Entscheidung kann vermutlich nicht allein von ihr getroffen werden, da sie viele Konsequenzen dieser Entscheidung nicht absehen und wichtige Fragen in diesem Zusammenhang nicht einschätzen kann. Demnach müssen andere stellvertretend für sie mitentscheiden. Für die Beteiligten kann eine ethische Fallbesprechung hilfreich sein, um diese stellvertretende Entscheidung möglichst gut zu treffen.
Betrachten wir Fallbeispiel 1-1 und die vielen Ansatzpunkte bzw. Notwendigkeiten für Palliativbetreuung, so verwundert es zunächst, warum Palliativbetreuung nicht auch stärker Betroffenen mit neurologischen Erkrankungen zugutekommt. Allerdings bemerken wir an Fallbeispiel 1-1 schon viele „Andersartigkeiten“ des neurologischen Palliativpatienten gegenüber dem „klassischen“ Palliativpatienten, d. h. dem Tumorpatienten. Frau Reiners ist schon jahrelang von dieser Problematik betroffen. Sie kann, wie schon angeführt, ihre Symptome kaum mitteilen. Trauer und Umgang mit ihrer Krankheit stellen sich bei ihr ganz anders dar.
Während im ersten Kapitel zunächst die Besonderheiten in der Neuro-Palliative Care in den Fokus gerückt werden, wird in Kapitel 2 die Situation des neurologischen Palliativpatienten unter dem Blickwinkel der Autonomie und Lebensqualität betrachtet. In den dann folgenden Kapiteln werden einige typische Symptome, die in der Palliativbehandlung neurologischer Erkrankungen häufig vorkommen, unabhängig von ihren Ursachen besprochen. Es geht dabei zunächst darum, diese Symptome in ihren verschiedenen Dimensionen wahrzunehmen. Anschließend wird die Behandlung des jeweiligen Symptoms in den verschiedenen Dimensionen beschrieben. Häufige Symptome, denen daher ein eigener Abschnitt gewidmet wurde, sind u. a. Schmerz, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Verwirrtheit, Lähmungen, Spastik, Rigor, Fatigue, Mundtrockenheit, Flüssigkeit in der Sterbephase, Kachexie, unruhige Beine.
Im Anschluss an diesen „Symptomteil“ werden in Kapitel 4 ethische Fragen und dann im fünften Kapitel einige neurologische Erkrankungen und die Möglichkeiten ihrer Palliativversorgung besprochen. „Modellerkran|21|kungen“, die besonders intensiv erforscht werden, sind:
die Demenz als Beispiel für den kognitiv veränderten Palliativpatienten und
die amyotrophe Lateralsklerose als Beispiel für den gelähmten, aber kognitiv nicht eingeschränkten Palliativpatienten.
1.2 Palliativversorgung
Was ist das Besondere am neurologischen Palliativpatienten? Warum haben es Patienten, die an fortgeschrittenen, unheilbaren neurologischen Erkrankungen, wie etwa der Parkinson-Krankheit, Multipler Sklerose, Demenz oder schweren Schlaganfällen, leiden, meist schwer, eine Palliativbehandlung zu bekommen?
Schon an Fallbeispiel 1-1 konnten wir sehen, dass es bei der Betroffenen wie bei vielen anderen Menschen mit neurologischen Erkrankungen frühzeitig und in erheblichem Umfang zu körperlichen Behinderungen, Lähmungen, Seh- und Koordinationsstörungen kam. Dies geschieht bei Tumorpatienten nicht in dem Ausmaß und vor allem nicht so frühzeitig im Krankheitsverlauf. Diese körperlichen Einschränkungen müssen von den Betroffenen sowie ihren Angehörigen, Pflegenden, Ärzten und Palliativkräften ausgehalten werden. Anders als z. B. Schmerzen können diese körperlichen Einschränkungen nicht einfach durch eine gute Symptom„kontrolle“ wegbehandelt werden. Diese körperlichen Einschränkungen erscheinen vielen Gesunden als schlicht nicht aushaltbar. Manche Gesunde wollen, wenn sie an solche körperlichen Einschränkungen denken, nie als „so ein Pflegefall“ enden und lieber sterben. Deshalb betrachten sie körperlich schwer behinderte, fortgeschritten neurologisch Erkrankte vielleicht als unwert, wie sich in persönlichen Mitteilungen betroffener Angehöriger gegenüber dem Autor zeigt: „Er hätte besser sterben sollen, als so dahinzuvegetieren.“ Oder: „Als Pflegefall hätte er nie leben wollen. Besser tot als so.“ Aber auch im Pflegeteam wird vielleicht diskutiert, dass man selbst lieber tot sei, als so zu leben. Eine Befragung Betroffener mit amyotropher Lateralsklerose, einer fortschreitenden Erkrankung mit ausgeprägten Lähmungen, bezüglich ihrer erlebten Lebensqualität zeigte eine erstaunlich gute individuelle Lebensqualität der Betroffenen (Lulé et al., 2008). Gesunde halten möglicherweise etwas für unerträglich, unwürdig und nicht lebenswert, was für die Betroffenen vielleicht eine ganz andere, schwer zu erfassende Lebensqualität hat.
Zu diesen Besonderheiten kommen die häufigen kognitiven Veränderungen neurologisch erkrankter Palliativpatienten. Wie wir an Fallbeispiel 1-1 gesehen haben, hat die Betroffene Schwierigkeiten, ihre Beschwerden klar zu äußern und Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Dadurch entstehen ganz andere Anforderungen an die Palliativbetreuung. Gängige Verfahren der Schmerz- und Symptomerfassung sind nicht anwendbar oder müssen an die Situation angepasst werden. Prozesse der Trauer und der Auseinandersetzung mit der schweren, fortschreitenden Erkrankung gestalten sich ganz anders, oft mehr emotional und weniger kognitiv. Auch an der kognitiven Bearbeitung ausgerichtete Konzepte der Trauer und Spiritualität etc. müssen an diese andere Situation angepasst werden. Stellvertretende Mitentscheidungen müssen ggf. getroffen werden.
Zu dieser Andersheit des neurologischen Palliativpatienten, etwa auf Grund von Lähmungen und kognitiven Einschränkungen, kommt, falls er betagter ist, die häufige Multimorbidität hinzu. Sie ist eine große Herausforderung. Da häufige neurologische Erkrankungen, wie z. B. Schlaganfall, Parkinson-Krankheit und Demenz, vor allem im Alter vorkommen, dürfte ein Großteil der neurologischen Palliativpatienten betagt sein. Die Betroffenen haben dann meist mehrere Erkrankungen. Anders als bei jüngeren Patienten müssen wir also gerade beim betagten neurologischen Palliativpatienten immer alle Krankheiten insgesamt und nicht nur die einzelne neurologische Erkrankung isoliert betrachten. Schmerzen können |22|daher oft gar keiner bestimmten Erkrankung zugeordnet werden. Ist es der Schlaganfall mit seinen Kontrakturen (Gelenkversteifungen) oder das schon lange bestehende Rheuma, das den Knochenschmerz auslöst? Wird die Atemnot durch die schon lange bestehende fortgeschrittene Herzschwäche oder die fortgeschrittene Multiple Sklerose ausgelöst? Verschiedene Erkrankungen führen angesichts dieser Multimorbidität zu gleichen Symptomen.
Aus der Situation des häufig älteren neurologischen Palliativpatienten, der oft mehrere chronische Erkrankungen aufweist, wird klar, welche Herausforderung dies für die Gesundheitsberufe bedeutet. Deshalb fordert Dörner (2001) den „chronischen Arzt“. Er beschreibt zunächst die Situation des üblicherweise für akute Erkrankungen ausgebildeten Arztes, der oft gar nicht in der Lage ist, den besonderen Herausforderungen des chronisch Kranken zu begegnen. Das gleiche Problem besteht auch in anderen Berufsgruppen. Auch hier muss umgedacht werden. Wir brauchen nicht nur den chronischen Arzt, sondern auch „chronisch Pflegende“. Gerade in der Altenpflege und der ambulanten Pflege wird regelhaft derartige chronische Pflege geleistet. Die Anforderungen sind daher groß! Schon die hospizlich-palliative Vorgehensweise mit ihrem Ziel der Linderung, nicht der Heilung, mit ihrer radikalen Patientenorientierung bedeutet eine deutliche Änderung der Haltung. Schon daran wird klar, dass es in der Palliativversorgung neurologisch Erkrankter entscheidend um Haltung und damit um das eigene Ethos geht. Wie Fallbeispiel 1-1 zeigt, spielen (ethische) Entscheidungsprozesse eine große Rolle. Dies alles stellt selbst für erfahrene Palliativkräfte im Hospiz oder auf einer Palliativstation eine große Herausforderung dar. Und das soll mit einem viel schlechteren Personalschlüssel als dem der Spezialeinrichtungen (Hospiz oder Palliativstation) in anderen Settings mit fortgeschritten neurologisch Erkrankten, etwa zu Hause oder im Heim, geleistet werden?
Vielleicht möchte mancher das Buch jetzt am liebsten zuschlagen und hält die Aufgabe für unlösbar. Ich glaube jedoch, dass die erfolgreichen Versuche einiger Krankenhäuser und Pflegeheime, die eine Palliativkultur für Nichttumorpatienten und insbesondere fortgeschritten neurologisch Erkrankte, z. B. mit Demenz, aufgebaut haben, trotz aller Schwierigkeiten Mut machen sollten.
Im Pflegeheimbereich waren solche Modelleinrichtungen das Geriatriezentrum Wienerwald in Wien, dessen Arbeit sehr gut in dem Buch „Alt, krank, verwirrt“ von Marina Kojer (2021) beschrieben wird, und das Pflegeheim des Roten Kreuzes in Bergen/Norwegen (Sandgathe-Husebø, 2009). Diesen Einrichtungen sind einige Pflegeheime in Deutschland gefolgt und haben gezeigt, dass sich eine Palliativkultur auch in einem deutschen Pflegeheim aufbauen lässt (Kostrzewa & Gerhard, 2010). Zurzeit betreuen Palliativstationen und ambulante spezialisierte Palliativteams zunehmend auch neurologisch Erkrankte.
Die Krankheitsverläufe sind bei neurologischen Palliativpatienten sehr vielgestaltig und oft anders als bei Tumorpatienten. Typischerweise werden in der Palliative Care vier Verlaufsdynamiken unterschieden (Lunney et al., 2003; Murray, 2009) (Abb. 1-1):
plötzlicher Tod
Krebserkrankungen – ständiges Fortschreiten mit üblicherweise abgrenzbarer Terminalphase
Organinsuffizienz – langsames Fortschreiten mit plötzlichen, unerwarteten Verschlechterungen, u. U. mit anschließender Erholung, aber eventuell auch tödlichem Ausgang
Demenz und Gebrechlichkeit – lang anhaltendes, langsames Fortschreiten, möglicherweise plötzlicher Tod durch eine Komplikation, wie z. B. eine Lungenentzündung oder -embolie.
Die Verläufe bei fortgeschritten neurologisch Erkrankten können allen Verlaufsdynamiken entsprechen, sind sehr verschiedenartig und daher sehr schlecht vorhersehbar. Betroffene mit Hirntumoren oder amyotropher Lateral|23|sklerose – einer Erkrankung mit fortschreitendem Nervenzelluntergang und fortschreitenden Lähmungen – kommen dem Verlaufstyp der Krebskrankheiten am nächsten. Betroffene mit Parkinson-Krankheit und anderen neurodegenerativen Erkrankungen, chronisch progredienter (fortschreitender) Multipler Sklerose, fortschreitenden Muskelerkrankungen oder Wachkoma folgen eher dem Verlaufstyp 4 (Demenz und Gebrechlichkeit). Betroffene mit schubförmiger Multipler Sklerose, mit fortschreitender Gefäßerkrankung des Gehirns und mehreren Schlaganfällen folgen meist dem Verlaufstyp 3 (Organinsuffizienz). Jedoch können Menschen mit Parkinson-Krankheit, anderen neurodegenerativen Erkrankungen, chronisch fortschreitender (progredienter) Multipler Sklerose, fortschreitenden Muskelerkrankungen oder Wachkoma durch wiederkehrende Komplikationen auch den Verlaufstyp 3 haben, weil es zu steten Verschlechterungen durch komplizierende Lungenentzündungen, Harnwegsinfekte etc. kommt, bei denen vorher nicht klar ist, ob sich der Patient davon erholt. Patienten mit schwersten Schlaganfällen sterben relativ rasch innerhalb der ersten Tage bis Wochen und entsprechen damit teilweise Verlaufstyp 1, wie Fallbeispiel 1-2 zeigt.
Abbildung 1-1: Typische Krankheitsverläufe in der Palliative Care (Quelle: mod. n. Lunney et al., 2003, S. 2387–2392)
Fallbeispiel 1-2
Herr S. ist 75 Jahre alt und erlitt plötzlich eine schwere Bewusstseinsstörung, eine Blickwendung nach links und eine vollständige Lähmung der rechten Körperhälfte. Ein Computertomogramm des Schädels zeigte eine Massenblutung in nahezu der gesamten lin|24|ken Hirnhälfte. Prognostisch wird nur ein Überleben für wenige Stunden bis Tage für möglich gehalten. Therapiemöglichkeiten bestehen aus kurativer Sicht nicht. Diese schlechte Prognose wird den Angehörigen mitgeteilt. Es werden eine intensive Begleitung und Palliativmaßnahmen angeboten. Der Patient wird von der Intensivstation, auf die er zunächst aufgenommen worden war, nach Absprache mit den Angehörigen und entsprechend seinem mutmaßlichen Einverständnis in ein Einzelzimmer mit Übernachtungsmöglichkeit für die Angehörigen auf der Allgemeinstation verlegt. Er atmet schnell und angestrengt, zeigt Schmerzzeichen in Form von Unruhe und wirkt, als stünde er unter starkem Stress. Magensonde, Wendeltubus und Sauerstoffsonde über die Nase werden entfernt, was den Stress des Patienten offensichtlich reduziert. Er erhält einen Perfusor mit Metamizol (5 g) gegen die zu vermutenden Kopfschmerzen, Morphin (10 mg) gegen die Atemnot und Haloperidol zur Prophylaxe opioidbedingter Übelkeit. Später wird wegen beginnender Verschleimung Butylscopolamin (60 mg/d) hinzugefügt. Darunter atmet er deutlich langsamer, weniger angestrengt und wirkt nicht mehr unruhig, sondern von der Körperhaltung und den Gesichtszügen her entspannt. Auch die Angehörigen nehmen keine Schmerzzeichen wahr. Den Angehörigen wird das Prinzip der körperstammnahen Berührung aus dem Konzept der Basalen Stimulation® nahegebracht. Ein CD-Spieler mit der Lieblingsmusik von Herrn S. wird organisiert. Er ist ein sehr musischer Mensch. Die Angehörigen organisieren eine 24-Stunden-Begleitung und wünschen keine Hospizbegleitung. Am Folgetag stirbt Herr S. In einem abschließenden Gespräch mit den Angehörigen äußern diese, wie froh sie sind, dass er so friedlich verstorben sei.
Im Gegensatz zu dem sehr raschen Verlauf in Fallbeispiel 1-2 haben viele neurologisch erkrankte Palliativpatienten einen wesentlich längeren Krankheitsverlauf als Tumorpatienten. Sehr oft ist die terminale Phase nicht vorhersehbar, wie Fallbeispiel 1-3 zeigt.
Fallbeispiel 1-3
Herr Meier ist 54 Jahre alt. Er leidet schon seit 30 Jahren an Multipler Sklerose. Zunächst hatte er vor allem Krankheitsschübe, die seit 20 Jahren nicht mehr auftreten. Die Erkrankung schreitet allmählich voran. Seit 15 Jahren sieht er schlecht, 20 Jahre konnte er nur mit Gehhilfe gehen und seit 10 Jahren sitzt er im Rollstuhl. Er leidet seit mehr als 20 Jahren an heftigen Schmerzen. Fragen der Vorsorgeplanung spielen schon seit 20 Jahren eine große Rolle. Plötzlich kommt es zu einer schweren Lungenentzündung und er verstirbt trotz intensivmedizinischer Maßnahmen nach wenigen Tagen im Krankenhaus.
Neurologisch Erkrankte erhalten wegen dieses sehr unterschiedlichen, oft langen und häufig schwer vorhersehbaren Verlaufs nur in manchen Fällen eine Palliativbetreuung. Ausnahmen bilden Patienten, die eher dem Verlaufstyp der Krebserkrankungen entsprechen, wie z. B. Patienten mit amyotropher Lateralsklerose oder manche Patienten mit Hirntumoren. Aber auch hier stellen sich für die speziellen Strukturen Hospiz oder Palliativstation auf Grund der andersartigen Symptome, z. B. der kognitiven Einschränkungen vieler Hirntumorerkrankten, bisweilen besondere Herausforderungen. Die meisten fortgeschritten neurologisch Erkrankten leben zu Hause, betreut von einem ambulanten Pflegedienst, oder im Heim.
Psychosoziale und spirituelle Betreuung sind integrale Bestandteile der Palliativbetreuung und Hospizarbeit. Dabei kommen mitunter sehr kognitive Prozesse der Krankheitsverarbeitung, Trauerarbeit etc. zum Einsatz. Auf Grund der teilweise starken kognitiven Veränderungen haben viele fortgeschritten neurologisch Erkrankte nicht die Möglichkeit, an dieser eher kognitiven Vorgehensweise teilzuhaben. Oft haben sie aber im Gegensatz zur veränder|25|ten Kognition, Sprache etc. eine ausgeprägte, vielleicht sogar kompensatorisch übersteigerte Emotionalität. Die Begleitung gestaltet sich daher ganz anders, wie im Folgenden gezeigt wird.
Monika Müller beginnt das Vorwort ihres Buches „Dem Sterben Leben geben“ mit den Sätzen:
„Auf der Suche nach einer spirituellen Praxis in meinem Leben habe ich so manches ausprobiert und eingeübt: Sitzen, Beten, Meditieren, wahrnehmendes Geben – alles hat mich nicht länger gefesselt und sich nicht dauerhaft in mein Alltagsleben eingeprägt. Als ich eines Sommerabends bei einer bewusstlosen Frau saß und auf ihr mühsames Atmen hörte, wurde mir sehr plötzlich bewusst, dass die Art und Weise, wie ich in mir geschenkter Anteilnahme bei dieser Frau war, eine eigene spirituelle Praxis sein könnte […]. Vielleicht können wir lernen, dies Beim-Anderen-Sein als spirituelle Praxis anzuerkennen und uns in ihr regelhaft zu üben“ (Müller, 2004, S. 7)
Hier wird deutlich, wie diese emotionale Ebene des „Da-Seins“ tragen kann. „Nur“ Beim-Anderen-Sein klingt sehr einfach, ist aber in Wirklichkeit eine anspruchsvolle emotionale Aufgabe, die sich im Gegensatz zum Gespräch mit dem kognitiv „intakten“ Patienten nicht als Therapiestunde abrechnen lässt. Es ist gerade dieses mit ganzem Herzen Beim-Betroffenen-Sein, der vielleicht gelähmt, sprachgestört, verwirrt oder bewusstlos ist, das ihm trotz aller „Ausfälle“ Würde verleiht.
Für dieses Beim-Anderen-Sein, wie es Monika Müller so schön ausdrückt, ist es jedoch notwendig, eine andere Haltung gegenüber dem neurologisch Erkrankten einzunehmen, die ihn nicht als Defektmenschen begreift, dessen Gehirn in erheblichen Teilen gestört ist, sondern als Menschen mit vielen noch vorhandenen Möglichkeiten. So kann ein halbseitig gelähmter Patient z. B. durchaus die nicht gelähmte Körperhälfte völlig normal bewegen, oder ein Betroffener mit Sprachstörung kann durchaus noch kommunizieren, auch wenn dies länger dauert und schwerer verständlich ist. Ein Demenzbetroffener kann seine Emotionen trotz Verwirrtheit klar äußern. Diese ressourcenorientierte Sichtweise steht im Gegensatz zur defizitorientierten Sichtweise. Man betrachtet den Betroffen nach dem Motto „Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll“.
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass es nur sehr begrenztes Wissen zu den „palliativen“ Bedürfnissen und Therapiemöglichkeiten fortgeschritten neurologisch Erkrankter gibt. Das Krankheitsbild der amyotrophen Lateralsklerose war hier Vorreiter: Zu ihm existieren einige Untersuchungen in Übersichtsarbeiten und Monographien (Borasio et al., 2002; Oliver et al., 2006). Auch zur Demenz wurden schon früh Erkenntnisse in der Praxis generiert (Volicer & Hurley, 1998). Schaut man dagegen auf andere häufige neurologische Erkrankungen, wie etwa Schlaganfall, Parkinson-Krankheit oder Multiple Sklerose, so findet sich bei Datenbankabfragen noch wenig, aber tendenziell immer mehr Literatur zur palliativen Behandlung! Sollte man daher diese Krankheitsbilder nicht palliativ behandeln? Die Antwort ist ein klares Nein. Wir benötigen etwas Anderes: Da wir wenig darüber wissen, müssen wir suchen, suchen nach Bedürfnissen und Nöten, Behandlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Dies ist eine große Herausforderung, sind wir doch mehr und mehr gewohnt, gerade in der Neurologie mit vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen (Evidenzen) an Therapieentscheidungen herangehen zu können (DGN, 2024; Diener & Weimar, 2012). Es wäre also völlig falsch, wenn Sie als Leser erwarten, dieses Buch zu lesen und dann zu wissen, wie Sie Ihre neurologisch betroffenen Palliativpatienten behandeln können. Sicher werden in diesem Buch einige Grundprinzipien palliativer Behandlung, wie z. B. Schmerz- und Symptombehandlung, vermittelt, aber viel wichtiger ist das ständige Suchen, welche dieser Möglichkeiten nun die passende und in welcher Form sie angemessen ist. Hierzu das Fallbeispiel 1-4 aus der klinischen Praxis des Autors.
|26|Fallbeispiel 1-4
Eine Assistenzärztin im letzten Ausbildungsjahr fragte den Autor, sie wolle nun, da sie fortgeschritten sei, von ihm wissen, wie man einen sterbenden neurologischen Palliativpatienten üblicherweise behandle. Sie zückte einen Schreibblock und wollte nun nach Art von „Kochrezepten“ wissen, was man tun müsse, wie hoch die übliche Morphindosis sei, welche Medikamente man einem Sterbenden gäbe […]. Sie war völlig überrascht, als ich ihr antwortete, man müsse erst einmal sehen, was der Betroffene benötige: Medikamente oder nichtmedikamentöse Maßnahmen oder vielleicht auch gar keine Therapie, sondern „nur“ eine gute Begleitung […] und wenn er Medikamente bekomme, könne man die Dosis nur individuell festlegen […]. Sie war sprachlos und konnte erst in einem Gespräch Wochen später thematisieren, dass sie zunächst enttäuscht war, dass es kein einfaches Rezept gäbe, und dann überrascht war, wie ausschließlich die Behandlung von den Bedürfnissen der Betroffenen ausgehe.
1.3 Grundlagen der Palliativbetreuung
Was ist Palliative Care und in welchen Strukturen kann sie stattfinden? Und vor allem: Welche dieser Strukturen sind für den neurologischen Palliativpatienten geeignet? Gemäß der Definition der Europäischen Gesellschaft für Palliative Care stellt Palliativbetreuung die angemessene Versorgung von Patienten mit fortgeschrittenen und progredienten Erkrankungen dar, die eine begrenzte Lebenserwartung haben und bei denen die Behandlung auf die Lebensqualität zentriert ist (Radbruch et al., 2011). Das Wort „Palliative Care“ leitet sich aus dem lateinischen „palliare“ („mit einem Mantel umhüllen“) ab. Damit ist der schützende Mantel gemeint, der den leidenden Menschen umhüllen soll. In dieser Definition öffnet sich ein breites Anwendungsfeld für Palliativbetreuung (Carter & Chichin, 2003). Obwohl in der Praxis in vielen Hospizen und Palliativstationen zu über 90 % Tumorpatienten betreut werden, wird der Tumorpatient in dieser Definition gar nicht gesondert benannt. Damit sind also keinesfalls nur Tumorpatienten als Adressaten von Palliativbetreuung gemeint, sondern z. B. durchaus auch Patienten mit einer neurologischen Erkrankung. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit den Grundprinzipien der Palliative Care für die Betreuung fortgeschritten neurologisch Erkrankter unverzichtbar.
1.3.1 Geschichte
Die moderne Palliativbetreuung ist als Profession aus einer Bürgerbewegung, nämlich der Hospizbewegung, hervorgegangen. Der sterbende Mensch und sein Umfeld, seine Angehörigen und Betreuenden stehen in der Hospizbewegung und der Palliativbetreuung im Zentrum der Bemühungen (Student & Napiwotzky, 2011). Die Geschichte der modernen Hospizbewegung ist sehr eng mit der Person von Cicely Saunders (1918–2005) verknüpft. Saunders machte sich bereits während ihrer Pflegeausbildung im Zweiten Weltkrieg Gedanken um die Betreuung Sterbender. Ein Rückenleiden zwang sie, ihre Pflegetätigkeit zu unterbrechen und nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin abzuschließen. Sie behielt ihr Ziel, eine umfassende Versorgung sterbender Menschen aufzubauen, jedoch bei. Ein Arzt empfahl ihr, Medizin zu studieren, wenn sie ihr Ziel der Betreuung Sterbender wirklich verfolgen wolle (Pleschberger, 2017). So wurde sie Ärztin und gründete 1967 in London das St Christopher’s Hospice als erstes modernes Hospiz. Auf Grund dieser besonderen Biographie vereinigte Saunders drei typische Berufsgruppen des Palliativteams in einer Person. Im St. Christopher’s Hospiz steht den Betroffenen seit der Gründung ein multidisziplinäres Team zur Verfügung, sodass das Konzept |27|der Multiprofessionalität seit der Geburtsstunde der modernen Palliativbetreuung verfolgt wurde. Freiwillige Hospizkräfte wurden in London von Anfang an in die Betreuung der Betroffenen einbezogen (Kasten 1-1). Damit wurde die Hospizbewegung als Bürgerbewegung integriert. Die von Saunders entwickelten Prinzipien der Schmerz- und Symptombehandlung (Saunders & Baines, 1991) berücksichtigen nicht nur die körperliche Dimension, sondern umfassen auch die psychische, soziale und spirituelle Dimension von Leiden. Saunders betreute schon von Anfang an im St. Christopher’s Hospiz Menschen mit einer bestimmten neurologischen Erkrankung, nämlich der amyotrophen Lateralsklerose (Golla et al., 2008).
Kasten 1-1:
Prinzipien der Hospizbetreuung (Kostrzewa & Gerhard, 2010)
Der sterbende Mensch und seine Angehörigen stehen im Mittelpunkt.
Es werden sehr hohe Kompetenzen in der Schmerz- und Symptombehandlung angestrebt.
Eine kontinuierliche Versorgung (24-Stunden-Bereitschaft) wird angestrebt.
Ein multiprofessionelles Team betreut den Betroffenen und seine Angehörigen.
Freiwillige Hospizhelfer werden in die Betreuung einbezogen.
Das Wort „Hospiz“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich übersetzt „Gastfreundschaft“. Ursprünglich waren damit Unterkünfte an Pilgerwegen gemeint. So bauten im Mittelalter Mönchsorden Pilgerunterkünfte und nannten sie Hospize (Pleschberger, 2017) (Kasten 1-2). In Frankreich und Irland wandelte sich die Bedeutung bereits im 19. Jahrhundert: Es wurden Sterbehäuser eingerichtet; 1842 wurde der Begriff „Hospiz“ dann erstmals in Verbindung mit der Pflege und Begleitung Sterbender verwendet (Klaschik, 2009a), und in Lyon wurde im selben Jahr das Sterbehaus „Calvaire“ gegründet. Im Jahre 1879 gründete schließlich Mary Aikenhead mit den Irish Sisters of Charity „Our Lady’s Hospice“ in Dublin.
Kasten 1-2:
Geschichte der Hospizbewegung und Palliativbetreuung (mod. n. Klaschik, 2009a)
Im Mittelalter: Hospize an Pilgerwegen als Pilgerunterkünfte:
1842: Sterbehaus „Calvaire“ in Lyon; Verwendung des Begriffs „Hospiz“ in Zusammenhang mit der Begleitung Sterbender
1879: Mary Aikenhead gründet in Dublin „Our Lady’s Hospice“.
1967: Cicely Saunders gründet das „St Christopher’s Hospice“ in London.
1969: Elisabeth Kübler-Ross veröffentlicht ihr Buch über Sterbebegleitung („On Death and Dying“).
1974: erster Palliativkonsiliardienst, das sogenannte „Hospital Support Team“, in New York.
1975: erste Palliativstation in Montreal, Kanada.
1975: erste Tagesklinik für Palliativpatienten in Sheffield, Großbritannien.
Der moderne Hospizgedanke von Saunders fand nach der Gründung des St. Christopher’s Hospizes in London 1967 rasch international Verbreitung. 1969 veröffentlichte die aus der Schweiz stammende Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross in den USA ihr Buch „On Death and Dying“ und schuf damit ein weiteres Grundlagenwerk der Palliative Care und Hospizbetreuung. Die deutsche Übersetzung hat den Titel „Interviews mit Sterbenden“ (Kübler-Ross, 2001). Sie beschrieb darin wesentliche Elemente der Sterbebegleitung einschließlich der Sterbephasen (Student & Napiwotzky, 2011).
Die erste Struktur der professionellen Palliativbetreuung in einem Krankenhaus wurde 1974 in New York gegründet. Interessanterwei|28|se war es keine Palliativstation, sondern ein Palliativkonsiliardienst, und zwar das „Hospital Support Team“ am New Yorker St. Louis Hospital (Klaschik, 2009a), der erste Palliativkonsiliardienst weltweit. Erst ein Jahr später (1975) gründete der Palliativmediziner Balfour Mount dann die erste Palliativstation im Royal Victoria Hospital in Montreal, Kanada. In diesem Zusammenhang taucht erstmals der Begriff „palliativ“ auf. Der vorher gebräuchliche Begriff „hospice medicine“ war nicht verwendbar, weil er auf Frankokanadisch eine sehr negative Bedeutung gehabt hätte (MacDonald, 2006).
In Deutschland fand die Entwicklung der Hospizbewegung im internationalen Vergleich spät statt (Kasten 1-3), denn 1971 kam ein Film mit dem Titel „Noch 16 Tage – eine Sterbeklinik in London“ heraus, der im St. Christopher’s Hospiz gedreht worden war. Er führte zu Missverständnissen: Viele Zuschauer glaubten fälschlicherweise, es ginge um Euthanasie (Radbruch et al., 2011). Auf Grund dieser Anlaufschwierigkeiten dauerte es noch viele Jahre bis zur Gründung der ersten Hospize und Palliativstationen in Deutschland. Pioniere aus Tübingen setzten im dortigen Paul-Lechler-Krankenhaus, einer Tropenklinik, schon Ende der 1960er-Jahre in einem Hausbetreuungsdienst den hospizlich-palliativen Gedanken um (Radbruch et al., 2011). Erst 1983 wurde in der Universitätsklinik Köln die erste Palliativstation Deutschlands (heute Dr. Mildred Scheel Haus) gegründet. Erst 1986 bzw. 1987 folgten die beiden ersten stationären Hospize, das Haus Hörn in Aachen und das St. Franziskus Hospiz in Recklinghausen.
Kasten 1-3:
Entwicklung der Hospiz- und Palliativbetreuung in Deutschland (mod. n. Gerhard, 2014, 2023a; Klaschik, 2009a; Kostrzewa & Gerhard, 2010)
1960er-Jahre: erste Konzepte der Palliativbetreuung im Paul-Lechler-Krankenhaus in Tübingen (unter der Leitung von Thomas Schlunk)
1971: In Deutschland läuft ein Film über das St. Christopher’s Hospiz in London („Noch 16 Tage – eine Sterbeklinik in London“), dessen Darstellung sehr missverständlich aufgenommen wird.
1983: Deutschlands erste Palliativstation an den Universitätskliniken Köln
1986: Hospiz Haus Hörn in Aachen
1987: Hospiz zum heiligen Franziskus in Recklinghausen
1991: Palliativprojekt der Bundesregierung (15 geförderte Palliativstationen)
1992: Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (heute DHPV)
1994: Gründung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin
1997: Erstellung von Ausbildungscurricula für Ärzte, Pflegende, Sozialarbeiter und Studenten
1999: Deutschlands erster Lehrstuhl für Palliativmedizin in Bonn
2000: Begründung sowohl der Zeitschrift für Palliativmedizin als auch der Hospiz-Zeitschrift
2003: Erlass der Musterweiterbildungsordnung „Palliativmedizin für Ärzte“
2007: Beschluss der SAPV (Verordnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung)
2009: Änderung der ärztlichen Approbationsordnung zur Einführung des verpflichtenden Querschnittsbereichs Palliativmedizin (QB 13) im Medizinstudium
2010: Charta zur Betreuung Schwerstkranker und Sterbender
2013: Im EBM sind Leistungen der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (AAPV) abrechenbar.
2015: Das Hospiz- und Palliativgesetz wird im Deutschen Bundestag verabschiedet. Darin finden sich einige Neuregelungen wie z. B. die Finanzierung des Advance Care Planning (Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase nach § 132 g SGB V).
|29|Die Geschichte der Palliativ- und Hospizbetreuung neurologisch Erkrankter kann wesentlich weniger aufweisen. Da es im Ursprungsland der Palliativ- und Hospizbetreuung, Großbritannien, im internationalen Vergleich sehr wenige Neurologen gibt, konnten die dortigen Fachärzte diesen Schwerpunkt nicht mitversorgen (Voltz & Borasio, 2007). Saunders hatte aber im St. Christopher’s Hospiz in London bereits seit dessen Gründung neurologisch Erkrankte mit amyotropher Lateralsklerose – einem fortschreitenden Untergang von Nervenzellen mit fortschreitenden Lähmungen – versorgt. In Deutschland dagegen sind zwei der sechs palliativmedizinischen Lehrstühle mit Neurologen besetzt. Es gibt daher intensive Forschungsarbeiten aus Deutschland, vor allem über die „Modellerkrankung“ amyotrophe Lateralsklerose (Borasio et al., 2002). Im Jahre 2004 erschien das Handbuch „Palliative Care in Neurology“ (Voltz et al., 2004), das unter deutscher federführender Herausgeberschaft von einem internationalen Autorenteam aus mehreren Kontinenten geschrieben wurde. Seither werden neurologisch erkrankte Palliativpatienten mehr und mehr in palliative Versorgungsstrukturen miteinbezogen. 2023 hat die AG Palliativmedizin der Deutschen Gesellschaft für Neurologie eine S2k-Leitlinie „Palliativmedizinische Versorgung neurologischer Erkrankungen“ im Rahmen der DGN-Leitlinien erstellt (DGN, 2023a). Auch Menschen mit anderen nichtonkologischen Erkrankungen finden langsam mehr Beachtung in der Palliativmedizin, wie z. B. die Monographien von Brown et al. (2012) und Johnson und Lehman (2013) zu kardiologisch und nephrologisch erkrankten Palliativpatienten zeigen. Zu beachten ist, dass viele medikamentöse Therapieprinzipien in der Palliativversorgung und insbesondere auch in der Neuro-Palliative Care einen Off-Label-Use darstellen (Gerhard, 2022). Off-Label-Use bedeutet die Anwendung eines Fertigarzneimittels außerhalb seiner Zulassung.
1.3.2 Was bedeutet Palliativbetreuung?
Palliativbetreuung wird auf Englisch „Palliative Care“ genannt. Wie bereits ausgeführt, stammt das erste Wort dieses Begriffs vom lateinischen „palliare“ ab, das so viel wie „mit einem Mantel umhüllen“ bedeutet, während „Care“ in diesem Zusammenhang nicht Pflege, sondern „ganzheitliche Umsorgung“ meint. Bildhaft gesprochen wird dem Erkrankten ein schützender, umsorgender Mantel umgelegt. Worin unterscheiden sich nun Palliativ- und Hospizbetreuung? Letztere ist aus dem ehrenamtlichen Engagement von Mitbürgern entstanden. Die Palliativbetreuung wird von speziell in diesem Bereich ausgebildeten Ärzten, Pflegenden, Sozialarbeitern, Seelsorgern, Krankengymnasten, Sprachtherapeuten etc. im Rahmen ihrer bezahlten, beruflichen Tätigkeit geleistet. Es gibt sehr große Überschneidungen zwischen den beiden Bereichen. So sind z. B. in einem Hospizverein in der Regel neben zahlreichen Ehrenamtlichen auch hauptberufliche, bezahlte Koordinatoren (meist aus der Pflege und/oder Sozialarbeit) tätig. Spezielle palliative Einrichtungen, etwa Palliativstationen im Krankenhaus, beziehen meist ehrenamtliche Hospizbegleiter in ihr Team ein, um den Bedürfnissen des Patienten besser gerecht zu werden.
Die Weltgesundheitsorganisation definierte 2002 Palliative Care folgendermaßen (Student & Napiwotzky, 2011, S. 10):
„Palliativbetreuung ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Angehörigen, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sind. Dies geschieht durch Prävention und Linderung von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen sowie durch exzellentes Einschätzen und Behandeln von Schmerzen und anderen Problemen physischer, psychosozialer und spiritueller Art.
|30|Palliativbetreuung:
bejaht das Leben und sieht das Sterben als einen normalen Prozess an
will den Tod weder beschleunigen noch hinauszögern
bietet dem Patienten Unterstützung, um bis zum Tod so aktiv wie möglich zu leben
unterstützt die Familie während der Erkrankung des Patienten und in der Trauerphase.“
In dieser sehr umfangreichen Definition sind schon die meisten wesentlichen Merkmale der Palliativbetreuung enthalten. Es geht um alle, die an fortgeschrittenen lebensbedrohlichen Erkrankungen leiden, nicht nur um Menschen mit Tumorerkrankungen, sondern durchaus auch um fortgeschritten neurologisch Erkrankte. Es geht um eine umfassende Betreuung in körperlicher, psychischer, sozialer und spiritueller Hinsicht. Diese ist nicht durch eine Berufsgruppe zu leisten, sondern benötigt ein gut vernetztes multiprofessionelles Team. Um Leiden präventiv zu behandeln, muss Palliativbetreuung frühzeitig im Krankheitsverlauf einsetzen, also lange bevor die Sterbephase erreicht ist. Daher muss Palliativbetreuung und ihre Struktur (Kasten 1-4) mit der krankheitsspezifischen neurologischen, hausärztlichen, allgemeinpflegerischen Betreuung etc. vernetzt werden.
Kasten 1-4:
Organisationsformen der Palliativversorgung (Gerhard, 2023a)
•SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung)
→Team aus Palliativärzten, Palliativpflegenden und Koordination zur Palliativversorgung, wenn mindestens zwei komplexe Symptome vorliegen
→schließt eine 24-Stunden-Rufbereitschaft ein
→Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung
•AAPV (Allgemeine ambulante Palliativversorgung)
→Palliativversorgung in weniger schweren Fällen durch den Hausarzt und einen ambulanten Palliativpflegedienst
•ambulanter Hospizdienst
→psychosoziale Begleitung durch geschulte ehrenamtliche Hospizhelfer
→Trauerbegleitung
→Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
→hauptamtliche Koordinationskraft
→Erreichbarkeit durch Hospizbüro
•ambulanter Palliativpflegedienst
→mehrere hauptamtliche Palliativpflegekräfte
→24-Stunden-Einsatzbereitschaft
→palliativpflegerische Versorgung
•Tageshospiz
→Betreuung nach Tagesklinikkonzept
•stationäres Hospiz
→Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen mit begrenzter Lebenserwartung, wenn eine Krankenhausbetreuung nicht erforderlich und eine ambulante Betreuung nicht möglich ist
→palliativ geschultes Pflegepersonal ergänzt durch ehrenamtliche Mitarbeiter
→ärztliche Betreuung durch Hausärzte und/oder speziell geschulte Palliativärzte
•Palliativstation
→Krankenhausstation für Patienten mit unheilbaren fortgeschrittenen Erkrankungen
→Ziel: Symptombehandlung, Schmerztherapie, Entlassung ins häusliche Umfeld
→enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflegenden, Sozialarbeitern, Seelsorgern und Psychologen (multidisziplinäres Team)
•Palliativdienst im Krankenhaus
→Beratung für alle Krankenhausärzte/-pflegende oder andere Gesundheitsberufe bezüglich Palliativbetreuung
→Arzt, Pflege, Sozialarbeit und/oder Physiotherapie und/oder Psychotherapie in enger Kooperation.
|31|Im Gegensatz zur professionellen Palliative Care wurde die Hospizidee von einer Bürgerbewegung, der Hospizbewegung, geprägt. Sie engagiert sich nach Klaschik (2009a) für:
einen neuen Umgang mit Leben, Sterben und Tod
einen anderen mitmenschlichen Umgang durch Wiedereinbindung von Familie, Freunden und sozialem Umfeld statt der „Isolation“ in einer Einrichtung wie dem Krankenhaus etc.
den Respekt vor der Autonomie und Würde Schwerstkranker und Sterbender.
Sie sehen an den aufgeführten Definitionen, dass es von der Haltung und Zielrichtung her starke Gemeinsamkeiten zwischen Hospizidee und Palliativbetreuung gibt. Unterschiede bestehen vor allem in der Ausübung durch professionell Tätige oder Ehrenamtliche und im Einbinden und Generieren von medizinisch-pflegerischem Fachwissen, das in beiden Bereichen unterschiedlich stark erfolgt. Die Hospizbewegung war historisch gesehen früher die Palliativbetreuung. Man könnte deshalb die Palliativbetreuung auch als den Einzug der Hospizidee in die Strukturen des Gesundheitswesens bezeichnen.
Welche dieser Strukturen sind für neurologisch Betroffene geeignet? Gegenwärtig finden kaum neurologisch Erkrankte Zugang zu diesen Strukturen, da dort überwiegend Tumorerkrankte betreut werden. Fortgeschritten neurologisch Erkrankte leben häufig zu Hause, versorgt durch Angehörige und eventuell einen ambulanten Pflegedienst, oder im Pflegeheim. Im Krankenhaus sind sie meist auf Allgemeinstationen statt auf speziellen Palliativstationen. Deshalb erreicht man sie in stationären Settings gegenwärtig am besten über palliative Mitbetreuungsangebote, wie z. B. einen Palliativdienst im Krankenhaus, oder über Organisationsentwicklungsprozesse, z. B. in Pflegeheimen. Im ambulanten Setting können sie über spezielle Palliativpflegedienste zusammen mit Palliativärzten im Rahmen der AAPV und SAPV erreicht werden.
1.3.3 Heilen oder lindern?
In der kurativen (heilenden) Medizin steht die Heilung eines betroffenen Patienten an oberster Stelle. Einbußen an Lebensqualität werden dafür in Kauf genommen. Ein Knochenbruch wird operiert, um ihn zu heilen. Dabei wird dem Betroffenen zunächst Schaden zugefügt und die Lebensqualität eingeschränkt, indem sein Körper aufgeschnitten und sein Knochen mit einer Schraube durchbohrt wird, um den Knochenbruch zu heilen und langfristig eine möglichst gute Lebensqualität zu schaffen. Ähnliche Beispiele finden sich auch in der Neurologie, etwa wenn eine Hirnblutung oder eine Nervenläsion operiert wird. Es finden sich auch Beispiele aus der konservativen Neurologie, wie die Antiepileptikagabe, die, vor allem in der Eindosierungsphase, zu Schwindel, Benommenheit, Konzentrationsstörungen etc. führen kann, im besten Falle aber Anfallsfreiheit bringt. Oder die Antibiotikagabe bei Hirnhautentzündung, die zu Durchfällen führen, aber die lebensgefährliche Infektion beseitigen kann. Oder die Blutdruckbehandlung, die zu Schwindel und Sturzneigung führen kann, aber Folgeerkrankungen des Bluthochdrucks, wie den Schlaganfall, weniger wahrscheinlich macht. In der „kurativen“ Pflege wird ein Betroffener, z. B. ein neurologisch Erkrankter mit Dekubitus, regelmäßig gelagert, auch wenn das für ihn unangenehm ist. Er muss diese Lagerungen aushalten, damit er langfristig ohne Dekubitus leben kann. Das Prinzip lautet in diesen Fällen, durch kurative Therapiemaßnahmen eine Heilung zu erreichen, auch wenn diese selbst unangenehm sind.
In der palliativen Betreuung geht es um Menschen, deren Erkrankung nicht mehr geheilt werden kann. Kurative Maßnahmen sind zwar möglich, aber oft unsinnig, da der Betroffene oft keinen Nutzen mehr davon hat. In der Palliativbetreuung steht daher die Lebensqua|32|lität des Betroffenen an oberster Stelle. Bei jeder Therapiemaßnahme wird zunächst geklärt, ob sie im Sinne der Lebensqualität für den Betroffenen angemessen ist. Fallbeispiel 1-5 aus dem „klassischen“ Bereich der Palliativversorgung, der Versorgung von Tumorpatienten, mag dies verdeutlichen.
Fallbeispiel 1-5
Frau R. ist 85 Jahre alt, bettlägerig und leidet an fortgeschrittenem Brustkrebs. Sie hat Hirnmetastasen und deshalb auch eine halbseitige Lähmung links. Wegen der Metastasen im gesamten Knochenbereich sind Lagerungen für sie trotz hochdosierter Analgetikabehandlung ausgesprochen schmerzhaft. Das Pflegeteam ist ratlos, ob es die Lagerungsbehandlung zur Dekubitusprophylaxe nun weiterführen soll oder nicht. Wegen der halbseitigen Lähmung und ihrer verminderten Fähigkeit, sich im Bett selbst zu bewegen, ist Frau R. besonders dekubitusgefährdet, schreit jedoch laut auf, wenn sie zur Seite gedreht wird. Wenige Minuten später schellt sie, da sie nicht mehr auf der Seite liegen kann. Auch die vorherige Gabe von Bedarfsanalgetika bessert die Situation nur teilweise. Obwohl jeweils schon starke Analgetika gegeben werden, hat sie immer noch Schmerzen. Schon zeigen sich deutliche Nebenwirkungen der Schmerzmittel. Sie ist nach der Verabreichung kaum ansprechbar und das, wo sie selbst doch immer wünschte, auch bei fortgeschrittener Erkrankung wach zu sein. Mehrere Mitglieder des Pflegeteams haben den Eindruck, dass sich Frau R. der Sterbephase nähert. Die eingesunkenen Augenhöhlen, die spitze Nase sprechen dafür. Sie beschließen daher gemeinsam, auch auf die Gefahr eines Dekubitus hin keine Lagerungsmaßnahmen mehr durchzuführen. Das Team denkt, ein Dekubitus schränke die Lebensqualität in der kurzen verbleibenden Lebensspanne von Frau R. weniger ein als die äußerst unangenehme Lagerungsbehandlung.
Zwei Tage später entwickelt Frau R. einen Dekubitus am Gesäß. Ein Teil des Teams hat Schuldgefühle. Man hat Angst vor der Pflegedienstleitung und Gutachtern, die einen Behandlungsfehler sehen könnten. Die Schmerzmittelgabe wird erhöht, damit nicht durch den Dekubitus zusätzliche Schmerzen auftreten. Die Teambesprechungen werden ausführlich dokumentiert und die Protokolle der Pflegedienstleitung mit einer Begründung, warum man sich so entschieden hat, übergeben. Frau R. stirbt 3 Tage später.
Fallbeispiel 1-5 verdeutlicht die unterschiedlichen Intentionen palliativer und kurativer Behandlung. Hätte Frau R. noch ein halbes Jahr zu leben gehabt, wäre es im Sinne der Lebensqualität angemessener gewesen, trotz aller Unannehmlichkeiten einen Dekubitus zu vermeiden und die Schmerzdosis trotz Einschränkung der Wachheit so stark zu erhöhen, dass Frau R. die Lagerung aushalten kann. Man hätte hier Einbußen an Lebensqualität, nämlich Wachheit, in Kauf genommen, um schlimmere Einbußen an Lebensqualität in Form eines schmerzhaften, stinkenden, schlecht heilenden Dekubitus zu vermeiden.
1.4 Die Sichtweise der Neurologie
„Die Geschichte der Neurologie in Deutschland ist die Geschichte einer Emanzipation“, schreibt Kömpf (2007, S. 19) in der Festschrift „100 Jahre Deutsche Gesellschaft für Neurologie“. Die Neurologie begann ähnlich wie die Palliativmedizin. Einzelne Kliniker aus der Inneren Medizin und Psychiatrie waren „Pioniere“ und setzten sich schwerpunktmäßig mit neurologischen Fragen auseinander. Bis zur Etablierung eigener neurologischer Kliniken und damit dem Dialog auf Augenhöhe mit den anderen Disziplinen dauerte es lange. Grausamerweise waren es die zahlreichen Hirnverletzungen im Ersten |33|Weltkrieg, die der Neurologie Entwicklungsvorschub leisteten. Durch die Art der Ausfälle bei den Betroffenen waren Rückschlüsse auf die Funktion der jeweils geschädigten Hirnregionen möglich. So konnte genauer herausgearbeitet werden, welche Hirnregion für welche Funktionen verantwortlich ist (Kömpf, 2007).
Auch nach dem Ersten Weltkrieg ging dieser Höhenflug der Neurologie mit der Entwicklung der Elektroenzephalographie, dem bis heute bedeutsamen EEG, weiter. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Neurologie dann wieder der Psychiatrie untergeordnet.
Im Osten Deutschlands, in der DDR, blieb die Neurologie der Psychiatrie bis zur Wende weitgehend untergeordnet und es bestanden dort nur Sektionen für Neurologie (Eisenberg, 2007).
Auch in den alten Bundesländern dauerte es lange, bis die Neurologie an allen Universitäten eigene Lehrstühle bekam. Erst 1968 gab es einen eigenen Facharzt für Neurologie, erst 1973 eine eigene deutschsprachige Fachzeitschrift, die „Aktuelle Neurologie“. In den späten 1980er- bis 1990er-Jahren wurden dann flächendeckend neurologische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern eingerichtet (Eisenberg, 2007).
Der dann folgende Höhenflug der modernen Neurologie war durch neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten gekennzeichnet. Als Beispiele wären zu nennen:
die Computer- und Kernspintomographie, die eine genaue Diagnostik von Hirnerkrankungen überhaupt erst ermöglichten
die Einführung der Lysebehandlung beim Schlaganfall
immunmodulatorische Verfahren bei der Multiplen Sklerose, die Krankheitsschübe und bleibende Ausfälle reduzieren
die Entwicklung immer differenzierterer Medikamente gegen die Parkinson-Krankheit bzw. epileptische Anfälle.
Die Liste der Neuerungen ist lang und die Erfolgsgeschichte der modernen Neurologie eng mit dem streng kurativen Paradigma verknüpft. Diese Geschichte war aber in der Vergangenheit auch von zahlreichen Rückschlägen gezeichnet. An ihr sehen wir, dass das Fach Neurologie immer dann sehr erfolgreich war, wenn:
es besonders genau die Defizite der Betroffenen herausarbeitete, also sehr defizitorientiert war
streng kurative, also dem Heilen verschriebene Therapien eingeführt wurden
die Abgrenzung von der Psychiatrie (und damit bisweilen auch von einer mehrdimensionalen Sichtweise) gut gelang.
Dementsprechend bestehen schon von der Grundhaltung her erhebliche Unterschiede zur Palliative Care, da diese eher ressourcen- als defizitorientiert denkt und nicht das Heilen, die Kuration, sondern das Lindern, die Palliation, in den Vordergrund stellt und psychosoziale bzw. spirituelle Ebenen gleichberechtigt in einem multiprofessionellen Ansatz integriert. Es mag daher nicht verwundern, dass es bisher noch wenig Palliativbetreuung in der Neurologie gibt. Mit den von Neurologen besetzten palliativmedizinischen Lehrstühlen (Prof. Voltz in Köln und Prof. Rolke in Aachen) in Deutschland, der Station Neuro-Palliative Care an der Charité Berlin und einigen palliativen Sektionen an neurologischen Kliniken ist jedoch ein Anfang gemacht. Inzwischen gibt es auch einige englischsprachige Monographien über Palliativbetreuung in der Neurologie. Im Jahre 2004 erschien eine erste Monographie zu diesem Thema von Voltz et al. (2004) mit dem Titel „Palliative Care in Neurology“. Es folgten weitere englischsprachige Monographien, und zwar im Jahr 2006 „Palliative Neurology“ von Maddocks et al. (Maddocks et al., 2006) und im Jahr 2009 „Palliative Care in Neurological Disease“ von Byrne et al. (2009), im Jahr 2018 das Werk „Neuropalliative Care“ von Creutzfeld et al. (2018). Eine breite Integration von Prinzipien der Palliativbetreuung in die Neurologie ist allerdings noch nicht gelungen. Am weitesten ist die Entwicklung sicherlich in der Palliativbetreuung der amyotrophen Late|34|ralsklerose gediehen, deren Paradigma, wie bereits beschrieben, schon im St. Christopher’s Hospiz in London verfolgt wurde und mittlerweile sogar Eingang in die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie gefunden hat (Ludolph, 2012).
1.5 Die person-zentrierte Sichtweise
Tom Kitwood (2022) formulierte sein Modell der person-zentrierten Versorgung als Konzept zur Betreuung von Menschen mit Demenz. Im Gegenzug zur neurologischen Sichtweise, die den Demenzbetroffenen über seine Ausfälle definiert, stellt Kitwood die Person an die erste Stelle. Laut Kitwood soll die Einzigartigkeit der dementen Person gewürdigt werden. Auf der Beziehungsethik von Martin Buber (1977) aufbauend steht im Zentrum die Begegnungskultur. Ziel der Betreuung ist nicht die Heilung der Demenzerkrankung, sondern Wohlbefinden und Begegnung. Dabei ist die versorgte Person das Zentrum aller Handlungen, in scharfem Kontrast etwa zu akutmedizinischen Settings, in denen das Ziel der Heilung das Zentrum der Bemühungen darstellt, oder in Settings der Langzeitpflege, in denen im negativen Falle die Ressourcen der Versorgenden das Zentrum der Handlungen darstellen können. Kitwood strebt danach, Menschen mit einer Demenz so zu behandeln, wie man selbst gerne behandelt werden möchte. Laut Martin und Sabbach (2011, S. 46) lässt sich dieses Modell der „person-centered care“ auf alle Menschen in vergleichbaren Versorgungssituationen, also auch fortgeschritten neurologisch Erkrankte, übertragen. Vergleichen wir das Paradigma der person-zentrierten Versorgung („person-centered care“) mit den Grundlagen der Palliativversorgung, sehen wir große Ähnlichkeiten. Im einen Falle ist von radikaler Patientenorientierung, im anderen von Person-Zentrierung die Rede. Der Unterschied ist, dass person-zentrierte Versorgung am Beispiel der Demenz und Palliativversorgung überwiegend am Beispiel des Tumorpatienten entwickelt wurde. Daher ergeben sich bezüglich der Details auch einige wesentliche Unterschiede. Die person-zentrierte Versorgung ist im Kontext der Neuro-Palliative Care sehr wichtig, da sie die Zentrierung auf den Betroffenen am Beispiel der kognitiven Veränderungen betrachtet, wie sie im Kontext von Neuro-Palliative Care häufig vorkommen. Einrichtungen, die mit Kitwoods Modell anhand des Dementia Care Mapping arbeiten, können vieles aus diesem Modell in die Neuro-Palliative Care übertragen.
1.6 Unterschiede der Sichtweisen am Beispiel Wachkoma
Die Neurologie bemüht sich, sehr genau anhand der Art und Kombination der Ausfälle den Ort der Schädigung im Nervensystem herauszuarbeiten. Dieses faszinierende diagnostische Fachgebiet der Neurologie, die neurologisch-topische Diagnostik, erreicht, dass sich der Ort der Störung teilweise ohne weitere Zusatzuntersuchungen identifizieren lässt und eine genaue Diagnose vermutet werden kann. Die Neurologie unterscheidet sich an diesem Punkt ganz erheblich von der „Apparatemedizin“, denn es sind ja zur Diagnostik nicht immer apparative Zusatzuntersuchungen erforderlich bzw. weiterführend. Der Preis dieser Möglichkeiten, die nur dadurch entstehen, dass die Defizite ganz genau beschrieben werden können, ist eben eine sehr defizitorientierte Sichtweise, bei der das Glas oft halb leer statt halb voll ist (Fallbeispiel 1-6). Ganz anders denkt die ressourcenorientierte Sichtweise der Palliative Care, die versucht, den Betroffenen in seinen verbliebenen Möglichkeiten, statt in seinen Defiziten anzusprechen.