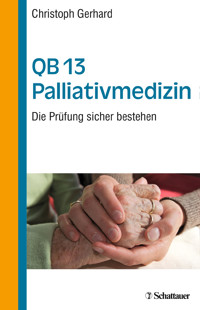26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie können schwerst kranke oder sterbende Menschen durch einen Palliativdienst im Akutkrankenhaus besser versorgt werden? Wie kann Palliative Care frühzeitig in die Krankenhausbehandlung integriert werden, um die Lebensqualität Betroffener zu erhöhen oder gar lebensverlängernd zu wirken? Der erfahrene Palliativmediziner Christoph Gerhard zeigt, wie ein Palliativdienst - unterstützt durch eine palliative Kultur, ein Schmerz- und Symptommanagement, eine auf Autonomie zielende Ethikberatung, eine Versorgungsplanung und Advance Care Planning - die Versorgungsrealität im Krankenhaus positiv verändern kann. Aus dem Inhalt •Definitionen und Abrechnungsmöglichkeiten des Palliativdienstes •Das Krankenhaus - ein Ort zum Sterben? •Palliativdienst im Krankenhaus - eine Frage der Haltung •Die Arbeitsweise des Palliativdienstes (Dokumentation, Kommunikation, Teamkultur etc.) •Ein anderer Umgang mit Schmerzen und Symptomen im -Krankenhaus •Wie können Palliativdienste mehr Autonomie ermöglichen? •Advance Care Planning im Krankenhaus •Chancen des Konzepts Palliativdienst •Ausblick
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Palliativdienst
Christoph Gerhard
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld;
Christine Sowinski, Köln; Franz Wagner, Berlin; Angelika Zegelin, Dortmund
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Palliative Care:
Christoph Gerhard, Dinslaken; Markus Feuz, Zürich
Christoph Gerhard
Palliativdienst
Handbuch zur Integration palliativer Kultur und Praxis im Krankenhaus
Dr. med. Christoph Gerhard
Leitender Arzt Palliativmedizin
Vorsitzender des Ethikkomitees
Katholisches Klinikum Oberhausen
Mülheimer Str. 83
DE-46045 Oberhauesen
Leiter des Kompetenzzentrums
QB13 Palliativmedizin
Institut für Allgemeinmedizin
Universitätsklinikum Essen
Pelmann Str. 81
DE-45131 Essen
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen Internetlinks, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien und Vervielfältigungen zu Lehr- und Unterrichtszwecken, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
z. Hd.: Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
3000 Bern 9
Schweiz
Tel: +41 31 300 45 00
E-Mail: [email protected]
Internet: www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg, Michael Herrmann, Lisa Marie Hempel
Herstellung: Daniel Berger
Umschlagabbildung: Martin Glauser, Uttigen
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Illustration/Fotos (Innenteil): Jürgen Georg, Schupfen
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Hubert & Co., Göttingen
Printed in Germany
1. Auflage 2017
© 2017 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-95070-9)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-75070-5)
ISBN 978-3-456-85070-2
http://doi.org/10.1024/85070-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Für meine Lebensgefährtin Bettina Kraft
Vorwort
Vor mehr als 12 Jahren begann der Autor, in einem Akutkrankenhaus ohne Palliativstation einen abteilungsunabhängigen, berufsgruppenübergreifenden Palliativdienst aufzubauen und zu leiten. Von Anfang an begeisterte ihn die Idee, überzeugt nach dem Motto: „Palliativversorgung für alle, die sie brauchen“, mit diesem Palliativdienst auch Patientengruppen zu erreichen, die niemals auf eine Palliativstation gelangt wären. Beispielsweise Tumorpatienten früh im Krankheitsverlauf, die viele onkologische Therapien erhielten, aber auch leidvolle Symptome, existenzielle Nöte und psychosoziale Probleme hatten, denen der Palliativdienst mit seinem Angebot begegnen konnte. Oder Nichttumorpatienten mit fortgeschrittenen internistischen oder neurologischen Erkrankungen. Dabei ging es darum, ganz in die Lebenswelt der Betroffenen einzutauchen und sie im Sinne einer radikalen Patientenorientierung als Lehrer anzusehen, da sie Situationen existenzieller Not und Todesnähe erleben, die die professionell Tätigen in der Regel so nicht erlebt haben. Fasziniert hat ihn, wie sich nach Art eines Schneeballeffekts palliative Vorgehensweisen im ganzen Krankenhaus verbreiteten, wenn sie den Stationsteams im Alltag praxisnah vorgelebt wurden. Noch mehr als auf der räumlich abgeschlossenen Palliativstation konnte hier eine palliative Kultur im Krankenhaus gefördert und geprägt werden. Zunächst war der Palliativdienst etwas, das von den Hauptakteuren nebenbei betrieben wurde und erst stark im Krankenhaus bekannt gemacht werden musste. Aber nach anfänglich starken Widerständen wurde der Palliativdienst schon bald immer öfter in die Patientenbehandlungen einbezogen oder war gar der Hauptbehandler, sodass zumindest Teilzeitstellen erforderlich und eingerichtet wurden. Wichtig war von Anfang an die Unabhängigkeit des Teams von einer Fachabteilung. Ebenso entscheidend für die Implementierung war die stetige Präsenz des Teams in der innerbetrieblichen Fortbildung, um immer wieder auf das Thema aufmerksam zu machen.
Nach vielen Jahren konnte der Autor mit seinem Palliativteam zunehmend Früchte der Arbeit ernten. Immer häufiger wurden sie bereits zu Aufklärungsgesprächen über Tumordiagnosen einbezogen und konnten Patienten im Sinne einer frühen Integration schon rechtzeitig und während des gesamten Krankheitsverlaufs, immer wenn sie hospitalisiert wurden, mitbetreuen. Der Palliativdienst betreute auch immer häufiger Nichttumorpatienten in unterschiedlichsten Erkrankungssituationen, die zurzeit etwa die Hälfte der Betreuungssituationen ausmachen. Eine statistische Auswertung zeigte, dass gegenwärtig fast alle Betroffenen in erwarteten Sterbesituationen in diesem Krankenhaus vom Palliativdienst mitbetreut werden und damit eine nahezu flächendeckende Implementierung des Konzepts gelungen ist. Daher ist es dem Autor ein großes Anliegen, die Erfahrungen, Chancen, aber auch Widerstände und Rückschläge zu analysieren und in einem Praxisbuch für andere in diesem Bereich Tätige niederzuschreiben.
Das Buch war schon lange angekündigt, nur erschienen dem Autor zu diesen Zeitpunkten die Widerstände noch zu groß, um andere zur Nachahmung zu bewegen. Daher wartete er, bis die Gesundheitsstrukturen eine ausreichende Verankerung des Konzepts garantierten. Dies ist nun mit der neuen Komplexpauschale für den Palliativdienst im DRG-Abrechnungssystem gelungen.
Dinslaken, im Februar 2017Christoph Gerhard
Danksagung
Der Autor dankt allen Mitstreitern, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Oberhausener Palliativdienst, insbesondere Anna Baagt, Sandra Förster und Friedhelm Gores, für die gemeinsame unermüdliche Arbeit an diesem Konzept.
Er dankt allen seinen Lehrern. Prof. Friedemann Nauck, Martina Kern und Monika Müller haben während der Kurse in Bonn und Frauenchiemsee den Grundstock zu seiner palliativen Arbeit gelegt. Neben seinen Patienten, den wichtigsten Lehrern überhaupt, waren es vor allem seine vieles hinterfragenden und diskutierenden Studenten bzw. Kursteilnehmer, die er unterrichten durfte, die Teams von anderen Krankenhäusern, mit denen er in Inhouse-Schulungen das Konzept des Palliativdienstes zu implementieren half, sowie Mitglieder gemeinsamer überregionaler Arbeitsgruppen, die ihn im Ringen um gute palliative Lösungen im Krankenhaus ständig weiterbrachten.
Der Autor dankt den vielen Mitstreitern, die ihn bei seinen Projekten für mehr Palliativkultur im Krankenhaus begleitet haben, seiner Krankenhausleitung: Geschäftsführer Michael Boos, Pflegedirektorin Bernadett Berger, Leiter medizinische Entwicklungen Dr. med. Holger Ernst, und, stellvertretend für viele andere, Herrn Dr. med. Thomas Kaden, dem internistischen Oberarzt, der auf vorbildliche Weise immer bereit war, Patienten gemeinsam und eng vernetzt auf Augenhöhe parallel palliativ und kurativ zu versorgen.
Der Autor dankt seinem großen Motivator, dem besten Lektor, den man sich vorstellen kann, Jürgen Georg, der dieses Projekt auch über manche Verzögerung hin immer nachhaltig unterstützt hat und nie das Vertrauen in den Autor verlor.
Der Autor dankt dem Redakteur Michael Herrmann für die ausgezeichnete, akkurate und akribische Redaktion des Manuskripttextes sowie Martina Kasper für die detaillierte Erstellung des Sachwortverzeichnisses.
Einleitung
Im deutschen Sprachraum sterben die meisten Menschen im Krankenhaus. Daher sind die Sterbebedingungen in Krankenhäusern von überragender Bedeutung dafür, wie die meisten von uns sterben können. Pioniere der Palliativversorgung, wie etwa Elisabeth Kübler-Ross, konnten vor ca. 50 Jahren feststellen, wie stark das Sterben im Krankenhaus tabuisiert ist. Die Hospizbewegung war damals ausgezogen als Protestbewegung gegen die Tabuisierung des Todes und die schlechten Sterbebedingungen in den Krankenhäusern. Inzwischen hat sie sich mächtig entwickelt und professionalisiert. Zum bürgerschaftlichen Engagement kam das professionelle Engagement der Gesundheitsberufe hinzu, die für gute Palliativversorgung stehen. Allerorts wurden Hospizinitiativen, stationäre Hospize und Palliativstationen gegründet. Die ersten derartigen Einrichtungen im deutschen Sprachraum waren 1983 die erste Palliativstation Deutschlands in Köln und 1986/87 die ersten deutschen Hospize in Aachen und Recklinghausen. Damals wurde eine großangelegte Studie zur Versorgung Sterbender im Krankenhaus durchgeführt, die 1988 erschreckende Ergebnisse lieferte. Dabei wurden Akteure des Krankenhausalltags differenziert zu den Sterbebedingungen befragt (George et al., 2013). Dieselbe Studie wurde 2013 wiederholt und ergab in diesem 25-Jahreszeitraum auf ernüchternde Weise keine wesentliche Verbesserung der Versorgung Sterbender im Krankenhaus. Es zeigte sich zwar eine Verbesserung der Sterbebedingungen für die ganz wenigen Menschen, die auf einer Palliativstation sterben konnten, aber nicht für die überwiegende Mehrheit der Krankenhauspatienten, die außerhalb einer Palliativstation sterben. Es ist uns anscheinend in den vergangenen Jahren gelungen, eine Verbesserung der spezialisierten Palliativversorgung auf Palliativstationen zu erreichen. Die palliative Versorgung in der Breite außerhalb der Spezialsettings scheint dabei allerdings auf der Strecke geblieben zu sein. Warum erweist sich das Krankenhaus in seiner Gesamtheit als so starr und nimmt die Möglichkeiten der Verbesserung der Sterbebedingungen durch moderne Palliativversorgung nicht auf? Ein Grund könnte sein, dass Krankenhäuser sich als Orte des Heilens und nicht des Sterbens definieren bzw. ihnen diese Definition von der Gesellschaft zugeschrieben wird. Es ist daher nur naheliegend, dass Krankenhäuser das Sterben in spezielle Palliativstationen ausgrenzen. Dies sind dann besondere Orte, an denen es in Krankenhäusern möglich ist, ganz und gar das palliative Paradigma der ganzheitlichen Umsorgung, der Linderung statt Heilung zu verwirklichen. Das übrige Krankenhaus und damit die größte Zahl der Sterbefälle bleiben dabei leider unberücksichtigt. Dort ist Sterben immer noch eine Art Betriebsunfall in einer Welt des Heilens.
Wie kann es gelingen, Palliativversorgung auch und vor allem dort zu verwirklichen, wo das Paradigma des Heilens dominiert? Dies sind die ganz normale Krankenhausstation oder die Intensivstation als sehr häufige Sterbeorte des Krankenhauses. Wird dort gute Versorgung unheilbar kranker und sterbender Menschen als Scheitern des Anspruchs auf Heilung erlebt? Stört der Sterbende die schnelllebige, mit Pathways durchökonomisierte Welt des Krankenhauses? Sicherlich sind diese unterschiedlichen Paradigmen der Heilung und Rettung im Gegensatz zum Begleiten statt Verhindern des Sterbens eine sehr große Herausforderung. Zwischen Palliativversorgung und Krankenhausmedizin bestehen daher grundsätzliche Unterschiede. Krankenhausmedizin hat sich in den vergangenen Jahrhunderten immer mehr der naturwissenschaftlichen Analyse der Krankheitssituation und ihrer möglichst zielführenden Reparatur verschrieben. Palliativversorgung betont dagegen in ihrer radikalen Patientenorientierung die Lebenswelt des Betroffenen, in die es einzutauchen gilt. Diese Lebenswelt ist umfassend und ihr ist keineswegs nur mit Mitteln der Naturwissenschaften beizukommen. Das Naturwissenschaftliche spielt sogar eine eher untergeordnete Rolle in diesem lebensweltlichen Zugang der Palliativversorgung. Dagegen spielen sozialwissenschaftlich fundierte Aspekte, wie Haltung, Empathie, Klientzentrierung, besonderes Eingehen auf kommunikative Bedürfnisse, Spiritualität sowie systemische oder existenzialistische Betrachtungen nicht nur des Betroffenen, sondern auch seines Umfelds, eine überragende Rolle, wie uns die WHO-Definition der Palliative Care zeigt. Versucht die Krankenhausmedizin, um eine möglichst gute Heilung und/oder Verlaufsmodifikation der Erkrankung des Betroffenen zu erreichen, dessen Probleme operationalisierbar zu machen und damit auf Symptome und Diagnosen einzuengen, so versucht Palliativversorgung einen möglichst weiten Blick auf die einmalige Lebenswelt einzunehmen.
Wie kann es gelingen, diese beiden höchst unterschiedlichen Welten miteinander zu vereinen, ihre Gegensätze auszuhalten und zu versöhnen? Die Aufgabe ist enorm. Die Studiendaten aus den Jahren 1988 und 2013 von George et al. (2013) zeigen dies nur zu deutlich, denn das Krankenhaus als System scheint recht resistent gegen eine Verbesserung der Sterbebedingungen zu sein, wenn man von den Ausnahmen, den Oasen der Palliativversorgung, wie sie Palliativstationen darstellen, einmal absieht. Durch die zunehmende Ökonomisierung des Krankenhauses in den vergangenen Jahrzehnten wird der Gegensatz der Versorgungsansätze noch größer, denn die Ökonomie zielt durch ihre Fallpauschalenlogik weg von einer Rundumversorgung des bedürftigen Menschen auf eine problemzentrierte Versorgung der Hauptdiagnose in handhabbarer Zeit nach vorgegebenen Standards. Im Gegensatz zum weiten lebensweltlichen Zugang der Palliativversorgung wird die Versorgung der Krankenhausmedizin doppelt eingeengt, und zwar nicht nur auf naturwissenschaftlich Analysierbares, sondern auch auf ökonomisch standardisierte Abläufe – zum Teil unter erheblichem Zeitdruck, da Zeit kostet und ggf. durch Rationalisierung einzusparen ist. Dabei ist gerade die vorhandene Zeit die wichtigste Ressource der Palliativversorgung, durch die das Eintauchen in die Lebenswelt der Betroffenen überhaupt erst möglich wird. Das palliative Paradigma des „high person – low technology“, also der ausgeprägten, zeitaufwendigen, persönlichen Zuwendung statt technisierter Vorgänge, macht es überdeutlich.
In dieser Gemengelage ist es nur zu verständlich, dass Krankenhäuser immer öfter Palliativstationen gründen als Orte, an denen Palliativversorgung in Reinkultur gedeihen kann. Das gesamte multiprofessionelle Team denkt dort palliativ. Patienten sind dort meist in einer überwiegend palliativen Phase, das heißt, sie benötigen fast nie parallel auch lebensverlängernde bzw. kurative Interventionen. In der Regel werden an diesen Orten sterbende Tumorpatienten und vielleicht einige wenige Nichttumorpatienten, etwa mit amyotropher Lateralsklerose, einer selteneren neurologischen Erkrankung, sehr gut multiprofessionell lindernd nach dem Total-Pain-Modell von Cicely Saunders entsprechend ihrer körperlichen, psychosozialen und spirituellen Bedürfnisse versorgt. Palliative Arbeitsprinzipien können in dieser „Monokultur“ hervorragend entwickelt werden. Nachteil ist die Versorgung von nur wenigen Menschen, fast nur Tumorpatienten und auch das in der Regel nur, wenn ihre tumorspezifischen Therapien abgeschlossen sind. Andere Adressaten der Palliativversorgung, wie etwa die absolut überwiegende Zahl der in einem Krankenhaus Versterbenden, werden dabei vergessen.
Im Gegensatz zu der weiter steigenden Zahl von Palliativstationen gehen palliative Organisationsentwicklungen, insbesondere die Verbreitung von Palliativdiensten, die Patienten überall im Krankenhaus mitbetreuen, eher schleppend voran. Selbst wo Palliativdienste vorhanden sind, kämpfen diese darum, die Patienten wirklich auf Augenhöhe parallel mitbetreuen zu dürfen und nicht erst kurz vor der Entlassung oder wenige Tage vor dem Versterben hinzugerufen zu werden.
Nach dem Motto „Palliativversorgung für alle, die sie brauchen“ sollte Palliativbetreuung im Krankenhaus nicht nur mehrheitlich Tumorpatienten am Lebensende auf Palliativstationen angeboten, sondern auch nachhaltig auf andere Gruppen ausgedehnt werden: auf die vielen Nichttumorpatienten, auf Patienten, die eine Leidenslinderung benötigen, aber noch in erheblichem Umfang auch lebensverlängernde bzw. kurativ intendierte Therapien erhalten, aber auch auf Tumorpatienten in früheren Erkrankungsphasen. Studien von Temel et al. (2010) zeigen eindrücklich, dass die frühe Integration der Palliativversorgung parallel zur onkologischen Therapie bei Menschen mit Bronchialkarzinom deren Leiden lindert, weniger onkologische Therapien erforderlich macht und sogar das Leben verlängert. Die Herausforderung besteht also im Anbieten von Palliativversorgung parallel zur lebensverlängernd bzw. kurativ intendierten Behandlung. Palliativversorgung muss daher parallel zu lebensverlängernden bzw. kurativ intendierten Therapien schon frühzeitig in die Krankenversorgung implementiert werden. Das heißt, Palliativdienste müssen schon frühzeitig einbezogen werden.
In Krankenhäusern ist man gewohnt, dass es klare Zuständigkeiten gibt, dass der Patient entweder operativ versorgt wird und auf der chirurgischen Station liegt oder konservativ versorgt wird und auf der internistischen Station ist oder zur Leidenslinderung bzw. ganzheitlichen Umsorgung nahe dem Lebensende auf eine Palliativstation verlegt wird. Die frühzeitige Integration von Palliative Care in die Versorgung fortschreitend lebensbedrohlich erkrankter Menschen (WHO-Definition) erfordert aber eine parallele Zuständigkeit kurativ und palliativ Tätiger sowie deren enge Vernetzung – und dies ist für die Krankenhauskultur eine neue Herausforderung. Hier müssen nämlich nicht nur unterschiedliche Akteure, sondern unterschiedliche Denkweisen vernetzt werden. Dies bedeutet für das System Krankenhaus einen Paradigmenwechsel.
Dieses Buch widmet sich sehr intensiv den Schwierigkeiten und Chancen des Aufbaus eines Palliativdienstes bzw. der Förderung palliativer Kultur im gesamten Krankenhaus. Im 1. Kapitel wird aufgezeigt, wie Palliativdienste aufgebaut und verortet sein müssen, um durch die gegenwärtigen Finanzierungssysteme refinanzierbar zu sein. Im 2. Kapitel wird der Gegensatz kurativen und palliativen Handelns im Krankenhaus mit Bezügen auf die historische Entwicklung des Krankenhauses und der Palliativversorgung verdeutlicht. Im 3. Kapitel wird skizziert, wie es durch Haltung gelingen kann, diese Gegensätze in einer Parallelität kurativen und palliativen Denkens zu überwinden. Im 4. Kapitel werden aus der Praxis spezifische Arbeitsweisen des Palliativdienstes sowie spezielle Schritte dargestellt, die beim Aufbau und im Alltag nötig sind, um diese schwierigen Aufgaben als gut vernetztes, effektiv arbeitendes interprofessionelles Team im Alltag zu handhaben. Im 5. Kapitel wird gezeigt, wie Palliativdienste einen anderen Umgang mit Schmerzen und Symptomen im Krankenhaus in einer suchenden Haltung und Offenheit gegenüber palliativen Versorgungsbedürfnissen ermöglichen können. Im 6. Kapitel steht das Thema „Autonomie“ im Vordergrund. Praxisnah werden einige Möglichkeiten dargestellt, wie Palliativdienste mehr Autonomie für die Betroffenen im Alltag erreichen können, etwa durch Prozesse des Advance Care Planning. Im 7. und letzten Kapitel werden die besonderen Chancen des Palliativdienstes dargestellt, nämlich die Betreuung von Patientengruppen, die niemals auf einer Palliativstation betreut werden könnten. Zunächst geht es um die Vorteile und Rahmenbedingungen von Palliativstationen, dann um die besonderen Chancen von Palliativdiensten nicht anstatt, sondern zusätzlich zur Palliativstation. Es werden zahlreiche beispielhafte Situationen gezeigt, in denen die Betroffenen bisher selten oder gar nicht palliativ versorgt werden. Es wird dargestellt, was die vernetzte palliative Versorgung von Menschen mit einer Demenz, nach einem Schlaganfall, mit Herzinsuffizienz, COPD, Niereninsuffizienz, Parkinson-Krankheit, Multipler Sklerose leisten kann, womit einige häufig „vergessene“ Problemstellungen bezüglich der Palliativversorgung im Akutkrankenhaus näher beschrieben werden. Zum Abschluss werden die besonderen Herausforderungen einer Palliativversorgung auf der Intensivstation dargestellt.
Dieses Buch möchte in keiner Weise ein Lehrbuch der Palliativ Care ersetzen, sondern sich ganz bewusst der Frage widmen, wie es gelingen kann, die Versorgung palliativbedürftiger Menschen im Krankenhaus (auch außerhalb einer Palliativstation) zu verbessern. Es gibt dem Leser Praxiswissen, wie eine Kultur palliativer Mitbehandlung im Krankenhaus aufgebaut und verstetigt werden kann. Es zeigt, was zur Implementierung eines Palliativdienstes nötig ist. Dabei greift der Autor nicht nur auf aktuelle Evidenzen aus der Literatur und Entwicklungen der Krankenhausfinanzierung zur besseren Palliativversorgung im Krankenhaus, sondern insbesondere auf seine eigenen Erfahrung bei der Implementierung und Verstetigung seines Palliativdienstes in Oberhausen und auf seine Inhouse-Schulungen und Organisationsberatung verschiedener Palliativdienste außerhalb zurück.
1. Definitionen und Abrechnungsmöglichkeiten des Palliativdienstes
Historisch gesehen war der Palliativdienst im Krankenhaus eine der frühen Strukturen professioneller Palliativversorgung. Bereits 1974 wurde im St.Louis Hospital in New York das erste „Hospital Support Team“ gegründet. Dies war ein Jahr vor der ersten Palliativstation, die Balfour Mount 1975 in Montreal gründete. Der Name „Hospital Support Team“ drückt bereits einige Charakteristika des Palliativdienstes aus. Er soll als Unterstützung (Support) im Krankenhaus zur Standardversorgung hinzukommen. Dass sich diese an sich sehr alte Idee im deutschen Sprachraum so schwer durchsetzen konnte, viel schwerer als das ein Jahr später entwickelte Konzept der Palliativstation, verwundert zunächst. Macht man sich allerdings die enormen Gegensätze zwischen den Haltungen der Standardkrankenhausversorgung und dem palliativen Paradigma klar, wie sie in der Einleitung dargestellt wurden, scheint es nur zu verständlich, dass es die Insellösung der Palliativstation wesentlich leichter hatte, sich durchzusetzen. Man hat die Gegensätze einfach durch Schaffung einer eigenen, abgespaltenen Einheit gelöst. Der dabei in Kauf genommene Nachteil ist groß: Es dürfen eben nur einige wenige Auserwählte von dieser abgespaltenen Einheit profitieren und an der Kultur des jeweiligen Krankenhauses ändert sich zunächst wenig. Auch in Ländern mit einer längeren palliativen Entwicklung, in denen das Palliativdienstkonzept mittlerweile sehr viel verbreiteter ist und wesentlich stärker implementiert wurde, wie etwa Großbritannien, scheint das Konzept in der Praxis noch immer nur auf einem sehr steinigen Weg umsetzbar. So beschreiben Sara Booth und Mitarbeitende an ihrem hervorragenden Buch „Palliative Care in the Acute Hospital Setting“ (Oxford, 2010) eindringlich, wie viel schwieriger und unbeliebter die Arbeit im Krankenhausteam im Vergleich zu anderen palliativen Settings bei den Mitarbeitenden ist.
Nachdem das Konzept Palliativdienst in Deutschland zwar schon recht frühzeitig implementiert wurde (vgl. Aulbert et al., 2011), führte es im deutschen Sprachraum lange eher ein Schattendasein. Während zunehmend Palliativstationen aufgebaut wurden, waren es nur wenige Institutionen, die ausschließlich oder überwiegend mittels Palliativdiensten im Krankenhaus arbeiteten (z.B. das Interdisziplinäre Zentrum für Palliativmedizin an der LMU München in der Anfangsphase), während die allermeisten sich überwiegend einer Palliativstation widmeten und vielleicht nebenbei auch einen Palliativdienst hatten.
Bereits zwischen 2006 und 2009 hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit ein Fachprogramm „Palliativversorgung in Krankenhäusern“ erstellt. Darin werden bereits Palliativmedizinische Dienste, wie es hier noch heißt, für alle Krankenhäuser gefordert, die mit der Behandlung und Begleitung Schwerkranker und Sterbender konfrontiert sind. Palliativmedizinische Dienste werden definiert und, falls sie die entsprechenden Kriterien erfüllen, in den Krankenhausplan für Bayern aufgenommen.
Durch die im Mai 2015 veröffentlichte S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer unheilbaren Krebserkrankung hat sich die Situation noch weiter grundlegend geändert und wurde jetzt für den gesamten deutschen Raum und nicht nur für ein Bundesland definiert. Ein hoch anerkanntes Expertengremium hat sich klar auf der Grundlage wissenschaftlicher Evidenzen geäußert, dass jedes Krankenhaus, das unheilbar Krebserkrankte behandelt, einen Palliativdienst anbieten soll. Es verwundert daher nicht, dass die Finanzierung der Palliativdienste in Krankenhäusern nur 6 Monate später im Hospiz- und Palliativgesetz in Deutschland geregelt wurde. Bereits im Herbst 2016 wurde zwischen den Verhandlungspartnern eine neue Komplexpauschale für Palliativdienste im Krankenhaus vereinbart und in den OPS-Kode aufgenommen. Bereits ab 2017 können Krankenhäuser individuell danach abrechnen.
So positiv diese Entwicklung Palliativdienste fördern wird, so schwierig bleibt die tatsächliche Integration der gegensätzlichen Kulturen im Krankenhaus. Es ist für die Entwicklungen und die beteiligten Akteure vor Ort außerordentlich hilfreich, dass in der neuen Komplexpauschale unumstößliche Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die Palliativdienste erfüllen müssen, damit die Krankenhäuser sie abrechnen können. So genügt es nicht, dass ein engagierter Schmerztherapeut oder Onkologe, der auch den Palliativkurs besucht hat, zusammen mit einer Pflegeperson, die irgendwo im Krankenhaus arbeitet, ab und zu mal nebenbei aus persönlichem Engagement palliativ zu versorgende Patienten behandelt, ohne dass sie dafür ein fest zugewiesenes Arbeitszeitkontingent haben. Palliativversorgung ist jetzt glücklicherweise als etwas geregelt, was man eben nicht aus Gutmenschentum nebenbei macht, sondern für das klare Arbeitsstrukturen und Qualifikationsprofile erfüllt werden müssen, wie in jeder anderen Fachabteilung im Krankenhaus auch. Palliativdienste wurden damit auf ein ebenbürtiges Niveau mit anderen Krankenhausstrukturen und Fachabteilungen gesetzt.
Die genauen Regelungen werden anschließend im Einzelnen beschrieben. Es gilt, diese neuen Rahmenbedingungen positiv zu nutzen, um die schwierige Integration palliativer Denkweisen und Strukturen im Alltag gestärkt voranbringen zu können. Ziel sollte dabei stets der Aufbau einer echten palliativen Kultur und Versorgungsform sein, von der die Betroffenen wirklich maßgeblich profitieren, und nicht bloß die Abrechnung einer weiteren neuen Fallpauschale, deren Vorgaben gerade mal so eben erfüllt werden. Die Fallpauschale sollte also nicht Ziel, sondern hilfreicher Motor der Entwicklung sein.
1.1 Komplexpauschale OPS 8-982 – erste Abrechnungsmöglichkeit für den Palliativdienst?
Bis 2010 wurden Palliativstationen als besondere Einrichtungen nach tagesgleichen Pflegesätzen finanziert, das heißt nicht nach einer bestimmten Fallpauschale, wie im DRG-System sonst üblich, sondern nach einem Tagessatz, der die gesamte Versorgung abdecken soll. Im Jahre 2005 wurde ein spezieller OPS, ein Operationen- und Prozedurenschlüssel, eingeführt. Der OPS ist die amtliche Klassifikation zum Verschlüsseln von Operationen, Prozeduren und allgemeinmedizinischen Maßnahmen im stationären Bereich und beim ambulanten Operieren. In dieser Systemlogik wurde die palliativmedizinische Komplexbehandlung als eine neue Prozedur eingefügt und nach einer Erprobungsphase ab 2010 abrechenbar gemacht. Eine Abrechnung ist allerdings erst möglich, wenn der Patient sich über 7 Tage in palliativmedizinischer Betreuung befindet und besondere Kriterien erfüllt sind.
Im OPS 8-982 werden keine genaueren Kriterien für die Struktur genannt, die die palliative Versorgung im Krankenhaus anbietet. Daher können sowohl Palliativstationen als auch Palliativdienste nach dieser Pauschale abrechnen, sofern sie besondere Kriterien erfüllen. Damit war 2010 erstmals im deutschen Gesundheitssystem die Abrechenbarkeit von Leistungen, die Palliativdienste erbringen, grundsätzlich möglich. Palliativdienste werden häufig erst kurz vor der Entlassung oder dem Versterben hinzugezogen. Selbst wenn die Akzeptanz und frühe Integration eines Palliativdienstes durch Maßnahmen der internen Öffentlichkeitsarbeit, wie sie in Kapitel 4 beschrieben werden, erhöht wird, bleibt immer noch eine beträchtliche Anzahl von Patienten, die kürzer als 7 Tage im Palliativdienst versorgt werden und damit nicht abgerechnet werden können.
Von der Strukturqualität wird im OPS 8-982 in Ansätzen ein multiprofessionelles Team, nämlich die Leitung durch einen Facharzt mit der Zusatzbezeichnung „Palliativmedizin“, besonders geschultes Pflegepersonal und unterschiedliche Therapiebereiche, wie Sozialarbeit, Psychologie, Physiotherapie, künstlerische Therapie oder Entspannungstherapie bzw. Patienten, Angehörigen- und Familiengespräche gefordert. Da mindestens zwei Therapiebereiche beteiligt sein müssen und die Patienten- bzw. Angehörigengespräche als Therapiebereich von allen Berufsgruppen durchgeführt werden können, müssen de facto mindestens drei Berufsgruppen beteiligt sein, nämlich fachlich spezialisierte Medizin, Pflege und ein weiterer Bereich (z. B. Sozialarbeit, Physiotherapie, künstlerische- oder Entspannungstherapie). Allerdings sind bis auf die gemeinsame Teambesprechung und die gemeinsame wochenbezogene Dokumentation keine weitergehenden Anforderungen an die Teamvernetzung gegeben. Rein theoretisch kann ein Arzt, der über die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin verfügt, zusammen mit einer Pflegeperson mit Zusatzausbildung in Palliativmedizin, die irgendwo im Haus arbeitet und für gewisse Stundenkontingente freigestellt ist, sowie Therapeuten auf Anforderung die Komplexpauschale erfüllen, ohne dass wirklich ein eigenständiges Team besteht.
Der OPS war damit ein gutes Signal, das als ersten Schritt die Abrechenbarkeit von Palliativdiensten ermöglichte, aber sowohl bezüglich der mangelnden Anforderungen an die eigenständige Fachlichkeit des Palliativteams und die Teambildung/Vernetzung als auch bezüglich der 7-Tage-Grenze, ab der erst eine Abrechnung erfolgen kann, noch suboptimal war. Außerdem wurde im OPS nicht zwischen Leistungen, die auf einer Palliativstation erbracht wurden, und Leistungen im Palliativdienst unterschieden, was zu einer Ungerechtigkeit in der Abrechnung führte, da die Strukturen einer Palliativstation zweifellos aufwendiger sind. Es war demzufolge nur konsequent, dass 2013 ein eigener OPS 8-98e für Palliativstationen gebildet wurde, in dem eine klare Strukturqualität, wie sie auf Palliativstationen üblich ist, mit eigenen Betten (mind. 5), eigenem Team, Rufdienst etc. vorgegeben wurde. Tabelle 1-1 und 1-2 zeigen die beiden OPS 8-982 und 8-98e im Originaltext.
1.2 Palliativdienste im Bayerischen Fachprogramm 2009
Das Fachprogramm hat eine bedarfsgerechte, verbesserte stationäre Versorgung Schwerkranker und Sterbender in Krankenhäusern zum Ziel. In dem Programm werden explizite Qualitätskriterien für palliativmedizinische Dienste genannt, die für alle Krankenhäuser in Bayern in Frage kommen, die Schwerkranke und Sterbende behandeln und begleiten, was nahezu allen Akutkrankenhäusern entsprechen dürfte.
Als Strukturqualität werden ein Facharzt mit Zusatzweiterbildung Palliativmedizin, eine Pflegekraft mit abgeschlossenem 160-Stunden-Palliativkurs und ein Sozialarbeiter/Sozialpädagoge mit Kenntnissen im Case Management von Palliativpatienten (Palliative-Care-Zusatzweiterbildung erwünscht) genannt. Der palliativmedizinische Dienst muss zu den üblichen Arbeitszeiten untertags erreichbar sein. Hiermit wird eine klarere Strukturqualität als im OPS 9-982 gefordert, denn es muss ein erreichbarer Palliativdienst existieren und es genügt nicht mehr, die einzelnen Berufsgruppen zusammenzuwürfeln.
Die Kriterien der Prozessqualität lehnen sich eng an den OPS 8-982 an. Zusätzlich zu den Kriterien des OPS werden folgende wichtige Punkte herausgestellt:
Betreuung von Palliativpatienten unabhängig von ihrer Grunderkrankung, also auch Einschluss von NichttumorpatientenEntlassungsplanung in enger Vernetzung mit ambulanten und stationären Strukturen (Pflegedienste, Pflegeheime, stationäre Hospize)regelmäßige und nicht nur wochenbezogene Dokumentation der palliativmedizinischen Leistung mit standardisierten Symptom- und Symptomverlaufsdokumentationen in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Stationenregelmäßige Fortbildung und regelmäßige SupervisionKooperationsvereinbarung mit einem örtlichen ambulanten Hospiz und/oder Palliativdienst, ggf. auch einem Team der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV).Die angeführten Punkte sind keineswegs lapidar, denn sie fordern neben klareren Strukturmerkmalen eine intensive Vernetzung und Integration des Palliativdienstes. So soll dieser zusammen mit den betroffenen Stationen regelmäßig Symptome und Symptomverläufe dokumentieren, wodurch bereits eine engere Verzahnung mit dem Alltagsgeschehen gefordert wird. Die Einbettung palliativen Handelns in eine umgebende Landschaft palliativer Strukturen mittels Kooperationsvereinbarungen und Entlassungsplanung fördert die kontinuierliche Patientenversorgung in unterschiedlichen Settings ohne Brüche. Aber auch Elemente der Reflexion des eigenen Handelns und der kontinuierlichen Weiterentwicklung werden durch die Forderung nach regelmäßiger Supervision und Fortbildung einbezogen. Die Verbindlichkeit der genannten Qualitätskriterien ist hoch, denn sie müssen erfüllt sein, damit ein Palliativdienst in den Krankenhausplan Bayern aufgenommen wird.
1.3 Der Palliativdienst in der S3-Leitlinie 2015
Die S3-Leitlinie „Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung“ wurde in dem Leitlinienprogramm Onkologie von allen maßgeblich an der Versorgung beteiligten Fachgesellschaften gemeinsam erstellt. Dabei wurden alle verfügbaren wissenschaftlichen Evidenzen nach strukturierten Verfahren gesammelt und in einem moderierten, strukturierten Entscheidungsprozess zu Empfehlungen zusammengefasst. Bei S3-Leitlinien gelten ausgesprochen anspruchsvolle „Spielregeln“, wie man zu den Empfehlungen gelangt. Die Literatursuche muss nach ausgefeilten Kriterien durchgeführt werden. International bereits vorhandene Leitlinien zu diesem Thema müssen nach geregelten Kriterien gesucht und berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung und Wichtung der gefundenen Literaturstellen erfolgt nach eindeutigen Kriterien. Der Konsensprozess zu einer Empfehlung wird moderiert und findet nach klaren Regeln statt. Die Stufe der S3-Leitlinie ist daher neben S1- und S2-Leitlinien die höchste, die es gibt. Wenn eine so hochrangige Leitlinie im Konsens aller beteiligten Fachgesellschaften zu einem Thema Stellung bezieht, so hat das einen hohen Empfehlungscharakter. Es kann sogar als vorweggenommenes Sachverständigengutachten in entsprechend strittigen Verfahren gesehen werden. Für die Akteure vor Ort besteht Erklärungsbedarf, wenn man die Leitlinie völlig unberücksichtigt lässt. Daher ist die Anschubwirkung auf die weitere Verbreitung von Palliativdiensten insbesondere auch in Krankenhäusern, die über keine Palliativstation verfügen, als sehr hoch anzusehen.
Betrachten wir nun die Empfehlungen im Einzelnen. So sind unter Punkt 11.5.4.2 Palliativdienste im Krankenhaus in der Leitlinie niedergelegt. Sie sind in die Empfehlungen 11.23 bis 11.29 untergliedert.
Empfehlung 11.23 definiert den Palliativdienst und beruht auf einem Expertenkonsens. Es wird klar gestellt, dass der Palliativdienst eine Form der stationären, spezialisierten Palliativversorgung ist. Zielgruppe sind demnach Patienten mit einer unheilbaren Erkrankung und begrenzter Lebenszeit, die nicht auf einer Palliativstation behandelt werden. Der Palliativdienst steht nach dieser Definition zur begleitenden Mitbehandlung in ein- oder mehrmaligen Visiten mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensqualität zur Verfügung.
Diese Empfehlung unterscheidet den Palliativdienst bereits deutlich von dem, was im OPS 8-982 gefordert wird. Statt der 7-Tage-Grenze, ab der eine Abrechnung möglich ist, spricht man hier von einer oder mehreren Visiten, was impliziert, dass durchaus kürzere Betreuungszeiten im Fokus stehen können.
Empfehlung 11.24 formuliert die evidenzbasierte Forderung, dass jedes Krankenhaus, das Patienten wegen einer unheilbaren Krebserkrankung behandelt, einen Palliativdienst anbieten soll. Da nahezu alle Allgemeinkrankenhäuser unheilbar Krebserkrankte behandeln, dürfte dies eine sehr große Zahl an Krankenhäusern sein. Nicht davon betroffen dürften lediglich Fachkrankenhäuser, zum Beispiel für Psychiatrie etc., sein. Es sind damit im Grunde genommen die gleichen Bedingungen wie im Bayerischen Fachprogramm.
Empfehlung 11.25 spricht sich aufgrund von Evidenzen dafür aus, dass Patienten mit unheilbarer Krebserkrankung während eines stationären Aufenthalts Kontakt mit einem Palliativdienst angeboten werden soll. Hier wird bereits ein wesentliches Kriterium genannt, dass sozusagen aufsuchend allen Patienten mit unheilbarer Tumorerkrankung das Angebot gemacht werden soll, statt eine besonders betroffenen Gruppe auszuwählen oder zu warten, bis sich Betroffene melden, weil sie es aufgrund erheblicher Symptome, Nöte etc. nicht mehr aushalten.
Empfehlung 11.26 nennt Komponenten einer Behandlung durch den Palliativdienst und dient zusätzlich zur weiteren klärenden Definition dessen, was ein Palliativdienst aufgrund von Evidenzen leisten soll:
Erfassung der Symptome und Bedürfnisse in allen vier Dimensionen von Patienten und AngehörigenBehandlung von Symptomen und Problemen in allen vier Dimensionenressourcenorientierte Unterstützung des Patienten und seiner Angehörigen, vor allem bei der Therapiezielfindung und der Auseinandersetzung mit der Krankheitvorausschauende VersorgungsplanungKoordination bzw. Organisation der PalliativversorgungMitbegleitung in der SterbephaseRituale des Abschiednehmens und ErinnernsVermittlung von TrauerbegleitungUnterstützung der Mitglieder des primären Behandlungsteams.In dieser Aufzählung werden wesentliche Merkmale von Palliativversorgung aufgeführt, wie sie bereits in der WHO-Definition genannt werden, nämlich die multidimensionale Erfassung und Behandlung von Symptomen und Problemen, die Unterstützung von Patienten und Angehörigen sowie die Trauerbegleitung. Zum direkten Vergleich sei die WHO-Definition dargestellt (s. Kasten). Besonders ist darauf hinzuweisen, dass die frühe Integration der Palliativversorgung parallel zu lebensverlängernden Therapien bereits in diese Definition aus dem Jahre 2002, also 8 Jahre vor der Veröffentlichung der Studie von Temel et al. (2010), einbezogen wurde.
WHO-Definition 2002(Übersetzung: Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin)
Palliativmedizin ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, welche mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Dies geschieht durch Vorbeugen und Lindern von Leiden durch frühzeitige Erkennung, sorgfältige Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen Problemen körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art. Palliative Care …
… ermöglicht Linderung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen.… bejaht das Leben und erkennt Sterben als normalen Prozess an.… beabsichtigt weder die Beschleunigung noch Verzögerung des Todes.… integriert psychologische und spirituelle Aspekte der Betreuung.… bietet Unterstützung, um Patienten zu helfen, ihr Leben so aktiv wie möglich bis zum Tod zu gestalten.… bietet Angehörigen Unterstützung während der Erkrankung des Patienten und in der Trauerzeit.… beruht auf einem Teamansatz, um den Bedürfnissen der Patienten und ihrer Familien zu begegnen, auch durch Beratung in der Trauerzeit, falls notwendig.… fördert Lebensqualität und kann möglicherweise auch den Verlauf der Erkrankung positiv beeinflussen.… kommt frühzeitig im Krankheitsverlauf zur Anwendung, auch in Verbindung mit anderen Therapien, die eine Lebensverlängerung zum Ziel haben, wie etwa Chemotherapie oder Bestrahlung, und schließt Untersuchungen ein, die notwendig sind, um belastende Komplikationen besser zu verstehen und zu behandeln.Zusätzlich zu den wichtigen Kernbereichen der Palliative Care, die bereits in der WHO-Definition enthalten sind, wird hier in der S3-Leitlinie explizit die vorausschauende Versorgungsplanung bzw. die Unterstützung bei der Therapiezielfindung genannt, beides Elemente des Advance Care Planning. Bei diesen Bereichen geht es vor allem um die Förderung der Autonomie der Betroffenen. In der WHO-Definition wird dieser Bereich noch nicht berücksichtigt. Wie im Kasten gezeigt, wird vor allem auf die Lebensqualität und die aktive Lebensgestaltung, aber noch nicht auf die vorausschauende Versorgungsplanung in Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Notfallausweisen etc. eingegangen, wie sie im Advance Care Planning mittels eines strukturierten Beratungsprozesses geleistet wird.
In der Empfehlung 11.27 geht es um Strukturqualitäten eines Palliativdienstes:
eigenständiges Teammultiprofessionelles Team mit mindestens drei Berufsgruppen: Ärzte, Pflegende und ein Vertreter eines weiteren Therapiebereichsein eigener Raum für Besprechungen und DokumentationErreichbarkeit zu den Regelarbeitszeiten des KrankenhausesKommunikation der Indikationskriterien, Teamstruktur, Erreichbarkeit und Arbeitsweise des Palliativdienstes an alle Abteilungen, die Patienten mit einer unheilbaren Krebserkrankung betreuen.Diese Strukturkriterien sind von besonderer Bedeutung, da hier klar festgelegt ist, dass Palliativdienste eigenständige Teams sind. Situationen, dass kein wirkliches Team besteht, sondern mehrere zusammengewürfelte Akteure mit Palliativausbildung nebeneinander her Palliativversorgung leisten, sind damit nicht gemeint. Ebenso wenig sind Situationen gemeint, in denen andere Teams, zum Beispiel der speziellen Schmerztherapie oder der geriatrischen bzw. neurologischen Frührehabilitation, mal eben noch Palliativversorgung mitleisten. Entsprechend der Komplexpauschale 8-982 und dem Bayerischen Fachprogramm werden mindestens drei Berufsgruppen gefordert, die an dem Team beteiligt sind. Das letzte Kriterium, nämlich dass der Palliativdienst seine Struktur und Arbeitsweise transparent an alle relevanten Fachabteilungen kommuniziert, ist als aufsuchendes Angebot der internen Öffentlichkeitsarbeit neu, aber von erheblicher Bedeutung für den Durchdringungsgrad im komplexen System Krankenhaus. Denn nur Akteure, die wissen, was ein Palliativdienst ist und wie er arbeitet, können diesen positiv für ihre Patienten nutzen und einbinden. Dieses Kriterium der transparenten Kommunikation geht über die Kriterien der Komplexpauschale 8-982 und das Bayerische Fachprogramm hinaus.
In Empfehlung 11.28 wird die Vernetzung zwischen dem Team der Primärbehandler und dem Palliativteam angesprochen. Die Beratung und Mitbehandlung durch den Palliativdienst soll danach in enger Abstimmung mit dem primär behandelnden Team erfolgen.
Diese Empfehlung ist sehr wichtig, da es ja nicht Sinn des Konzepts ist, dass zwei Teams nebeneinander her arbeiten, sondern dass eine engmaschige Vernetzung erfolgen sollte. Andernfalls kann die Situation für den betroffenen Patienten und seine Zugehörigen eher verwirrender werden, da er vom primär behandelnden Team und vom Palliativteam unterschiedliche und teilweise widersprüchliche Informationen erhält, da diese sich nicht abgestimmt haben. Auch könnte es im Rahmen der Pharmakotherapie zum Beispiel ungünstig sein, wenn das primär behandelnde Team eine Stimulation des Darms verfolgt und das Palliativteam im Sinne der Symptomlinderung bei ausgeprägten Bauchkrämpfen mit entsprechenden, dämpfenden Maßnahmen versucht, seine Symptome zu lindern. Es wäre, als würde jemand versuchen, auf der Autobahnauffahrt mit angezogener Handbremse auf hohe Geschwindigkeit zu beschleunigen. Es sollen nach dieser Empfehlung eben abgesprochene Synergien und keine gegensätzlichen, sich blockierenden Vorgehensweisen erreicht werden.
Empfehlung 11.29 beschreibt Maßnahmen der Qualitätssicherung bezüglich der Prozessqualität des Palliativdienstes. Durchgeführt werden sollen danach:
individualisierte Therapieplanungregelmäßige Evaluation des Therapiezielsregelmäßige Evaluation der durchgeführten Behandlungsmaßnahmenein Austausch mit zuweisenden und weiterführenden Behandelnden und Abstimmung mit stationären und ambulanten Versorgungs- und Therapieangebotenmultiprofessionelle, regelmäßige Teamtreffen zur Fallbesprechungeine gemeinsame multiprofessionelle Dokumentationdas Angebot einer externen Supervision für alle Teammitglieder.Diese internen und externen Evaluationsmaßnahmen dienen der ständigen Reflexion des eigenen Handelns und haben damit unschätzbare Bedeutung für die Akteure in einem so schwierigen Betreuungsfeld. Sie sollten daher keinesfalls vernachlässigt werden.
In der Langfassung der S3-Leitlinie findet sich noch ein ausführlicher Kommentar. Darin wird zunächst der Unterschied zwischen einer konsiliarischen Behandlung und einer Mitbehandlung durch den Palliativdienst betont. Im einen Fall handelt es sich eher um ein punktuelles Angebot, nämlich eine ausführliche Visite, der eine Beratung folgt, während der Palliativdienst eine kontinuierliche Mitbehandlung anbietet. Daher war es nur folgerichtig, dass der Name entsprechender Strukturen von Palliativkonsiliardienst in Palliativdienst geändert wurde. Die Mitbehandlung durch den Palliativdienst ähnelt eher einem Liaisondienst, wie er teilweise in der Psychiatrie betrieben wird, als dem klassischen Konsil.
Ebenso wird in dem Kommentar auf das entscheidende Thema eingegangen, ob ein Palliativdienst dann integriert wird, wenn entsprechende Versorgungsbedürfnisse (Symptome, psychosoziale Belastung, ethische Problemstellungen etc.) vorliegen oder bereits dann, wenn sich ein Patient mit entsprechend fortgeschrittenem, unheilbarem Tumor im Krankenhaus befindet. In der Praxis des Autors genügt es nicht, zu warten, bis sich ein Behandlungsteam meldet, weil ein betroffener Patient ausgeprägte Versorgungsbedürfnisse hat, sondern es ist notwendig, zugehende und aufsuchende Angebote, wie etwa tägliche Nachfragen, ob sich Menschen mit palliativem Versorgungsbedarf und/oder fortgeschrittenen Krankheitssituationen auf der jeweiligen Station befinden, beim Stationsteam in den Arbeitsablauf zu integrieren.
1.4 Palliativdienste im Hospiz- und Palliativgesetz 2015
Das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG), das Ende 2015 nahezu zeitgleich mit dem Gesetz zum Verbot geschäftsmäßiger Suizidbeihilfe verabschiedet wurde, hat eine Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland zum Ziel. Für Krankenhäuser sind zwei Regelungen von herausragender Bedeutung. Zum einen können eigenständige Palliativstationen krankenhausindividuelle Entgelte mit den Krankenkassen vereinbaren, sofern das Krankenhaus dies wünscht. Zum anderen können Krankenhäuser ab 2017 für Palliativdienste krankenhausindividuelle Zusatzentgelte vereinbaren. Ab 2019 wird es bundeseinheitliche Zusatzentgelte für Palliativdienste geben.
Während der OPS 8-982 eigentlich zunächst für Palliativstationen gedacht war, aber, da er keine bestimmte Struktur voraussetzt, auch für Palliativdienste abrechenbar war, wird nun im Hospiz- und Palliativgesetz erstmals eine spezielle Finanzierung für Palliativdienste in Aussicht gestellt.
1.5 Der neue OPS für Palliativdienste 2016
Weniger als ein Jahr nach der Verabschiedung des Hospiz- und Palliativgesetzes im Deutschen Bundestag konnten sich die Verhandlungspartner bereits auf einen neuen OPS für Palliativdienste einigen. Entsprechend dem Ziel des Hospiz- und Palliativgesetzes geht es ja nicht nur um eine Finanzierung, sondern vor allem um eine Verbesserung der Palliativversorgung. Daher werden im OPS sehr klare Strukturkriterien genannt, die ein Palliativdienst erfüllen muss, um nach dem neuen OPS abrechnen zu können.
Zunächst muss es sich um ein eigenständiges Team handeln. Zentral ist die Eigenständigkeit der Palliative Care bzw. Palliativmedizin. Im Sinne einer angemessenen Qualität kann es nicht mehr angehen, dass palliative Strukturen bloße Anhängsel einer anderen Fachabteilung sind, sondern sie müssen wirklich eigenständig sein. Neben der organisatorischen Eigenständigkeit dürfen diese Teams nämlich nicht einer anderen Fachdisziplin weisungsgebunden unterstellt sein, wie in einem Glossar der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zum OPS erläutert. Dies dürfte glücklicherweise zu einem Rückgang palliativer Pseudostrukturen führen, die ab und zu nebenbei und weitgehend nicht miteinander vernetzt palliative Konsile erbringen, ohne dass für sie ein entsprechendes Arbeitszeitkontingent besteht. Solche Pseudostrukturen können gegenwärtig noch versuchen, nach dem OPS 8-982 abzurechnen, dürften aber an den Kriterien des OPS 8-98h scheitern. Denn im neuen OPS werden feste Stellenkontingente und 24-Stunden-Erreichbarkeit gefordert. Damit dürften Palliativdienste eine Emanzipation von etwas, das man fast ehrenamtlich noch nebenbei macht, zu einer professionellen Struktur auf Augenhöhe mit den anderen Krankenhausstrukturen erfahren. Der neue OPS ist daher mehr als zu begrüßen. Die einzelnen Regelungen können Tabelle 1-3 der OPS-Kriterien nach DIMDI (Deutsches Institut für medizinische Dokumentation) entnommen werden.
Eingangs wird im OPS 8-98h angegeben, dass die Kodierung der Ziffer OPS 8-98h das Kodieren anderer OPS aus dem Palliativbereich, nämlich des OPS 8-982 oder des OPS 8-98e ausschließt. Damit ist gemeint, dass mehrere palliativmedizinische OPS-Kodes nicht zur selben Zeit kodiert werden können. Es ist aber durchaus möglich, dass derselbe Patient zunächst durch den Palliativdienst (nach OPS 8-98h) mitbehandelt wird, um dann später auf die Palliativstation verlegt zu werden (OPS 8-98e).
Festgeschrieben wurde in diesem OPS nochmals das Prinzip der aktiven, ganzheitlichen Behandlung auf verschiedenen Ebenen, wobei hier die Symptomkontrolle und die psychosoziale Stabilisierung konkret genannt werden. Es muss, wie in den anderen palliativen Komplexpauschalen auch, eine progrediente fortgeschrittene Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung vorliegen. Hier sind eben nicht nur die Krebserkrankung, sondern auch die fortgeschrittenen kardialen, pulmonalen, renalen, neurologischen und geriatrischen Erkrankungen eingeschlossen. Es geht eben beispielsweise auch um Menschen mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz, fortgeschrittener Parkinson-Krankheit, schwerem Schlaganfall, schwerer chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder terminaler Niereninsuffizienz. Der Zusatz „ohne Beeinflussung der Grunderkrankung“ meint hier, wie das Glossar der AG Stationäre Versorgung der DGP erläutert, dass die palliative Mitbehandlung keine kurative Intention hat. Es kann aber durchaus sein, dass die fallführende Krankenhausabteilung noch kurativ intendierte Behandlungen, wie etwa die antibiotische Behandlung einer Pneumonie, durchführt. Lediglich der Palliativdienst darf keine kurative Behandlungsstrategie verfolgen. Hier gilt es, sorgsam das Behandlungsziel zu analysieren und zu dokumentieren. Zum Beispiel könnte es der Symptombehandlung dienen, extrem schmerzhafte und belastende epileptische Anfälle unter palliativer Intention mit Antiepileptika zu behandeln, was dann das etwas andere Ziel der Symptombehandlung verfolgen würde, statt nur Antiepileptika zur klassischen Epilepsiebehandlung zu verordnen.
Besonders hervorzuheben sind mehrere Standards, die im neuen OPS gefordert werden. Zum einen findet sich in diesen Richtlinien das palliative Kernprinzip der Multiprofessionalität wieder, denn der Palliativdienst muss aus mindestens drei, besser mehr Berufsgruppen bestehen: Medizin, Pflege und Sozialarbeit/Physiotherapie/Psychotherapie. Wenn Palliativdienste wirklich die verschiedenen Bedürfnisebenen des Total-Pain-Modells (körperlich, psychisch, sozial, spirituell) abdecken sollen, brauchen sie, im Sinne einer umfassenden Versorgung nach dem Prinzip der Total Care als Antwort auf Total Pain, wirklich diese Multidimensionalität, die verschiedene Berufsgruppen als Team vernetzt gemeinsam leisten können. Daher ist es auch wichtig, dass die Teambildung bzw. Vernetzung als Kriterium über Teambesprechungen und die geforderte Bildung eines festen Teams geregelt wird. Diese Multiprofessionalität wird darüber, dass bei jeder Teambesprechung drei Berufsgruppen anwesend sein müssen, auch im Verhinderungsfalle (Urlaub, Krankheit, etc.) gefordert, sodass für jede beteiligte Berufsgruppe mindestens eine Doppelbesetzung vorzuhalten ist. Da dies für kleinere Krankenhäuser schwierig sein wird, ist bewusst auch die Behandlung durch einen externen Palliativdienst, der dann z. B. von einem anderen Krankenhaus aus mehrere Krankenhäuser versorgt, vorgesehen und mit eigenen OPS-Schlüsseln kodierbar. Die Abstimmung des Vorgehens mit der fallführenden Abteilung ist auch hier ein wichtiges Kriterium, um an gemeinsamen und nicht etwa gegensätzlichen Zielen zu arbeiten. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin empfiehlt, dass wesentliche Prozesse des OPS, wie die Teambesprechung, die Abstimmung mit der fallführenden Abteilung etc., mit Verfahrensanweisungen nachweisbar werden.
Besonders innovativ ist an der neuen Komplexpauschale, dass Leistungen des sogenannten Advance Care Planning zu den Leistungen des Palliativdienstes gehören. Insbesondere Menschen mit nichtonkologischen Erkrankungen sind häufig kaum in der Lage, ihre Autonomie ohne fremde Hilfe zu verwirklichen, vor allem, wenn sie multimorbide sind und kognitive oder sprachliche Einschränkungen haben. Sie brauchen Menschen, die nach ihrem Willen suchen, ihre ggf. vorhandenen schriftlichen Verfügungen anwenden und interpretieren, nach ihrem mutmaßlichen Willen fragen und darüber in ausführliche Gespräche mit den Angehörigen bzw. Vertretern des Betroffenen gehen, aktuelle Willensäußerungen, die dem natürlichen Willen entsprechen, wahrnehmen und interpretieren.
Es wird der gesamte Zeitaufwand der am Patienten oder patientenbezogen an den Angehörigen bzw. Bezugspersonen erbracht wird, addiert. Reine Dokumentationstätigkeiten oder Organisationstätigkeiten, etwa zur Planung der weiteren Versorgung, Teambesprechungszeiten und Besprechungszeiten mit den primärversorgenden Teams fließen in die Zeitrechnung nicht ein.
Die ärztlichen Mitarbeitenden des Palliativdienstes müssen an 7 Tagen der Woche einen 24-Stunden-Rufdienst für die primärversorgende Fachabteilung zur Verfügung stellen. Dabei geht es aber, wie im Glossar der deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zu ersehen, nicht darum, dass der Rufdienst nachts oder am Wochenende zu neuen, noch nicht in die Palliativdienstbetreuung eingeschlossenen Patienten gerufen wird, sondern lediglich zu Patienten, die bereits durch den Palliativdienst betreut werden. Dennoch werden für den Rufdienst mindestens zwei bis drei Ärzte gebraucht, die zumindest halbtags fest im Palliativdienst mitarbeiten. Von der Qualifikation her müssen die Ärzte keine Palliativmediziner sein, das heißt, sie brauchen nicht die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, aber sie müssen Mitarbeitende des Palliativdienstes und Fachärzte sein.
1.6 Wie kann ein Palliativdienst die OPS-Abrechnungsvoraussetzungen erfüllen?
Es gelten folgende Voraussetzungen:
Es muss sich um ein fachlich eigenständiges Team handeln, das niemandem weisungsgebunden untersteht, was de facto einer eigenen palliativmedizinischen Fachabteilung entspricht.Es muss ein multiprofessionelles Team fest vorhanden sein, mit nachweisbaren Stellenkontingenten in den Dienstplänen und der Personalplanung. Stets müssen mindestens drei Berufsgruppen zur Betreuung der Patienten zur Verfügung stehen (Medizin, Pflege und Sozialarbeit und/oder Physiotherapie und/oder Psychotherapie).Das Team muss aus eigenen Kräften einen ärztlichen Rufbereitschaftsdienst bewältigen können, das heißt, alle Ärzte, die Rufbereitschaft leisten, müssen Mitarbeitende des Palliativteams sein. Sie müssen aber nicht die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin haben, sondern können auch Fachärzte in Ausbildung zum Palliativmediziner sein.Das Palliativteam muss eine gut vernetzte Teamstruktur haben und über gute Kenntnisse und Erfahrungen in der Palliativversorgung verfügen. So müssen die leitenden Ärzte und Pflegekräfte nicht nur die Zusatzausbildung Palliativmedizin/-pflege, sondern auch eine 6-monatige Erfahrung in der speziellen Palliativversorgung vorweisen können.Die Arbeitsweise des Teams muss dem Paradigma der radikalen Patientenorientierung, wie sie palliativer Haltung entspricht und Hauptbestandteil guter Palliativversorgung ist, gehorchen und dies muss sich in der gesamten Dokumentation und Behandlungsplanung, die patientenindividuell ist, niederschlagen.Das Team muss lokal über gute Netzwerkstrukturen und gute Kontakte zu den umliegenden Anbietern palliativer Versorgungsangebote (Hospiz, SAPV, Palliativstation etc.) verfügen.Das Team muss besonders ausgeprägtes Wissen und eine entsprechende Haltung gegenüber Angehörigen haben und in Bezug auf Unterstützungsangebote für Angehörige in der Region gut vernetzt sein.Im Team müssen koordinative Fähigkeiten des palliativen Case Managements vorhanden sein.Das Team muss über Kenntnisse in Advance Care Planning verfügen, um der Aufgabe der vorausschauenden Behandlungsplanung gut gewachsen zu sein und den Patientenwillen stets zu ergründen und ihm Gehör zu verschaffen.