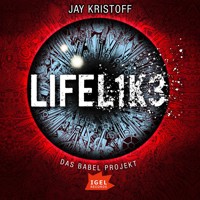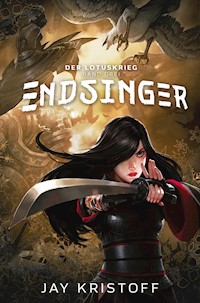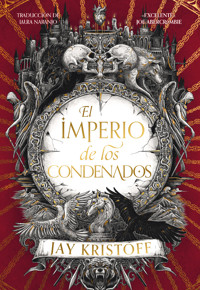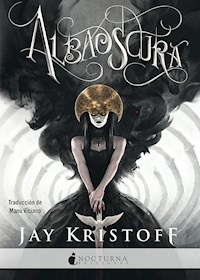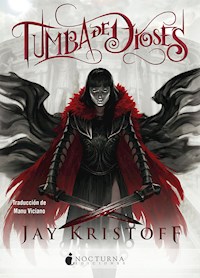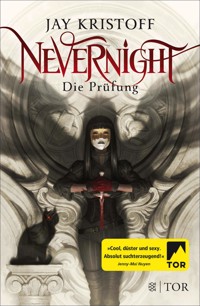
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Tor
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nevernight
- Sprache: Deutsch
»Nevernight« ist der erste Roman einer neuen bildgewaltigen und epischen Fantasy-Serie von »New York Times«-Bestseller-Autor Jay Kristoff. In einer Welt mit drei Sonnen, in einer Stadt, gebaut auf dem Grab eines toten Gottes, sinnt eine junge Frau, die mit den Schatten sprechen kann, auf Rache. Mia Corvere kennt nur ein Ziel: Rache. Als sie noch ein kleines Mädchen war, haben einige mächtige Männer des Reiches – Francesco Duomo, Justicus Remus, Julius Scaeva – ihren Vater als Verräter an der Itreyanischen Republik hinrichten und ihre Mutter einkerkern lassen. Mia selbst entkam den Häschern nur knapp und wurde unter fremdem Namen vom alten Mercurio großgezogen, einem Antiquitätenhändler. Mercurio ist jedoch kein gewöhnlicher Bürger der Republik, er bildet Attentäter für einen Assassinenorden aus, die »Rote Kirche«. Und Mia ist auch kein gewöhnliches Kind, sie ist eine Dunkelinn: Seit der Nacht, in der ihre Familie zerstört wurde, wird sie von einer Katze begleitet, die in ihrem Schatten lebt und sich von ihren Ängsten nährt. Mercurio bringt Mia vieles bei, doch um ihre Ausbildung abzuschließen, muss sie sich auf den Weg zur geheimen Enklave der »Roten Kirche« machen, wo sie eine gefährliche Prüfung erwartet … Nach dem zusammen mit Amie Kaufman verfassten Science-Fiction-Roman »Illuminae« ist »Nevernight« der neueste Geniestreich von Jay Kristoff: für die Leser von Anthony Ryan, Patrick Rothfuss und Sarah J. Maas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 924
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jay Kristoff
Nevernight
Die Prüfung
Über dieses Buch
Sie ist keine Heldin. Sie ist eine Frau, die Helden fürchten.
In einer Welt mit drei Sonnen, in einer Stadt, gebaut auf dem Grab eines toten Gottes, sinnt eine junge Frau, die mit den Schatten sprechen kann, auf Rache.
Mia Corvere kennt nur ein Ziel: Rache. Als sie noch ein kleines Mädchen war, haben einige mächtige Männer des Reiches – Francesco Duomo, Justicus Remus, Julius Scaeva – ihren Vater als Verräter an der Itreyanischen Republik hinrichten und ihre Mutter einkerkern lassen. Mia selbst entkam den Häschern nur knapp und wurde unter fremdem Namen vom alten Mercurio großgezogen, einem Antiquitätenhändler. Mercurio ist jedoch kein gewöhnlicher Bürger der Republik, er bildet Attentäter für einen Assassinenorden aus, die »Rote Kirche«. Und Mia ist auch kein gewöhnliches Kind, sie ist eine Dunkelinn: Seit der Nacht, in der ihre Familie zerstört wurde, wird sie von einer Katze begleitet, die in ihrem Schatten lebt und sich von ihren Ängsten nährt. Mercurio bringt Mia vieles bei, doch um ihre Ausbildung abzuschließen, muss sie sich auf den Weg zur geheimen Enklave der »Roten Kirche« machen, wo sie eine gefährliche Prüfung erwartet…
»Nevernight« ist der erste Roman einer neuen bildgewaltigen und epischen Fantasy-Serie von »New York Times«-Bestseller-Autor Jay Kristoff.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jay Kristoff verbrachte den Großteil seiner Jugend mit einem Haufen Bücher und vielseitiger Würfel in seinem spärlich beleuchteten Zimmer. Als Master of Arts verfügt er über keine nennenswerte Bildung. Er ist zwei Meter groß und hat laut Statistik noch 13020 Tage zu leben. Zusammen mit seiner Frau und dem faulsten Jack-Russell-Terrier der Welt lebt er in Melbourne. Jay Kristoff glaubt nicht an Happy Ends.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
[Caveat Emptor]
Erstes Buch Wenn überall Blut ist
1 Erste Male
2 Der Tanz
3 Hoffnungslos
4 Freundlichkeit
5 Komplimente
6 Staub
7 Begegnungen
8 Erlösung
9 Das Dunkel
Zweites Buch Glas oder Eisen
10 Lieder
11 Neu
12 Fragen
13 Lektion
14 Masken
15 Wahrheit
16 Wanderung
17 Stahl
18 Geißelung
19 Maskenball
20 Gesichter
21 Worte
22 Macht
23 Austausch
24 Reibung
25 Haut
26 Einhundert
27 Wahrdunkel
Drittes Buch Aus Schwarz wird Rot
28 Gift
29 Die Trennung
30 Favoriten
31 Entscheidung
32 Blut
33 Stufen
34 Verfolgung
35 Karma
36 Sonnenuntergang
Epilog
[Dicta Ultima]
[KARTE: Hier fiel er]
Danksagung
Für meine Schwestern
Licht und Dunkel und alles Schöne dazwischen
Nur Licht den Schatten macht
dem Tag stets folgt die Nacht
und zwischen Schwarz und Weiß
liegt Grau.
Altes ysiirisches Sprichwort
Caveat Emptor
Wenn Menschen sterben, scheißen sie sich oft in die Hosen.
Ihre Muskeln erschlaffen, ihre Seelen flattern befreit davon, und alles andere … rutscht eben einfach so raus. Das ist eine Tatsache, die Schreiberlinge nur selten erwähnen, so beliebt der Tod bei ihrem Publikum auch sein mag. Wenn unser Held in den Armen seiner Heldin sein Leben aushaucht, dann weisen sie nicht unbedingt auf den feuchten Fleck im Schritt hin oder auf den Gestank, der ihr die Tränen in die Augen treibt, als sie sich für den letzten Kuss über ihn beugt.
Das sei nur deshalb warnend vorangestellt, meine edlen Freunde, weil euer Erzähler keine solche Zurückhaltung kennt. Und falls euer schwacher Magen der unangenehmen Realität eines echten Blutbads nicht gewachsen sein sollte, dann sei darauf hingewiesen, dass die Seiten, die ihr in euren Händen haltet, von einem Mädchen erzählen, das mit so geschickter Hand mordete, wie ein Virtuose den Geigenbogen schwingt. Und die für den berühmten Satz »und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage« so verderblich war wie ein Sägeblatt für nackte Haut.
Sie ist nun selbst dahingegangen – eine Nachricht, die den Gemeinen wie den Gerechten auf dieser Welt ein breites Lächeln auf die Lippen zaubern dürfte. Eine Stadt aus Brücken und Gebein sank durch ihre Hand auf den Meeresgrund. Und dennoch bin ich mir sicher, sie fände eine Möglichkeit, mich umzubringen, wenn sie wüsste, dass ich diese Worte zu Papier bringe. Eine Möglichkeit, mich aufzuschlitzen und dem hungrigen Dunkel zu überlassen. Dennoch denke ich, dass jemand zumindest versuchen sollte, ihr wahres Ich von den Lügen zu trennen, die erzählt wurden. Über sie. Durch sie. Von ihr selbst.
Es sollte jemand sein, der sie wahrlich kannte.
Dieses Mädchen, das manche Bleiche Tochter nannten. Oder Königsmacherin. Oder Krähe. Aber meistens hatte man gar keinen Namen für sie. Eine Mörderin von Mördern, deren wahre Mordbilanz nur die Göttin und ich tatsächlich kennen. War sie nun berühmt oder berüchtigt, als ihr Ende kam? Ehrlich gesagt, für mich bestand zwischen beidem niemals ein Unterschied. Aber schließlich habe ich die Dinge immer schon anders betrachtet als ihr.
Und nie wirklich in der Welt gelebt, die ihr die eure nennt.
Ebenso wenig wie sie, wenn man so will.
Ich denke, deswegen habe ich sie geliebt.
Erstes BuchWenn überall Blut ist
1Erste Male
Der Junge war schön.
Karamellweiche Haut, ein Lächeln süß wie Honigtau. Schwarze, perfekt zerzauste Locken. Starke Hände und harte Muskeln und dann diese Augen – bei den Töchtern, diese Augen. Fünftausend Faden tief.
Seine Lippen fuhren sanft über die ihren, warm und leicht gekräuselt. Sie standen engumschlungen auf der Wisperbrücke, wie ein schamroter Fleck vor den geschwungenen Linien des Himmels. Seine Hände wanderten über ihren Rücken, und ihre Haut kribbelte vor knisternder Spannung. Der federleichte Strich, mit dem seine Zunge die ihre berührte, ließ sie erschauern. Ihr Herz schlug rasend schnell, und ein Verlangen, tief wie Schmerz, erfasste ihr Inneres.
Sie trieben auseinander wie Tänzer, kurz bevor die Musik verklingt, mit noch immer vibrierenden Saiten. Sie hatte die Augen geöffnet und merkte, dass er ihren Blick in dem rauchigen Licht erwiderte. Unter ihnen gluckste leise ein Kanal, der seine träge Flut zum Meer führte, in dessen Wasser sie sich dann verlor. Genau wie sie es am liebsten selbst getan hätte. Genau wie sie es später noch tun würde. In der Hoffnung, dabei nicht zu ertrinken.
Ihre letzte Nimmernacht in dieser Stadt. Ein Teil von ihr wollte sich noch immer nicht verabschieden. Aber bevor sie ging, wollte sie es wissen. Das zumindest war sie sich schuldig.
»Bist du sicher?«, fragte er.
Da sah sie ihm in die Augen.
Nahm ihn an der Hand.
»Ich bin mir sicher«, flüsterte sie.
Der Mann war widerwärtig.
Schuppige Haut, ein kaum ausgeprägtes Kinn, das sich in stoppligen Fettfalten verlor. Ein leichter Speichelschimmer rund um den Mund, Wangen und Nase von Whiskyröte geküsst, und dann diese Augen – bei den Göttern, diese Augen. Blau wie der von den Sonnen versengte Himmel.
Er hatte den Humpen an die Lippen gesetzt und leerte ihn bis zur Neige, umtost von Musik und Lachen. Noch kurz stand er schwankend mitten im Schankraum, dann warf er eine Münze auf den Eisenholztresen und stolperte ins Licht der Sonnen. Trüb und trunken ließ er die Augen über das Pflaster vor sich wandern. Auf den Straßen herrschte dichtes Gedränge, und er schob sich durch die Menschenmassen, die Gedanken nur aufs Nachhausekommen und traumlosen Schlaf gerichtet. Er sah nicht auf. Entdeckte die Gestalt nicht, die sich auf dem Dach gegenüber hinter eine Steinfratze duckte, gipsweiß und mörtelgrau gekleidet.
Das Mädchen beobachtete, wie er zur Brüderbrücke humpelte. Hob ihre Harlekinmaske, um an ihrem Zigarillo zu ziehen. Mit Nelkenduft versetzter Rauch ringelte sich in die Luft. Der Anblick seines Kadaverlächelns und seiner hanfseilaufgerauten Hände ließ sie erschauern. Ihr Herz schlug rasend schnell, und ein Verlangen, tief wie Schmerz, erfasste ihr Inneres.
Ihre letzte Nimmernacht in dieser Stadt. Ein Teil von ihr wollte sich noch immer nicht verabschieden. Aber bevor sie ging, sollte er es wissen. Das zumindest war sie ihm schuldig.
Ein Schatten, in Katzengestalt gegossen, saß neben ihr auf dem Dach. Er war flach wie ein Stück Papier und halb durchscheinend, schwarz wie der Tod. Den Schwanz hatte er beinahe besitzergreifend um ihren Knöchel geschlungen. Kühle Wasser rannen durch die Adern der Stadt und verloren sich im Meer. Genau wie sie es am liebsten selbst getan hätte. Genau wie sie es später noch tun würde. In der Hoffnung, dabei nicht zu ertrinken.
»… bist du sicher …?«, fragte die Katze, die Schatten war.
Das Mädchen sah weiter zu, wie sich der Mann auf sein Bett zu bewegte.
Sie nickte langsam.
»Ich bin mir sicher«, flüsterte sie.
Das Zimmer war klein gewesen, sparsam möbliert; mehr hatte sie sich nicht leisten können. Aber sie hatte Rosenschönkerzen aufgestellt und einen Strauß Wasserlilien auf die sauberen, weißen Laken gelegt, von denen sie einladend eine Ecke umgeschlagen hatte, und der Junge hatte über die zuckrige Süße der ganzen Szenerie gelächelt.
Sie war ans Fenster getreten und hatte über die große alte Stadt Gottesgrab hinausgeblickt. Über weißen Marmor und ockerfarbene Ziegel und elegante Türmchen, die den von den Sonnen versengten Himmel küssten. Im Norden erhoben sich die Rippen viele hundert Fuß den rötlichen Wolken entgegen, und winzige Fenster ließen Licht in die Wohnungen, die in das uralte Gebein hineingeschlagen worden waren. Kanäle ergossen sich aus dem hohlen Rückgrat und zeichneten auf die Haut der Stadt ein Linienmuster, das den Netzen verrückter Spinnen glich. Lange Schatten spannten sich über die Menschenmengen auf den Bürgersteigen, als das Licht der zweiten Sonne allmählich verblich – die erste war schon lange verschwunden – und es ihrem dritten, düsterroten Schwesterbruder überließ, über die Gefahren der Nimmernacht zu wachen.
Oh, wenn es doch nur Wahrdunkel gewesen wäre.
Dann würde er sie nicht sehen.
Sie war sich nicht sicher, ob sie wollte, dass er sie bei alldem sah.
Der Junge trat auf leisen Sohlen hinter sie, umfangen von einem Dunst aus frischem Schweiß und Tabak. Er ließ seine Hände um ihre Taille gleiten, und seine Finger fuhren wie Eis und Flammen über die Vertiefungen an ihren Hüften. Sie atmete heftiger; ein Kitzel erfasste sie, tief und uralt. Wimpern flatterten wie Schmetterlinge gegen ihre Wangen, während seine Hände die kleine Höhlung ihres Bauchnabels ertasteten, über ihre Rippen tanzten und höher, höher glitten, bis sie ihre Brüste umfingen. Prickelnde Gänsehaut breitete sich aus, als er in ihr Haar hineinatmete. Sie machte den Rücken rund und schob sich dabei gegen das Harte in seinem Schritt, eine Hand in die ungebärdigen Locken gekrallt. Sie konnte nicht atmen. Sie konnte nicht sprechen. Sie wollte, dass all dies nie begann und niemals endete.
Sich umwendend begegnete sie seufzend wieder seinen Lippen und machte sich an den Manschettenknöpfen seiner zerknitterten Ärmel zu schaffen, die Hände ungeschickt, schweißfeucht und bebend. Sie zog ihnen beiden die Hemden aus, stieß wieder gegen seine Lippen, sank mit ihm aufs Bett. Nur sie und er. Haut auf Haut. Ob er es war, der da stöhnte, oder sie, das konnte sie nicht sagen.
Der Schmerz des Verlangens war unerträglich, er durchdrang sie, und ihre Hände zitterten, als sie die wachsglatten Konturen seiner Brust erforschten, die feste, V-förmige Linie, die sich in seiner Hose verlor. Als sie ihr mit den Fingern folgte, stieß sie auf pulsierende Hitze, hart wie Eisen. Furchterregend. Verwirrend. Er stöhnte, zuckte wie ein neugeborenes Fohlen, als sie ihn streichelte, und seufzte mit schwerer Zunge.
Noch nie zuvor hatte sie so viel Angst gehabt.
Noch nie in all ihren sechzehn Jahren.
»Bei den Töchtern …«, hauchte sie.
Das Zimmer war üppig und von der Art, wie es sich nur die Reichsten leisten konnten. Doch auf der Kommode stand eine Batterie leerer Flaschen, auf dem Nachttisch eine Vase mit verwelkten Blumen. Sie fand es tröstlich, dass dieser Mann, den sie so hasste, so reich und so völlig vereinsamt war. Durch das Fenster beobachtete sie, wie er seinen Gehrock aufhängte und den abgetragenen Dreispitz über eine leere Karaffe stülpte. Und während sie ihm zusah, versuchte sie sich selbst davon zu überzeugen, dass sie tun konnte, was sie sich vorgenommen hatte. Dass sie hart und scharf geschliffen war wie Stahl.
Wie sie so dasaß, auf dem Dach gegenüber, ließ sie den Blick über die Stadt Gottesgrab schweifen, über blutbeflecktes Pflaster und verborgene Tunnel und hochaufragende Kathedralen aus schimmerndem Gebein. Die Rippen stießen hoch über ihr in den Himmel, gewundene Kanäle flossen aus dem verdrehten Rückgrat. Lange Schatten spannten sich über die Menschenmengen auf den Bürgersteigen, als das Licht der zweiten Sonne weiter verblich – die erste war schon lange verschwunden – und es ihrem dritten, düsterroten Schwesterbruder überließ, über die Gefahren der Nimmernacht zu wachen.
Oh, wenn es doch nur Wahrdunkel gewesen wäre.
Dann würde er sie nicht sehen.
Sie war sich nicht sicher, ob sie wollte, dass er sie bei alldem sah.
Sie streckte ihre geschickten Finger aus und zog die Schatten an sich. Dann verwob und verdrehte sie die schwarzen Spinnwebfäden, bis sie ihr wie ein Mantel um die Schultern fielen. Augenblicklich verschwand sie vom Angesicht der Welt. Fast wurde sie durchscheinend, als sei sie nur ein kleiner Fleck auf einem Bild dieser Stadt. Mit einem federnden Satz sprang sie über die Kluft zwischen den Häusern, packte sein Fensterbrett und zog sich daran hoch. Silberschnell hatte sie einen Flügel geöffnet und glitt durch den Raum dahinter, geräuschlos wie die Katze, die Schatten war und die ihr folgte. Als sie das Stilett aus dem Gürtel zog, wurde ihr Atem heftiger, und ein Kitzel erfasste sie, tief und uralt. Ungesehen duckte sie sich in eine Ecke, ihre Wimpern flatterten wie Schmetterlinge gegen ihre Wangen, und sie beobachtete, wie er mit zitternden Händen einen Becher füllte.
Sie atmete zu laut; alles, was sie gelernt hatte, stürzte in ihrem Kopf durcheinander. Aber er war zu betäubt, um etwas zu bemerken – ihr Atem wurde übertönt von der Erinnerung an das Knacken tausend langgezogener Hälse und an das stille Lied des Henkersmannes, zu dem tausend Paar Füße tanzten. Ihre Knöchel wurden weiß, so fest umklammerte sie den Griff ihres Dolches, als sie ihm aus ihrem dunklen Winkel zusah. Sie konnte nicht atmen. Sie konnte nicht sprechen. Sie wollte, dass all dies nie begann und niemals endete.
Mit einem Seufzer trank er einen Schluck und begann, sich an den Manschettenknöpfen seiner zerknitterten Ärmel zu schaffen zu machen, die Hände ungeschickt, schweißnass und bebend. Dann zog er sich das Hemd aus, humpelte über die Dielenbretter und ließ sich auf das Bett sinken. Jetzt waren es nur noch sie und er, ein Atemzug um den anderen. Ihr Ende oder seines, sie konnte es nicht länger sagen.
Zitternd und zögernd wartete sie in der Dunkelheit. Unerträglich lang. Dann erinnerte sie sich daran, wer er war, was dieser Mann ihr genommen hatte und dass alles zusammenbrechen würde, wenn sie jetzt versagte. Und so riss sie sich zusammen, warf ihren Schattenumhang von sich und trat vor, ihm entgegen.
Er keuchte wie ein neugeborenes Füllen, als sie im roten Sonnenlicht vor ihm erschien, mit einem Harlekinlächeln anstelle ihres eigenen.
Noch nie zuvor hatte sie jemanden gesehen, der so viel Angst hatte.
Noch nie in all ihren sechzehn Jahren.
»Bei den Göttern …«, hauchte er.
Er war auf ihr, die Hosen um die Knöchel. Seine Lippen an ihrem Hals. Eine Ewigkeit verstrich, zwischen Begehren und Fürchten und Lieben und Hassen, und dann spürte sie ihn, wie er heiß und erstaunlich hart gegen das Weiche zwischen ihren Beinen drückte. Sie holte Luft, vielleicht, um etwas zu sagen (aber was hätte sie sagen sollen?), und dann der Schmerz, so ein Schmerz, oh, bei den Töchtern, es tat weh. Er war in ihr – es war in ihr – so hart und wirklich, dass sie einen Aufschrei nicht unterdrücken konnte, obwohl sie sich auf die Lippen biss.
Er war rücksichtslos, achtlos, und sein Gewicht lastete auf ihr, als er wieder und wieder zustieß. Es hatte nichts mit den süßen Vorstellungen zu tun, die sie sich von diesem Augenblick gemacht hatte. Die Beine gespreizt, die Muskeln verkrampft, trat sie gegen die Matratze und wollte nur noch, dass er aufhörte. Dass er innehielt.
Hatte es sich so anfühlen sollen?
Hatte es so sein sollen?
Falls später alles schiefging, war dies ihre letzte Nimmernacht auf dieser Welt. Und sie hatte gewusst, dass das erste Mal immer das schlimmste war. Sie hatte gedacht, sie sei bereit. Weich genug, feucht genug, begierig genug. Und das, was die anderen Straßenmädchen unter viel Gekicher und wissenden Blicken gesagt hatten, träfe auf sie nicht zu.
»Mach die Augen zu«, hatten sie ihr geraten. »Es ist ganz schnell vorbei.«
Aber er war so schwer, und sie gab sich alle Mühe, nicht zu heulen, und sie wünschte sich, dass es nicht so hätte sein müssen, sondern anders. Sie hatte von diesem Augenblick geträumt und sich etwas ganz Besonderes erhofft. Aber jetzt, mittendrin, hatte sie das Gefühl, dass es eine grobe, ungeschlachte Sache war. Kein Zauber, kein Feuerwerk, kein überwältigendes Glücksgefühl. Nur der Druck seines Körpers auf ihrer Brust, der Schmerz seiner Stöße, und tatsächlich hatte sie die Augen geschlossen, während sie keuchte und mit gequältem Gesicht darauf wartete, dass er endlich fertig war.
Er drückte seine Lippen auf ihre, und seine Hand legte sich um ihre Wange. Und in diesem Augenblick flackerte etwas auf – eine Süße, die noch einmal diesen Kitzel auslöste, trotz der Peinlichkeit und Atemlosigkeit und Schmerzhaftigkeit der ganzen Sache. Sie erwiderte seinen Kuss, und Hitze wallte in ihr auf, überflutete und erfüllte sie, als sich all seine Muskeln anspannten. Und er drückte sein Gesicht in ihr Haar und erschauerte bei seinem kleinen Tod, dann sank er auf ihr zusammen, weich und feucht und schlaff.
Sie lag da und holte tief Luft. Leckte sich seinen Schweiß von den Lippen. Seufzte.
Er rollte sich zur Seite, schob sich neben sie. Als sie zwischen ihre Beine fasste, spürte sie Feuchtigkeit und Pein. Verschmiert auf Fingerspitzen und Schenkeln. Auf den sauberen weißen Laken.
Blut.
»Warum hast du mir nicht gesagt, dass es dein erstes Mal ist?«, fragte er.
Sie sagte nichts. Starrte nur auf den roten Schimmer auf ihren Fingerspitzen.
»Tut mir leid«, flüsterte er.
Nun sah sie ihn an.
Und genauso schnell wieder weg.
»Dir muss nichts leidtun.«
Sie war auf ihm und drückte ihn mit den Knien auf den Boden. Seine Finger um ihr Handgelenk, ihr Stilett an seinem Hals. Eine Ewigkeit verstrich, zwischen Zappeln und Zischen und Beißen und Betteln, doch dann drang die Klinge endlich ein, scharf und erstaunlich hart, sank in seinen Hals und schabte über sein Rückgrat. Er rang nach Luft, wollte vielleicht sprechen (aber was hätte er sagen sollen?), und sie sah es in seine Augen – Schmerz, so ein Schmerz, oh, bei den Töchtern, es tat so weh. Die Klinge war in ihm – sie war in ihm –, während er versuchte zu schreien. Aber sie hatte ihm die Hand auf den Mund gelegt.
Panik ergriff ihn, Verzweiflung, und er kratzte über ihre Maske, als sie den Dolch in der Wunde drehte. Es hatte nichts mit den schrecklichen Vorstellungen zu tun, die sie sich von diesem Augenblick gemacht hatte. Seine Beine spreizten sich, Blut strömte aus seinem Hals, er trat gegen die Matratze und wollte nichts mehr, als dass sie aufhörte. Dass sie innehielt.
Hatte es sich so anfühlen sollen?
Hatte es so sein sollen?
Wäre alles schiefgegangen, wäre dies ihre letzte Nimmernacht auf dieser Welt gewesen. Und sie hatte gewusst, dass das erste Mal immer das schlimmste war. Sie hatte gedacht, sie sei noch nicht bereit. Nicht stark genug, nicht kalt genug. Und dass die Worte des alten Mercurio für sie nicht gelten würden.
»Vergiss nicht zu atmen«, hatte er ihr geraten. »Es ist ganz schnell vorbei.«
Er trat um sich, und sie hielt ihn immer noch gepackt, und alles in ihr fragte sich, ob es wohl immer so sein würde. Sie hatte gedacht, dieser Augenblick würde etwas Böses an sich haben. Ein Zins, den sie entrichten musste, kein Moment, den man genoss. Aber jetzt, mittendrin, fühlte es sich an wie ein herrlicher Tanz. Wie er sich unter ihr aufbäumte. Die Angst in seinen Augen, als er ihr die Maske herunterriss. Das Schimmern der Klinge, als sie zustach, die Hand fest auf seinen Mund gepresst, während sie beruhigend nickte, ihn mit mütterlicher Stimme still zu sein hieß und darauf wartete, dass er endlich starb.
Er schlug mit den Nägeln nach ihrer Wange, und der ekelhafte Gestank seines Atems und seiner Scheiße erfüllte den Raum. Und in diesem Augenblick flackerte etwas auf – ein Entsetzen, das nach Gnade verlangte, trotz der Tatsache, dass er dieses Ende hundertfach verdient hatte. Sie riss ihre Klinge wieder heraus und bohrte sie dann in seine Brust. Hitze flutete über ihre Hände, ein ganzer Schwall, als sich all seine Muskeln anspannten. Und er packte ihre Knöchel und seufzte im Augenblick seines Todes, fiel unter ihr in sich zusammen, weich und feucht und schlaff.
Sie hockte noch immer auf ihm und holte tief Luft. Schmeckte Salz und Rot. Seufzte.
Dann rollte sie sich zur Seite, zwischen die zerwühlten Laken. Als sie ihr Gesicht berührte, spürte sie etwas Feuchtes, Warmes. Verschmiert auf Händen und Lippen.
Blut.
»Höre mich, Niah«, flüsterte sie. »Höre mich, Mutter. Dieses Fleisch dir zum Fest. Dieses Blut dir zum Wein. Dieses Leben, dieses Ende, meine Gabe an dich. Halte ihn fest bei dir.«
Die Katze, die Schatten war, hockte auf dem Kopfteil des Bettes und sah zu. Auf eine Weise, wie es nur den Augenlosen gegeben ist. Sie sagte kein Wort.
Das musste sie auch nicht.
Gedämpftes Licht der Sonnen auf ihrer Haut. Rabenschwarzes Haar, schweißfeucht, hing ihr in die Augen. Sie zog die ledernen Hosen hoch, warf sich ein mörtelgraues Hemd über und schlüpfte in ein Paar Wolfsfellstiefel. Wund. Befleckt. Aber doch irgendwie froh. Beinahe zufrieden.
»Das Zimmer ist für die ganze Nimmernacht bezahlt«, sagte sie. »Falls du es haben willst.«
Der Junge hatte sich auf einen Ellenbogen aufgestützt und sah ihr von der anderen Seite des Bettes aus zu. »Und mein Geld?«
Sie deutete auf eine Börse, die vor dem Spiegel lag.
»Du bist jünger als meine üblichen Freierinnen«, sagte er. »Erste Male habe ich ganz selten.«
Sie sah sich im Spiegel an. Blasse Haut und dunkle Augen. Jünger, als sie eigentlich war. Und obwohl der Beweis des Gegenteils gerade auf ihrer Haut trocknete, fiel es ihr einen Augenblick lang schwer, in ihrem Spiegelbild etwas anderes als ein Mädchen zu erkennen. Etwas Schwaches und Zitterndes, das auch sechzehn Jahre in dieser Stadt nicht hatten aushärten können.
Sie stopfte sich das Hemd in den Hosenbund. Überprüfte die Harlekinmaske in ihrem Mantel. Und das Stilett an ihrem Gürtel. Schimmernd und scharf.
Der Henker würde bald die Taverne verlassen.
»Ich muss gehen«, sagte sie.
»Darf ich dich etwas fragen, Mi Dona?«
»Von mir aus.«
»Wieso ich? Wieso jetzt?«
»Wieso nicht?«
»Das ist doch keine Antwort.«
»Du meinst, ich hätte mich aufsparen sollen, oder? Wie ein Geschenk, das auf jemanden wartet? Und das jetzt für immer verdorben ist?«
Der Junge sagte nichts, sah sie nur mit diesen endlos tiefen Augen an. Wie gemalt, so schön. Das Mädchen zog einen Zigarillo aus einem silbernen Etui. Zündete ihn an einer Kerze an. Atmete tief ein.
»Ich wollte nur wissen, wie das ist«, sagte sie schließlich. »Falls ich heute Nacht sterbe.«
Grau ausatmend zuckte sie die Achseln.
»Jetzt weiß ich es.«
Und damit trat sie in die Schatten.
Gedämpftes Licht der Sonnen auf ihrer Haut. Der mörtelgraue Mantel floss über ihre Schultern, so dass in dem matten Licht nicht mehr als ein Schatten von ihr übrig blieb. Sie stand neben einem Marmorbogen auf der Piazza des Bettlerkönigs, und die dritte Sonne hing gesichtslos am Himmel. Die Erinnerung an das Ende des Henkers trocknete mit den Blutflecken auf ihren Händen. Die Erinnerung an die Lippen des Süßen trocknete mit den Flecken in ihren Hosen. Sie fühlte sich wund. Aber doch irgendwie froh. Beinahe zufrieden.
»Wie ich sehe, bist du nicht tot.«
Der alte Mercurio sah von der anderen Seite des Torbogens zu ihr hinüber, den Dreispitz tief ins Gesicht gezogen, einen Zigarillo zwischen den Lippen. Er wirkte irgendwie kleiner. Dünner. Älter.
»An mir lag es nicht«, antwortete das Mädchen.
Nun sah sie ihn an, mit seinen fleckigen Händen und schwächer werdenden Augen. Und obwohl der Beweis des Gegenteils gerade auf ihrer Haut trocknete, fiel es ihr einen Augenblick lang schwer, etwas anderes als ein Mädchen in sich zu erkennen. Etwas Schwaches und Zitterndes, das auch sechs Jahre unter seinen Fittichen nicht hatten aushärten können.
»Wir werden uns eine ganze Weile nicht sehen, oder?«, fragte sie. »Vielleicht niemals wieder.«
»Das hast du gewusst«, erwiderte er. »Du hast es so gewählt.«
»Ich weiß nicht, ob ich je wirklich eine Wahl hatte«, sagte sie.
Langsam öffnete sie die geballte Faust und streckte ihm eine Börse aus Schafsleder hin. Der alte Mann nahm die dargebotene Gabe und zählte mit einem tintenbefleckten Finger den Inhalt. Knochenklappernd. Blutbefleckt. Siebenundzwanzig Zähne.
»Offenbar hat der Henker schon ein paar verloren, bevor ich ihn zu fassen bekam«, erklärte sie.
»Das werden sie verstehen.« Mercurio warf ihr den Beutel mit den Zähnen zurück. »Sei um Schlag sechs am siebzehnten Pier. Dort liegt eine Dweymeri-Brigantine, die Trelenes Galan. Sie ist ein freies Schiff und fährt nicht unter itreyanischer Flagge. Sie wird dich mitnehmen.«
»An einen Ort, an den du mir nicht folgen kannst.«
»Ich habe dich gut unterwiesen. Was jetzt kommt, musst du allein bewältigen. Du musst vor der ersten Wende des Septimus an der Schwelle der Roten Kirche stehen, sonst wirst du sie niemals überschreiten.«
»Ich verstehe.«
Warme Zuneigung schimmerte in seinen entzündeten Augen. »Du bist die beste Schülerin, die ich je in den Dienst der Mutter entsandt habe. An jenem Ort wirst du deine Flügel ausbreiten und fliegen. Wir werden uns wiedersehen.«
Sie zog das Stilett aus ihrem Gürtel. Bot es ihm, den Kopf geneigt, auf ihrem Unterarm liegend an. Die Klinge war aus Grabgebein, schimmerte so weiß und hart wie Stahl, während der geschnitzte Griff die Form einer fliegenden Krähe hatte. Die Bernsteinaugen schimmerten im roten Licht der Sonne.
»Behalte es.« Der alte Mann schniefte. »Es gehört dir. Du hast es dir verdient. Endlich.«
Sie betrachtete die Waffe von allen Seiten.
»Sollte ich ihm einen Namen geben?«
»Könntest du natürlich. Aber wozu?«
»Alle großen Klingen haben Namen. So ist das nun mal.«
»Blödsinn.« Mercurio nahm den Dolch und hielt ihn hoch. »Deiner Klinge einen Namen geben, das ist so ein Quatsch, der Helden vorbehalten ist, Mädchen. Männer, über die Lieder gesungen, von denen Legenden erzählt und nach denen Gören benannt werden. Auf dich und mich wartet die Schattenstraße. Und wenn du das Tänzchen darauf richtig tanzt, dann wird deinen Namen nie jemand erfahren, und den von diesem Metzgerdorn an deinem Gürtel schon gar nicht. Du wirst ein Gerücht sein. Ein Flüstern. Ein Gedanke, der die Dreckskerle dieser Welt in der Nimmernacht schweißnass aus dem Schlaf fahren lässt. Das Letzte, was du in dieser Welt je sein wirst, Mädchen, ist ein Held für irgendwelche Leute.«
Damit gab er ihr den Dolch zurück.
»Aber du wirst jemand sein, den Helden fürchten.«
Jetzt lächelte sie. Unvermittelt und schrecklich traurig. Sie verharrte einen Augenblick. Beugte sich vor. Bedachte die Sandpapierwangen mit einem sanften Kuss.
»Du wirst mir fehlen«, sagte sie.
Und damit trat sie in die Schatten.
2Der Tanz
Der Himmel weinte.
Oder zumindest war es ihr damals so erschienen. Das kleine Mädchen wusste, dass das Wasser, das von dem kohlefarbenen Grau über ihren Köpfen heruntertropfte, Regen genannt wurde – sie zählte gerade erst zehn Jahre, aber um das zu wissen, war sie alt genug. Dennoch gefiel ihr der Gedanke, dass Tränen von dem grauen Zuckerwattegesicht fielen. So kalt, verglichen mit ihren eigenen. Und ohne Salz oder Biss. Aber ja, der Himmel weinte ganz sicherlich.
Was sonst hätte er auch in einem solchen Augenblick tun können?
Sie stand auf dem Rückgrat über dem Forum, auf schimmerndem Grabgebein, den kalten Wind im Haar. Auf der Piazza zu ihren Füßen hatte sich eine große Menschenmenge versammelt, ein Meer aus offenen Mündern und gelben Zähnen und geballten Fäusten. Sie wogte dem Schafott in der Mitte des Forums entgegen, und das Mädchen fragte sich: Wenn sie es umstieß, dürften dann die Männer, die darauf standen, vielleicht einfach wieder nach Hause gehen?
Noch nie zuvor hatte sie so viele Menschen gesehen. Männer und Frauen von verschiedenster Gestalt, Kinder, die nicht viel älter waren als sie selbst. Sie trugen hässliche Kleider, und ihr Gebrüll hatte sie verängstigt, sie hatte nach der Hand ihrer Mutter gefasst und sie fest umklammert.
Ihre Mutter bemerkte das offenbar gar nicht. Ihre Augen ruhten wie gebannt auf dem Schafott, wie die aller anderen. Aber Mutter spuckte nicht auf die Männer, die vor den Hanfschlingen standen, sie warf kein faules Obst oder zischte durch die zusammengebissenen Zähne das Wort »Verräter«. Dona Corvere stand einfach nur da, das schwarze Kleid durchweicht von den Himmelstränen, wie eine Statue am Rande eines noch leeren Grabes.
Noch war es leer. Aber nicht mehr lange.
Die Kleine hatte fragen wollen, warum ihre Mutter nicht weinte. Sie wusste nicht, was »Verräter« bedeutete, und hätte gern danach gefragt. Doch sie ahnte, dass dies ein Moment war, in dem Worte keinen Platz hatten. Und so stand sie weiter da und schwieg.
Und sah stattdessen zu.
Sechs Männer befanden sich auf dem Schafott. Einer trug die Kapuze des Henkers, schwarz wie das Wahrdunkel. Ein anderer trug das Gewand eines Priesters, weiß wie Taubenfedern. Die vier anderen hatten Stricke um die Handgelenke und ein rebellisches Funkeln in ihren Augen. Aber als der Kapuzenmann ihnen die Schlingen um den Hals legte, sah das Mädchen, dass mit dem Blut aus ihren Wangen auch der Widerstandsgeist aus ihren Zügen wich. Über die Jahre sollte sie immer wieder hören, wie tapfer ihr Vater gewesen war. Aber wie sie ihn so sah, am Ende der Viererreihe, da wusste sie, dass er Angst hatte.
Sie war erst zehn Jahre alt, aber sie kannte die Farbe der Angst.
Der Priester war vorgetreten und schlug mit seinem Stab auf die Bohlenbretter. Mit seinem wildwuchernden, gestrüppgleichen Bart und den ochsenbreiten Schultern wirkte er eher wie ein Bandit, der einen heiligen Mann erschlagen und sich seine Kleider übergeworfen hatte, als ein wirklich heiliger Mann. Die drei Sonnen, die an einer Kette um seinen Hals hingen, versuchten, ihren dumpfen Goldglanz zu verbreiten, aber die Wolken am weinenden Himmel ließen das nicht zu.
Seine Stimme war so zäh wie Sirup, süß und dunkel. Aber sie sprach von Verbrechen gegen die itreyanische Republik. Von Betrug und Hochverrat. Der heilige Bandit rief das Licht als Zeugen an (sie fragte sich, ob es dieses Zeugnis wohl auch verweigern konnte) und nannte dann jeden Mann bei seinem Namen.
»Senator Claudius Valente.«
»Senator Marconius Albari.«
»General Gaius Maxinius Antonius.«
»Justicus Darius Corvere.«
Der Name ihres Vaters erklang wie der letzte Ton des traurigsten Liedes, das sie je gehört hatte. Tränen traten ihr in die Augen und ließen die Welt gestaltlos verschwimmen. Wie klein und blass er aussah, dort draußen in dieser brüllenden See. Wie allein. Sie erinnerte sich daran, wie er noch vor nicht allzu langer Zeit gewesen war: hochgewachsen und stolz und oh, so stark. Seine grabbeinerne Rüstung war weiß wie die Wintertiefe, sein Mantel floss wie ein karmesinroter Strom über seine Schultern. Seine Augen, blau und hell, waren von kleinen Fältchen umgeben, wenn er lachte.
Rüstung und Mantel waren jetzt verschwunden, ersetzt durch dreckige Lumpen aus Sackleinen. Dunkle Schwellungen wie pralle Beeren bedeckten sein Gesicht. Sie wollte so sehr, dass er sie ansah. Sie wollte so sehr, dass er nach Hause kam.
»Verräter!«, schrie der Mob. »Lasst sie tanzen!«
Das Mädchen wusste nicht, was damit gemeint war. Musik war keine zu hören.[1]
Der heilige Bandit sah zu den Zinnen hinauf, zu den Markgeborenen und den Politicos, die sich dort oben versammelt hatten. Offenbar war der ganze Senat zu diesem Spektakel erschienen; beinahe hundert Männer in purpurn gesäumten Roben sahen mit gnadenlosen Augen zum Schafott hinunter.
Rechts vom Senat stand ein Grüppchen Männer in weißen Rüstungen. Blutroten Mänteln. Die Schwerter, mit zuckenden Flammen umkränzt, blank in den Händen. Luminatii, so hießen sie, das wusste sie sehr wohl. Sie waren die Waffenbrüder ihres Vaters gewesen, vor dem Verrat, denn das, so nahm sie an, war es ja wohl, was Verräter taten.
Es war alles so lärmend laut.
Inmitten der Senatoren stand ein gutaussehender, dunkelhaariger Mann mit durchdringenden, schwarzen Augen. Er trug eine weiße Robe mit einem Saum aus tiefstem Purpur – die Tracht eines Konsuls. Und das Mädchen, das noch so wenig wusste, erkannte doch, dass es sich zumindest bei ihm um einen Mann von Rang und Ansehen handelte. Um jemanden, der weit über den Priestern oder den Soldaten oder dem Mob stand, der nach einem Tänzchen schrie, obwohl es keine Musik gab. Wenn er es befahl, dann würde die Menge ihren Vater gehenlassen. Wenn er es befahl, dann würden das Rückgrat auseinanderbrechen und die Rippen zitternd zu Staub zerfallen, und Aa, der Gott des Lichts höchstselbst, würde seine drei Augen schließen und gesegnetes Dunkel über diese schreckliche Szenerie breiten.
Der Konsul trat vor. Der Mob auf dem Platz wurde still. Und als der gutaussehende Mann zu sprechen anhob, drückte das Mädchen die Hand seiner Mutter, erfüllt von jener Hoffnung, wie nur Kinder sie kennen.
»Hier in der Stadt Gottesgrab, im Lichte des Aa und auf einstimmigen Beschluss des itreyanischen Senats, verkünde ich, Konsul Julius Scaeva, dass diese Angeklagten der Rebellion gegen unsere ruhmreiche Republik für schuldig befunden wurden. Für Männer, die Verrat an den Bürgern Itreyas üben, kann es nur ein Urteil geben. Ein Urteil für jene, die diese Nation erneut unter das Joch eines Königs zwingen wollten …«
Ihr stockte der Atem.
Ihr Herz flatterte.
»… den Tod.«
Lautes Gebrüll brandete auf und wusch wie der Regen über sie hinweg. Und dann blickte sie mit weit aufgerissenen Augen vom gutaussehenden Konsul zum heiligen Banditen und schließlich zu ihrer Mutter – bitte mach, dass sie aufhören –, aber die Augen ihrer Mutter ruhten fest auf dem Mann, der dort unten stand. Nur die zitternde Unterlippe verriet, wie sehr sie litt. Und das kleine Mädchen hielt es nicht mehr aus, und der Schrei erhob sich in ihr und quoll über ihre Lippen
neinneinnein
und die Schatten überall auf dem Forum erzitterten unter ihrer Wut. Das Schwarze am Fuße eines jeden Mannes, jeder Jungfrau und jedes Kindes, die Dunkelheit, die das Licht der verborgenen Sonnen warf, wenn es auch nur blass und dünn war – täuscht euch nicht, o edle Freunde – diese Schatten erbebten.
Aber keinem fiel das auf. Niemanden kümmerte es.[2]
Die Augen Dona Corveres blieben auf ihren Ehemann gerichtet, als sie das kleine Mädchen, einen Arm über der Brust, eine Hand am Kopf, fest an sich drückte. So fest, dass die Kleine sich nicht bewegen konnte. Nicht umdrehen. Nicht atmen.
Jetzt stellt ihr euch sicher vor: eine Mutter, die das Gesicht ihrer Tochter in ihren Röcken verbirgt. Die Wolfsmutter mit aufgerichtetem Nackenfell, die ihr Junges vor dem Anblick des Mordes beschützt, der dort unten gleich begangen werden wird. Das ist verständlich. Verständlich, aber falsch. Denn die Dona hielt ihre Tochter so fest, dass sie über die Menge blickte und alles genau zu schmecken bekam. Jeden Bissen dieser bitteren Mahlzeit. Jede Krume.
Und so hatte das Mädchen zugesehen, wie der Henker jede Schlinge prüfte, eine nach der anderen. Er humpelte zu einem Hebel am Rand des Schafotts und hob die Kapuze kurz, um auszuspucken. Das Mädchen sah ganz kurz sein Gesicht – gelbeZähnegraueStoppelnHasenscharteweg. In ihr schrie etwas Sieh nicht hin, sieh nicht hin, und sie schloss die Augen. Da wurde der Griff ihrer Mutter fester, und ihr Flüstern erklang scharf wie ein Rasiermesser.
»Weiche nie zurück«, hauchte sie. »Fürchte dich nie.«
Das Mädchen fühlte die Worte tief in der Brust. In diesem tiefsten, dunkelsten Ort, wo die Hoffnung, die Kinder noch atmen und Erwachsene betrauern, verdorrte und zerfiel, um wie Asche vom Wind davongetragen zu werden.
Und das Mädchen öffnete seine Augen.
Da sah er auf. Ihr Vater. Nur ein kurzer Blick durch den Regen. Später, in kommenden Nimmernächten, fragte sie sich oft, was er in diesem Augenblick gedacht haben mochte. Aber es gab keine Worte, die sie durch den zischenden Schleier erreicht hätten. Nur Tränen. Nur den weinenden Himmel. Und der Henker zog an seinem Hebel, und der Boden tat sich auf. Und zu ihrem Entsetzen verstand sie es nun. Hörte es endlich.
Die Musik.
Der Lärm der brüllenden Menge. Der Peitschenknall, mit dem das Seil sich straffte. Das guh-guh-guh erwürgter Männer mischte sich mit dem Applaus des heiligen Banditen und des gutaussehenden Konsuls und dem Lärm einer Welt, die plötzlich falsch und verdorben war. Und zu dieser fürchterlichen Musik begann ihr Vater mit zuckenden Beinen und rot anlaufendem Gesicht zu tanzen.
Papa …
»Weiche nie zurück.« Ein kaltes Flüstern in ihren Ohren. »Fürchte dich nie. Und vergiss niemals. Niemals.«
Das Mädchen nickte langsam.
Ließ die Hoffnung mit ihrem Atem aus der Brust entweichen.
Und sah zu, wie ihr Vater starb.
Sie stand an Deck des Schiffes und sah zu, wie die Stadt Gottesgrab immer kleiner und kleiner wurde. Die Brücken und Kathedralen der Hauptstadt verblassten, bis nur noch die Rippen sichtbar blieben, sechzehn beinerne Bögen, die viele hundert Fuß in die Luft ragten. Aber während die Minuten zu Stunden verschmolzen, versanken selbst diese riesenhaften Spitzen hinter der Lippe des Horizonts und verschwanden im Dunst.[3]
Ihre Hände umklammerten die salzgebleichte Reling der Trelenes Galan. Unter ihren Nägeln sah man dunkel das geronnene Blut. Am Gürtel ein Stilett aus Grabgebein, im Beutel die Zähne eines Henkers. Dunkle Augen spiegelten die launenhafte rote Sonne über ihnen, während der Schimmer ihres kleinen, blauen Geschwisters noch den westlichen Himmel erhellte.
Die Katze, die Schatten war, saß bei ihr. Wie hingegossen im Dunkel rund um ihre Füße. Weil es dort kühler war. Ein kluger Kopf hätte vielleicht bemerkt, dass der Schatten des Mädchens einen Hauch schwärzer war als jener anderer Menschen. Ein kluger Kopf hätte bemerkt, dass er schwarz genug war für zwei.
Glücklicherweise herrschte an Bord der Galan ein gewisser Mangel an klugen Köpfen.
Sie war nicht besonders hübsch. Oh, natürlich, in den Geschichten, die ihr gehört haben werdet, beschreibt man die Assassine, durch deren Hand die itreyanische Republik zerstört wurde, als übernatürliche Schönheit mit milchweißer Haut und schmalen Kurven und bogenförmigen Lippen. Und es stimmt, sie besaß diese Eigenschaften, aber im Gesamtbild wirkten sie … als passten sie nicht recht zusammen. »Milchweiß« ist schließlich nur ein nettes Wort für »teigig«, und »schmal« ist die poetische Variante von »ausgemergelt«.
Ihre Haut war blass und ihre Wangen hohl, was sie leicht hungrig und hager wirken ließ. Das krähenschwarze Haar fiel ihr bis über die Rippen, sah man von dem schiefen Pony ab, den sie sich selbst geschnitten hatte. Ihre Lippen und die Haut um ihre Augen hatten stets die Farbe blauer Flecken, und ihre Nase war mindestens einmal gebrochen worden.
Wäre ihr Gesicht ein Puzzlespiel gewesen, die meisten hätten es nicht fertig zusammengesetzt, sondern wieder in den Karton getan.
Dazu kam, dass sie klein war. Dünn wie eine Bohnenstange. Kaum genug Hintern, um die Hosen am Herunterrutschen zu hindern. Keine Schönheit, für die ein Geliebter in den Tod ginge, für die sich Heere in Marsch setzten oder Helden einen Gott oder Dämonen erschlügen. Ganz im Gegensatz zu dem, was man euch erzählt hat, ich weiß. Aber, edle Freunde, das heißt nicht, dass sie ohne Liebreiz war. Und im Übrigen haben eure Scheißdichter sowieso keine Ahnung.
Die Trelenes Galan war ein Zweimaster, mit Seeleuten bemannt, die von den Dweym-Inseln stammten und sich die Hälse zu Ehren ihrer Göttin Trelene[4] mit Ketten aus Drakenzähnen schmückten. Die Dweymeri, die im vorigen Jahrhundert von den Truppen der itreyanischen Republik besiegt worden waren, hatten dunkle Haut und überragten den durchschnittlichen Itreyaner um mehr als einen Kopf. Der Legende nach stammten sie von Riesentöchtern ab, die bei silberzüngigen Männern gelegen hatten, aber diese hübsche Geschichte hält einer Überprüfung nicht stand.[5] Schlichter ausgedrückt, sie waren groß wie Bullen und hart wie Sargnägel, und dass sie die Angewohnheit hatten, ihre Gesichter mit Tätowierungen aus Leviathan-Tinte zu verzieren, ließ sie auf den ersten Blick auch nicht unbedingt freundlicher erscheinen.
Doch trotz ihres abschreckenden Äußeren behandelten die Dweymeri ihre Passagiere in der Regel eher wie Schutzbefohlene und weniger wie bloße Fahrgäste. Und so kam es, dass sich ein sechzehnjähriges Mädchen, das allein reiste und zu seinem Schutz nichts weiter als ein Stückchen geschärftes Grabgebein bei sich hatte, an Bord begeben konnte, ohne Ärger seitens der Seeleute befürchten zu müssen. Allerdings hatten auch einige Männer auf der Galan angeheuert, die nicht aus Dweym stammten. Und einem von ihnen erschien dieses einsame Mädchen leichte Beute.
Es ist nun einmal Tatsache: Wenn man nicht gerade ganz mit sich allein ist – und in einigen Fällen selbst dann –, kann man sich darauf verlassen, dass man mindestens einen Narren in seiner Nähe ertragen muss.
Er hatte etwas Lebemännisches an sich. Ein itreyanischer Bock mit glatter Brust und einem hübschen Lächeln, das ihm sicherlich eine Reihe von Kerben an seinem Bettpfosten eingebracht hatte. An seiner Filzmütze steckte eine Pfauenfeder. Bis die Galan in Ysiir anlegen würde, waren es noch sieben Wochen, und für manche Männer sind sieben Wochen eine zu lange Zeit, um sich allein auf die eigenen Hände zu verlassen. Und daher lehnte er sich neben sie an die Reling und lächelte sie federleicht an.
»Du bist aber ein hübsches Ding«, sagte er.[6]
Sie sah ihn gerade lange genug an, um einen Eindruck zu bekommen, dann blickten ihre kohlschwarzen Augen wieder über das Meer.
»Ich habe mit Euch nichts zu schaffen, mein Herr.«
»Oh, nun komm schon, sei nicht so spröde, meine Schöne. Ich will nur freundlich sein.«
»Ich habe genügend Freunde, vielen Dank, mein Herr. Bitte, lasst mich in Ruhe.«
»Auf mich wirkst du ziemlich einsam, meine Schöne.«
Übertrieben sanft strich er ihr ein Härchen von der Wange. Sie wandte sie um und trat mit jenem Lächeln, das in Wahrheit das Hübscheste an ihr war, einen Schritt näher. Bei ihren nächsten Worten hatte sie ihr Stilett gezogen und an jene Stelle gepresst, an der die meisten männlichen Probleme wurzeln, und ihr Lächeln wurde im gleichen Maße breiter, in dem sich seine Augen weiteten.
»Ihr fasst mich noch einmal an, mein Herr, und ich verfüttere Eure Kronjuwelen an die verdammten Seedraken.«
Der Pfau schrie leicht auf, als sie noch einmal fester gegen die Wurzel des besagten Übels drückte, die nun ein wenig kleiner erschien als noch kurz zuvor. Erbleichend trat er einen Schritt zurück, dann wandte er sich mit seiner tiefsten Verbeugung ab und versuchte, sich davon zu überzeugen, dass seine Hand vielleicht doch die bessere Gesellschaft darstellte.
Das Mädchen wandte sich wieder dem Meer zu. Schob den Dolch zurück in den Gürtel.
Wie gesagt, sie war von ganz eigenem Liebreiz.
Um keine weitere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, blieb sie anschließend meist für sich und ließ sich nur zu den Mahlzeiten sehen, und wenn sie frische Luft schnappen wollte, dann tat sie das in der stillen Nimmernacht. Ansonsten verbrachte sie die Zeit in der Hängematte ihrer Kajüte, studierte die dicken Wälzer, die ihr der alte Mercurio mitgegeben hatte, und war damit zufrieden. Ihre Augen taten sich schwer mit der ysiirischen Schrift, aber die Katze, die Schatten war, half ihr bei den schwierigsten Passagen, eingerollt in ihre Haarsträhnen über ihre Schulter blickend, während sie Hypaciahs Arkemische Wahrheiten studierte oder eine staubtrockene Ausgabe von Plienes’ Lehren über die Gurgel[7] las.
Und so saß sie auch jetzt über die Lehre gebeugt, die glatte Stirn vor Anstrengung gefurcht.
»… versuch’s noch einmal …«, flüsterte die Katze.
Das Mädchen massierte sich die Schläfen und verzog das Gesicht. »Davon bekomme ich Kopfschmerzen.«
»… o du armes mädchen, soll ich vielleicht pusten …?«
»Das sind doch Kindermärchen. Dieses Zeug erzählt man kleinen Stöpseln, die noch nicht mal über die Tischkante gucken können.«
»… sie wurden auch nicht für eine itreyanische leserschaft verfasst …«
Wieder wandte sich das Mädchen der dünnen Spinnenschrift zu, räusperte sich und las laut vor: »Der Himmel über der Republik Itreya wird von drei Sonnen erhellt, die man gewöhnlich für die Augen des Lichtgottes Aa hält. Es ist kein Zufall, dass die Ungewaschenen Aa oft als den Allessehenden bezeichnen.«
Sie hob eine Augenbraue und sah die Schattenkatze an. »Ich wasche mich eigentlich ziemlich oft.«
»… plienes war sehr elitär …«
»Du meinst, er war ein Blödmann.«
»… fahre fort …«
Seufzen. »Die größte der drei Sonnen ist eine zornesrote Kugel namens Saan. Sehend. Wie ein Räuber und Tagedieb schlurft Saan schrecklich langsam über den Himmel und ist dort beinahe einhundert Wochen hintereinander zu sehen. Die zweite Sonne heißt Saai. Wissend. Ein kleiner, blaugesichtiger Bursche, der schneller auf- und untergeht als seine Brüder …«
»… als seine geschwister«, verbesserte die Katze. »… das alt-ysiirische kennt keine geschlechterspezifischen nomen …«
»… der schneller auf- und untergeht als seine Geschwister und vielleicht vierzehn Wochen lang zu sehen ist, während er fast die doppelte Zeit jenseits des Horizonts verbringt. Die dritte Sonne heißt Shiih. Beobachtend. Shiih ist ein trübgelber Riese, der beinahe ebenso langsam wie Saan über den Himmel wandert.«
»… sehr gut …«
»Wenn die drei Sonnen ihrer schwerfälligen Wege gegangen sind, erleben Itreyas Bürger jene wahre Nacht, die sie ›Wahrdunkel‹ nennen, die aber nur für kurze Zeit alle zweieinhalb Jahre einmal eintritt. Alle anderen Abende … an allen Abenden sehnen sich die Itreyaner nach kurzer Dunkelheit, um mit den Kameraden zu trinken, bei ihren Liebsten zu liegen …«
Das Mädchen hielt inne.
»Was heißt oshk? Das Wort hat Mercurio mich nie gelehrt.«
»… das ist nicht weiter überraschend …«
»Es hat also etwas mit Sex zu tun.«
Die Katze bewegte sich elegant auf ihre andere Schulter hinüber, ohne auch nur eine einzige Locke in Unordnung zu bringen.
»… es bedeutet, ›Liebe zu machen, ohne sich zu lieben‹ …«
»Verstehe.« Das Mädchen nickte. »… bei ihren Liebsten zu liegen, ihre Huren zu ficken oder irgendwas dazwischen, doch müssen sie das ständige Licht der sogenannten Nimmernacht ertragen, die eines oder mehrere der Augen des Aa am Himmel erstrahlen lassen. Manchmal drei Jahre ohne Unterlass, ohne einen Tropfen tiefer Dunkelheit.«
Das Mädchen klappte das Buch mit lautem Knall zu.
»… hervorragend …«
»Mir platzt der Kopf.«
»… die ysiirische schrift ist nichts für schwache köpfe …«
»Na, vielen Dank auch.«
»… das habe ich nicht gemeint …«
»Natürlich nicht.« Sie erhob sich und rieb sich die Augen. »Komm, lass uns ein wenig frische Luft schnappen gehen.«
»… du weißt, dass ich keine luft brauche …«
»Das Atmen übernehme ich. Du kannst mir dabei zusehen.«
»… wie du willst …«
Die beiden schlichen sich auf Deck. Die Schritte des Mädchens blieben flüsterleise, und die Katze machte überhaupt kein Geräusch. Oben erwartete sie der brüllende Wind, der die Nimmernachtwende ankündigte; Saais blauer Schimmer verblasste langsam am Horizont, so dass nun nur noch Saan sein düsterrotes Glühen über den Himmel schickte.
Das Deck der Galan war fast verlassen. Ein riesiger Steuermann mit groben Gesichtszügen stand am Ruder, zwei Mann hielten Ausschau in den Krähennestern, ein kleiner Schiffsjunge (der immer noch fast einen Kopf größer war als sie) war über dem Stiel seines Wischmopps eingenickt und träumte offenbar von seiner Liebsten. Das Schiff pflügte seit fünfzehn Wenden durch die Schwertersee, und südlich von ihnen lag die bruchzahnige Küste von Liis. In einiger Entfernung sah das Mädchen ein weiteres Schiff, verschwommen in Saans Licht. Ein schwerer Frachter, der die Dreifachsonne der itreyanischen Marine geflaggt hatte und durch die Wellen schnitt wie ein grabbeinerner Dolch durch die Kehle eines alten Henkersmanns.
Das blutige Ende, das sie dem Henker bereitet hatte, lastete schwer auf ihr. Schwerer als die Erinnerung an die glatte Härte des Süßen, an seinen Schweiß, der später auf ihrer Haut getrocknet war. Wenngleich sie seitdem eine Mörderin war, war sie jetzt doch auch eine frisch entjungferte Frau, und der Gedanke an den Gesichtsausdruck des Henkers, als sie seine Kehle durchschnitten hatte … stand damit im Widerstreit. Es ist eine große Sache, wenn vor den eigenen Augen ein Mensch vom Leben mit all seinen Möglichkeiten in die Endgültigkeit des Todes hinübergleitet. Und es ist noch einmal etwas ganz anderes, wenn man selbst derjenige gewesen ist, der dafür gesorgt hat.
»Hallo, meine Hübsche.«
Die Stimme riss sie aus ihren Überlegungen, und sie schalt sich für ihre Unachtsamkeit. Was hatte Mercurio ihr beigebracht? Drehe dem Raum nie den Rücken zu. Und nun hätte sie zwar einwenden können, dass ihre jüngste Bluttat sie vielleicht mit Recht abgelenkt hatte oder dass es auf einem offenen Schiffsdeck keine Räume im eigentlichen Wortsinn gab, aber trotzdem hörte sie beinahe die Weidenrute, die der alte Assassine als Antwort auf ihre Entschuldigung schwang.
»Zweimal die Treppe rauf!«, hätte er gebrüllt. »Rauf und wieder runter!«
Als sie sich umwandte, sah sie den jungen Seemann mit der Pfauenfeder und dem Kerbholzlächeln vor sich. Neben ihm stand ein anderer Mann, so breit wie eine Brücke. Unter seinen Hemdsärmeln zeichneten sich die Muskeln ab wie Walnüsse, die man in schlecht genähte Säcke gestopft hat. Dem Aussehen nach war er ebenfalls ein Itreyaner, gebräunt und mit blauen Augen, aus denen der stumpfe Glanz der Gottesgraber Straßen sprach.
»Ich hatte gehofft, dass wir uns noch mal wiedersehen«, sagte der Pfau.
»Und ich durfte wohl kaum darauf hoffen, dass wir es nicht tun. Dafür ist das Schiff zu klein, mein Herr.«
»Jetzt nennst du mich wieder einen Herren, ja? Bei unserer letzten Begegnung hast du noch damit gedroht, mir einige sehr geschätzte Körperteile zu entfernen und sie an die Fische verfüttern.«
Sie sah zu dem Schiffsjungen hinüber. Beobachtete den ausgestopften Walnusssack durch die dichten Wimpern.
»Es war keine Drohung, Herr.«
»Du wolltest dich also nur großtun? Dann wäre es Zeit für eine Entschuldigung, findest du nicht?«
»Und Ihr würdet eine Entschuldigung annehmen, Herr?«
»Unter Deck mit Sicherheit.«
Kleine Wellen liefen über ihren Schatten, wie über das Wasser eines Mühlteichs, wenn es zu regnen beginnt. Doch der Pfau war mit seiner verletzten Ehre beschäftigt und der Walnusssack mit dem Gedanken an die herrliche Misshandlung, zu der er vielleicht gleich Gelegenheit bekommen würde, und so merkten die beiden nichts.
»Ich muss nur einmal laut schreien, das ist euch doch wohl klar«, sagte sie.
»Und wie laut könntest du wohl schreien«, fragte der Pfau mit einem Lächeln, »bevor wir deinen knöchernen Arsch über die Reling befördern?«
Sie sah zum Ruderstand hinüber. Zu den Krähennestern. Ein Sturz ins Meer wäre ein Todesurteil – selbst wenn die Galan ihre Fahrt unterbrach und versuchte, sie zu retten. Sie schwamm nur wenig besser als der Anker des Schiffes, und in der Schwertersee wimmelte es vor Seedraken wie in den Hosen eines Süßen vor Sackratten.
»Nicht sehr laut«, räumte sie ein.
»… entschuldigt, meine edlen freunde …«
Die beiden Kerle zuckten zusammen, als sie die Stimme hörten, und fuhren herum. Der Pfau plusterte sich auf und machte ein doppelt grimmiges Gesicht, um die Angst zu verstecken, die ihn plötzlich überkam. Und dort, hinter ihnen auf dem Deck, sahen sie die Katze, die Schatten war und die sich eine Pfote leckte.
Sie war so dünn wie altes Pergament und durchscheinend genug, dass sie das Deck dahinter noch erkennen konnten. Ihre Stimme glich dem Raunen von Satinlaken auf kalter Haut.
»… ich fürchte, ihr habt das falsche mädchen zum tanz aufgefordert …«, sagte sie.
Ein Kälteschauer legte sich verstohlen über sie, leicht wie ein Flüstern und doch eisig. Eine Bewegung ließ den Pfau zum Deck hinabblicken, und er erkannte mit wachsendem Entsetzen, dass der Schatten des Mädchens viel größer war, als er hätte sein sollen. Als er überhaupt hätte sein können. Und was noch schlimmer war: Der Schatten bewegte sich.
Dem Pfau blieb der Mund offen stehen, als sie ihren Stiefel ins Gemächt seines Kumpans rammte. Der Walnusssack klappte vornüber, sie packte seinen Arm, riss ihn über die Bordwand und stieß den Mann ins Meer. Der Pfau fluchte, als sie hinter ihn glitt, aber er stellte fest, dass er keinen Schritt machen konnte, um sich zur Wehr zu setzen – es war, als klebten seine Stiefel im Schatten des Mädchens fest. Sie gab ihm einen harten Tritt in den Hintern, und er krachte mit dem Gesicht gegen die Reling. Das Mädchen riss ihn herum, drückte ihm ein Messer an die Kehle und presste ihn so fest gegen die Bordwand, dass sich sein Hals höchst unangenehm krümmte.
»Ich erbitte Entschuldigung, junge Frau«, keuchte er. »Bei der Wahrheit von Aa, ich wollte nicht respektlos sein.«
»Wie lautet Euer Name, Herr?«
»Maxinius«, flüsterte er. »Maxinius, wenn es Euch beliebt.«
»Weißt du, was ich bin, Maxinius-wenn-es-Euch-beliebt?«
»… D-Dun …«
Seine Stimme bebte. Sein Blick glitt zu den Schatten, die um ihre Füße waberten.
»Dunkelinn.«
Mit dem nächsten Atemzug sah der Pfau sein ganzes kleines Leben vor seinen Augen vorüberziehen. Alles, was richtig und was falsch gewesen war. Das Scheitern, die Triumphe und das dazwischen. Das Mädchen spürte einen Hauch von Traurigkeit eine vertraute Gestalt neben ihrem Gesicht. Die Katze, die keine Katze war, hockte nun auf ihrer Schulter, so wie sie sich auf den Bettpfosten des Henkers gesetzt hatte, als sie ihn der Gurgel überantwortete. Und auch wenn sie keine Augen hatte, so wusste das Mädchen doch, dass sie die Lebenszeit betrachtete, die sich in den Pupillen des Pfaus spiegelte, und ganz in seinen Bann geschlagen war, wie ein Kind vor einem Puppentheater.
Nun solltet ihr begreifen: Unsere Heldin hätte diesen jungen Mann verschonen können. Und euer Erzähler hätte euch an diesem entscheidenden Punkt ganz einfach anlügen und zu einem Ablenkungsmanöver greifen können, um sie in einem besseren Licht darzustellen.[8] Aber die Wahrheit ist nun einmal, meine edlen Freunde, dass sie ihn nicht verschonte. Dennoch werdet ihr vielleicht ein wenig Trost in dem Umstand finden, dass sie immerhin innehielt. Und das nicht, um sich an seiner misslichen Lage zu ergötzen. Oder den Augenblick zu genießen.
Sondern um zu beten.
»Höre mich, Niah«, flüsterte sie. »Höre mich, Mutter. Dieses Fleisch dir zum Fest. Dieses Blut dir zum Wein. Dieses Leben, dieses Ende, meine Gabe an dich. Halte ihn fest.«
Ein sanfter Stoß, und er stürzte in die mahlenden Wogen. Als die Pfauenfeder im Wasser versank, begann sie über das Brüllen des Windes zu schreien, so laut wie die Teufel in der Gurgel. Mann über Bord!, kreischte sie, Mann über Bord! Und schnell läuteten alle Glocken. Aber bis die Galan gewendet hatte, war von dem Pfau oder dem Walnusssack keine Spur mehr zu entdecken.
Und so schnell und einfach war die Bilanz unserer jungen Assassine um das Dreifache gestiegen.
Vom rollenden Kiesel zur Lawine.
Der Kapitän der Galan war ein Dweymeri, der Wolfsfresser hieß, sieben Fuß groß, die dunklen Locken mit Salz verklebt. Der gute Kapitän war verständlicherweise erzürnt darüber, dass zwei seiner Besatzungsmitglieder vorzeitig abgemustert hatten, und sehr interessiert daran, mehr über das Wie und Warum zu erfahren. Aber als er das blasse Mädchen, das den Alarm ausgelöst hatte, in seiner Kajüte befragte, berichtete die Kleine schüchtern murmelnd von einem Streit zwischen den Itreyanern, der in einem Handgemenge endete, bei dem sie unter lauten Flüchen beide über Bord gefallen waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Seebären – auch wenn es sich dabei um dumme Itreyaner handeln mochte – sich gegenseitig in ihr kühles Seemannsgrab gestoßen hatten, war gering. Aber noch viel unwahrscheinlicher war, dass dieses kleine Mädchen die beiden Kerle ganz allein der Trelene geopfert hatte.
Der Kapitän baute sich vor ihr auf, vor diesem heimatlosen Kind in Grau und Weiß, das ein Geruch verbrannter Nelken umspielte. Er wusste weder, wer die Kleine war, noch warum sie nach Ysiir wollte. Aber als er sich seine Pfeife aus Seedrakenknochen in den Mund schob und den Flintstein schlug, um sie anzuzünden, sah er unwillkürlich auf die Deckplanken. Und bemerkte den Schatten, der sich um die Füße des seltsamen Mädchens ringelte.
»Am besten bleibst du bis zum Ende der Reise für dich, Kleine.« Er atmete in die Düsternis zwischen ihnen. »Ich lasse dir die Mahlzeiten in deine Kajüte bringen.«
Das Mädchen sah zu ihm hinüber, die Augen schwarz wie die Gurgel. Dann blickte sie selbst zu ihrem Schatten hinunter, der dunkel genug für zwei war. Und sie stimmte der Überlegung des Wolfsfressers zu, mit einem Lächeln, süß wie Honigtau.
Kapitäne sind schließlich meistens schlaue Köpfe.
Fußnoten
[1]
Sie wusste noch nicht, wie man richtig zuhört. Das ist den wenigsten von euch da draußen gegeben.
[2]
Doch, da war etwas, dem das auffiel. Etwas, das sich sehr wohl kümmerte.
[3]
Die Rippen sind wohl das beeindruckendste Wahrzeichen der Hauptstadt Itreyas: Sechzehn großartige, verknöcherte Türme erheben sich schimmernd im Herzen der Stadt aus Brücken und Gebein. Es sind, wie es heißt, die Rippen des letzten Titanen, der von Aa, dem Gott des Lichts, im Krieg um die Herrschaft über den Himmel Itreyas besiegt wurde. Aa befahl seinen Getreuen, dort einen Tempel zu erbauen, wo der Titan zur Erde herabgestürzt war, um seinem Sieg ein Denkmal zu setzen. Und so wurde die Saat für die große Stadt auf dem Grab des letzten Feindes des Lichts gesät.
Seltsam jedoch, meine edlen Freunde, dass ihr in keiner heiligen Schrift und in keinem Buch den Namen dieses Titanen finden werdet …
[4]
Herrin der See, drittgeborenes Kind des Lichts und der Gurgel; jene, die einmal die Welt trinken wird.
[5]
Wie betrunken hätte ein Mann sein müssen, um ernsthaft darüber nachzudenken, einer Riesin den Hof zu machen? Und vor allem, wie hätte er in derart berauschtem Zustand sein eigenes Werkzeug an Ort und Stelle bringen oder gar die Leiter besteigen können, die er dafür gebraucht hätte?
[6]
Ganz offensichtlich handelte es sich um einen Mann mit dem Einfallsreichtum eines Dichters.
[7]
Nur sechs Exemplare sind noch erhalten. Plienes und alle bekannten Ausgaben seiner Werke wurden im Jahr 27 PR der Fackel überantwortet, in jenem großen Feuer, das kurzzeitig als »der hellste Schein« bekannt war.
Der Scheiterhaufen, der auf Betreiben von Großkardinal Crassus Alvaro aufgetürmt worden war, bestand aus über viertausend »Brandbüchern« und wurde von der itreyanischen Geistlichkeit als großer Erfolg gefeiert – bis Crassus’ Sohn, Kardinal Leo Alvaro, darauf aufmerksam machte, dass es keinen helleren Schein in der Schöpfung geben konnte als den von Lichtgott Aa höchstpersönlich und dass es sich daher um Gotteslästerung handelte, wenn man ein von Menschenhand errichtetes Großfeuer mit einem solchen Namen bedachte.
Nach der Kreuzigung des Großkardinals verfügte Großkardinal Alvaro II, dass das Feuer ab sofort in allen Schriften als »Heller Schein« bezeichnet werden sollte.
[8]
»Schön, sie war vielleicht die gefürchtetste Mörderin von ganz Itreya und hatte zahllose Menschen auf dem Gewissen, sie mochte die Herrin der Klingen sein und die Zerstörerin der Republik, aber seht doch, es war auch etwas Gutes in ihr. Sie ließ Gnade walten, sogar gegenüber Vergewaltigern und Schlägern. Und jetzt: gefühlvolle Geigenmusik!«
3Hoffnungslos
Etwas war ihr gefolgt. Von diesem Ort jenseits der Musik, wo ihr Vater gestorben war. Etwas Hungriges. Ein noch blindes, raupenartiges Bewusstsein, das von durchscheinenden Flügeln träumte. Und von dem Mädchen, das sie ihm gewähren würde.
Das kleine Mädchen lag zusammengerollt auf einem Palastbett in den Gemächern ihrer Mutter, die Wangen tränennass. Ihr Bruder neben ihr war fest in seine Windeln gewickelt und blinzelte mit seinen großen schwarzen Augen. Der Säugling verstand nichts von dem, was um ihn herum geschah. Er war viel zu jung, um zu begreifen, dass sein Vater – und der Rest seiner kleinen Welt – ein Ende gefunden hatte.
Das kleine Mädchen beneidete ihn.
Ihre Wohnung befand sich hoch oben in der Krümmung der zweiten Rippe. In die Wände aus uraltem Grabgebein waren reichverzierte Friese geschnitzt. Aus dem bleiverglasten Fenster konnte sie die dritte und fünfte Rippe auf der anderen Seite sehen, die viele hundert Fuß über das Rückgrat ragten. Nimmernachtwinde heulten um die versteinerten Türme und trugen kühle Luft von den Wassern der Bucht heran.
Der Reichtum zeigte sich noch im kleinsten Winkel, roter Samt und Kunstobjekte, die aus allen vier Ecken der itreyanischen Republik stammten. Eine bewegende Mekwerk-Skulptur vom Ehernen Kolleg. Wandteppiche mit Millionen von Stichen, gestickt von den blinden Propheten von Vaan. Ein Kronleuchter aus reinem Dweymeri-Kristall. Diener wuselten wie kleine Wirbelstürme aus weichen Gewändern umher, und im Auge dieses Sturms stand die Dona Corvere, die sie zur Eile trieb, eilt euch, eilt euch, bei der Liebe des Aa.
Das kleine Mädchen saß nun neben seinem Bruder auf dem Bett. Es hielt einen schwarzen Kater an seine Brust gepresst, der leise schnurrte. Aber dann bemerkte das Tier einen tieferen Schatten am Saum des Vorhangs, stellte das Nackenfell auf und fauchte. Bohrte seine Krallen in die Hände der Kleinen, die ihn daraufhin auf den Boden fallen ließ, vor die Füße einer Dienerin, die mit einem Aufschrei stolperte. Dona Corvere wandte sich wütend ihrer Tochter zu.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: