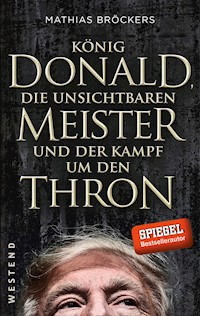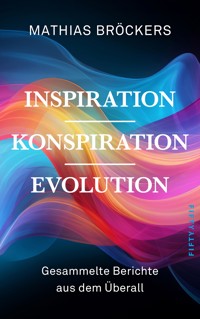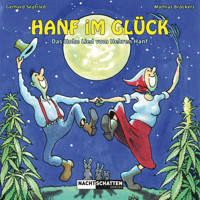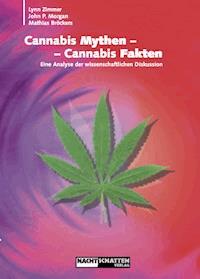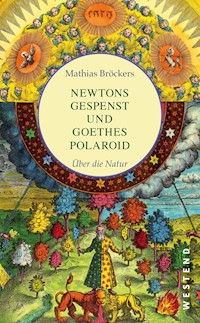
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das "Fragment über die Natur" gilt als der herausragende Schlüsseltext für das Denken Goethes über die Natur. Es steht am Anfang seiner lebenslangen Erforschung von Steinen und Pflanzen, Tieren und Menschen, Licht und Farben und legt den Grundstein für die Methode der "zarten Empirie", mit der er sich als Wissenschaftler seinen Gegenständen nähert. So kam denn auch der Pionier der Farbfotografie mit Newtons "spectre" (engl. Erscheinung, Gespenst), dem von einem Prisma Farben getrennten weißen Lichtstrahl, nicht weiter, erforschte die Farbwahrnehmung mit Goethe'schen Methoden und erfand das farbige Polaroid-Sofortbild. Mathias Bröckers zeigt, dass Goethes Erkenntnisse über die Natur ihrer Zeit voraus waren und heute für die Zukunft relevanter sind als je zuvor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ebook Edition
Mathias Bröckers
Newtons Gespenst und Goethes Polaroid
Über die Natur
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-729-0
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2019
Umschlaggestaltung: www.pleasantnet.de
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
© privat
Mathias Bröckers ist freier Journalist, der unter anderem für die taz und Telepolis schreibt. Neben Artikeln, Radiosendungen und Beiträgen für Anthologien veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Seine Werke Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf (1993), Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11.9. (2002) und Wir sind die Guten (2014, zusammen mit Paul Schreyer) wurden internationale Bestseller.
Für Nora, Juri, Clara und Hugo
Fragment über die Natur
(Erstveröffentlicht 1782 im Tiefurter Journal, J.W. v. Goethe: Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. 1)
Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen – unvermögend aus ihr herauszutreten, und unvermögend tiefer in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arme entfallen.
Sie schafft ewig neue Gestalten, was da ist, war noch nie, was war, kommt nicht wieder – alles ist neu, und doch immer das Alte.
Wir leben mitten in ihr und sind ihr fremde. Sie spricht unaufhörlich mit uns und verrät uns ihr Geheimnis nicht. Wir wirken beständig auf sie und haben doch keine Gewalt über sie.
Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben und macht sich nichts aus den Individuen. Sie baut immer und zerstört immer, und ihre Werkstätte ist unzugänglich.
Sie lebt in lauter Kindern, und die Mutter, wo ist sie? – Sie ist die einzige Künstlerin: aus dem simpelsten Stoff zu den größten Kontrasten; ohne Schein der Anstrengung zu der größten Vollendung – zur genausten Bestimmtheit, immer mit etwas Weichem überzogen.
Jedes ihrer Werke hat ein eigenes Wesen, jede ihrer Erscheinungen den isoliertesten Begriff, und doch macht alles eins aus.
Sie spielt ein Schauspiel: ob sie es selbst sieht, wissen wir nicht, und doch spielt sie’s für uns, die wir in der Ecke stehen.
Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr, und doch rückt sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig, und ist kein Moment Stillestehen in ihr. Fürs Bleiben hat sie keinen Begriff, und ihren Fluch hat sie ans Stillestehen gehängt. Sie ist fest. Ihr Tritt ist gemessen, ihre Ausnahmen selten, ihre Gesetze unwandelbar.
Gedacht hat sie und sinnt beständig; aber nicht als ein Mensch, sondern als Natur. Sie hat sich einen eigenen allumfassenden Sinn vorbehalten, den ihr niemand abmerken kann.
Die Menschen sind alle in ihr und sie in allen. Mit allen treibt sie ein freundliches Spiel und freut sich, je mehr man ihr abgewinnt. Sie treibt’s mit vielen so im Verborgenen, dass sie’s zu Ende spielt, ehe sie’s merken.
Auch das Unnatürlichste ist Natur, auch die plumpste Philisterei hat etwas von ihrem Genie. Wer sie nicht allenthalben sieht, sieht sie nirgendwo recht.
Sie liebt sich selber und haftet ewig mit Augen und Herzen ohne Zahl an sich selbst. Sie hat sich auseinandergesetzt, um sich selbst zu genießen. Immer lässt sie neue Genießer erwachsen, unersättlich sich mitzuteilen.
Sie freut sich an der Illusion. Wer diese in sich und andern zerstört, den straft sie als der strengste Tyrann. Wer ihr zutraulich folgt, den drückt sie wie ein Kind an ihr Herz.
Ihre Kinder sind ohne Zahl. Keinem ist sie überall karg, aber sie hat Lieblinge, an die sie viel verschwendet und denen sie viel aufopfert. Ans Große hat sie ihren Schutz geknüpft.
Sie hat wenige Triebfedern, aber, nie abgenutzte, immer wirksam, immer mannigfaltig.
Sie spritzt ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor und sagt ihnen nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen. Sie sollen nur laufen; die Bahn kennt sie.
Ihr Schauspiel ist immer neu, weil sie immer neue Zuschauer schafft.
Leben ist ihre schönste Erfindung, und der Tod ist ihr Kunstgriff, viel Leben zu haben.
Sie hüllt den Menschen in Dumpfheit ein und spornt ihn ewig zum Lichte. Sie macht ihn abhängig zur Erde, träg und schwer, und schüttelt ihn immer wieder auf.
Sie gibt Bedürfnisse, weil sie Bewegung liebt. Wunder, dass sie alle diese Bewegung mit so wenigem erreicht.
Jedes Bedürfnis ist Wohltat; schnell befriedigt, schnell wieder erwachsend. Gibt sie eins mehr, so ist’s ein neuer Quell der Lust; aber sie kommt bald ins Gleichgewicht.
Sie setzt alle Augenblicke zum längsten Lauf an, und ist alle Augenblicke am Ziele.
Sie ist die Eitelkeit selbst, aber nicht für uns, denen sie sich zur größten Wichtigkeit gemacht hat.
Sie lässt jedes Kind an sich künsteln, jeden Toren über sich richten, Tausende stumpf über sich hingehen und nichts sehen, und hat an allen ihre Freude und findet bei allen ihre Rechnung.
Man gehorcht ihren Gesetzen, auch wenn man ihnen widerstrebt; man wirkt mit ihr, auch wenn man gegen sie wirken will.
Sie macht alles, was sie gibt, zur Wohltat, denn sie macht es erst unentbehrlich. Sie säumet, dass man sie verlange; sie eilet, dass man sie nicht satt werde.
Sie hat keine Sprache noch Rede, aber sie schafft Zungen und Herzen, durch die sie fühlt und spricht.
Ihre Krone ist die Liebe. Nur durch sie kommt man ihr nahe. Sie macht Klüfte zwischen allen Wesen, und alles will sich verschlingen. Sie hat alles isoliert, um alles zusammenzuziehen. Durch ein paar Züge aus dem Becher der Liebe hält sie für ein Leben voll Mühe schadlos.
Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und quält sich selbst. Sie ist rau und gelinde, lieblich und schrecklich, kraftlos und allgewaltig. Alles ist immer da in ihr. Vergangenheit und Zukunft kennt sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigkeit. Sie ist gütig. Ich preise sie mit allen ihren Werken. Sie ist weise und still. Man reißt ihr keine Erklärung vom Leibe, trutzt ihr kein Geschenk ab, das sie nicht freiwillig gibt. Sie ist listig, aber zu gutem Ziele, und am besten ist’s, ihre List nicht zu merken.
Sie ist ganz, und doch immer unvollendet. So wie sie’s treibt, kann sie’s immer treiben.
Jedem erscheint sie in einer eignen Gestalt. Sie verbirgt sich in tausend Namen und Termen, und ist immer dieselbe.
Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausführen. Ich vertraue mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht hassen.Ich sprach nicht von ihr. Nein, was wahr ist und was falsch ist, alles hat sie gesprochen.
Alles ist ihre Schuld, alles ihr Verdienst.
Eine Art Lebensprogramm
Im Frühjahr 1828 erhielt Goethe seine Manuskripte aus dem Nachlass der verstorbenen Herzogin Anna Amalia zurück, darunter auch das Fragment über die Natur, welches er 1782 für ihr Journal von Tiefurt eingereicht hatte. Während eines Sommerfests auf ihrem Schlösschen in Tiefurt bei Weimar hatte Anna – Mutter des amtierenden Herzogs Carl August – gemeinsam mit ihren Freundinnen die Idee eines Wochenblatts geboren. »Es ist eine Gesellschaft von Gelehrten, Künstlern, Poeten und Staatsleuten beiderlei Geschlechts zusammengetreten«, hieß es kurz darauf im »Avertissement« der neuen Zeitung, die nur an ausgewählte Abonnenten verbreitet wurde – handschriftlich und ohne Namensnennung der Autoren – um »alles was Politick, Witz, Talent und Verstand , in unseren dermalen so merkwürdigen Zeiten hervorbringen, in einer peridodischen Schrift den Augen eines sich selbst gewählten Publikums vorzulegen«. Vorbild war das berühmte Journal de Paris, das gleich in der ersten Ausgabe parodiert wurde. »Es ist ein kleiner Scherz, den ich mir diesen Sommer gemacht habe, der so gut reüssiret hat, daß es noch bis jetzt continuiret wird; vielleicht wird es Ihnen auch einige gute Stunden machen«, schreibt Anna Amalia, als sie im November 1781 einige Exemplare an »Frau Rath Goethe« nach Frankfurt sandte. Auch Goethe selbst schickte später weitere Ausgaben an seine Mutter und schreibt dazu: »Es sind recht artige Sachen drinnen und wohl wert, daß Sie es durchblättern. Wenn Sie es genug haben, schicken Sie es nach Zürich an Frau Schultheß.«
Die Frau Mama und Goethes Freundin in Zürich durften sich zu einem sehr exklusiven Leserkreis zählen – die Auflage des von Weimarer Pennälern in Schönschrift kopierten Blatts betrug kaum mehr als ein Dutzend Exemplare. »Die Verfasser sind Hätschelhans, Wieland, Herder, Knebel, Kammerherr Seckendorff und Einsiedel«, schreibt die Herzogin weiter an Goethes Mutter und setzt neckisch hinzu: »Der Frau Räthin weltberühmte Kennerschaft wird ihr leicht die Stücke von jedem Autor erraten lassen.« Ob Mutter Elisabeth die anonymen Artikel ihres »Hätschelhans« und der anderen wirklich identifizierte, ist nicht überliefert. Sicher ist nur, dass es die Qualität dieser anonym auftretenden Autoren war – der Crème de la Crème der »Weimarer Klassik« –, die dem exklusiven Blatt eine Auflage von 42 Ausgaben und eine Lebenszeit von knapp drei Jahren bescherte.
Dazu gehörte auch jener außerordentliche Aufsatz in der 32. Ausgabe, der Fragment über die Natur überschrieben war und von allen Leserinnen und Lesern sogleich als Goethe-Text identifiziert wurde – was aber nicht der Wahrheit entsprach. Zwar hatte Goethe ihn, aus der Feder seines Schreibers Philip Seidel, bei der Redaktion eingereicht, die aus Anna Amalia, Luise von Göchhausen und dem Kammerherrn von Einsiedel bestand, doch antwortete er seinem Freund Ludwig von Knebel, der ihm nach Erscheinen Ende 1782 in einem Brief begeistert mit Worten wie »meisterhaft und groß« dazu gratulierte, sogleich, dass er nicht der Verfasser sei: »Der Aufsatz ist nicht von mir, und ich habe bisher ein Geheimnis daraus gemacht, von wem er sei. Ich kann nicht leugnen, dass der Verfasser mit mir umgegangen und mit mir über diese Gegenstände oft gesprochen hat […]. Er hat mir selbst viel Vergnügen gemacht und hat eine gewisse Leichtigkeit und Weichheit, die ich ihm vielleicht nicht hätte geben können.«
Als Goethe nun fast 50 Jahre später das Manuskript aus dem Nachlass der einstigen »Chefredakteurin« und Herausgeberin Anna Amalia wiedererhält und gefragt wird, ob es in die im Entstehen begriffene Gesamtausgabe seiner Werke aufgenommen werden soll, schreibt der nunmehr 79-Jährige:
»Dass ich diese Betrachtungen verfasst, kann ich mich faktisch zwar nicht erinnern, allein sie stimmen mit den Vorstellungen überein, zu denen sich mein Geist damals ausgebildet. Ich möchte die Stufe damaliger Einsicht einen Komparativ nennen, der seine Richtung gegen einen noch nicht erreichten Superlativ zu äußern gedrängt ist. Man sieht die Neigung zu einer Art von Pantheismus, indem den Welterscheinungen ein unerforschliches, unbedingtes, humoristisches, sich selbst widersprechendes Wesen zum Grunde gedacht ist, und mag als Spiel, dem es bitterer Ernst ist, gar wohl gelten.«
So ist es und so wurde dieses Stück nicht nur in Goethes Werkausgabe letzter Hand aufgenommen, sondern steht bis heute darin. Zusammen mit den Erläuterungen zu dem aphoristischen Aufsatz »Die Natur«, die Goethe am 24. Mai 1828 an Kanzler Müller schickt (siehe Anhang), leitet es in die Gesamtausgabe seiner Naturwissenschaftlichen Schriften ein.
Dort gehört er hin und überstrahlt als herausragender Schlüsseltext für das Naturverständnis des Dichters und Forschers Goethe nahezu alles, was er jemals veröffentlicht hat. Das ist nicht wenig – die Taschenbuchversion der »Weimarer Ausgabe« zählt 143 Bände – doch abgesehen vom Faust, einigen Stücken und Gedichten sowie dem Bestseller Die Leiden des jungen Werthers hat kaum ein Text von Goethe größere Bedeutung erlangt als dieser aphoristische Aufsatz. Nicht beim großen Publikum des Volkspoeten und Theaterautors Goethe, sondern bei Naturforschern und Wissenschaftlern – also ausgerechnet in jenen Kreisen, in denen Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten und vor allem seine Farbenlehre oft als dilettantische Versuche eines Amateurs abgetan wurden.
Der Forschungsreisende Alexander von Humboldt – heute als Pionier ökologischen, nachhaltigen Denkens gefeiert – leitete sein fünfbändiges Hauptwerk Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschreibung (1845-1862) mit ausführlichen Zitaten aus der Natur ein, der Biologe und Darwinist Ernst Haeckel stellt den Text seiner Natürlichen Schöpfungsgeschichte (1868) voran, sein Lehrer – der Pathologe und Anti-Darwinist Rudolf Virchow – kritisiert zwar einige »Anthropomorphisierungen« (die Goethe dank Schiller später überwunden hätte), stellt diese Gedanken aber ins Zentrum seiner Betrachtungen über Goethe als Naturforscher (1861). Auch der Physiker Hermann von Helmholtz, der Goethes Farbenlehre als »Irrtum« abtat, lobte diesen Text, der Biologe Thomas Huxley, die »Bulldoge Darwins«, ließ 1869 eine englische Version dieser»wonderful rhapsody« als Editorial der ersten Ausgabe des bis heute bedeutenden britischen Wissenschaftsjournals Nature drucken, und der Architekt Frank Lloyd Wright und seine Frau sorgten mit einer Übersetzung für Verbreitung in Amerika. Rainer Maria Rilke und Stefan Zweig, der das Natur-Fragment in einem Sonderdruck für Freunde drucken ließ, zählten ebenso zu den Bewunderern wie Sigmund Freud, der in seinen Erinnerungen bekundet, »dass der Vortrag von Goethes schönem Aufsatz Die Natur in einer populären Vorlesung kurz vor der Reifeprüfung die Entscheidung gab, dass ich Medizin studierte«.
»Der in Rede stehende Aufsatz ist eine Art Lebensprogramm, das allem Goethe’schen Denken über die Natur zu Grunde liegt«, notiert 1892 der Herausgeber der Naturwissenschaftlichen Schriften Goethes, Rudolf Steiner, in einem Beitrag, in dem er auch den wahrscheinlichen Autor der Hymne – Christoph Tobler – benennt (siehe Anhang – Rudolf Steiner: Zu dem Fragment über die Natur). Der junge Theologe, Übersetzer und Schwager des Schweizer Goethe-Freunds Lavater hatte sich den Sommer 1781 über in Weimar aufgehalten, galt den Damen und Herren des dortigen Musenhofs als »philosophischer Kopf« und war Goethe persönlich durch zahlreiche Gespräche wohlbekannt. Schon Goethes Freundin Charlotte von Stein hatte dem nach Erscheinen der Natur im Tiefurter Journal so begeisterten Freund Knebel in einem Brief Tobler als Verfasser genannt. Da dieser später nur kurz als Pfarrer in Offenbach und danach bis an sein Lebensende in seiner Schweizer Heimat kaum noch als Autor hervorgetreten ist – also das blieb, was man heute ein »One-Hit-Wonder« nennen würde –, hat in der Folge Zweifel an der Autorenschaft Toblers genährt. Als heißester Ghostwriter-Kandidat gilt neben dem Schweizer mittlerweile der Bruder des Journal-Redakteurs und Kammerherrns Einsiedel, August von Einsiedel. Doch wer auch immer der eigentliche Urheber dieser Zeilen war – auf uns und die Nachwelt gekommen sind sie durch Goethe, als »Spiel, dem es bitterer Ernst ist«.
Dass es der bald 80-jährige Geheimrat Goethe später als »Komparativ« bezeichnet, als vorläufiges Stadium seiner Naturerkenntnis, dem noch die zwei entscheidenden Aspekte – »Polarität« und »Steigerung« – zum »Superlativ« fehlten, scheint aus heutiger Sicht eine Untertreibung, wird doch dieser »Superlativ« durchaus auch schon hier erreicht. Weshalb es kein Zufall ist, dass sich die Evangelisten Darwins – Huxley und Haeckel – diesen Text auf die Fahnen schrieben, ihn also für den »Kampf ums Dasein« mit »blutigen Zähnen und Krallen« reklamierten und den naturforschenden Poeten Goethe zum Vorläufer der Darwin’schen Evolutionslehre erklärten. Tatsächlich aber war Goethe, wie sich anhand dieser Hymne zeigen lässt, eher ein sehr früher Post-Darwinist – durchaus mit einem deutlichen Gespür für die Evolution, Entwicklung, Dynamik ausgestattet, aber eben auch mit einer Abneigung, Leben allein auf simple Mechanik und Genetik zu reduzieren, wie es Darwins Nachfolger taten.
Ein Vierteljahrhundert vor der Entdeckung der Doppelhelix des DNA-Moleküls und ein Menschenalter vor der Entschlüsselung des menschlichen Genoms schrieb Gottfried Benn 1932 in einem Essay über Goethe und die Naturwissenschaften:
»Es schlägt sich ein Bogen, es zieht eine metaphysische Spannung von des Thales Primärvorstellung: alles ist Wasser, das heißt alles ist eins, zu jenem Hymnus über die Natur aus dem Jahre 1782 und zu der Vorstellung der Urphänomene, die Goethes ganzes Schaffen durchzieht.«
Zur Biologie heißt es in diesem Aufsatz dann:
»Und so bleiben aus der biologischen Forschung des ganzen Jahrhunderts übrig: zwei Lehrsätze von Lamarck [vergleiche Oscar Hertwig: Das Werden der Organsimen] und die Mendel’schen Gesetze, beides innerhalb der Goetheschen Theorie gelegen, innerhalb seiner theoretischen Normen, seines naturwissenschaftlichen Instinkts –: der Rest ist Diskussion, Züchtungstohuwabohu, Brutschrankeuphorie. Und die Kardinalfrage der neuzeitlichen Lebensforschung: wie entstehen neue Gene blieb bis heute unbeantwortet.« (Gottfried Benn: Essays und Reden, 1989, S.