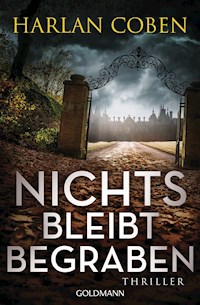
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vor über zwanzig Jahren wurde Patricia Lockwood während eines Raubüberfalls entführt und schwer misshandelt. Ihr gelang die Flucht, doch ihr Peiniger wurde nie gefasst. Auch die damals gestohlenen Gemälde blieben verschollen. Bis in einem New Yorker Apartment neben einer Leiche eines der Bilder gefunden wird – und der Koffer, den der Entführer Patricia zu packen zwang. Zeit für Patricias Cousin, Windsor Horne Lockwood III, den Dingen auf den Grund zu gehen: Win, wie seine wenigen Freunde ihn nennen, ist hochintelligent, skrupellos und wild entschlossen, den Fall zu lösen. Einen Fall, der die dunkelsten Geheimnisse seiner Familie ans Tageslicht zu bringen droht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Vor über zwanzig Jahren wurde Patricia Lockwood während eines Raubüberfalls entführt und schwer misshandelt. Wochen später gelang ihr durch einen glücklichen Zufall die Flucht, doch ihr Peiniger wurde nie gefasst. Auch die wertvollen Gemälde, die damals der illustren Lockwood-Familie gestohlen wurden – ein Vermeer und ein Picasso –, blieben verschollen.
Bis in einem New Yorker Apartment neben einer Leiche eines der Bilder gefunden wird – zusammen mit dem Koffer, den der Entführer Patricia damals zu packen zwang. Zeit für Patricias Cousin, Windsor Horne Lockwood III., den Dingen auf den Grund zu gehen. Dabei hat Win, wie seine wenigen Freunde ihn nennen, ganz eigene Ermittlungsmethoden: hochintelligent, skrupellos und mit scheinbar endlosen Ressourcen ausgestattet ist er wild entschlossen, den Fall zu lösen. Selbst als dieser Fall die dunkelsten Geheimnisse seiner Familie ans Tageslicht zu bringen droht …
Weitere Informationen zu Harlan Coben und zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
HARLAN COBEN
Nichts bleibt begraben
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Gunnar Kwisinski
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Win« bei Grand Central Publishing, New York/Boston. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Deutsche Erstveröffentlichung August 2021
Copyright © der Originalausgabe 2021 by Harlan Coben
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbHRedaktion: Anja Lademacher
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Arcangel/Yolande de Kort; Arcangel/Peter Greenway; FinePic®, München
TH · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-25970-9V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Diane und Michael Discepolo Mit Liebe und Dankbarkeit
EINS
Es ist der Wurf, der die Meisterschaft entscheiden wird. Langsam und im hohen Bogen fliegt der Ball auf den Korb zu.
Mir ist das egal.
Alle anderen im Lucas Oil Stadium in Indianapolis starren mit offenen Mündern auf den Ball.
Ich nicht.
Ich starre auf die andere Seite des Felds. Zu ihm hinüber.
Natürlich habe ich einen Platz am Spielfeldrand auf Höhe der Mittellinie. Rechts neben mir sitzt ein Marvel-Superheld-Schauspieler der ersten Garde in einer Art Kompressions-T-Shirt, das jeden einzelnen Muskel hervorhebt – Sie kennen ihn –, und links von mir präsentiert der umjubelte Rap-Mogul Swagg Daddy, dem ich vor drei Jahren seinen Privatjet abgekauft habe, ein Modell seiner eigenen Sonnenbrillenmarke. Ich mag Sheldon (das ist Swagg Daddys richtiger Name), sowohl als Menschen als auch seine Musik, allerdings begrüßt er die Leute so überschwänglich und fröhlich, dass ich es als extrem unterwürfig empfinde und vor Scham im Boden versinken möchte.
Ich selbst trage einen maßgeschneiderten dunkelblauen Nadelstreifenanzug aus der Savile Row, ein Paar handgefertigte bordeauxfarbene Bedfordshire-Schuhe von Basil, dem besten Schuhmacher von GJ Cleverley’s eine Limited Edition Lily-Pulitzer-Seidenkrawatte in Rosa und Grün und die Sonderanfertigung eines Hermès-Einstecktuchs, das mit himmlischer Präzision aus der linken Brusttasche hervorschaut.
Ich bin ein echter Dandy.
Außerdem bin ich – für alle, die nicht zwischen den Zeilen lesen können – reich.
Der Ball, der durch die Luft fliegt, wird über den Ausgang des gehypten College-Basketballturniers entscheiden, das auch als »March Madness« bekannt ist. Schon seltsam, wenn man sich das überlegt. All der Schweiß und die Tränen, das Taktieren, der Talentaufbau und das Training, dazu die unzähligen Stunden, in denen die Spieler allein vor der Garage auf den Korb werfen, die Dribbel- und Passübungen, das Gewichteheben und die Steigerungsläufe, die man so oft wiederholt, bis man sich übergibt, all die Jahre in den unterschiedlichsten, aber immer miefigen Sporthallen. Basketballgruppen für Kinder, Basketballsommercamps, Basketballjugendturniere, Highschool-Basketball, Sie verstehen schon, was ich meine – und im Endeffekt läuft alles nur darauf hinaus, dass eine simple orangefarbene Kugel den Regeln der Physik folgend genau in diesem Moment auf einen metallischen Zylinder zufliegt.
Entweder geht der Ball daneben und die Duke University gewinnt, oder er geht rein und die South State University und ihre Fans stürmen zum Feiern auf den Platz. Der Marvel-Superheld war auf der South State University. Swagg Daddy hat, so wie ich, die Duke University besucht. Beiden sieht man die Erregung an. Die lärmende Menge verstummt vor Anspannung. Die Zeit scheint langsamer zu vergehen.
Noch einmal: Obwohl meine Alma Mater beteiligt ist, ist mir das egal. Ich kann mit dem ganzen Fanrummel nichts anfangen. Es interessiert mich nicht, wer einen Wettbewerb gewinnt, an dem ich nicht aktiv teilnehme – oder jemand, der mir am Herzen liegt. Ich frage mich oft, warum andere Leute so etwas tun.
Ich nutze die Zeit, um mich auf ihn zu konzentrieren.
Er heißt Teddy Lyons und ist einer der übertrieben vielen Assistenztrainer auf der Bank von South State. Er ist gut einen Meter achtzig groß und kräftig, ein fescher, fleischiger Bauerntrampel. Big T – er möchte so genannt werden – ist dreiunddreißig Jahre alt, und dies ist bereits sein vierter Job als College-Coach. Soweit ich weiß, ist er ein ganz ordentlicher Taktiker, sein Spezialgebiet ist jedoch die Talentsuche.
Die Hupe ertönt und verkündet das Ende der Spielzeit. Der Ausgang des Wettbewerbs ist noch immer offen.
Es ist so still in der Arena, dass ich tatsächlich höre, wie der Ball auf den Ring trifft.
Swagg umklammert mein Bein. Der Marvel-Superheld drückt mir einen muskulösen Trizeps auf die Brust, als er erwartungsvoll die Arme ausbreitet. Der Ball prallt einmal, zweimal, dann ein drittes Mal auf den Ring, als wollte dieses leblose Objekt die Menge piesacken, bevor es völlig eigenständig über Sieg oder Niederlage entscheidet.
Ich behalte weiterhin Big T im Auge.
Als der Ball schließlich vom Ring rollt und zu Boden fällt – eindeutig ein Fehlwurf –, explodiert der Bereich der Arena, in dem die Blue-Devil-Fans sitzen. Am Rand meines Sichtfelds sacken alle auf der South-State-Bank zusammen. Ich mag das Wort »niederschmetternd« nicht – es ist ein seltsames Wort –, aber hier passt es. Sie sacken zusammen und wirken tatsächlich niedergeschmettert. Ein paar kollabieren und brechen in Tränen aus, als die Realität der Niederlage langsam in ihr Bewusstsein vordringt.
Nicht so Big T.
Marvel-Superheld lässt sein hübsches Gesicht in seine Hände sinken. Swagg Daddy umarmt mich. »Wir haben gewonnen! Win!«, schreit er. Dann überlegt er kurz: »Oder klingt ›Wir sind Gewinner, Win‹ besser?«
Ich runzele die Stirn. Das Stirnrunzeln sagt ihm, dass ich Besseres erwartet habe.
»Ja, schon gut«, sagt Swagg.
Ich kann ihn kaum hören. Das Getöse ist mehr als ohrenbetäubend. Er beugt sich weiter zu mir herüber.
»Meine Party wird fantastisch!«
Er läuft aufs Feld und mischt sich unter die Feiernden. Mit ihm stürmt der Rest der ausgelassen jubelnden Masse auf den Platz und verschluckt ihn. Ein paar Leute klopfen mir im Vorbeigehen auf den Rücken. Sie wollen mich zum Mitfeiern animieren, ich aber bleibe sitzen.
Wieder halte ich nach Teddy Lyons Ausschau, doch der ist verschwunden.
Aber nicht lange.
***
Zwei Stunden später sehe ich Teddy Lyons wieder. Er stolziert auf mich zu.
Ich befinde mich in einem Dilemma.
Ich werde Big T verletzen. Daran führt kein Weg vorbei. Ich bin mir noch nicht sicher, wie, aber auf jeden Fall wird er schwere körperliche Schäden davontragen.
Das ist nicht mein Dilemma.
Mein Dilemma ist das Wie.
Nein, ich habe keine Angst, erwischt zu werden. Dieser Aspekt ist komplett durchgeplant. Big T hat eine Einladung zu Swagg Daddys Party bekommen. Und so kommt er gerade durch die Tür, die er für den VIP-Eingang hält. Was er aber nicht ist. Eigentlich findet hier nicht einmal die Party statt. Es dröhnt zwar laute Musik durch den Korridor, aber das ist nur Show.
In diesem Lagerhaus sind nur Big T und ich.
Ich trage Handschuhe. Ich bin bewaffnet – das bin ich immer –, obwohl ich die Waffen nicht brauchen werde.
Big T kommt näher, also kehren wir zurück zu meinem Dilemma: Schlage ich ohne Vorwarnung zu, oder gebe ich ihm das, was manche Leute als eine faire Chance betrachten würden?
Es geht mir nicht um Moral oder Fair Play oder so etwas. Wie die allgemeine Bevölkerung dies bezeichnen würde, ist mir egal. Ich habe mir im Laufe der Jahre schon diverse Kratzer geholt. Wenn man in den Kampf zieht, sind sämtliche Regeln schnell hinfällig. Beißen, treten, mit Sand werfen, Waffen benutzen, man tut einfach, was nötig ist. In richtigen Kämpfen geht es ums Überleben. Da gibt es weder Preise noch Belobigungen für Fairness. Es gibt einen Sieger und einen Verlierer. Weiter nichts. Ob man dabei »geschummelt« hat, ist völlig egal.
Kurz zusammengefasst: Bei dieser abscheulichen Kreatur habe ich nicht die geringsten Skrupel zuzuschlagen, auch wenn sie noch nicht bereit ist. Ich habe keine Angst davor, ihn mit einem – um es umgangssprachlich auszudrücken – »billigen Trick« zu überrumpeln. Eigentlich hatte ich sogar genau das geplant: Ich wollte ihm eine verpassen, solange er noch unvorbereitet ist. Mit einem Schläger, einem Messer oder dem Pistolenkolben. Bring es zu Ende.
Und wo liegt jetzt das Dilemma?
Das Dilemma ist, dass es mir nicht ausreicht, ihm die Knochen zu brechen. Ich will auch seinen Geist brechen. Und wenn ein harter Kerl wie Big T einen vermeintlich fairen Kampf gegen meine zierliche Wenigkeit verliert – ich bin älter, viel kleiner und leichter und viel attraktiver (daran gibt es keinen Zweifel), also das Paradebeispiel eines verweichlichten Dandys –, würde das Big T wahrhaft demütigen.
Und genau das will ich erreichen.
Er ist nur noch wenige Schritte von mir entfernt. Ich treffe meine Entscheidung, trete vor und versperre ihm den Weg. Big T bleibt stehen und runzelt die Stirn. Er starrt mich einen Moment lang an. Ich lächle ihm zu. Er erwidert das Lächeln.
»Ich kenn Sie«, sagt er.
»Was Sie nicht sagen.«
»Sie sind vorhin beim Spiel gewesen. Haben am Spielfeldrand gesessen.«
»Schuldig«, sage ich.
Er streckt seinen riesigen Handschuh aus, um mir die Hand zu schütteln. »Teddy Lyons. Man nennt mich Big T.«
Ich schüttele seine Hand nicht. Ich starre sie an, als hätte er sie gerade aus dem Anus eines Hundes gezogen. Big T wartet einen Moment, wie erstarrt, dann zieht er seine Hand zurück, als wäre sie ein kleines Kind, das getröstet werden muss.
Ich lächle ihm wieder zu. Er räuspert sich.
»Wenn Sie mich entschuldigen würden …«
»Das würde ich nicht, nein.«
»Was?«, fragt er.
»Sie sind etwas schwer von Kapee, nicht wahr, Teddy?« Ich seufze. »Nein, ich würde und werde Sie nicht entschuldigen. Für Sie gibt es keine Entschuldigung. Können Sie mir jetzt folgen?«
Sein Blick verfinstert sich wieder. »Haben Sie irgendein Problem?«
»Hm. Was lässt sich darauf entgegnen?«
»Hä?«
»Ich könnte sagen: ›Nein, aber Sie haben ein Problem‹, oder ›Ich? Danke mir geht’s bestens‹, oder etwas in der Art, aber ehrlich gesagt klingen all diese humorigen Repliken in meinen Ohren nicht ganz richtig.«
Big T wirkt perplex. Eigentlich will er mich einfach beiseiteschieben. Andererseits erinnert er sich, dass ich zwischen all den Prominenten saß und somit jemand Bedeutendes sein könnte.
»Äh«, sagt Big T, »ich geh dann mal auf die Party.«
»Nein, das tun Sie nicht.«
»Wie bitte?«
»Hier gibt es keine Party.«
»Wenn Sie sagen, hier gibt es keine Party …«
»Die Party findet zwei Blocks entfernt statt«, sage ich.
Er stemmt die Handschuhe in die Hüfte. Eine klassische Trainerpose. »Was zum Teufel soll das hier?«
»Ich habe Ihnen die falsche Adresse zusenden lassen. Die Musik? Das ist nur Show. Der Security-Mann, der Sie vorne über den VIP-Eingang reingelassen hat? Er arbeitet für mich und ist sofort verschwunden, nachdem Sie durch die Tür getreten sind.«
Big T blinzelt zweimal. Dann tritt er näher an mich heran. Ich weiche keinen Zentimeter zurück.
»Was soll das werden?«, fragt er.
»Ich werde Ihnen eine Tracht Prügel verpassen, Teddy.«
Oh, sein Lächeln wird immer breiter. »Sie?«, fragt er. Seine Brust hat jetzt fast die Ausmaße der Spielwand in einem Squashcourt. Er kommt noch näher und blickt mit dem Selbstvertrauen eines großen, kräftigen Mannes auf mich herab, der dank seiner Statur noch nie kämpfen musste oder auch nur zum Kampf herausgefordert wurde. Das ist die dilettantische und amateurhafte Vorgehensweise, auf die Big T in solchen Situationen am liebsten zurückgreift – er bedrängt seinen Gegner mit seinem massigen Körper und wartet, dass der klein beigibt.
Ich gebe natürlich nicht klein bei. Ich lege meinen Kopf in den Nacken und sehe ihm in die Augen. Und jetzt erkenne ich, dass erste Zweifel seinen Blick trüben.
Ich warte nicht länger.
Mich so zu bedrängen war ein Fehler. Es vereinfacht meine erste Aktion. Ich lege die Fingerspitzen meiner rechten Hand so zusammen, dass sie eine Art Pfeilspitze formen, und ramme ihm diese Spitze auf den Kehlkopf. Er stößt ein gurgelndes Geräusch aus. Gleichzeitig trete ich ihm mit dem Spann seitlich gegen das rechte Knie, das, wie meine Recherchen ergeben haben, zwei Kreuzbandoperationen hinter sich hat.
Es knackt.
Big T fällt wie eine Eiche.
Ich hebe das Bein an und trete kräftig mit der Ferse zu.
Er stößt einen Schrei aus.
Ich trete noch einmal zu.
Er stößt einen Schrei aus.
Ich trete noch einmal zu.
Stille.
Den Rest erspare ich Ihnen.
Zwanzig Minuten später erscheine ich auf Swagg Daddys Party. Ein Security-Mann führt mich ins Hinterzimmer. Hier kommen nur drei Arten von Leuten rein – schöne Frauen, berühmte Gesichter und dicke Brieftaschen.
Wir lassen es bis fünf Uhr morgens krachen. Dann fährt eine schwarze Limousine Swagg und meine Wenigkeit zum Airport. Der Privatjet steht vollgetankt bereit.
Swagg verschläft den Rückweg nach New York City. Ich dusche – ja, mein Jet hat eine Dusche –, rasiere mich und kleide mich in einen grauen Kiton-K50-Business-Anzug.
Am Flughafen erwarten uns zwei schwarze Limousinen. Zum Abschied verwickelt Swagg mich in eine Art komplizierte Handschlagsumarmung. Er fährt mit einer Limousine zu seinem Anwesen in Alpine. Ich fahre mit der anderen direkt zu meinem Büro in einem 48-stöckigen Wolkenkratzer an der Park Avenue in Midtown. Das Lock-Horne-Building ist seit seiner Vollendung im Jahr 1967 im Besitz meiner Familie.
Auf dem Weg nach oben mache ich kurz im dritten Stock Station. In diesen Räumen befand sich die Sportagentur meines besten Freunds, die er jedoch vor ein paar Jahren aufgegeben hat. Danach habe ich sie zu lange leer stehen lassen, weil die Hoffnung zuletzt stirbt. Ich war sicher, dass mein Freund es sich anders überlegen und zurückkehren würde.
Das tat er nicht. Und so geht das Leben weiter.
Die neuen Mieter sind Fisher & Friedman, die sich selbst als »Anwaltskanzlei für Verbrechensopfer« vermarkten. Noch deutlicher formulieren sie es auf ihrer Website, die mich von ihnen überzeugt hat:
Wir helfen Ihnen, den Vergewaltigern, den Stalkern, den Mistkerlen, den Trollen, den Perverslingen und den Psychos direkt in die Eier zu treten.
Unwiderstehlich. Wie schon bei der Sportagentur, die diese Räume früher belegte, bin ich auch in dieser Firma stiller Teilhaber.
Ich klopfe an. Als Sadie Fisher »Herein« sagt, öffne ich die Tür und stecke den Kopf hinein.
»Viel Arbeit?«, frage ich.
»Soziopathen haben gerade Hochsaison«, sagt Sadie, ohne von ihrem Computermonitor aufzublicken.
Da hat sie natürlich recht. Aus diesem Grund habe ich in die Kanzlei investiert. Es gefällt mir, dass sie sich für die Unterdrückten und Geprügelten einsetzen, betrachte die aus Verunsicherung gewalttätig werdenden Männer – es sind fast immer Männer – allerdings auch als eine Wachstumssparte.
Schließlich sieht Sadie mich an. »Ich dachte, du wolltest zum Spiel nach Indianapolis.«
»Da war ich auch.«
»Ach richtig, der Privatjet. Manchmal vergesse ich, wie reich du bist.«
»Nein, tust du nicht.«
»Stimmt. Also, was gibt’s?«
Sadie trägt eine heiße Bibliothekarinnenbrille und einen rosafarbenen Hosenanzug, der eng anliegt und ihre Rundungen hervorhebt. Sie hat mir erklärt, dass das Absicht ist. Als sie anfing, Frauen zu vertreten, die sexuell belästigt und missbraucht worden waren, hatte man ihr geraten, sich konservativ zu kleiden und eher konturlose, unauffällige und damit gewissermaßen »unschuldige« Garderobe zu tragen, Sadie hielt das jedoch für Victim Blaming, weil den Frauen damit die Verantwortung zugeschoben wurde.
Und ihre Reaktion? Mach es genau umgekehrt.
Ich weiß nicht recht, wie ich das Thema ansprechen soll, also sage ich einfach: »Ich habe gehört, dass eine deiner Mandantinnen im Krankenhaus liegt.«
Das weckt ihre Aufmerksamkeit.
»Würdest du es für angebracht halten, ihr etwas zu schicken?«, frage ich.
»Was denn zum Beispiel, Win?«
»Blumen vielleicht. Oder Schokolade.«
»Sie liegt auf der Intensivstation.«
»Ein Stofftier. Luftballons.«
»Luftballons?«
»Irgendetwas, um ihr zu sagen, dass wir an sie denken.«
Sadie sah wieder auf ihren Monitor. »Das Einzige, was unsere Mandanten sich wünschen, ist etwas, das wir ihnen anscheinend nicht bieten können: Gerechtigkeit.«
Ich öffne den Mund, um etwas zu sagen, schweige dann aber doch, weil ich mich für Diskretion und Klugheit statt für Zuspruch und Angeberei entscheide. Als ich mich umdrehe und gehen will, sehe ich, dass zwei Personen – eine Frau und ein Mann – zielstrebig auf mich zukommen.
»Windsor Horne Lockwood?«, sagt die Frau.
Schon bevor sie ihre Marken herausholen, weiß ich, dass sie von einer Strafverfolgungsbehörde sind.
Sadie weiß das auch. Automatisch steht sie auf und kommt zu mir. Ich habe eine Menge Anwälte, die mich in geschäftlichen Angelegenheiten vertreten. Wenn es um persönliche Belange ging, ist aber mein bester Freund, der in diesen Räumen ansässige Sportagent, eingesprungen, der auch eine Anwaltszulassung besitzt. Denn in ihn hatte ich volles Vertrauen. Jetzt, da er – zumindest zeitweilig – aus dem Spiel ist, hat Sadie diese Rolle offenbar instinktiv übernommen.
»Windsor Horne Lockwood?«, wiederholt die Frau.
So heiße ich. Oder, wenn man es ganz genau nimmt, Windsor Horne Lockwood III. Ich stamme, wie schon der Name verrät, aus altem Geldadel und sehe auch aus, wie man es von Personen aus diesen Kreisen erwartet: rötliche Haut, blonde, leicht ergraute Haare, fein ziselierte patrizische Gesichtszüge, eine etwas hochmütige Körperhaltung. Ich bemühe mich, nicht zu verheimlichen, wer oder was ich bin. Ich weiß auch nicht, ob ich das könnte.
Ich überlege, was ich bei der Sache mit Big T vermasselt habe. Ich bin gut. Ich bin sogar sehr gut. Aber ich bin nicht unfehlbar.
Wo hatte ich einen Fehler gemacht?
Sadie ist schon fast neben mir. Ich warte. Statt selbst zu antworten, überlasse ich ihr die Antwort. Sie fragt: »Wer will das wissen?«
»Ich bin Special Agent Karen Young vom FBI«, sagt die Frau.
Young ist schwarz. Sie trägt ein dunkelblaues Hemd mit Button-down-Kragen unter einer taillierten mittelbraunen Lederjacke. Sehr modisch für eine FBI-Agentin.
»Und das ist mein Partner Special Agent Jorge Lopez.«
Lopez ist eher ein typischer Vertreter seiner Zunft. Sein Anzug hat die Farbe nassen Asphalts, seine rötliche Krawatte macht einen etwas traurigen Eindruck.
Sie zeigen uns ihre Dienstmarken.
»Worum handelt es sich?«, fragt Sadie.
»Wir würden gerne mit Mr Lockwood reden.«
»Das hatte ich schon mitbekommen«, erwidert Sadie scharf. »Worum geht es?«
Young lächelt und steckt ihre Marke wieder ein. »Es geht um einen Mord.«
ZWEI
Wir haben uns schnell in eine Sackgasse manövriert. Young und Lopez wollen mich ohne weitere Erklärungen irgendwohin mitnehmen. Sadie will nichts davon wissen. Irgendwann greife ich ein, und wir finden eine Art Übereinkunft. Ich werde mit ihnen fahren. Sie werden mich nicht ohne einen Anwalt vernehmen.
Sadie, deren Weisheit größer ist als ihre dreißigjährige Lebenserfahrung vermuten lässt, gefällt das nicht. Sie nimmt mich zur Seite und sagt: »Sie werden dich trotzdem befragen.«
»Das ist mir bewusst. Dies ist nicht mein erstes Aufeinandertreffen mit der Polizei.« Auch nicht mein zweites, drittes oder … aber das braucht Sadie nicht zu wissen. Aus drei Gründen will ich weder Zeit schinden noch auf eine »anwaltliche Vertretung« bestehen: Erstens hat Sadie einen Gerichtstermin, von dem ich sie nicht abhalten will. Zweitens: Wenn es um Teddy »Big T« Lyons geht, will ich aus unmittelbar einleuchtenden Gründen nicht, dass Sadie so direkt mit der Sache konfrontiert wird. Und drittens bin ich neugierig, was den Mord angeht, und schon genetisch mit einem überbordenden Selbstbewusstsein ausgestattet. Was will man machen?
Wir steigen in den Wagen und starten Richtung Uptown. Lopez fährt, Young ist Beifahrerin, ich sitze hinten. Seltsamerweise geht eine nahezu greifbare Unruhe von ihnen aus. Beide versuchen, professionell aufzutreten – was sie ja auch tun –, aber ich spüre das, was darunterliegt. Dieser Mord ist anders, ungewöhnlich. Sie versuchen, das zu verbergen, doch ihre Erregung ist wie ein Pheromon, das mir unweigerlich in die Nase steigt.
Anfangs versuchen Lopez und Young es mit der üblichen Schweigetechnik. Die Idee dahinter ist recht banal: Die meisten Menschen ertragen die Stille nicht und tun alles, um das Schweigen zu brechen, selbst wenn sie dazu etwas sagen müssen, mit dem sie sich selbst belasten.
Ich bin fast beleidigt, dass sie es bei mir mit dieser Methode probieren.
Natürlich lasse ich mich nicht locken. Ich lehne mich zurück, lege die Fingerspitzen aneinander und starre wie ein Tourist bei seinem ersten Besuch in der großen bedrohlichen Stadt aus dem Autofenster.
Schließlich sagt Young: »Wir wissen Bescheid über Sie.«
Ich greife in die Jackentasche und drücke eine Taste auf meinem Handy. Ab jetzt wird das Gespräch aufgezeichnet. Es wird direkt in eine Cloud übertragen, falls meine neuen FBI-Freunde bemerken, dass ich das Gespräch aufgezeichnet habe, und beschließen, es zu löschen oder das Handy zu zerstören.
Ich bin jederzeit auf alles vorbereitet.
Young dreht sich zu mir um. »Ich sagte, wir wissen Bescheid über Sie.«
Ich schweige.
»Sie haben früher ein paar Sachen fürs FBI erledigt«, sagt sie.
Dass sie von meiner Verbindung zum FBI wissen, überrascht mich, ich lasse es mir jedoch nicht anmerken. Direkt nach meinem Abschluss an der Duke University habe ich ein paar Aufträge erledigt, was allerdings streng geheim war. Die Tatsache, dass ihnen das jemand erzählt hat – es muss von ganz oben kommen –, bestätigt einmal mehr, dass es sich um einen äußerst ungewöhnlichen Mordfall handelt.
»Wie man hört, waren Sie ziemlich gut«, sagt Lopez und sieht mir über den Rückspiegel in die Augen.
Ein schneller Wechsel von Schweigen zu Schmeichelei. Ich reagiere weiterhin nicht.
Wir fahren die Central Park West hinauf, die Straße, in der ich wohne. Die Chancen, dass dieser Mord etwas mit Big T zu tun hat, sinken rapide. Zum einen weiß ich, dass Big T überlebt hat, wenn auch keinesfalls unversehrt. Und wenn das hier mit der Angelegenheit in Verbindung stehen würde, wären wir jetzt Richtung Downtown zum Hauptquartier am Federal Plaza 26 unterwegs und nicht in der Gegenrichtung zu meinem Domizil im Dakota Building, Ecke Central Park West und 72nd Street.
Ich denke darüber nach. Da ich allein lebe, kann es sich nicht um einen geliebten Menschen handeln. Vielleicht hat ein Gericht einen Durchsuchungsbefehl für mein Apartment ausgestellt, und sie haben etwas gefunden, das mich belastet oder das sie mir anhängen wollen, aber auch das kann ich mir nicht recht vorstellen. Der diensthabende Portier hätte mich informiert. Eine meiner versteckten Alarmanlagen hätte eine Meldung an mein Handy geschickt. Außerdem bin ich nicht so leichtsinnig und lasse etwas herumliegen, was die Polizei auf mich aufmerksam machen würde.
Zu meiner Überraschung fährt Lopez, ohne zu halten, am Dakota vorbei und weiter Richtung Uptown. Sechs Blocks später, als wir am American Museum of Natural History vorbeifahren, entdecke ich zwei Streifenwagen des New York Police Department an der 81st Street vor dem Beresford, einem anderen berühmten Luxusapartmenthaus aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.
Lopez mustert mein Gesicht im Rückspiegel. Ich sehe ihn an und runzele die Stirn.
Die Uniformen der Beresford-Portiers sind anscheinend von denen sowjetischer Generäle aus den späten Siebzigern des letzten Jahrhunderts inspiriert. Als Lopez hält, dreht Young sich um und fragt: »Kennen Sie jemanden in diesem Gebäude?«
Ich lächele sie schweigend an.
Sie schüttelt den Kopf. »Gut, gehen wir.«
Lopez rechts von mir, Young links, führen sie mich geradewegs durch die Marmorlobby zu einem wartenden, holzgetäfelten Aufzug. Als Young auf den Knopf für das oberste Stockwerk drückt, wird mir klar, dass wir uns in höhere Gefilde begeben – sowohl wörtlich als auch im übertragenen, vor allem aber im finanziellen Sinn. Einer meiner Mitarbeiter, ein Vizepräsident bei Lock-Horne-Securities, besitzt ein »Classic Six«-Apartment im vierten Stock des Beresford mit einem etwas eingeschränkten Blick auf den Park. Er hat dafür mehr als fünf Millionen Dollar bezahlt.
Young dreht sich zu mir um und sagt: »Irgendeine Idee, wohin es geht?«
»Aufwärts?«, sage ich.
»Witzig.«
Ich klimpere bescheiden mit den Augen.
»In die oberste Etage«, sagt sie. »Waren Sie dort schon mal?«
»Ich glaube nicht«, sage ich.
»Wissen Sie, wer da wohnt?«
»Ich glaube nicht.«
»Ich dachte, bei euch Reichen kennt jeder jeden.«
»Man soll die Menschen nicht auf Stereotype reduzieren«, sage ich.
»Aber Sie waren doch bestimmt schon einmal in diesem Gebäude, oder?«
Bevor ich mir die Antwort ersparen kann, öffnet sich die Fahrstuhltür mit einem Ping. Ich hatte angenommen, dass wir direkt in ein imposantes Apartment treten würden – Fahrstühle enden oft direkt in Penthouse-Suiten –, aber wir stehen in einem dunklen Korridor. An den Wänden schwere kastanienbraune Stofftapeten. Wir gehen nach rechts durch eine offene Tür zu einer schmiedeeisernen Wendeltreppe. Lopez stapft sie hinauf, und Young signalisiert mir, dass ich ihm folgen soll. Das tue ich.
Es ist alles voll Gerümpel.
Fast zwei Meter hohe Stapel aus alten Zeitungen, Magazinen und Büchern säumen den Rand der Treppe. Wir müssen im Gänsemarsch nach oben gehen – ich sehe ein Time Magazine von 1998 – und uns selbst dann noch immer wieder zur Seite drehen, um durch die engsten Stellen zu kommen.
Der Gestank nimmt einem den Atem.
Es ist zwar ein Klischee, aber an diesem Klischee ist etwas dran: Nichts stinkt so sehr wie ein verwesender Leichnam. Young und Lopez halten sich Nase und Mund zu. Ich nicht.
Das Beresford hat vier Türme, an jeder Ecke einen. Wir erreichen den Treppenabsatz im Nordostturm. Wer auch immer hier hoch oben in einem der prestigeträchtigsten Gebäude Manhattans wohnt (oder gewohnt hat, um genau zu sein), war ein echter sammelwütiger Messie. Wir können uns kaum rühren. Vier Kriminaltechniker klettern in voller Montur im Chaos herum und durchsuchen es.
Der Reißverschluss des Leichensacks ist schon verschlossen. Ich bin überrascht, dass sie den Leichnam noch nicht nach draußen gebracht haben, aber an dieser Sache ist einfach alles seltsam.
Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hier soll.
Young zeigt mir ein Foto, von dem ich annehme, dass es den Toten zeigt – geschlossene Augen, der Körper bis unters Kinn mit einem weißen Laken bedeckt. Ein älterer Mann mit blassgrauer Haut. Ich schätze ihn auf Anfang siebzig. Er hat eine Glatze mit einem grauen Haarkranz, der an den Ohren zu lang ist, einen mächtigen, lockigen Bart dicht und schmutzig weiß – es sieht aus, als wäre er dabei gewesen, ein Schaf zu verspeisen, als das Foto entstand.
»Kennen Sie ihn?«, fragt Young.
Ich entscheide mich für die Wahrheit. »Nein.« Ich gebe ihr das Foto zurück. »Wer ist er?«
»Das Opfer.«
»Ja, danke, das hatte ich mir auch schon gedacht. Ich wollte wissen, wie er heißt.«
Die Agenten sehen sich an. »Wir wissen es nicht.«
»Haben Sie den Eigentümer des Apartments gefragt?«
»Wir gehen davon aus«, sagt Young, »dass er der Eigentümer ist.«
Ich warte.
»Dieses Turmzimmer wurde vor fast dreißig Jahren von einer nicht rückverfolgbaren Briefkastenfirma gekauft.«
Eine nicht rückverfolgbare Briefkastenfirma. Damit kenne ich mich aus. Ich nutze selbst häufig ähnliche Finanzinstrumente, weniger, um der Besteuerung zu entgehen, auch wenn das oft ein positiver Nebenaspekt ist. Vermutlich ähnlich wie unserem verstorbenen Messie geht es mir dabei vor allem um die Anonymität.
»Keine Papiere?«, frage ich.
»Bisher haben wir nichts gefunden.«
»Die Mitarbeiter im Gebäude …«
»Er hat allein gelebt. Pakete und Ähnliches wurden unten an der Treppe abgelegt. In den oberen Etagen des Gebäudes gibt es keine Security-Kameras, oder wenn es sie doch geben sollte, sagen sie es uns nicht. Die Hausgebühren wurden von der Briefkastenfirma immer pünktlich bezahlt. Den Portiers zufolge war der Eremit – so haben sie ihn genannt – ein hundertprozentiger Einsiedler. Er hat das Haus nur sehr selten verlassen, und selbst dann hat er das Gesicht mit einem Schal verdeckt und hat einen geheimen Ausgang im Keller benutzt. Der Manager hat ihn erst heute Morgen gefunden, weil der Gestank bis ins Stockwerk darunter vorgedrungen war.«
»Und im ganzen Haus weiß keiner, wer er ist?«
»Bisher haben wir niemanden gefunden«, sagt Young, »aber wir gehen noch von Tür zu Tür.«
»Damit stellt sich natürlich eine Frage«, sage ich.
»Und die wäre?«
»Warum bin ich hier?«
»Das Schlafzimmer.«
Young scheint eine Antwort von mir zu erwarten. Sie bekommt aber keine.
»Folgen Sie mir.«
Als wir uns nach rechts wenden, habe ich einen wunderbaren Blick auf das riesige Planetarium des American Museum of Natural History gegenüber und den Central Park in seiner ganzen Pracht. Aus meiner Wohnung habe ich auch einen beneidenswerten Blick über den Park, allerdings ist das Dakota nur neun Stockwerke hoch, während wir hier in der zwanzigsten Etage oder höher sind.
Ich bin nicht leicht zu überraschen, aber als ich das Schlafzimmer betrete – als ich sehe, warum man mich hierhergebracht hat –, bleibe ich wie vom Schlag getroffen stehen. Ich rühre mich nicht. Ich starre es nur an. Ich versinke in der Vergangenheit, als wäre das Bild vor mir ein Zeitportal. Ich bin ein achtjähriger Junge, der sich auf Lockwood Manor in den Salonseines Großvaters schleicht. Der Rest der Großfamilie ist noch draußen im Garten. Ich trage einen schwarzen Anzug und stehe allein auf dem edlen Parkettboden. Das war, bevor die Familie zerbrochen ist – oder im Rückblick vielleicht genau der Moment, in dem die ersten Risse entstanden. Großvaters Begräbnis. Dieser Salon, sein Lieblingsraum, wurde mit einem süßlich riechenden Desinfektionsmittel ausgesprüht. Der vertraute, beruhigende Geruch seines Pfeifentabaks dominiert aber. Ich genieße ihn. Behutsam strecke ich eine Hand aus, lege sie auf das Leder seines Lieblingssessels, als würde er jeden Moment darin erscheinen – mit Strickjacke, Hausschuhen, Pfeife und allem Drum und Dran. Schließlich nimmt mein achtjähriges Ich all seinen Mut zusammen, und ich setze mich in den Ohrensessel. Als ich das tue, blicke ich auf die Wand über dem Kamin, so wie Großvater es oft tat.
Ich weiß, dass Young und Lopez meine Reaktion beobachten.
»Wir haben erst gedacht«, sagt Young, »dass es eine Fälschung sein muss.«
Ich starre weiter, so wie ich es als Achtjähriger in diesem Ledersessel tat.
»Also haben wir uns aus dem Met dort drüben gegenüber im Park eine Kuratorin geschnappt«, fährt Young fort. Met ist in diesem Fall die Kurzform für das Metropolitan Museum of Art. »Sie will das Bild noch einmal abnehmen und ein paar Tests machen, um ganz sicherzugehen, ist aber eigentlich davon überzeugt, dass es echt ist.«
Im Gegensatz zum Rest des Turms ist das Schlafzimmer des Messies sauber, ordentlich, übersichtlich und zweckmäßig eingerichtet. Das Bett an der Wand ist gemacht. Es hat kein Kopfteil. Bis auf eine Lesebrille und ein ledergebundenes Buch ist der kleine Tisch daneben leer. Ich weiß jetzt, warum ich hergeholt wurde – um mir den einzigen Gegenstand anzusehen, der an der Wand hängt.
Das Ölgemälde heißt einfach Mädchen am Klavier und ist von Jan Vermeer.
Ja, der Vermeer. Und ja, das Gemälde.
Dieses Meisterwerk ist klein, wie die meisten der nur vierunddreißig existierenden Vermeer-Bilder, nur etwa einen halben Meter hoch und vierzig Zentimeter breit, trotzdem hinterlässt es in seiner Schlichtheit und Schönheit einen überwältigenden Eindruck. Das Mädchen, das mein Urgroßvater vor fast hundert Jahren gekauft hatte, hing früher im Salon von Lockwood Manor. Vor über zwanzig Jahren hatte meine Familie dieses Gemälde, das nach heutigen Maßstäben geschätzte zweihundert Millionen Dollar wert ist, zusammen mit Picassos Der Leser, dem einzigen anderen Meisterwerk, das wir besaßen, als Leihgabe der Lockwood Gallery überlassen, die sich in der Founders Hall auf dem Campus des Haverford College befindet. Vielleicht haben Sie die Berichte über den nächtlichen Einbruch gelesen. Im Lauf der Jahre war immer wieder einmal zu hören gewesen, dass eines der beiden Kunstwerke gesehen wurde – der Vermeer zuletzt angeblich auf der Yacht eines Prinzen aus dem Nahen Osten. Keine dieser Spuren – einige habe ich persönlich überprüft – hat sich als richtig erwiesen. Es gab auch Mutmaßungen, dass der Diebstahl das Werk desselben Verbrechersyndikats gewesen wäre, das dreizehn Kunstwerke aus dem Isabelle Stewart Gardner Museum in Boston gestohlen hatte, darunter Werke von Rembrandt, Manet, Degas und ja, auch einen Vermeer.
Keins der gestohlenen Werke aus diesen beiden Raubüberfällen wurde wiedergefunden.
Bis jetzt.
»Irgendeine Idee?«, fragte Young.
Ich habe zwei leere Rahmen in Großvaters Salon aufgehängt, eine Hommage an die gestohlenen Werke, aber auch ein Versprechen, dass seine Kunstwerke eines Tages zurückkehren würden.
Dieses Versprechen hatte sich, allem Anschein nach, gerade zumindest zur Hälfte erfüllt.
»Und der Picasso?«, frage ich.
»Bisher keine Spur«, sagt Young, »aber wie Sie sehen, müssen wir noch ein bisschen was durchgucken.«
Der Picasso ist deutlich größer – mehr als einen Meter fünfzig hoch und über einen Meter breit. Wenn er hier wäre, hätten sie ihn vermutlich schon gefunden.
»Fällt Ihnen sonst noch irgendetwas dazu ein?«, fragt Young.
Ich deute auf die Wand. »Wann kann ich ihn abholen und nach Hause bringen?«
»Das wird noch eine Weile dauern. Sie wissen ja, wie das läuft.«
»Ich kenne einen renommierten Kunstkurator und -restaurator an der New York University. Sein Name ist Pierre-Emmanuel Claux. Ich möchte, dass er sich um das Werk kümmert.«
»Wir haben unsere eigenen Leute.«
»Nein, Special Agent, die haben Sie nicht. Wie Sie eben selbst sagten, haben Sie sich heute Morgen eine beliebige Person vom Met geschnappt, und …«
»Das war keinesfalls eine beliebige Person …«
»Das ist nicht zu viel verlangt«, unterbreche ich sie. »Die von mir vorgeschlagene Person ist wie kaum eine andere darin geschult, die Echtheit eines Kunstwerks zu verifizieren, sachgemäß damit umzugehen und es, falls nötig, zu restaurieren.«
»Wir werden darüber nachdenken«, sagt Young, um die Sache abzuschließen. »Sonst noch irgendetwas?«
»Wurde das Opfer erwürgt oder wurde ihm die Kehle durchgeschnitten?«
Wieder sehen sie sich an. Dann räuspert Lopez sich und fragt: »Woher wissen Sie …«
»Das Laken reichte ihm bis zum Kinn«, sage ich. »Auf dem Foto, das Sie mir gezeigt haben. Ich gehe davon aus, dass so die Wunde verdeckt werden sollte.«
»Darauf möchte ich lieber nicht eingehen, okay?«, sagt Young.
»Ist der Todeszeitpunkt bekannt?«, frage ich.
»Und darauf auch nicht.«
Zusammenfassung: Ich stehe unter Verdacht.
Ich weiß jedoch nicht recht, warum. Wenn ich die Tat begangen hätte, hätte ich das Bild auf jeden Fall mitgenommen. Oder vielleicht doch eher nicht. Vielleicht wäre ich so clever gewesen, ihn zu ermorden und das Gemälde zurückzulassen, damit sie es finden und meiner Familie zurückgeben.
»Fällt Ihnen noch etwas ein, was uns weiterhelfen könnte?«, fragt Young.
Die auf der Hand liegende Theorie lasse ich außen vor: Der Einsiedler war ein Kunsträuber. Er hatte den größten Teil seines Diebesguts zu Geld gemacht, die Einkünfte dazu genutzt, seine Identität zu verschleiern und eine anonyme Briefkastenfirma zu gründen, über die er die Wohnung gekauft hatte. Aus irgendeinem Grund – vermutlich, weil er das Bild liebte, oder einfach, weil es zu gefährlich war, es zu verkaufen – hatte er den Vermeer behalten.
»Also«, fährt Young fort, »waren Sie noch nie hier, oder?«
Sie fragt zu beiläufig.
»Mr Lockwood?«
Interessant. Offenbar glauben sie Beweise dafür zu haben, dass ich schon einmal in diesem Turm war. Das war ich nicht. Außerdem sind sie mit mir zum Tatort gefahren, was mehr als ungewöhnlich ist, nur um mich aus dem Konzept zu bringen. Wenn sie dem üblichen Protokoll bei einer Mordermittlung gefolgt wären und mich in einen Vernehmungsraum gebracht hätten, wäre ich auf der Hut gewesen und hätte mich zurückgehalten. Und wahrscheinlich hätte ich einen Anwalt mitgebracht.
Was, bitte sehr, glauben sie, gegen mich in der Hand zu haben?
»Ich danke Ihnen, auch im Namen meiner Familie, dass Sie den Vermeer gefunden haben. Ich hoffe, dass uns diese Entdeckung auch bald zu dem Picasso führt. Ich betrachte die Angelegenheit so weit als erledigt und würde gern in mein Büro zurückkehren.«
Young und Lopez gefällt das nicht. Young sieht Lopez an und nickt. Der verschwindet ins Nebenzimmer.
»Einen Moment noch«, sagt Young. Sie greift in ihre Mappe und zieht ein weiteres Foto heraus. Als sie es mir zeigt, bin ich schon wieder verblüfft.
»Erkennen Sie das, Mr Lockwood?«
Um Zeit zu gewinnen, sage ich: »Nennen Sie mich Win.«
»Erkennen Sie das, Win?«
»Sie wissen, dass ich das tue.«
»Es ist das Wappen Ihrer Familie, richtig?«
»Ja, das stimmt.«
»Wie Sie sich vorstellen können, wird es noch eine Weile dauern, bis wir die Durchsuchung der Wohnung des Opfers abgeschlossen haben«, fährt Young fort.
»Das sagten Sie bereits.«
»Im Schlafzimmerschrank haben wir jedoch einen Gegenstand gefunden.« Young lächelt. Mir fällt auf, dass es ein nettes Lächeln ist. »Nur einen?«
Ich warte.
Lopez kommt ins Zimmer zurück. Ihm folgt ein Techniker von der Spurensicherung, der einen Krokodillederkoffer mit brünierten Metallbeschlägen in der Hand hat. Ich erkenne den Koffer, traue aber meinen Augen nicht. Es ergibt einfach keinen Sinn.
»Kennen Sie den Koffer?«, fragt Young.
»Müsste ich das?«
Aber selbstverständlich kenne ich ihn. Vor vielen Jahren hatte Tante Plum jedem männlichen Familienmitglied einen solchen Koffer geschenkt. Sie waren alle mit dem Familienwappen und unseren Initialen verziert. Als sie ihn mir schenkte – ich war damals vierzehn –, habe ich mich sehr bemüht, nicht die Stirn zu runzeln. Ich habe nichts gegen teuer und luxuriös. Gegen vulgär und verschwenderisch dagegen schon.
»Ihre Initialen sind auf dem Koffer.«
Der Techniker kippt den Koffer leicht auf die Seite, damit ich das kitschige barocke Monogramm besser sehen kann:
WHL3.
»Das sind Sie, oder? WHL3 – Windsor Horne Lockwood der Dritte?«
Ich bewege mich nicht, sage nichts, lasse mir nichts anmerken. Allerdings und ganz ohne die Sache dramatisieren zu wollen, gerät meine Welt doch etwas ins Schlingern.
»Also, Mr Lockwood, wollen Sie uns erzählen, wie Ihr Koffer hierherkommt?«
DREI
Young und Lopez warten auf eine Erklärung. Ich fange mit der reinen Wahrheit an: Ich habe den Koffer seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Seit wie vielen Jahren? Hier ist meine Erinnerung schon leicht getrübt. Viele, sage ich. Mehr als zehn? Ja. Mehr als zwanzig? Ich zucke die Achseln. Ob ich denn zumindest bestätigen könne, dass das mein Koffer ist? Nein, da müsse ich ihn mir genauer ansehen, ihn öffnen und seinen Inhalt begutachten. Young gefällt das nicht. Das hatte ich auch nicht erwartet. Ob ich denn nicht zumindest aufgrund des Aussehens bestätigen könne, dass der Koffer mir gehört habe? Nein, es tue mir leid, aber das könne ich nicht sicher sagen. Lopez wies noch einmal darauf hin, dass das doch meine Initialen und mein Familienwappen seien. Das seien sie, bestätige ich, das schließe allerdings nicht aus, dass jemand ein Duplikat des Koffers angefertigt haben könnte. Warum jemand so etwas hätte tun sollen? Ich habe keine Ahnung.
Das also ist der Stand der Dinge.
Ich gehe die Wendeltreppe hinunter und stelle mich in eine Hausecke, wo ich Kabir, meinem Assistenten, eine SMS schreibe, dass er sofort einen Wagen zum Beresford schicken soll – an einer Rückfahrt mit meinen Begleitern von der Bundesbehörde bin ich nicht interessiert. Außerdem soll er sich darum kümmern, dass der Hubschrauber einsatzbereit ist, damit ich nach Lockwood Manor fliegen kann, dem Familienanwesen in der Main Line Region in Philadelphia. Die Verkehrssituation zwischen Manhattan und Philadelphia ist kaum vorhersehbar. Um diese Zeit würde die Fahrt wahrscheinlich gut zweieinhalb Stunden dauern. Der Hubschrauber braucht nur eine Dreiviertelstunde.
Ich habe es eilig.
Die schwarze Limousine erwartet mich an der 81st Street. Als wir uns dem Hubschrauberlandeplatz an der 30th Street in der Nähe des Hudson River nähern, rufe ich Cousine Patricia auf ihrem Handy an.
»Ich höre«, meldet sie sich.
Ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen. »Scherzkeks.«
»Entschuldige, Cousine. Alles in Ordnung?«
»Ja.«
»Ich hab länger nichts von dir gehört.«
»Ich von dir auch nicht.«
»Und was verschafft mir die Ehre?«
»Ich bin im Begriff, einen Hubschrauber nach Lockwood zu nehmen.«
Patricia sagt nichts.
»Können wir uns da treffen?«
»In Lockwood?«
»Ja.«
»Wann?«
»In einer Stunde.«
Sie zögert, was verständlich ist. »Ich war ewig nicht mehr in Lockwood, das muss …«
»Ich weiß«, unterbreche ich sie.
»Ich habe ein wichtiges Meeting.«
»Sag’s ab.«
»Einfach so?«
Ich warte.
»Was ist los, Win?«
Ich warte noch etwas länger.
»Okay«, sagt sie. »Wenn du es mir am Telefon sagen wolltest, hättest du es schon getan.«
»Dann sehen wir uns in einer Stunde«, sage ich und lege auf.
Drei Minuten nachdem wir die Benjamin-Franklin-Brücke über den Delaware River überflogen haben, der hier die Grenze zwischen New Jersey und Pennsylvania bildet, erhebt sich Lockwood Manor vor uns, ein Anblick, der einen eigenen Soundtrack verdient hätte. Der Hubschrauber, ein AgustaWestland AW169, wird langsamer, als er über die alten Steinmauern fliegt, schwebt kurz über der Lichtung und landet auf der Rasenfläche vor den Gebäuden, die wir immer noch die »neuen Stallungen« nennen. Vor gut einem Vierteljahrhundert hatte ich den alten Pferdestall, ein Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert, abreißen lassen. Dieser symbolische Akt erwies sich für mich als ungewohnt emotional. Ich hatte mir selbst eingeredet, dass durch einen Abriss und den folgenden Wiederaufbau die Erinnerungen auf dem Schutthaufen des Gehirns landen würden.
Das taten sie nicht.
Als ich meinen Freund Myron zum ersten Mal nach Lockwood eingeladen hatte – in den Semesterferien unseres ersten Studienjahrs –, hatte er den Kopf geschüttelt und gesagt: »Sieht aus wie Wayne Manor.« Er bezog sich natürlich auf Batman – die ursprüngliche Fernsehserie mit Adam West und Burt Ward in den Hauptrollen, der einzige Batman, der für uns zählte. Ich wusste, was er meinte. Das Herrenhaus wirkt prächtig, kühn und hat auch eine gewisse Aura, das »imposante Wayne Manor« aus der Serie, ist allerdings aus rotem Ziegel, während Lockwood aus grauem Stein besteht. Im Laufe der Zeit sind auch noch ein paar Anbauten hinzugekommen, insbesondere die beiden geschmackvollen, wenn auch riesigen Seitenflügel. Sie sind komfortabel und klimatisiert, viel heller und luftiger als die alten Räume, wirken aber zu bemüht. Man merkt, dass es Nachbauten sind. Ich brauche den alten Stein von Lockwood Manor, brauche die Feuchtigkeit, den Moder, die Zugluft.
Andererseits komme ich inzwischen nur noch als Besucher.
Nigel Duncan, der langjährige Butler/Anwalt der Familie – ja, es ist eine bizarre Mischung – empfängt mich. Nigel hat ein Doppelkinn und eine Glatze, über die er drei lange, dünne Strähnen gekämmt hat. Er trägt Joggingkleidung – Grau in Grau, also eine graue Jogginghose mit Villanova-Logo, Band und Schleife vor dem ausladenden Bauch, und einen grauen Kapuzenpullover mit dem Schriftzug »Penn« auf der Vorderseite.
Ich sehe ihn stirnrunzelnd an. »Hübsches Groutfit.«
Nigel verneigt sich vollendet. »Würde Master Win mich lieber im Frack sehen?«
Nigel hält sich für komisch.
»Sind das echte Chucks?«, frage ich und deute auf seine Turnschuhe.
»Sie sind sehr angesagt.«
»Bei Achtklässlern.«
»Autsch.« Dann sagt er: »Wir haben Sie nicht erwartet, Master Win.«
Mit dem ewigen Master will er mich triezen. Ich lasse ihm seinen Spaß. »Ich habe auch nicht erwartet herzukommen.«
»Ist alles in Ordnung?«
»Groovy«, antworte ich.
Nigels gelegentlich auftretender britischer Akzent ist Fake. Er wurde hier auf dem Anwesen geboren. Sein Vater hat für meinen Großvater gearbeitet, genau wie Nigel für meinen Vater. Aber Nigel hat einen etwas anderen Weg eingeschlagen. Mein Vater hat ihm das Bachelorstudium an der University of Pennsylvania und den Master in Jura bezahlt, um Nigel »mehr« zu ermöglichen als das Leben eines Butlers und ihn dann dennoch dauerhaft an Lockwood zu binden, indem er an die Familientradition appellierte.
Öffentliche Bekanntmachung: Die Reichen sind sehr gut darin, Großzügigkeit einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen.
»Bleiben Sie über Nacht?«, fragt Nigel.
»Nein«, sage ich.
»Ihr Vater schläft.«
»Wecken Sie ihn nicht.«
Wir gehen zum Hauptgebäude. Nigel möchte den Grund meines Besuchs erfahren, würde aber niemals fragen.
»Wissen Sie«, sage ich, »dass Ihr Outfit perfekt zur Farbe des Steins passt, aus dem das Haus gebaut wurde?«
»Deshalb trage ich ihn. Zur Tarnung.«
Ich werfe nur einen sehr kurzen Blick auf den Pferdestall. Nigel sieht es, tut aber so, als hätte er nichts gemerkt.
»Patricia kommt gleich«, sage ich.
Nigel bleibt stehen und dreht sich zu mir um. »Die Patricia? Ihre Cousine?«
»Genau die«, sage ich.
»Oje.«
»Würden Sie sie dann in den Salon führen?«
Ich gehe die Steintreppe hinauf und in den Salon. Ich rieche immer noch einen Hauch von Pfeifentabak. Mir ist klar, dass das unmöglich ist, weil in diesem Raum seit fast vierzig Jahren niemand mehr Pfeife geraucht hat, und dass das Gehirn nicht nur gelegentlich falsche Bilder und Töne, sondern auch – häufiger noch – Gerüche heraufbeschwört. Trotzdem ist der Geruch für mich real. Vielleicht verweilen Aromen tatsächlich, besonders diejenigen, in denen wir den größten Trost finden.
Ich gehe zum Kamin hinüber und starre auf den leeren Bilderrahmen, der die Stelle markiert, die einst der Vermeer einnahm. Der Picasso hing an der gegenüberliegenden Wand. Die komplette »Sammlung Lockwood«, zwei Werke im Wert von dreihundert Millionen Dollar. Hinter mir höre ich Absätze auf dem Marmor klackern. Die Chucks sind das nicht.
Nigel räuspert sich. Ich wende ihnen weiter den Rücken zu.
»Sie erwarten doch nicht ernsthaft, dass ich sie ankündige, oder?«
Ich drehe mich um, und da steht sie. Meine Cousine Patricia.
Patricias Blick durchstreift den Raum, bevor er auf mir hängen bleibt. »Ein seltsames Gefühl, wieder hier zu sein«, sagt sie.
»Es ist zu lange her«, sage ich.
»Ich muss Ihnen beipflichten«, wirft Nigel ein.
Patricia und ich sehen ihn an. Er versteht die Botschaft.
»Ich bin oben, falls mich jemand braucht.«
Er zieht die massiven Holzflügeltüren zu und geht. Sie fallen dumpf ins Schloss. Patricia und ich sagen einen Moment lang nichts. Sie ist, genau wie ich, in den Vierzigern. Wir sind Cousine und Cousin ersten Grades. Unsere Väter waren Brüder. Beide Männer, Windsor der Zweite und Aldrich, waren hellhäutig und blond. Ich bin das auch, Patricia hingegen kommt nach ihrer Mutter Aline, einer indigenen Brasilianerin aus Fortaleza. Onkel Aldrich schockierte die Familie mit seiner Entscheidung, die zwanzigjährige Schönheit nach seiner ausgedehnten Wohltätigkeitstour durch Südamerika nach Lockwood mitzubringen. Patricia trägt ihre dunklen Haare in einer modischen Kurzhaarfrisur. Ihr blaues Kleid ist gleichermaßen schick und lässig. Die mandelförmigen Augen glänzen. Wenn ihre Miene entspannt ist, zeigt sie nicht etwa ein zickiges »Resting Bitch Face«, vielmehr ist ihr Gesicht ergreifend melancholisch und bestürzend schön. Cousine Patricia ist eine bezaubernde und sehr telegene Person.
»Also, was ist los?«, fragt Patricia.
»Der Vermeer wurde gefunden.«
Sie ist verblüfft. »Ehrlich?«
Ich erzähle ihr von dem Messie, dem Turmzimmer im Beresford und dem Mord. Ich bin nicht für mein Taktgefühl oder meine Einfühlsamkeit bekannt, aber ich gebe immer mein Bestes, den Spannungsbogen bis zuletzt aufrechtzuerhalten. Cousine Patricia mustert mich mit diesem eindringlichen Blick, und wieder stürze ich durch ein Zeitportal zurück in die Vergangenheit. Als Kinder sind wir stundenlang auf diesem Gelände herumgestreift. Wir haben Verstecken gespielt. Wir sind geritten, sind im Pool und im See geschwommen. Wir haben Schach und Backgammon gespielt, Golf und Tennis trainiert. Wenn uns das Anwesen zu pompös oder zu düster wurde, was auf Lockwood Manor gelegentlich geschieht, sah Patricia mich nur an, verdrehte die Augen und entlockte mir so ein Lächeln.
Ich habe in meinem Leben nur einer Person gesagt, dass ich sie liebe. Nur einer einzigen.
Nein, es war nicht die eine ganz besondere Frau, die mir mein Herz gebrochen hatte – mein Herz wurde mir noch nie gebrochen, es hat noch nicht einmal einen Riss bekommen. Nur einer Person habe ich je meine Liebe gestanden und das war Myron Bolitar, mit dem mich eine platonische Männerfreundschaft verbindet. Es gab in meinem Leben einfach keine große Liebe, sondern nur eine große Freundschaft. Und bei Verwandten war es ähnlich. Wir sind vom selben Fleisch und Blut. Ich pflege gute, herzliche, in jeder Hinsicht intensive Beziehungen zu meinem Vater, Tanten und Onkeln, Cousins und Cousinen. Zu meiner Mutter hatte ich praktisch keine Beziehung – ich habe sie seit ich acht Jahre alt war weder gesehen noch mit ihr gesprochen –, zumindest bis kurz vor ihrem Tod nicht, da war ich über dreißig.
Ich habe ziemlich weit ausgeholt, nur um Ihnen mitzuteilen, dass Patricia mir immer die liebste Verwandte war. Selbst nach dem großen Bruch zwischen unseren Vätern, der auch der Grund dafür war, dass sie Lockwood seit ihrer Jugend nicht mehr besucht hat. Und auch nach der verheerenden Tragödie, durch die der Graben zwischen ihnen unüberbrückbar und – leider – auch dauerhaft verfestigt wurde.
Als ich fertig bin, sagt Patricia: »Das hättest du mir auch alles am Telefon erzählen können.«
»Stimmt.«
»Also, was gibt es noch?«
Ich zögere.
»Ach Mist«, sagt sie.
»Wie bitte?«
»Du hältst mich hin, Win, und das ist wirklich nicht deine Art … ach verdammt, es ist übel, oder?« Cousine Patricia tritt einen Schritt näher. »Was ist los?«
Ich sage es einfach: »Der Koffer von Tante Plum.«
»Was ist damit?«
»Der Messie hatte nicht nur den Vermeer. Er hatte auch den Koffer.«
***
Wir stehen uns schweigend gegenüber. Cousine Patricia braucht einen Moment. Ich lasse ihn ihr.
»Was heißt, er hatte auch den Koffer?«
»Nur das«, sage ich. »Der Koffer war dort. In der Wohnung des Messies.«
»Hast du ihn gesehen?«
»Ja, hab ich.«
»Und sie wissen nicht, wer der Messie ist?«
»Genau. Sie konnten ihn noch nicht identifizieren.«
»Hast du die Leiche gesehen?«
»Nur ein Foto von seinem Gesicht.«
»Beschreib ihn.«
Das tue ich.
»Das könnte jeder sein«, sagt sie, als ich fertig bin.
»Ich weiß.«
»Ist aber auch egal«, sagt Patricia. »Er hat immer eine Sturmhaube getragen. Oder … oder er hat mir die Augen verbunden.«
»Ich weiß«, sage ich noch einmal, diesmal bekümmerter.
Die Standuhr in der Ecke schlägt. Wir warten schweigend, bis sie fertig ist.
»Aber es ist möglich, na ja, sogar wahrscheinlich …« Patricia kommt von der gegenüberliegenden Wand des Salons auf mich zu. Jetzt sind wir nur noch gut einen Meter voneinander entfernt. »Hat der Mann, der die Bilder gestohlen hat, auch …«
»Ich würde keine voreiligen Schlüsse ziehen«, sage ich.
»Was weiß das FBI über den Koffer?«
»Nichts. Aufgrund des Monogramms und des Wappens haben sie angenommen, dass es meiner ist.«
»Du hast ihnen nichts gesagt?«
Ich verzog das Gesicht. »Natürlich nicht.«
»Moment, dann verdächtigen sie dich?«
Ich zucke die Achseln.
»Aber wenn sie herausbekommen, was es mit dem Koffer auf sich hat …«, setzt Patricia an.
»Dann werden sie uns beide verdächtigen, ja.«
***
Für alle, die es noch nicht erraten haben, ja, meine Cousine ist die Patricia Lockwood.
Wahrscheinlich kennen Sie ihre Story aus 60 Minutes oder einer ähnlichen Sendung, aber für diejenigen, die es irgendwie verpasst haben, Patricia Lockwood leitet die Abeona-Shelter-Heime, Häuser für missbrauchte und obdachlose Teenagerinnen, junge Frauen oder wie auch immer der aktuell korrekte Begriff lautet. Sie ist Herz, Seele, Motivatorin und das Gesicht einer der am schnellsten wachsenden und angesehensten Wohltätigkeitsorganisation des Landes. Ihr wurden verdientermaßen Dutzende humanitäre Preise verliehen.
Wo soll ich also anfangen?
Ich werde nicht näher darauf eingehen, wie die Familie zerbrach, wie ihr Vater Aldrich und meiner in Streit gerieten, die beiden Brüder sich gegenseitig bekämpften und mein Vater, Windsor der Zweite, seinen Bruder besiegte, denn ehrlich gesagt glaube ich, dass mein Vater und mein Onkel sich irgendwann wieder versöhnt hätten. Unsere Familie hat, wie so viele, ganz egal, ob arm oder reich, eine lange Geschichte aus Streit und Versöhnung.
Zwar ist nichts dicker als Blut, aber es gibt auch kaum etwas Flüchtigeres.
Die mögliche Versöhnung wurde jedoch vom großen Schlussstrichzieher verhindert – dem Tod.
Ich werde das Geschehen so sachlich wie möglich schildern.
Vor vierundzwanzig Jahren haben zwei Männer mit Sturmhauben meinen Onkel Aldrich Powers Lockwood ermordet und meine achtzehnjährige Cousine Patricia entführt. Zuerst wurde sie noch ein paarmal gesehen – fast wie die Gemälde, wenn ich jetzt darüber nachdenke –, sämtliche Ermittlungen erwiesen sich dann aber als Sackgassen. Es gab zwar eine Lösegeldforderung, doch wie sich bald herausstellte, handelte es sich um Trittbrettfahrer, die ein paar schnelle Dollar machen wollten.
Es war, als wäre meine Cousine vom Erdboden verschluckt worden.
Fünf Monate nach der Entführung hörten Camper in der Nähe der Glen-Onoka-Wasserfälle die hysterischen Schreie einer jungen Frau. Im nächsten Moment kam Patricia aus dem Wald und rannte auf ihr Zelt zu.
Sie war nackt und völlig verdreckt.
Fünf. Monate.
Es dauerte eine Woche, bis die Polizei den kleinen Geräteschuppen aus Kunststoff gefunden hatte, wie man ihn in jedem Baumarkt kaufen kann und in dem Patricia festgehalten worden war. Die Handschellen, die sie mithilfe eines Steins hatte zerbrechen können, lagen noch auf dem Lehmboden. Daneben stand ein Eimer, auf dem sie ihre Notdurft verrichten konnte. Das war alles. Der Schuppen war zwei mal zwei Meter groß, die Tür von außen mit einem Vorhängeschloss gesichert. Er war dunkelgrün und daher im Wald so gut wie unsichtbar – ein Spürhund aus der Hundestaffel des FBI hatte ihn gefunden.
Die Medien nannten den Tatort später »Hütte des Schreckens«. Wie passend diese Bezeichnung war, bestätigte sich noch einmal, als die Spurensicherung die DNA von neun weiteren jungen Frauen/Teenagerinnen/Mädchen im Alter von sechzehn bis zwanzig Jahren darin entdeckte. Sechs Leichen wurden bis heute gefunden, sie alle waren in der Nähe vergraben worden.
Die Täter wurden nie gefasst. Sie wurden auch nie identifiziert. Sie waren einfach verschwunden.
Körperlich schien es Patricia den Umständen entsprechend gut zu gehen. An ihrer Nase und den Rippen waren zwar Spuren alter Brüche zu finden – es war eine gewaltsame Entführung gewesen –, die aber ordentlich verheilt waren. Dennoch dauerte es eine Weile, bis sie sich erholt hatte. Als sie dann wieder ins Leben zurückkehrte und mit der Welt in Kontakt trat, machte sie das mit großer Vehemenz. Sie kanalisierte ihr Trauma, es wurde ihre Triebfeder. Sie machte die Passion, mit der sie für ihre Leidensgenossinnen eintrat, die missbraucht und ohne Hoffnung zurückgelassen worden waren, zu ihrer Mission.
Ich habe mit Cousine Patricia nie über diese fünf Monate gesprochen.
Sie hat sie nie zur Sprache gebracht, und ich bin nicht der Typ, der andere dazu auffordert, sich ihm zu öffnen.
Patricia geht im Salon auf und ab. »Lass uns versuchen, etwas Abstand zu gewinnen und die Sache rational zu betrachten.«
Ich warte, damit sie sich etwas sammeln kann.
»Wann genau wurden die Bilder gestohlen?«
Ich antworte ihr, dass es am 18. September des entsprechenden Jahres war.
»Das war dann also sieben Monate bevor …«, sie geht immer noch auf und ab, »… bevor Dad ermordet wurde.«
»Eher acht.«
Ich hatte es im Hubschrauber schon überschlagen.
Sie bleibt stehen und reißt die Arme hoch. »Was zum Teufel ist hier los, Win?«
Ich zucke die Achseln.
»Willst du sagen, dass die Typen, die die Bilder gestohlen haben, noch einmal zurückgekommen sind, Dad ermordet und mich entführt haben?«
Wieder zucke ich die Achseln. Ich zucke oft die Achseln, tue das allerdings mit einer gewissen Verve.
»Win?«
»Erzähl mir Schritt für Schritt, was passiert ist«, sage ich.
»Ist das dein Ernst?«
»Absolut.«
»Ich will das nicht«, sagt Patricia mit dünner Stimme, die so ganz und gar nicht zu ihr passt. »Ich habe die letzten vierundzwanzig Jahre versucht, das Thema zu meiden.«
Ich sage nichts.
»Verstehst du das?«
Ich sage immer noch nichts.
»Spiel jetzt nicht den Geheimnisvollen, okay?«
»Das FBI wird wissen wollen, ob du den ermordeten Messie identifizieren kannst.«
»Das kann ich nicht. Das habe ich dir auch schon gesagt. Und wozu soll das auch gut sein? Er ist tot, richtig? Nehmen wir mal an, dass es dieser alte Glatzkopf war. Er ist tot. Es ist vorbei.«
»Wie viele Männer sind an dem Abend, als du entführt wurdest, ins Haus eingedrungen?«, frage ich.
Sie schließt die Augen. »Zwei.«
Als sie die Augen wieder öffnet, zucke ich noch einmal die Achseln.
»Scheiße«, sagt sie.
VIER
Wir beschließen, vorerst nichts zu unternehmen. Im Prinzip liegt die Entscheidung bei Cousine Patricia – schließlich wird nicht mein, sondern ihr Leben auf den Kopf gestellt –, aber ich stimme ihr zu. Sie will über alles nachdenken und erst einmal sehen, was wir noch in Erfahrung bringen können. Denn wenn wir diese Tür einmal geöffnet haben, gibt es keine Möglichkeit mehr, sie wieder zu schließen.
Ich sehe kurz nach meinem Vater, aber er schläft noch immer. Ich störe ihn nicht. Meistens ist er bei klarem Verstand. Es gibt aber auch Tage, an denen er das nicht ist. Ich steige wieder in den Hubschrauber und verlasse Lockwood. Mit meiner App arrangiere ich ein Rendezvous mit einer Frau. Wir beschließen, uns um 21 Uhr zu treffen. Sie nutzt den Codenamen Amanda. Ich verwende Myron als Codenamen, weil er diese App so widerwärtig findet. Ich habe ihn gebeten, mir zu erläutern, warum das so ist. Myron sagte irgendetwas über die tiefere Bedeutung von Liebe, sprach von Verbundenheit, dem Einssein, vom gemeinsamen Aufwachen und dem Einbeziehen einer anderen Person in sein Leben.
Meine Augen trübten sich.
Myron schüttelte den Kopf. »Dir das Konzept der romantischen Liebe zu erklären ist, als wollte man einem Löwen das Lesen beibringen: Erstens klappt es sowieso nicht, und zweitens könnte jemand verletzt werden.«
Das gefällt mir.
Übrigens haben Sie diese App nicht. Sie bekommen sie auch nicht.
Eine Stunde später trete ich in mein Büro. Mein Assistent Kabir ist da. Kabir ist ein achtundzwanzigjähriger amerikanischer Sikh. Er hat einen langen Bart. Er trägt einen Turban. Wahrscheinlich sollte ich das nicht erwähnen, weil er in diesem Land geboren wurde und sich wie das Klischee eines Amerikaners verhält, mehr als jeder andere, den ich kenne, aber um es in Kabirs Worten zu sagen: »Der Turban. Den Turban muss ich immer wieder erklären.«
»Neuigkeiten?«, frage ich ihn.
»Haufenweise.«
»Etwas Dringendes?«
»Ja.«
»Dann gib mir eine Stunde.«
Kabir nickt und reicht mir eine Wasserflasche. Es ist ein Kaltgetränk mit den neuesten NAD+-Molekülen, die helfen, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Ich habe das neueste Präparat aus Harvard bekommen, von einem Arzt, der im Bereich Langlebigkeit arbeitet. Mit dem Fahrstuhl fahre ich runter in den privaten Trainingsraum im Untergeschoss. Dort habe ich Hanteln, einen schweren Boxsack, eine Boxbirne, eine Ringerpuppe, Übungsschwerter aus Holz (Bokken), Gummipistolen, einen Wing-Tsun-Dummy mit Armen und Beinen aus Hartholz … Sie verstehen schon, was ich meine.
Ich trainiere jeden Tag.
Ich habe mit einigen der besten Kampflehrer der Welt gearbeitet. Ich habe alle Kampftechniken trainiert, die Sie kennen – Karate, Kung-Fu, Taekwondo, Krav Maga, Jiu-Jitsu in verschiedenen Varianten –, und viele, die Sie nicht kennen. Ich habe ein Jahr im kambodschanischen Siem Reap verbracht, um die Khmer-Kampftechnik Bokator zu studieren, ein Name, der grob, aber treffend übersetzt »einen Löwen verprügeln« bedeutet. Ich habe zwei College-Sommersemesterferien in der Nähe von Jinhae in Südkorea bei einem zurückgezogen lebenden Soo-Bahk-Do-Meister verbracht. Ich übe Schläge, Würfe, Griffe, Hebeltechniken (die ich allerdings nicht mag), Druckpunkte (die in echten Kämpfen nicht wirklich nützlich sind), Eins-gegen-eins-Kämpfe, Kämpfe gegen mehrere Gegner, gegen Waffen jeder Art. Ich bin ein ausgezeichneter Scharfschütze mit Handfeuerwaffen. (Ich beherrsche auch den Umgang mit Gewehren, sehe aber nur selten die Notwendigkeit, sie zu nutzen.) Ich habe mit Messern, Schwertern und Klingen aller Art gearbeitet, und obwohl ich die philippinische Form des Kali eskrima sehr bewundere, muss ich sagen, dass ich vom Kampfstilmix unserer Delta Force mehr profitiert habe.
Ich bin allein in meinem Studio, also ziehe ich alles aus bis auf die Unterwäsche – eine Hybrid-Boxershorts, für diejenigen, die es wissen müssen – und fange mit ein paar traditionellen Katas an. Ich bewege mich schnell. Zwischen den Übungen bearbeite ich jeweils drei Minuten den Boxsack. Das beste Herz-Kreislauf-Training der Welt. Als ich jung war, habe ich fünf Stunden am Tag trainiert. Auch heute ist es immer noch mindestens eine Stunde täglich. Meistens arbeite ich mit einem Coach, weil ich immer noch lernbegierig bin. Heute muss ich auf die Anleitungen verzichten.
All das hat natürlich das Geld möglich gemacht. Ich kann überallhin reisen – oder jeden Experten für eine unbestimmte Zeit einfliegen lassen. Das Geld verschafft mir Zeit, den Zugriff auf Trainer, modernste Technologien und Ausrüstung.
Klingt das nicht doch ein bisschen nach Batman?
Wenn man es recht bedenkt, war Bruce Waynes einzige Superkraft sein ungeheurer Reichtum.
Meine auch. Und ja, es ist gut, ich zu sein.
Meine Haut ist schweißbedeckt. Ich spüre den Rausch, den das Training mit sich bringt. Ich treibe mich weiter an. Ich habe mich immer selbst angetrieben und nie Antrieb von außen gebraucht. Myron ist der einzige Trainingspartner, den ich je zu Gast hatte, was aber daran lag, dass er dazulernen musste, nicht etwa daran, dass ich Motivation brauchte.





























