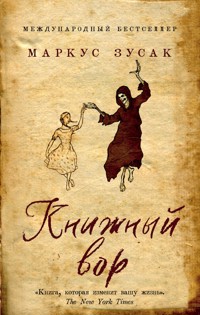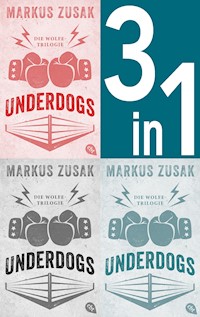2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Millionen Lesern sehnsüchtig erwartet – der neue große Roman vom preisgekrönten Autor des Weltbestsellers »Die Bücherdiebin«.
Dies ist die Geschichte der fünf Dunbar-Brüder. Nach dem Tod der geliebten Mutter und dem Weggang ihres Vaters leben sie nach ihren ganz eigenen Regeln. Sie trauern, sie lieben, sie hassen, sie hoffen und sie suchen. Nach einem Weg, mit ihrer Vergangenheit klarzukommen, nach der Wahrheit und nach Vergebung. Schließlich ist es Clay – angetrieben von den Erinnerungen an ihren tragischen Verlust –, der beschließt, eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, die Vergangenheit zu überwinden und so sich selbst und seine Familie zu retten. Dafür verlangt er sich alles ab, was er geben kann, und mehr: nichts weniger als ein Wunder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Dies ist die Geschichte der fünf Dunbar-Brüder. Nach dem Tod der geliebten Mutter und dem Weggang ihres Vaters leben sie nach ihren ganz eigenen Regeln. Sie trauern, sie lieben, sie hassen, sie hoffen und sie suchen. Nach einem Weg, mit ihrer Vergangenheit klarzukommen, nach der Wahrheit und nach Vergebung. Schließlich ist es Clay – angetrieben von den Erinnerungen an ihren tragischen Verlust –, der beschließt, eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, die Vergangenheit zu überwinden und so sich selbst und seine Familie zu retten. Dafür verlangt er sich alles ab, was er geben kann, und mehr: nichts weniger als ein Wunder.
Autor
Der Bestsellerautor Markus Zusak hat sechs Romane geschrieben, darunter »Die Bücherdiebin« und »Der Joker«. Seine von Publikum und Presse gleichermaßen gefeierten Bücher sind in mehr als vierzig Sprachen übersetzt. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Sydney.
Weitere Informationen unter: Facebook: /markuszusak Instagram: @markuszusak Tumblr: http://www.zusakbooks.comFolgen Sie der Unterhaltung zu »Nichts weniger als ein Wunder« unter #BridgeofClay und #NichtswenigeralseinWunder
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Markus Zusak
Nichts weniger als ein Wunder
Roman
Deutsch von Alexandra Ernst
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Bridge of Clay« bei Alfred A. Knopf, an imprint of Random House Children’s Books, a division of Penguin Random House LLC, New York.
Das erste Zitat von Homer stammt aus »Ilias«. In Prosa übertragen von Karl Ferdinand Lempp. Herausgegeben von Michael Schroeder. © Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 2009. Das zweite Zitat von Homer stammt aus »Odyssee«. Aus dem Altgriechischen von Karl Ferdinand Lempp. Herausgegeben von Michael Schroeder. © Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 2009.
Copyright der Originalausgabe © 2018 by Markus Zusak Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Limes in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Redaktion: Bernd Stratthaus
Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com (Tithi Luadthong; ilolab; Rudchenko Liliia)
JaB · Herstellung: sam Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-24235-0 V003 www.limes-verlag.de
Für Scout, Kid und Little Small,für Cateund in liebevoller Erinnerung an K. E.:eine große Liebhaberin von Sprache jeglicher Art
Vor dem Anfang Der alte Klapperkasten
Am Anfang gab es einen Mörder, ein Maultier und einen Jungen, aber noch sind wir nicht am Anfang, noch sind wir vor dem Anfang, und vor dem Anfang, da gibt es mich, Matthew, und ich sitze in der Küche, mitten in der Nacht – in diesem uralten Flussdelta des Lichts –, und ich tippe und hämmere unermüdlich. Das Haus ist still.
Die anderen schlafen.
Ich sitze am Küchentisch.
Nur ich und der alte Klapperkasten, wie unsere vor Langem abhandengekommene Großmutter laut unserem ebenfalls schon lange abhandengekommenen Vater die Schreibmaschine immer nannte. Eigentlich sagte sie »der olle Klapperkasten«, aber solche Spitzfindigkeiten liegen mir nicht. Schrammen und Besonnenheit liegen mir, Höhen und Muskeln und Blasphemie, und gelegentlich eine Spur Sentimentalität. Wenn du wie die anderen bist, fragst du dich wahrscheinlich, ob ich überhaupt einen vollständigen Satz zu Papier bringen kann, und du würdest nicht glauben, dass ich über Heldendichtung und die alten Griechen Bescheid weiß. Manchmal ist es ganz nützlich, in dieser Hinsicht unterschätzt zu werden, aber noch besser, wenn jemand es erkennt. Ich hatte Glück.
Bei mir war es Claudia Kirkby.
Es gab einen Jungen, einen Sohn, einen Bruder.
Ja, für uns gab es immer einen Bruder, und er war derjenige von uns fünfen, der alles auf seine Schultern lud. Wie immer, sagte er ruhig und besonnen zu mir, und natürlich traf er damit ins Schwarze. In einem heruntergekommenen Hinterhof in einer heruntergekommenen Hinterhofstadt lag tatsächlich eine alte Schreibmaschine begraben, aber ich musste den Spaten an der richtigen Stelle einstechen, sonst würde ich einen toten Hund oder eine tote Schlange ausgraben (was ich dann auch tat). Ich dachte mir, wenn der Hund und die Schlange da waren, konnte die Schreibmaschine nicht weit sein.
Ein perfekter, piratenloser Schatz.
Ich fuhr am Tag nach meiner Hochzeit hinaus.
Hinaus aus der Stadt.
Durch die Nacht.
Durch die Unmengen leeren Raums. Und noch weiter.
Die Stadt, in die ich fuhr, war ein unbarmherziges Szenenland. Man sah es schon von Weitem. Die strohige Landschaft, der Marathon des Himmels, ringsum eine Wildnis aus Gestrüpp und Eukalyptus. Und es stimmte, es stimmte haargenau: Die Menschen buckelten und bückten sich. Die Welt hatte sie abgenutzt.
Vor dem Bankgebäude, gleich neben einem der zahlreichen Pubs, wies mir eine Frau den Weg. Sie war die aufrechteste Frau der Stadt.
»Biegen Sie von der Turnstile Street links ab, okay? Dann etwa zweihundert Meter geradeaus und wieder links.«
Sie war braunhaarig und gut gekleidet, mit Jeans und Stiefeln, einer roten Bluse und einem Auge, das sie gegen die Sonne zusammenkniff. Einzig das eingefallene Dreieck unterhalb ihres Halses verriet sie, die müde, alte und geriffelte Haut, wie der Griff einer Ledertruhe.
»Haben Sie’s verstanden?«
»Verstanden.«
»Nach welcher Hausnummer suchen Sie denn?«
»Dreiundzwanzig.«
»Ach, dann wollen Sie also zu den alten Merchisons, ja?«
»Nun, eigentlich nicht.«
Die Frau kam näher, und jetzt bemerkte ich ihre Zähne, die weiß und glänzend waren und gelb, so wie die gleißende Sonne. Ich streckte ihr meine Hand entgegen, und da standen wir nun, sie und ich und ihre Zähne und die Stadt.
»Ich heiße Matthew«, sagte ich. Der Name der Frau war Daphne.
Als ich schon wieder am Wagen stand und sie am Geldautomaten, drehte sie sich um und kam noch einmal zurück. Sie ließ sogar ihre Kreditkarte im Schlitz stecken und baute sich mit der Hand in die Hüfte gestemmt vor mir auf. Ich war gerade am Einsteigen, und Daphne nickte. Sie wusste Bescheid. Sie wusste fast alles, wie eine Frau, die alle Nachrichten liest.
»Matthew Dunbar.«
Das war keine Frage.
Da war ich also, zwölf Stunden von zu Hause entfernt, in einer Stadt, in die ich in meinen ganzen einunddreißig Jahren noch nie einen Fuß gesetzt hatte, und doch hatte man mich erwartet.
Eine ganze Weile schauten wir uns an, mindestens ein paar Sekunden lang, und alles war weit und offen. Leute kamen herbei und wanderten die Straße entlang.
»Was wissen Sie sonst noch?«, fragte ich. »Wissen Sie, dass ich wegen der Schreibmaschine hier bin?«
Sie öffnete das zweite Auge.
Sie nahm es mit der Mittagssonne auf.
»Schreibmaschine?« Jetzt hatte ich sie völlig aus der Spur gebracht. »Was meinen Sie damit?«
Wie aufs Stichwort rief ein alter Mann, ob das ihre verdammte Karte in dem Geldautomaten sei, die verdammt noch mal den ganzen Verkehr aufhielt, und sie eilte hin, um die Karte zu holen. Vielleicht hätte ich ihr erklären sollen, dass es in dieser Geschichte wirklich einen alten Klapperkasten gab, aus einer Zeit, als in Arztpraxen noch Schreibmaschinen standen und Sekretärinnen auf die Tasten hämmerten. Ich werde nie erfahren, ob es sie interessiert hätte oder nicht. Ihre Wegbeschreibung allerdings war ein Volltreffer.
Miller Street:
Ein starres Fließband aus kleinen, zurückhaltenden Häusern, die alle in der Sonne brieten.
Ich stellte den Wagen ab, schlug die Tür zu und überquerte den knisternden Rasen.
Jetzt bedauerte ich, dass das Mädchen, das ich gerade geheiratet hatte, nicht bei mir war. Oder besser gesagt die Frau, die Mutter meiner zwei Töchter. Und natürlich auch die Töchter selbst. Die Mädchen hätten diesen Ort geliebt, sie wären geschlendert und gehüpft, mit Fohlenbeinen und sonnigem Haar. Auf dem Rasen hätten sie Rad geschlagen und gerufen: »Und guck mir ja nicht auf die Unterhose, klar?«
Tolle Flitterwochen.
Claudia war auf der Arbeit.
Die Mädchen waren in der Schule.
Aber einem Teil von mir gefiel das.
Einem großen Teil von mir gefiel es sogar sehr.
Ich atmete ein, ich atmete aus. Und klopfte.
Im Haus war es wie in einem Ofen.
Die Möbel wurden geröstet.
Die Bilder waren gerade aus dem Toaster gesprungen.
Es gab auch eine Klimaanlage. Die kaputt war.
Tee und Kekse. Die Sonne schlug hart gegen das Fenster. Am Tisch wurde ausgiebig geschwitzt. Tropfen klatschten aus Achseln auf Stoff.
Die Merchisons waren ehrliche, haarige Leute.
Er ein blaues Unterhemd mit mächtigen Koteletten, wie pelzige Axtklingen an seinen Wangen, sie eine Frau namens Raelene, mit Perlohrringen, engen Löckchen und einer Handtasche auf dem Schoß. Sie war auf dem Weg zum Einkaufen gewesen, blieb nun aber da. In dem Augenblick, als ich den Garten erwähnte und die Möglichkeit, dass dort etwas vergraben war, hatte sie angebissen. Als die Tassen leer und von den Keksen nur noch Krümel übrig waren, wandte ich mich den Koteletten zu und wartete. Er kam gleich zur Sache:
»Dann machen wir uns mal an die Arbeit.«
Draußen in dem länglichen, vertrockneten Garten ging ich nach links, wo die Wäscheleinen hingen und eine zerzauste, ausgedörrte Banksie stand. Ich warf einen Blick hinter mich: das kleine Haus, das Wellblechdach. Die Sonne stand noch über allem, zog sich aber allmählich zurück und neigte sich gen Westen. Ich grub mit der Schaufel und meinen Händen, und dann war da etwas …
»Gottverdammt!«
Der Hund.
Noch einmal.
»Gottverdammt!«
Die Schlange.
Beide nur noch Knochen.
Wir fegten behutsam die Erde ab.
Legten sie dann auf den Rasen.
»Na, da soll mich doch …«
Dreimal sagte er es, und beim dritten Mal am lautesten, als ich die alte Remington fand. Bleikugelgrau, wie eine Waffe in der Erde, eingewickelt in drei Lagen feste Plastikfolie, die so durchsichtig war, dass ich die Tasten sehen konnte. Erst das Q, dann das W und in der Mitte F, G und H.
Eine Weile schaute ich sie nur an.
Die schwarzen Tasten grinsten wie Monsterzähne. Aber freundlich.
Schließlich griff ich in das Loch und zog sie mit vorsichtigen, erdbeschmutzten Händen heraus. Dann schaufelte ich alle drei Löcher wieder zu. Wir holten die Schreibmaschine aus der Plastikhülle, kauerten uns nieder und betrachteten sie.
»Ein Mordsgerät«, sagte Mr. Merchison. Die pelzigen Äxte zuckten.
»Das stimmt.« Einfach prachtvoll.
»Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet, als ich heute Morgen aufgewacht bin.« Er hob die Schreibmaschine auf und reichte sie mir.
»Wollen Sie zum Essen bleiben, Matthew?«
Das kam von der alten Dame, die immer noch ganz fassungslos war. Doch Fassungslosigkeit hatte gegen das Abendessen keine Chance.
Immer noch kauernd schaute ich zu ihr hoch. »Danke, Mrs. Merchison, aber ich bin immer noch satt von den ganzen Keksen.« Wieder blickte ich zum Haus. Es war jetzt in Schatten gehüllt. »Ich sollte mich wieder auf den Weg machen.« Ich schüttelte den beiden die Hand. »Danke. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar.« Dann wandte ich mich mit der Schreibmaschine unter dem Arm zum Gehen.
Damit war Mr. Merchison allerdings nicht einverstanden.
Er rief mir ein unverblümtes »Oi!« zu.
Was sollte ich machen?
Es musste einen Grund geben, warum ich die beiden Tiere ausgebuddelt hatte. Unter den Wäscheleinen drehte ich mich um – eine altersschwache, quietschende Wäschespinne, genau wie bei uns zu Hause – und wartete darauf, dass es gesagt wurde. Und er sagte es auch.
»Haben Sie nicht was vergessen, Kumpel?«
Mit einer Kopfbewegung wies er auf die Hundeknochen und die Schlange.
Und so fuhr ich davon.
Auf dem Rücksitz meines alten Kombis lagen die Gebeine eines Hundes, eine Schreibmaschine und das zarte, gewundene Skelett einer Mulgaschlange.
Nach der Hälfte der Strecke fuhr ich rechts ran. Ich kannte einen Ort in der Nähe – nur ein kleiner Umweg, und ich hätte mich ausschlafen können –, aber ich entschied mich dagegen. Stattdessen legte ich mich in den Wagen, mit der Schlange direkt neben meinem Hals. Als ich wegdöste, musste ich daran denken, dass es immer und überall eine Zeit vor dem Anfang gibt, denn vorher und vor so vielen Dingen war da ein Junge in dieser Hinterhofstadt gewesen, und er hatte sich hingekniet, als die Schlange den Hund und der Hund die Schlange getötet hatte … Aber davon später.
Im Augenblick musst du nur eins wissen:
Am nächsten Tag fuhr ich nach Hause.
Ich fuhr zurück in die Stadt, in die Archer Street, wo wirklich alles angefangen hatte. Es war eine stürmische Heimkehr. Die Diskussion, warum zum Henker ich den Hund und die Schlange hatte mitbringen müssen, lag jetzt ein paar Stunden zurück, und jene, die gehen mussten, waren gegangen, und jene, die bleiben konnten, waren noch hier. Das i-Tüpfelchen war der Schlagabtausch mit Rory gewesen. Ausgerechnet Rory. Er weiß genauso gut wie jeder andere, wer und warum und was wir sind.
Eine tragische Bruchbude von einer Familie.
Eine Comic-Sprechblase mit einem KA-WUMM aus Bengeln, Blut und Bestien.
Wir waren für solche Relikte wie geschaffen.
Mitten in dem ganzen Hin und Her grinste Henry, Tommy lachte, und beide sagten: »Alles wie immer.« Der Zweitjüngste von uns schlief. Er hatte die ganze Zeit geschlafen, während ich weg war.
Meine beiden Mädchen kamen herein und bewunderten die Knochen. Dann fragten sie: »Warum hast du die mitgebracht, Dad?«
Weil er ein Idiot ist.
Ich hörte Rorys Gedanken, wie aus der Pistole geschossen, aber er würde sie nie vor meinen Kindern aussprechen.
Und Claudia Dunbar? Die frühere Claudia Kirkby schüttelte den Kopf und nahm meine Hand, und sie war so verdammt glücklich, dass ich am liebsten schon wieder auf die Knie gesunken wäre. Und das alles nur, weil ich froh war.
Froh.
Froh klingt dämlich, aber ich schreibe und erzähle dir das alles nur, weil es die reine Wahrheit ist. Genauso sind wir. Ich besonders, weil ich diese Küche mit ihrer großartigen und schrecklichen Vergangenheit liebe. Ich muss es hier tun. Es ist angemessen. Ich bin froh, wenn ich höre, wie meine Notizen klappernd auf die Seiten fallen.
Vor mir steht die alte Schreibmaschine.
Dahinter liegt eine zerkratzte, hölzerne Tischlandschaft.
Eine Landschaft mit einem Salz- und einem Pfefferstreuer (die nicht zusammenpassen) und einer Hügelkette aus hartnäckigen Toastkrümeln. Das Licht aus der Diele ist gelb, das Licht hier drin ist weiß. Ich sitze und denke und klappere. Ich haue auf die Tasten. Schreiben ist immer schwer, aber es wird einfacher, wenn man etwas zu sagen hat:
Ich will dir von meinem Bruder erzählen.
Von dem vierten Dunbar-Jungen namens Clay.
Ihm ist alles widerfahren.
Und er hat uns alle verändert.
Teil 1 Städte
Ein Porträt des Mörders als Mann mittleren Alters
Vor dem Anfang (zumindest was das Schreiben angeht) gab es also eine Schreibmaschine, einen Hund und eine Schlange. Und am eigentlichen Anfang (vor elf Jahren) einen Mörder, ein Maultier und Clay. Selbst an einem Anfang muss jemand den Anfang machen, und an diesem Tag konnte das nur der Mörder sein. Immerhin war er derjenige, der alles in Bewegung und uns dazu brachte zurückzublicken. Weil er eintraf. Er kam um sechs Uhr.
Wie es der Zufall wollte, war es das perfekte Timing. Ein Abend im Februar. Der Asphalt kochte von der Hitze des Tages. Die Sonne stand noch quälend hoch am Himmel. Die Hitze war ihm Halt und Stütze, oder besser gesagt: Sie hielt ihn umklammert. In der Geschichte der Menschheit war dieser Mörder wohl der erbärmlichste:
Mittelgroß, etwa eins fünfundsiebzig.
Mit fünfundsiebzig Kilo mittelschwer.
Aber lass dich nicht täuschen: Er war ein ödes Land in einem Anzug, eine Biegung nach unten, ganz und gar zerbrochen. Er lehnte sich der Luft entgegen, als ob er erwartete, dass sie ihm den Garaus machte, aber das tat sie nicht, nicht heute, denn mit einem Mal wusste er, dass dies nicht der Tag war, an dem ein Mörder etwas geschenkt bekam.
Nein, heute konnte er es fühlen.
Er konnte es riechen.
Er war unsterblich.
Und genau das war das Problem.
Ausgerechnet heute, wo er besser tot gewesen wäre, konnte der Mörder nicht getötet werden.
Eine halbe Ewigkeit, mindestens zehn Minuten lang, stand er an der Mündung der Archer Street. Er war erleichtert, dass er endlich angekommen war, und von seiner Anwesenheit bis ins Mark erschüttert. Der Straße war es herzlich egal; der Wind war beständig, aber nicht aufdringlich, und sein rauchiges Aroma konnte man mit Händen greifen. Die Autos standen kreuz und quer, wie auf einem Spielbrett liegen gebliebene Würfel, und die Stromleitungen hingen unter dem Gewicht der stummen und von der Hitze wie erstarrten Tauben durch. Ringsum erhob sich eine Stadt und rief:
Willkommen zurück, Mörder.
Die Stimme klang warm und nah.
Du bist wohl ziemlich durch den Wind, was? Aber was sag ich da – das trifft es nicht im Mindesten: Du steckst bis zum Hals in der Scheiße.
Das wusste er schon.
Die Hitze kam immer näher.
Die Archer Street machte sich langsam warm, rieb sich die Hände, und der Mörder fing Feuer. Er fühlte, wie es in seiner Jacke emporkroch, und mit den Flammen kamen die Fragen:
Konnte er weitergehen und den Anfang vollenden?
Konnte er es wirklich durchziehen?
Einen letzten Augenblick lang gönnte er sich den Luxus, jene kurze Erregung in der Stille, dann schluckte er, massierte sich den Schopf aus dornigen Haaren und begab sich mit grimmiger Entschlossenheit zum Haus Nummer achtzehn.
Ein Mann im brennenden Anzug.
An diesem Tag ging er zu fünf Brüdern.
Zu uns Dunbar-Jungs.
Vom ältesten zum jüngsten:
Ich, Rory, Henry, Clayton, Thomas.
Wir würden nie mehr dieselben sein.
Er übrigens auch nicht, und um dir einen kleinen Eindruck dessen zu vermitteln, worauf sich der Mörder einließ, erzähle ich dir, wie wir waren.
Viele sahen in uns Rabauken.
Barbaren.
Meistens stimmte das auch.
Unsere Mutter war tot.
Unser Vater hatte sich davongemacht.
Wir fluchten wie Matrosen, kämpften wie Rivalen und forderten einander ständig heraus: beim Poolbillard oder Pingpong (immer an Tischen aus dritter oder vierter Hand, die wir auf dem hubbeligen Rasen hinter dem Haus aufstellten), beim Monopoly, Darts, Football, beim Kartenspiel und bei allem anderen, was uns in die Finger kam.
Wir hatten ein Klavier, auf dem niemand spielte.
Unser Fernseher war uns hilflos ausgeliefert.
Das Sofa quälten wir bereits seit zwanzig Jahren.
Manchmal klingelte das Telefon, und kurz danach joggte einer von uns aus dem Haus und am Zaun entlang nach nebenan. Dann war es nur die alte Mrs. Chilman, die eine Flasche Tomatensoße gekauft hatte und das verdammte Ding nicht aufbekam. Und derjenige, der hinausgelaufen war, kehrte wieder zurück, ließ die Tür zuknallen, und das Leben nahm wieder seinen gewohnten Lauf.
Für uns fünf ging das Leben immer weiter.
Das war etwas, was wir in uns hinein- und aus uns herausprügelten, besonders dann, wenn die Dinge extrem gut oder völlig schiefliefen. Dann verließen wir die Archer Street am späten Nachmittag. Wir gingen in die Stadt, zu den Türmen, den Straßen, zu den verängstigt wirkenden Bäumen. Wir tauchten ein in die lauten Gespräche, die uns aus den Pubs entgegenschlugen, aus den Häusern und Wohnungen. Wir waren uns ganz sicher, all das gehörte uns. Manchmal hätten wir am liebsten alles aufgesammelt, es unter die Arme geklemmt und mit nach Hause genommen. Es spielte keine Rolle, dass wir am nächsten Tag aufwachten und sahen, dass alles wieder weg war, all die Gebäude und das bunte Licht.
Oh, und noch eine Sache.
Das Wichtigste überhaupt.
Soviel ich weiß, waren wir die Einzigen, deren kleiner Zoo aus dysfunktionalen Haustieren ein Maultier besaß.
Und was für ein Maultier.
Das fragliche Huftier hieß Achilles, und die Vorgeschichte, die erzählte, wie er in einem Hinterhof auf dem Gelände einer Pferderennbahn in einer Kleinstadt gelandet war, ist sehr lang. Darin kommen vor: die verlassenen Ställe und Trainingsbahnen hinter unserem Haus, eine Gemeindesatzung aus den Tagen der ersten Siedler, ein trauriger alter Mann mit einer Rechtschreibschwäche. Des Weiteren unsere tote Mutter, unser geflohener Vater und unser Jüngster, Tommy Dunbar.
Als sich die Episode zutrug, wurden nicht alle im Haus gefragt; das Erscheinen des Maultiers war wieder mal ein Anlass für eine lebhafte Diskussion mit Rory.
(»Oi, Tommy, was iss’n hier los?«
»Was denn?«
»Was meinste mit ›was denn‹? Willste mich verschaukeln? Da steht ein Esel im Garten!«
»Das ist kein Esel. Das ist ein Maultier.«
»Wo ist der Unterschied?«
»Ein Esel ist ein Esel, und ein Maultier ist eine Kreuzung zwischen …«
»Ist mir egal, ob das ’ne Kreuzung zwischen ’nem Galopper und ’nem verdammten Shetlandpony ist! Was macht das Vieh unter unserer Wäscheleine?«
»Er frisst Gras.«
»Das sehe ich!«)
Wir behielten das Maultier.
Oder besser gesagt: Achilles blieb.
Wie alle Tiere von Tommy hatte auch das Maultier so seine Macken. Achilles fand sich zu Höherem berufen. An der Hintertür fehlte das Fliegengitter, und wenn die Tür nicht richtig geschlossen wurde oder gar sperrangelweit offen stand, spazierte er ins Haus. Das passierte mindestens einmal pro Woche, und mindestens einmal pro Woche bekam ich einen Anfall. Das klang dann etwa so:
»Herr-gott noch mal!« Ich hatte eine gewisse Reputation als Gotteslästerer, wobei es mir ausnehmend gut gelang, den Herrn vom Gott zu trennen und Letzteren über Gebühr zu betonen. »Ich hab es euch Kleinhirnen nicht nur einmal gesagt, sondern mindestens hundertmal: Macht die verdammte Tür zu!«
Und so weiter.
Was uns zu dem Mörder zurückbringt. Woher hätte er es wissen sollen?
Er hätte vermuten können, dass keiner von uns zu Hause war, als er eintraf. Er hätte ahnen können, dass er die Wahl hatte: entweder seinen alten Schlüssel benutzen oder vor der Haustür auf uns warten. Um eine einzige Frage zu stellen, um uns einen Vorschlag zu unterbreiten.
Er erwartete den Hohn von Menschen, hoffte sogar darauf.
Aber nicht das.
Was für eine Breitseite:
Das schmerzliche kleine Haus, dieser Faustschlag aus Stille.
Und dieser Einbrecher, dieser Gauner von einem Maultier.
Etwa gegen Viertel nach sechs wagte er sich Schritt für Schritt in die Archer Street vor, und das Huftier blinzelte.
Und so kam es.
Das erste Augenpaar, in das der Mörder beim Betreten des Hauses blickte, gehörte Achilles, und mit Achilles war nicht zu spaßen. Er stand in der Küche, nicht weit von der Hintertür entfernt, genau vor dem Kühlschrank, mit seinem üblichen Was-zum-Henker-glotzt-du-denn-so in sein langes, schiefes Gesicht gemeißelt. Die Nüstern bebten, seine Zähne mahlten. Nonchalant. Überlegen. Wenn er die Absicht hatte, Wache zu halten, dann machte er seine Sache richtig gut.
Und nun?
Nun sah es so aus, als würde Achilles ihm erklären, wie die Sache lief.
Erst die Stadt, dann dieses Maultier.
Theoretisch ergab das zumindest ansatzweise Sinn. Wenn in dieser Stadt irgendwo ein Huftier auftauchen konnte, dann hier: bei den Ställen, den Trainingsplätzen, bei den nachhallenden Stimmen der Rennplatzbesucher.
Aber ein Maultier?
Der Schock war unbeschreiblich, und die Umgebung tat ihr Übriges: Diese Küche befand sich nämlich in einer Klimazone der besonderen Art.
Trübe Wände.
Ein ausgedörrter Boden.
Eine Landzunge aus schmutzigem Geschirr, die sich bis zur Spüle zog.
Und dann die Hitze. Diese Hitze.
Selbst die wohlwollende Wachsamkeit des Maultiers ließ einen Moment im Angesicht dieser schrecklichen, tonnenschweren Hitze nach. Drinnen war es noch schlimmer als draußen, und das war eine höchst beachtliche Leistung.
Aber es dauerte nicht lange, da war Achilles wieder auf dem Posten. Oder war der Mörder so dehydriert, dass er sich die Sache nur einbildete? Von allen Küchen auf der Welt ausgerechnet in dieser. Er war versucht, sich die Knöchel in die Augen zu drücken, um den Anblick herauszuwringen, aber es war vergeblich.
Das war keine Einbildung.
Er war sich sicher, dass dieses Tier keinen Hufbreit des zerklüfteten Linoleumbodens preisgeben würde. Und dieser grau-rot-hellbraune Flickenteppich, dieser ziegelgesichtige, breitäugige, großnüsterne, arrogante Saubeutel von einem Maultier machte dem Mann eins ganz unmissverständlich klar:
Ein Mörder konnte machen, was er wollte. Aber niemals, unter gar keinen Umständen, sollte er nach Hause kommen.
Clays Treppentraining
Während der Mörder auf das Maultier traf, machte Clay sich auf der anderen Seite der Stadt warm. Eigentlich machte sich Clay unentwegt warm. Im Augenblick tat er das in einem alten Apartmenthaus, mit Stufen unter seinen Füßen, einem Jungen auf dem Rücken und einer Gewitterwolke in der Brust. Sein kurzes dunkles Haar lag platt an seinem Kopf, und in seinen Augen brannte ein Feuer.
Rechts von ihm rannte ein zweiter Junge, blond, ein Jahr älter, der Mühe hatte, mit ihm Schritt zu halten, ihn aber trotzdem antrieb. Links von ihm sprang ein Border Collie, und zusammen waren sie Henry und Clay, Tommy und Rosa, und sie taten, was sie immer taten:
Einer redete.
Einer trainierte.
Einer klammerte sich fest.
Selbst der Hund gab alles.
Sie hatten einem Freund Geld gegeben und besaßen jetzt einen Schlüssel, der ihnen freien Zugang zu dem Haus gewährte. Zehn Dollar für eine Burg aus Beton. Nicht schlecht. Sie rannten.
»Du elender Scheißhaufen«, sagte Henry (der Geldsammler, der Nette), der neben Clay rannte. Er lief betont locker und lachte. Sein Lächeln rutschte ihm vom Gesicht, und er fing es mit der Hand auf. In diesen Augenblicken kommunizierte er mit Clay durch bewährte und altgediente Beleidigungen. »Du bist nichts«, sagte er, »du bist weich.« Ihm tat alles weh, aber er musste weiterreden. »Du bist so weich wie ein Zwei-Minuten-Ei, Kumpel, und mir wird ganz schlecht, wenn ich dich rennen sehe.«
Kurz danach kam es zu einem weiteren Vorfall, der schon Tradition hatte.
Tommy, der Jüngste, der Tiersammler, verlor einen Schuh.
»Mensch, Tommy, ich hab dir doch gesagt, du sollst sie fester zubinden. Komm schon, Clay, du bist schwach, du bist erbärmlich, wie wär’s, wenn du dich mal ein bisschen anstrengst?«
Sie kamen in den sechsten Stock, wo Clay Tommy nach links abwarf und das Schandmaul zu seiner Rechten attackierte. Sie landeten auf den klammen Fliesen. Clay grinste schief, der andere lachte lauthals, und sie alle schüttelten den Schweiß ab. Clay nahm Henry in den Schwitzkasten, hob ihn hoch und schleuderte ihn herum.
»Du musst echt mal duschen, Kumpel.« Typisch. Wenn man Henry umbringen wollte, musste man sein Mundwerk extra totschlagen. »Das ist widerlich, Mann.« Er fühlte den Draht in Clays Armen, mit dem sein klugscheißender Hals zugedrückt wurde.
Tommy, erst dreizehn Jahre alt, nahm Anlauf und warf sich auf seine Brüder, sodass sie gemeinsam zu Boden rumpelten, Arme, Beine, Jungen und Fliesen. Rosa hopste in großen Sprüngen um sie herum, den Schwanz hoch aufgestellt, alle Sinne nach vorn gerichtet. Schwarze Beine. Weiße Pfoten. Sie bellte, aber die drei rangen weiter.
Als es vorbei war, lagen sie auf ihren Rücken. Auf diesem Stock, dem obersten, gab es ein Fenster, schmuddeliges Licht und wogende Brustkörbe. Die Luft war schwer. Kiloweise strömte sie aus ihren Lungen. Henry schluckte sie gierig hinunter, aber sein Herz lag ihm auf der Zunge.
»Tommy, du kleiner Scheißer.« Er drehte den Kopf und grinste. »Ich glaube, du hast mir gerade das Leben gerettet, Bruder.«
»Danke.«
»Nein, ich hab zu danken.« Er deutete auf Clay, der sich auf einen Ellbogen stützte. Die andere Hand steckte in seiner Hosentasche. »Ich hab keine Ahnung, warum wir uns mit diesem Irren herumschlagen.«
»Ich auch nicht.«
Natürlich wussten sie es.
Immerhin war er ein Dunbar, und bei Clay wollte man es immer wissen.
Aber was?
Was gab es über Clayton, unseren Bruder, zu wissen?
Die Fragen folgten ihm nun schon seit Jahren:
Warum immer nur dieses Lächeln, niemals ein Lachen?
Warum kämpfte er ständig, aber nie um zu gewinnen?
Was gab es so Besonderes auf unserem Dach, dass er immer wieder dort hochstieg?
Warum rannte er nicht, um sich Befriedigung zu verschaffen, sondern Unbehagen – warum nutzte er es als eine Art Tor zu Schmerz und Leid, und warum tat er sich das immer wieder an?
Keine dieser Fragen war die richtige.
Es waren Aufwärmfragen.
Nichts weiter.
Nachdem sie auf dem Rücken verschnauft hatten, machten sie noch drei Runden, wobei Rosa auf dem Weg den verlorenen Schuh aufsammelte.
»Oi, Tommy.«
»Ja?«
»Schnür sie nächstes Mal fester zu, klar?«
»Klar, Henry.«
»Doppelte Knoten, oder ich sorge dafür, dass du doppelt siehst, klar?«
»Klar, Henry.«
Unten angelangt gab er ihm einen Klaps auf die Schulter, das Zeichen, dass er wieder auf Clays Rücken klettern sollte. Und dann rannten sie nach oben und fuhren mit dem Fahrstuhl wieder nach unten. (Manche Leute würden das Mogeln nennen, aber in Wahrheit war es viel schwieriger als Laufen, weil die Erholungsphase deutlich kürzer war.) Nach dem letzten Anstieg nahmen Henry, Tommy und Rosa wieder den Fahrstuhl, aber Clay lief die Treppe nach unten. Draußen marschierten sie zu Henrys zerbeultem Blechkasten von einem Auto, auf dem der Buchstabe P klebte, weil Henry erst eine provisorische Fahrerlaubnis hatte. Dann ging die alte Leier wieder los.
»Rosa, raus da, ich fahre.« Sie saß mit gespitzten Ohren hinterm Steuer und sah aus, als ob sie gleich das Radio einschalten würde. »Los, Tommy, schaff sie da raus, wenn ich bitten darf.«
»Komm schon, Mädchen, hör auf mit dem Quatsch.«
Henry schob die Hand in die Hosentasche.
Eine Faust voll Münzen.
»Also, Clay, wir sehen uns oben.«
Zwei Jungen fuhren mit dem Auto, der dritte rannte.
Zum Fenster hinaus: »Oi, Clay!«
Er gab Gas. Er drehte sich nicht um, aber er konnte alles hören. Dieselben Sprüche, jedes Mal.
»Bring Margeriten mit, wenn’s geht. Das waren ihre Lieblingsblumen.«
Als ob er das nicht wüsste.
Der Wagen setzte sich mit klackendem Blinker in Bewegung. »Und lass dich nicht übers Ohr hauen!«
Clay rannte schneller.
Er stemmte sich dem Hügel entgegen.
Erst hatte ich ihn trainiert, danach Rory. Während ich es mit altmodischem und unsinnigem Anstand probierte, prügelte Rory nur auf ihn ein. Aber es gelang ihm nie, Clay zu brechen. Henry hatte sein eigenes System. Er tat es wegen des Geldes, aber auch, weil er es mochte, wie sich schon bald zeigen wird.
Die Rahmenbedingungen waren klar und gleichzeitig kurios:
Wir sagten ihm, was er tun sollte.
Er tat es.
Wir quälten ihn.
Er ertrug es.
Henry warf ihn manchmal einfach aus dem Wagen, weil er ein paar Kumpel nicht im Regen nach Hause laufen lassen wollte, und Clay stieg anstandslos aus und fiel in einen Laufschritt. Und wenn Henry dann an ihm vorbeifuhr und ihm »Heul doch!« zubrüllte, lief er noch ein bisschen schneller. Tommy drehte sich schuldbewusst um und schaute durch das Heckfenster, und Clay ließ den verkorksten Haarschnitt nicht aus den Augen, der kleiner und kleiner wurde, bis der Wagen aus seinem Blickfeld verschwunden war. Und soll ich dir was sagen?
Es sah vielleicht so aus, als würden wir ihn trainieren.
Aber so war es nicht. Nicht einmal annähernd.
Mit der Zeit wurden die Worte spärlicher, und die Methoden häuften sich. Wir alle wussten, worauf er aus war, aber nicht, was er damit erreichen wollte.
Wofür zum Teufel trainierte Clay Dunbar?
Um halb sieben beugte er sich mit Tulpen vor den Füßen über den Friedhofszaun. Er lag schön und hoch, dieser Ort. Clay gefiel es hier. Er sah die Sonne zwischen den Wolkenkratzern grasen.
Städte.
Diese Stadt.
Da unten trieb es den Verkehr nach Hause. Das Licht änderte sich. Der Mörder kam.
»Entschuldigen Sie.«
Er packte den Zaun fester und sagte nichts.
»Junger Mann?«
Jetzt schaute er zur Seite, und da stand eine alte Frau und nippte an ihren Lippen. Sie mussten wohlschmeckend sein. Sie deutete auf ihn.
»Wären Sie so freundlich?« Sie hatte formlose Augen, ein müdes Kleid, und sie trug Socken. Die Hitze kam nicht gegen sie an. »Wären Sie wohl so freundlich, mir eine von diesen Blumen zu schenken?«
Clay schaute in die tiefen Rillen, in die Schlieren auf ihrer Stirn. Er reichte ihr eine Tulpe.
»Danke. Danke, junger Mann. Für meinen William.«
Der Junge nickte und folgte ihr durch das offene Tor. Er umschiffte die Gräber, und als er sein Ziel erreicht hatte, kauerte er sich hin, stand auf, verschränkte die Arme, drehte sich der Abendsonne entgegen. Er wusste nicht, wie lange Henry und Tommy brauchten, bis sie rechts und links von ihm Aufstellung nahmen und der Hund mit hängender Zunge zum Grabstein trottete. Alle drei standen gekrümmt und steif da, die Hände in den Taschen. Und wenn der Hund eine Hose angehabt hätte, hätte er die Vorderpfoten ebenfalls in die Taschen geschoben. Sie alle hatten nur Augen für den Grabstein und die Blumen davor, denen sie beim Verwelken zuschauen konnten.
»Keine Margeriten?«
Clay warf ihm einen Blick zu.
Henry zuckte mit den Schultern. »Tommy?«
»Was?«
»Gib’s ihm. Er ist dran.«
Clay streckte die Hand aus. Er wusste, was zu tun war.
Tommy reichte Clay die Flasche mit Reinigungsmittel, der damit die Metallplatte einsprühte. Als Nächstes nahm er den Ärmel eines grauen Sweatshirts in Empfang und schrubbte damit die Inschrift sauber.
»Du hast eine Stelle vergessen.«
»Wo?«
»Bist du blind? Da, in der Ecke. Guck hin! Hast du Tomaten auf den Augen?«
Clay fand die Stelle und rieb sie kreisförmig ab. Der Ärmel war schwarz vom Drecksmaul der Stadt. Alle drei trugen Achselshirts und abgewetzte Shorts. Alle drei verkrampften die Kiefer. Henry zwinkerte Tommy zu. »Gute Arbeit, Clay. Wird Zeit zu gehen, was? Wir wollen doch nicht zu spät zur Show kommen.«
Tommy und der Hund folgten ihm als Erste, wie immer.
Dann erst Clay.
Als er zu ihnen trat, sagte Henry: »Gute Friedhöfe sind gute Nachbarn.« Also ehrlich, was für einen Schrott er manchmal von sich gab.
Tommy sagte: »Ich komme nicht gern her, das weißt du doch, oder?«
Und Clay?
Clay, der Stille, der Lächelnde, drehte sich schweigend um und starrte über das sonnenbeschienene Gelände aus Statuen, Kreuzen und Grabsteinen.
Sie alle sahen aus wie Pokale für den Zweitplatzierten.
Barbaren
In der Küche der Archer Street Nr. 18 stand es unentschieden.
Der Mörder zog sich langsam ins Haus zurück. Dessen Stille war Ehrfurcht gebietend – ein riesiges Feld, auf dem die Schuld sich austoben und ihn niederringen konnte. Aber es war auch eine Täuschung: Der Kühlschrank brummte, das Maultier atmete, und dann waren da noch die anderen Tiere. Als der Mörder rückwärts in die Diele ging, nahm er Bewegung wahr. Hatte man ihn aufgespürt? Umzingelt?
Eher nicht.
Nein, die Tiere stellten keine Bedrohung dar. Es waren die beiden Ältesten von uns, die er fürchten musste.
Ich war der Vernünftige.
Der ausdauernde Brotverdiener.
Rory war der Unüberwindliche.
Die menschliche Fußfessel.
Etwa um halb sieben lehnte Rory an einem Strommast auf der anderen Straßenseite. Er lächelte schief und reumütig, lächelte einfach nur aus Spaß. Die Welt war dreckig, genau wie er. Nach einer kurzen Suche zog er ein langes Frauenhaar aus dem Mund. Wer immer sie war, sie lag in Rorys Vorstellung irgendwo da draußen und wartete mit gespreizten Beinen auf ihn. Ein Mädchen, das wir niemals kennenlernen werden.
Ein paar Augenblicke zuvor war er einem anderen Mädchen begegnet, einem, das wir kannten. Carey Novac. Direkt vor ihrer Einfahrt.
Sie roch nach Pferd, und sie hatte ihn gegrüßt.
Sie war von ihrem alten Rad gestiegen.
Sie hatte gutgrüne Augen und kastanienbraunes Haar, meilenweit hing es ihr über den Rücken, und sie gab ihm eine Nachricht für Clay mit. Es hatte etwas mit einem Buch zu tun, eins von dreien, alle von enormer Bedeutung. »Sag ihm, ich liebe Buonarroti immer noch.«
Rory war sprachlos. Und doch wieder nicht. »Borna-wer?«
Das Mädchen lachte auf dem Weg zur Garage. »Sag’s ihm einfach, okay?«
Doch dann zeigte sie Nachsicht und wandte sich, bewaffnet mit all ihren Sommersprossen und ihrem Selbstvertrauen, noch einmal um. In ihr war eine Großherzigkeit, gepaart mit Hitze, Schweiß und Leben. »Du weißt schon«, sagte sie. »Michelangelo?«
»Was?« Jetzt war er völlig verdattert. Die Kleine ist verrückt, dachte er. Süß, aber total plemplem. Wen interessierte schon dieser dämliche Michelangelo?
Aber aus irgendeinem Grund blieb der Gedanke hängen.
Er fand den Strommast, lehnte sich eine Weile an und überquerte dann die Straße. Der Hunger trieb ihn nach Hause.
Ich dagegen steckte im Verkehr fest.
Von allen Seiten drängten die Autos auf mich ein, zu Tausenden und Abertausenden, alle die Schnauzen auf ein einziges Ziel gerichtet: heimwärts. Eine stetige Hitzewelle quoll durch das Seitenfenster ins Innere meines Kombis (den ich noch immer fahre), und an mir zog eine endlose Parade aus Plakatwänden, Schaufenstern und Menschenmaterial vorbei. Mit jeder Bewegung schob sich die Stadt zu mir herein, und doch nahm ich auch meinen charakteristischen Geruch nach Holz, Wolle und Politur wahr.
Ich ließ meinen Unterarm aus dem Fenster baumeln.
Mein Körper fühlte sich an wie ein Hackklotz.
Meine Hände waren klebrig von Kleister und Terpentin, und ich wollte nur noch nach Hause. Unter die Dusche, dann Essen machen, später lesen oder einen alten Film ansehen.
Das war doch nicht zu viel verlangt, oder?
Heimkommen und entspannen?
Keine Chance.
Bernborough
Für Tage wie diesen gab es bei Henry strenge Regeln.
Erstens: ein Bier.
Zweitens: Kalt musste es sein.
Aus diesem Grund trennte er sich auf dem Friedhof von Tommy, Clay und Rosa und traf sie erst später in Bernborough Park wieder.
(Für alle, die sich in dieser Gegend nicht auskennen: Bernborough Park ist ein alter Sportplatz. Damals bestand er aus verfallenen Tribünen und einer ganzen Containerladung Glassplitter. Es war außerdem der Schauplatz von Clays berüchtigten Trainingsläufen.)
Aber bevor Henry in den Wagen stieg, fühlte er sich noch verpflichtet, Tommy letzte Instruktionen mit auf den Weg zu geben. Auch Rosa lauschte aufmerksam.
»Wenn ich mich verspäte, sag ihnen, sie sollen auf mich warten, klar?«
»Klar, Henry.«
»Und sag ihnen, sie sollen ihr Geld bereithalten.«
»Klar, Henry.«
»Geht’s dir gut mit dem ewigen ›Klar, Henry‹?«
»Sehr gut sogar.«
»Mach weiter so, und ich stell dich auf die Strecke zu den anderen. Willst du das?«
»Nein danke, Henry.«
»Kann ich dir nicht verübeln, Kleiner.« Ein kurzes Lächeln am Ende eines spielerischen, ausgeklügelten Schlagabtauschs. Er gab Tommy einen zugleich sanften und festen Klaps aufs Ohr und schnappte sich dann Clay. »Und du, tu mir einen Gefallen.« Er packte sein Gesicht mit beiden Händen. »Renn den beiden bloß nicht davon, klar?«
In der postautomobilen Staubwolke schaute der Hund Tommy an.
Tommy schaute Clay an.
Clay schaute niemanden an.
Als er in die Hosentasche griff, wollte er sich nur noch … fallen lassen, in einen Laufschritt, aber er blieb, wo er war. Die Stadt lag vor ihnen ausgebreitet und der Friedhof in ihrem Rücken. Dann machte er zwei Schritte auf Rosa zu, hob sie hoch und klemmte sie sich unter den Arm.
Er stand auf, und der Hund grinste.
Die Augen waren weizengolden.
Sie lachte über die Welt da unten.
Am Fuß der Entreaty Avenue – wo der Hügel anfing, den er gerade hinaufgerannt war – setzte er sie schließlich ab. Sie trotteten über die faulenden Frangipaniblätter zur Poseidon Road, wo das Zentrum des Rennviertels lag. Eine rostige Ladenmeile.
Während Tommy sehnsüchtige Blicke in Richtung Zoogeschäft warf, sehnte sich Clay nach anderen Orten, nach ihren Straßen und Denkmälern.
Lonhro, dachte er.
Bobby’s Lane.
Der gepflasterte Peter Pan Square.
Sie hatte kastanienbraunes Haar und gutgrüne Augen, und sie ging bei Ennis McAndrew in die Lehre. Ihr Lieblingspferd war Matador. Ihr Lieblingsrennen war schon immer das Cox Plate gewesen. Ihr Lieblingssieger war der mächtige Kingston Town, der dieses Rennen vor etwa drei Jahrzehnten gewonnen hatte. (Die besten Dinge geschehen immer vor unserer Geburt.)
Das Buch, das sie las, hieß Der Steinbrecher.
Eins von dreien mit enormer Bedeutung.
In der Hitze der Poseidon Road wandten sich die Jungen und der Hund nach Osten, und nach kürzester Zeit kam Bernborough Park in Sicht.
Sie gingen weiter, bis sie mit seinem Schatten verschmolzen, und dann immer noch weiter; sie stiegen durch ein Loch im Zaun.
Dort auf der Geraden, von der Sonne beschienen, warteten sie.
Innerhalb weniger Minuten hatten sich wieder die üblichen Verdächtigen versammelt: Geierjungen auf dem Kadaver des Sportplatzes; die Bahnen waren mit Unkraut überwuchert. In Streifen löste sich der rote Belag. Der Rasen des Infields war zu einem undurchdringlichen Dschungel zugewuchert.
»Guck mal«, sagte Tommy mit ausgestrecktem Zeigefinger.
Immer mehr Jungen tauchten auf. Sie kamen aus allen Richtungen ihrer pubertierenden Herrlichkeit. Selbst auf diese Entfernung konnte man ihr sonnenverbranntes Lächeln sehen und die Vorstadtnarben zählen. Und man konnte sie riechen, dieses Aroma noch unfertiger Männer.
Eine Weile beobachtete Clay sie von der Außenbahn. Sie tranken, kratzten sich unter den Armen. Warfen mit Flaschen. Ein paar traten gegen die aufgebrochene Bahn. Dann hatte er genug gesehen.
Er legte Tommy die Hand auf die Schulter und trat mit ihm in den Schatten der Tribüne.
Die Dunkelheit fraß ihn auf.
Die Griechen haben ihn erwischt
Für den Mörder war es ein beschämender Trost, als er die anderen im Wohnzimmer fand – das wir oft nur »Tommys Stall« nannten. Und dann natürlich die Namen. Großartig, behaupteten die einen, lächerlich die anderen. Den Goldfisch sah er als Erstes.
Er folgte einem Seitenblick hinüber zum Fenster, wo das Aquarium auf einem Podest stand, und der Fisch machte einen Satz nach vorn und schwamm dann wieder abrupt zurück, wobei er gegen die Glasscheibe prallte.
Seine Schuppen sahen aus wie Gefieder.
Der Schwanz ein goldener Rechen.
AGAMEMNON.
Ein Aufkleber unten an der Glasscheibe verkündete in grünem Filzstift und engen, jungenhaften Buchstaben den Namen, der dem Mörder bekannt war.
Nebenan, auf einem angefressenen Sofa, lag schlafend zwischen der Fernbedienung und einer schmutzigen Socke ein großes graues Monster von einer Katze mit mächtigen schwarzen Tatzen und einem Schwanz wie ein Fragezeichen, ein Tiger, der auf den Namen Hektor hörte.
In vielerlei Hinsicht war Hektor das am meisten verabscheute Tier im Haus. Er lag trotz der brütenden Hitze zu einem fetten, felligen C zusammengerollt da, nur sein Schwanz ragte kerzengerade nach hinten, wie ein zotteliges Schwert. Jedes Mal, wenn er sich rührte, stoben büschelweise Katzenhaare hoch, er aber schlief unbeeindruckt weiter und schnurrte dabei. Es musste nur jemand in seine Nähe kommen, und schon warf er den Motor an. Selbst bei einem Mörder. Hektor war noch nie besonders wählerisch gewesen.
Und schließlich der hohe Vogelkäfig, der auf einem Bücherregal stand.
In dem Käfig hockte mit strenger Miene, aber glücklich, eine Taube.
Die Tür stand offen.
Hin und wieder, wenn sie sich bewegte, ruckte sie sparsam mit dem lilafarbenen Kopf. Dann hielt sie wieder still. Mehr tat diese Taube nicht, tagein, tagaus, während sie darauf wartete, sich auf Tommy niederlassen zu können.
Wir nannten sie meistens Telly.
Oder T.
Aber niemals, unter gar keinen Umständen, benutzten wir ihren vollen, empörenden Namen.
Telemach.
Wir hatten eine Stinkwut auf Tommy wegen dieser Namen.
Wir ließen es ihm nur aus einem einzigen Grund durchgehen. Wir verstanden ihn nämlich vollkommen.
Der Kleine wusste, was er tat.
Im Wohnzimmer schaute sich der Mörder um.
Eine Katze, ein Vogel, ein Goldfisch, ein Mörder.
Und natürlich das Maultier in der Küche.
Ein ziemlich harmloser Haufen.
In dem seltsamen Licht, in der hängenden Hitze und inmitten der anderen Gegenstände in diesem Wohnzimmer – ein oft benutzter und ebenso oft verfluchter Laptop, die mit Kaffeeflecken getränkten Armlehnen des Sofas, die Türme aus Schulbüchern auf dem Teppich – fühlte der Mörder, wie es hinter ihm lauerte, direkt in seinem Rücken. Es fehlte nur, dass es sich nach vorne gebeugt und laut BUH! gerufen hätte.
Das Klavier.
Das Klavier.
Herrgott, dachte er, das Klavier.
Hölzern, aus Walnuss und Aufrichtigkeit, stand es mit geschlossenem Mund und einem Meer aus Staub auf dem Deckel in der Ecke.
Tief und ruhig, beispiellos bedrückt.
Ein Klavier, mehr nicht.
Es mag dir unverfänglich erscheinen, aber sieh genau hin: Sein linker Fuß fing an zu zucken. Sein Herz schmerzte mit einer solchen Wucht, dass es ihn um ein Haar zur Haustür hinauskatapultiert hätte.
Und ausgerechnet jetzt betrat ein Paar Füße die Veranda.
Ein Schlüssel. Eine Tür. Und dann Rory. Und keine Zeit, die Fassung wiederzuerlangen. Worte, die der Mörder sich womöglich zurechtgelegt hatte, flogen ihm stumm aus der Kehle, und mit ihnen auch die Luft. Was blieb, war der Geschmack seines hämmernden Herzens. Er konnte nur einen kurzen Blick erhaschen, denn der Junge sauste wie der Blitz durch die Diele. Beschämend war, dass er nicht wusste, wen er vor sich hatte.
Rory oder mich?
Henry oder Clay.
Tommy war es ganz sicher nicht. Dafür war die Gestalt zu groß.
Der Mörder spürte lediglich einen Körper, der sich bewegte, und dann ein entzücktes Gebrüll aus der Küche.
»Achilles! Du Satansbraten!«
Die Kühlschranktür ging auf und wieder zu, woraufhin Hektor hochschaute. Er plumpste auf den Teppich und streckte die Hinterbeine auf typisch zitternde Katzenart. Dann schlenderte er in die Küche. Sofort änderte sich der Ton der Stimme.
»Was zum Teufel willst du denn hier, Hektor, du Klumpen Scheiße. Wenn du heute Nacht wieder auf mein Bett springst, war’s das für dich, Kumpel, das schwör ich dir.« Das Knistern einer Brottüte, das Knacken einer geöffneten Dose. Dann wieder ein Lachen. »Guter alter Achilles!« Natürlich scheuchte er das Maultier nicht aus dem Haus. Soll sich doch Tommy darum kümmern, dachte er. Oder noch besser: Sollte ich ihn doch später finden. Das würde ein Spaß werden. Und so war es auch.
So schnell er gekommen war, so schnell sauste er wieder durch die Diele. Die Haustür knallte zu, und weg war er.
Wie du dir vorstellen kannst, musste dieser Schock erst einmal verarbeitet werden.
Viele Herzschläge und Atemzüge lang.
Sein Kopf senkte sich, seine Gedanken bedankten sich.
Der Goldfisch rumste gegen das Aquarium.
Der Vogel beäugte ihn und marschierte dann wie ein Oberst auf der Stange hin und her. Schließlich kam die Katze zurück. Hektor betrat das Wohnzimmer und setzte sich hin, als würde er darauf warten, dass sich der Vorhang hob. Der Mörder war davon überzeugt, dass er seinen Puls hören konnte. Das scharrende Pochen. Er fühlte es ja selbst in seinen Handgelenken.
Eine Entscheidung war nun wenigstens gefallen.
Er musste sich hinsetzen.
Mit einer einzigen Bewegung versenkte er sich in den Wehranlagen des Sofas.
Der Kater leckte sich über die Lippen und sprang los.
Der Mörder schaute auf und sah ihn in vollem Flug – ein dicker grauer Klumpen aus Fell und Streifen. Er wappnete sich für den Aufprall, der nicht lange auf sich warten ließ. Einen Moment lang fragte er sich, ob er ihn streicheln sollte oder nicht. Hektor war das völlig egal, er brachte mit seinem Schnurren fast das Haus zum Einsturz, mitten auf dem Schoß des Mörders. Er fing sogar an, vor lauter Wonne zu treteln und mit den Krallen die Oberschenkel des Mörders zu zerfleischen. Und dann ereignete sich noch etwas.
Er konnte es nicht fassen.
Sie kommen.
Sie kommen.
Die Jungen kommen, und ich sitze hier mit dem schwersten Schmusekater, den die Welt je gesehen hatte. Genauso gut hätte er unter einem Amboss liegen können. Einem schnurrenden Amboss.
Diesmal war es Henry, der sich die Haare aus den Augen strich und mit entschlossenen Schritten die Küche betrat. Er nahm den Anblick weniger belustigt, jedoch gelassener hin.
»Ja, gut gemacht, Achilles, danke für die Erinnerung. Matthew kriegt nachher garantiert einen Anfall.«
Und was für einen.
Als Nächstes machte er den Kühlschrank auf und bewies doch tatsächlich Manieren. »Würdest du bitte mal den Kopf ein Stück zur Seite nehmen? Danke.«
Es schepperte leicht, als er Bierdosen in eine Kühltasche warf. Und schon war er wieder weg, auf dem Weg nach Bernborough Park. Und wieder blieb der Mörder allein zurück.
Was war denn hier los?
Konnte denn niemand die Anwesenheit des Killers spüren?
Nein, so leicht würde es nicht werden, und nun musste er, zerdrückt in den Polstern, die Umstände seiner naturgegebenen Unsichtbarkeit zur Kenntnis nehmen: Er war zwischen der Erleichterung über die aus ihr resultierende Gnade und der Scham über seine Ohnmacht hin- und hergerissen – und so saß er da, still und stumm. Umwirbelt von einem Zyklon aus Katzenhaaren, die im Abendlicht aufstoben. Der Goldfisch führte weiter Krieg mit der Glasscheibe, und die Taube stand stramm.
Während ihn das Klavier von hinten beobachtete.
Die menschliche Fußfessel
Als der Letzte von ihnen in Bernborough Park aufgetaucht war, schüttelten sie sich die Hände. Sie lachten. Sie waren ausgelassen. Sie tranken auf diese jugendliche Art, mit gierigen, weit aufgerissenen Mündern. Sie sagten »Oi!« und »Hey!« und »Wo zum Geier warst du, du dämlicher Doofkopp?«. Sie waren Virtuosen der Alliteration, nur wussten sie es nicht.
Sobald er die Autotür hinter sich zugeschlagen hatte, bestand Henrys erste und oberste Priorität darin, sich zu vergewissern, dass sich Clay in der Umkleidekabine unter der Tribüne befand. Da unten traf er die Herausforderer des Tages: sechs Jungen, die alle auf ihn warteten. Folgendes würde passieren:
Sie würden den Tunnel verlassen.
Dann würden sie sich auf der 400-Meter-Strecke verteilen.
Drei an der 100-Meter-Marke.
Zwei an der 200-Meter-Marke.
Und einer irgendwo zwischen der 300-Meter-Marke und dem Ziel.
Und jeder Einzelne von ihnen würde alles in seiner Macht Stehende tun, um Clay daran zu hindern, seinen Lauf zu vollenden. Leichter gesagt als getan.
Der Mob, der dem Geschehen gespannt folgte, schloss Wetten ab. Sie legten sich auf eine Zeit fest, und da kam Henry ins Spiel. Henry nahm freudig die Einsätze entgegen. Ein Stück Kreide in der Hand und eine alte Stoppuhr um den Hals, und er war bereit.
Am Fuß der Tribüne wurde er von etlichen Jungen belagert. Einige von ihnen waren für Henry nur Spitznamen, an denen Körper klebten. Wir, die wir die Szene beobachten, sehen alle bis auf zwei von ihnen hier zum ersten und einzigen Mal, sie bleiben Narren auf ewig. Irgendwie nett, wenn man so darüber nachdenkt.
»Wie sieht’s aus, Henry?«, fragte Lepra. Einen Typ mit einem solchen Spitznamen kann man nur bedauern; überall auf seinem Leib blühte der Schorf, in allen Formen und Farben. Als er acht war, hatte er angefangen, blödsinnige Sachen mit seinem Fahrrad anzustellen, und seitdem offensichtlich nicht mehr damit aufgehört.
Beinahe hätte Henry Mitleid mit ihm gezeigt, doch stattdessen grinste er ihn nur an. »Wie sieht was aus?«
»Wie müde ist er?«
»Nicht sehr.«
»Ist er schon über die Treppe gelaufen? Die von Furz?« Diesmal kam die Frage von Spritti. Charlie Drayton. »Und den Hügel hoch zum Friedhof?«
»Hört zu, er ist gut, er fühlt sich wohl, klar? Er ist absolut fit.« Henry rieb sich vor Vorfreude die Hände. »Da unten warten sechs der Besten. Sogar Starkey ist dabei.«
»Starkey? Der Sauhund ist wieder da? Der bringt mindestens noch mal dreißig Sekunden, denk ich.«
»Ach was, Fisch, Starkey hat bloß’n großes Maul. Clay rennt glatt an ihm vorbei.«
»Wie viele Stockwerke sind doch gleich in dem Furz-Haus?«
»Sechs«, sagte Henry. »Ach übrigens, Furz, der Schlüssel setzt schon Rost an. Wird Zeit, dass du uns einen neuen besorgst, vielleicht schenk ich dir dann einen Wetteinsatz.«
Furz, mit welligen Haaren und einem welligen Gesicht, leckte sich über die welligen Lippen. »Was denn – echt?«
»Na ja, vielleicht ’nen halben.«
»He«, warf ein Typ namens Grusel ein. »Warum kriegt Furz ’ne kostenlose Wette?«
Henry nahm dem Frager den Wind aus den Segeln, ehe überhaupt eine Brise aufkommen konnte. »Weil uunglucklichäärweyse du, Grusel, bloß ein bleichgesichtiger Wichser bist, während Furz was hat, was wir brauchen. Er ist nützlich.« Mit belehrender Stimme fuhr er fort. »Ergo: Du bist überflüssig. Kapiert?«
»He, Henry, wie wär’s damit.« Furz versuchte, so viel wie möglich aus der Situation herauszuschlagen. »Du kriegst meinen Schlüssel, und dafür kriege ich drei Wetten gratis.«
»Gratis? Was bist du, ein verdammter Grieche?«
»Ich glaub nicht, dass die Griechen ›gratis‹ sagen. Ich glaub, das sind die Lateiner.«
Die Stimme kam aus dem Park. Henry kniff die Augen zusammen. »Warst du das, Chewie, du Fellgesicht? Soweit ich weiß, kannst du nicht mal anständig Englisch sprechen.« Und zu den anderen gewandt: »Habt ihr gehört, was der Arsch gesagt hat?«
Sie lachten. »Der war gut, Henry.«
»Und glaubt ja nicht, dass ihr mit einem ›Der war gut, Henry‹ irgendwelche Pluspunkte sammeln könnt.«
»He, Henry.« Furz gab noch nicht auf. »Wie wär’s mit …«
»Mann, krieg die Schwindsucht!« Wut brandete in seiner Stimme hoch, aber es war gespielte Wut, keine echte. Mit siebzehn hatte Henry so ziemlich alles erlebt, was das Leben einem Dunbar vor die Füße kotzen konnte, und jedes Mal kam er mit einem Lächeln wieder aus der Scheiße gekrochen. Er hatte eine Schwäche für die Mittwochabende hier in Bernborough und auch für die Jungs, die am Rand standen und zuschauten. Diese Show war sein Wochenhighlight, und für Clay war es immerhin ein zusätzliches Aufwärmtraining. »Also schön, ihr Wichser, wer will als Erster? Mindesteinsatz zehn Kröten, oder ihr könnt euch gleich verpissen.«
Mit einem Satz sprang er auf die unterste Tribünenbank.
Die Wetten wurden wild durcheinandergerufen, von 2.17 bis 3.46, bis sich 2.32 allgemein durchsetzte. Mit dem kurzen grünen Kreidestummel schrieb Henry die Namen und Zeiten auf den Beton zu ihren Füßen, neben die Wetten der vergangenen Woche.
»Also schön, Wundertüte, das reicht jetzt.«
Wundertüte, auch bekannt als Vong oder Kurd Vongdara, hatte endlos lang mit sich gerungen. Er nahm nicht vieles ernst, aber das hier schon. »Okay«, sagte er. »Wenn Starkey da draußen ist, dann … Scheiße, 5.11.«
»Ach du lieber Himmel.« Henry, der am Boden kauerte, grinste. »Und denkt dran, Jungs, Rückzieher gibt’s nicht, und wehe, jemand vergreift sich an der Kreide …«
Er verstummte.
Er hatte etwas gesehen.
Jemanden.
Sie hatten sich zu Hause in der Küche nur um Minuten verpasst, aber jetzt stand er da – hart und unverwechselbar, mit rostdunklem Haar und Augen wie Metallsplittern. Er kaute Kaugummi. Henry war entzückt.
»Was’n los?« Ein Chor aus fragenden Stimmen erhob sich. »Was ist denn? Was …?« Und dann machte Henry eine Kopfbewegung in Richtung der Stimme, die zwischen den Kreidestrichen am Boden landete.
»Gentlemen …«
Eine Sekunde lang war ein kollektiver Fluch von den Gesichtern der Jungen abzulesen, der an dieser Stelle nicht ausgeschrieben werden soll, und dann brach die Hölle los.
Und am Schluss stand keine Wette mehr wie zuvor.
Rauchzeichen
Okay, das war’s. Es reichte ihm.
Grimmig und schuldbeladen und reumütig war der Mörder zu der Überzeugung gelangt, dass wir ihn zwar verachten konnten, nicht aber ignorieren. Außerdem durfte das, was er gleich tat, als Zeichen von guten Manieren gewertet werden. Wenn er schon das Haus ohne unsere Zustimmung betreten hatte, hätte er uns zumindest vorwarnen sollen.
Er wuchtete Hektor von seinem Schoß.
Er ging zum Klavier.
Anstatt den Deckel über den Tasten aufzuklappen (was er nicht übers Herz brachte), legte er die Saiten von oben frei, und was er dort fand, war womöglich noch schlimmer. Denn dort, im Inneren des Klaviers, lagen zwei kohlfarbene Bücher auf einem alten blauen Wollkleid. In einer Tasche steckte ein Knopf, und unter dem Kleid war das versteckt, weswegen er das Klavier geöffnet hatte: ein Päckchen Zigaretten.
Langsam streckte er den Arm aus.
Sein Körper faltete sich zusammen.
Er musste darum kämpfen, ihn wieder zu begradigen.
Das Klavier zu schließen und in die Küche zu gehen verlangte ihm eine große Kraftanstrengung ab. Er fischte ein Feuerzeug aus der Besteckschublade und stellte sich vor Achilles.
»Verpiss dich.«
Jetzt erst wagte er zu sprechen. Jetzt erst wurde ihm klar, dass das Maultier es nicht auf ihn abgesehen hatte. Und so zündete der Mörder sich eine Zigarette an und ging zur Arbeitsplatte.
»Wenn ich schon mal hier bin, kann ich genauso gut das Geschirr spülen.«
Die Idioten
In der Umkleidekabine duckten sich die Wände vor Scham unter dilettantischem Graffitigekritzel. Clay saß barfuß da und achtete nicht auf seine Umgebung. Tommy kniete auf dem Boden und zupfte Grashalme aus Rosas Bauchfell. Nach einer Weile trottete die Hündin zu Clay, der ihr sanft eine Hand auf die Schnauze legte.
»Dunbar.«
Wie erwartet waren sie zu sechst, jeder vor dem Hintergrund einer anderen Sprayersünde. Fünf redeten und scherzten miteinander. Einer hatte ein Mädchen dabei: das Tier namens Starkey.
»He, Dunbar.«
»Ja?«
»Nicht du, Tommy, der debile Schwachkopf.«
Clay sah auf.
»Hier.« Starkey warf ihm eine Rolle Kreppband zu, das ihn an der Brust traf. Als es auf dem Boden landete, schnappte Rosa es sich und hielt es zwischen ihren Zähnen. Clay sah zu, wie sie damit spielte, während Starkey weiter pöbelte.
»Ich will bloß keine Ausreden hören, wenn ich da draußen mit dir den Boden aufwische, das ist alles. Und mir ist noch sehr gegenwärtig, wie du früher auf diesen Tape-Scheiß gestanden hast. Außerdem gibt’s da draußen jede Menge Glassplitter. Du sollst dir ja nicht deine zarten kleinen Füßchen verletzen.«
»Dir ist es gegenwärtig?«, wiederholte Tommy ungläubig.
»Darf ein Schläger nicht auch über einen Wortschatz verfügen? Ich habe ja auch ›debil‹ gesagt, was im Übrigen ganz ausgezeichnet zu eurer Sippe passt.« Starkey und das Mädchen grinsten, und Clay konnte nicht anders: Sie gefiel ihm. Er betrachtete ihren Lippenstift und das grimmige Grinsen. Ihm gefiel der BH-Träger, der über ihre Schulter nach unten gerutscht war. Und auch die Art, wie sie einander berührten und sich aneinander rieben, störte ihn nicht – ihr Schritt an seinem Oberschenkel, die Beine rechts und links davon. Es war Neugier, nichts weiter. Erstens war sie nicht Carey Novac. Zweitens ging es hier ums Geschäft. Für die da draußen waren die Jungen in der Umkleidekabine die Rädchen in einer wunderbaren Maschine, ein verdorbenes Vergnügen. Für Clay waren sie Kollegen in einem festgelegten System. Wie viel konnten sie ihm antun? Wie viel konnte er aushalten?
Er wusste, dass sie bald nach draußen gehen würden, und so lehnte er sich zurück. Er schloss die Augen, stellte sich vor, Carey wäre bei ihm. Die Wärme und das Licht ihrer Arme. Die Sommersprossen in ihrem Gesicht waren Nadelstiche, ganz winzig und tiefrot, wie ein Diagramm, oder noch besser: wie ein Zahlenbild, auf dem Kinder einzelne Punkte verbinden müssen. Auf ihrem Schoß lag das Buch mit dem hellen Einband, das sie miteinander lasen. In bronzefarbenen, rissigen Buchstaben stand da der Titel: Der Steinbrecher.
Unter dem Titel war zu lesen: Alles, was Sie schon immer über Michelangelo Buonarroti wissen wollten – ein endloser Steinbruch monumentaler Größe. Schlug man das Buch auf, sah man, dass ganz vorne eine Seite herausgerissen war, diejenige mit der Biografie des Autors. Als Lesezeichen diente ein Wettschein jüngeren Datums:
Royal Hennessey, 5. RennenNr. 2 – MatadorAuf Sieg: $ 1,–
Irgendwann stand sie auf und beugte sich über ihn.
Sie lächelte auf diese interessierte Art, die ihr eigen war, als ob sie allem direkt ins Gesicht schauen würde. Sie kam näher und berührte mit ihrer Unterlippe seine Oberlippe, das Buch zwischen ihre Körper geschmiegt. »Da wusste er, dass dies die Welt war und dass sie nur aus einer Vision bestand.«
Während sie ihre Lieblingsstelle zitierte, berührte ihr Mund immer wieder seinen – dreimal, viermal, lass es fünfmal sein. Dann rückte sie kaum merklich von ihm ab und sagte:
»Samstag?«
Ein knappes Nicken, denn am Samstagabend, in drei Tagen, trafen sie sich in der Realität, an seinem anderen verwunschenen, vergessenen Platz. An einem Ort, den man »Umfeld« nannte. Dort lagen sie wach. Ihre Haare kitzelten ihn stundenlang. Aber niemals rührte er sich oder strich die Strähnen beiseite.
»Clay.« Sie verblasste. »Es ist so weit.«
Doch er wollte die Augen nicht öffnen.
Ein schiefzahniger Teenager namens Frettchen musste weichen, und Rory nahm seinen Platz ein. So war es immer, wenn er um der alten Zeiten willen auf der Bildfläche erschien.
Er ging durch den Tunnel und betrat die unbehagliche Umkleidekabine, und sogar Starkey hörte auf, mit seinem Mädchen anzugeben. Rory hob den Finger und legte ihn fest an die Lippen. Dann wuschelte er Tommy grob durch die Haare und baute sich dicht vor Clay auf. Er betrachtete ihn lächelnd mit seinen unschätzbaren Metallsplitteraugen.
»Oi, Clay.« Er konnte einfach nicht widerstehen. »Machst du den Quatsch immer noch?«
Und Clay erwiderte das Lächeln. Er konnte ebenfalls nicht widerstehen.
Er lächelte, aber er sah nicht hoch.
»Seid ihr bereit, Jungs?«
Mit der Stoppuhr in der Hand machte Henry die Ansage.
Als Clay aufstand, richtete Tommy die übliche Frage an ihn. All das war Teil des Rituals.
Wie beiläufig deutete er auf Clays Hosentasche.
»Soll ich für dich drauf aufpassen, Clay?«
Clay schwieg und antwortete Tommy doch.
Immer das Gleiche.
Er schüttelte nicht mal den Kopf.
Sie ließen die Graffiti hinter sich.
Sie gingen durch den Tunnel zurück nach draußen.
Sie nahmen im Licht Gestalt an.
In der Arena befanden sich etwa zwei Dutzend Idioten, verteilt auf beide Seiten, und klatschten sie herbei. Idioten applaudierten Idioten, es war außerordentlich. Das war es, was dieser Mob am besten konnte.
»Kommt schon, Jungs!«
Die Stimmen klangen warm. Die Hände klatschten.
»Lauf, was das Zeug hält, Clay! Lass sie Dreck fressen, Kumpel.«
Das gelbe Licht verharrte hinter der Tribüne.
»Bring ihn nicht um, Rory.«
»Zeig’s ihm, Starkers, du Arschgesicht!«
Gelächter. Starkey blieb stehen.
»Oi.« Er deutete mit dem Finger auf den Sprecher. »Vielleicht sollte ich mich erst mal mit dir warm machen.« Es klang wie ein Zitat aus einem Film. Das »Arschgesicht« störte ihn nicht, aber er konnte es nicht leiden, wenn man ihn »Starkers« nannte. Er blickte hinter sich und sah sein Mädchen zu den heruntergekommenen Tribünenbänken gehen. Für den Rest dieses Gesindels interessierte sie sich nicht; einer von denen reichte ihr voll und ganz. Er setzte seinen massigen Körper in Bewegung, um zu den anderen aufzuschließen.