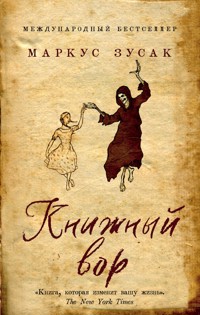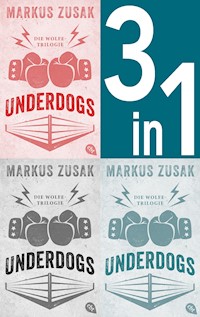8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der grandiose berührende Coming-of-Age-Roman, mit dem Markus Zusak weltberühmt wurde. Jetzt als Serienverfilmung »The Messenger – Seltsame Botschaften«
In Eds Briefkasten liegt – eine Spielkarte. Ein Karo-Ass. Darauf stehen drei Adressen. Die Neugier treibt ihn hin zu diesen Orten, doch was er dort sieht, bestürzt ihn zutiefst: drei unerträglich schwere Schicksale, Menschen, die sich nicht selbst aus ihrem Elend befreien können. Etwas in Ed schreit: »Du musst handeln! Tu endlich was!« Dreimal fasst er sich ein Herz, dreimal verändert er Leben. Da flattert ihm die nächste Karte ins Haus. Wieder und wieder ergreift Ed die Initiative – doch wer ihn auf diese eigenartige Mission geschickt hat, ist ihm völlig schleierhaft.
In diesem großartigen Coming-of-Age-Roman erzählt Markus Zusak, der Autor des Weltbestsellers »Die Bücherdiebin«, ungeheuer spannend und mit viel Situationskomik eine Geschichte über Zivilcourage. Der Roman wurde von der Presse gefeiert und unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2007 ausgezeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für Scout
DANKSAGUNG
Mein besonderer Dank gilt meinen Freunden von der Baycrew, dem Taxiverband New South Wales und Anna McFarlane für ihr Wissen und ihr Engagement.
Teil 1: Die erste Botschaft
Der Überfall
Der Bankräuber ist ein totaler Versager.
Ich weiß es.
Er weiß es.
Die ganze Bank weiß es.
Selbst mein bester Freund Marvin weiß es und der ist ein noch größerer Versager als der Bankräuber.
Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass Marvs Auto draußen auf einem Parkplatz steht, wo man nur eine Viertelstunde parken darf. Wir liegen mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden und von der Viertelstunde sind nur noch ein paar mickrige Minuten übrig.
»Der Kerl sollte sich besser etwas beeilen«, sage ich.
»Wem sagst du das«, flüstert Marv zurück. »Das ist eine bodenlose Frechheit.« Seine Stimme steigt vom Boden in die Höhe. »Ich kriege einen Strafzettel, nur wegen diesem Blödmann! Ich kann mir nicht noch einen Strafzettel leisten, Ed.«
»So viel ist der Wagen ja nicht mal wert.«
»Was?«
Marv schaut mich von der Seite her an. Ich merke, dass er sauer ist. Beleidigt. Wenn es etwas gibt, was Marv unter keinen Umständen toleriert, dann ist es eine abfällige Bemerkung über sein Auto. Er wiederholt seine Frage.
»Was hast du gesagt, Ed?«
»Ich sagte«, flüstere ich, »dass der Wagen nicht mal so viel wert ist wie ein Strafzettel.«
»Hör mal«, sagt Marvin, »ich kann ja eine Menge schlucken, aber …«
Ich schalte meine Ohren auf Durchzug, denn ehrlich gesagt kommt aus Marvins Mund nur noch gequirlte Kacke, wenn er erst mal anfängt, über sein Auto zu reden. Er quatscht und quatscht, wie ein kleines Kind, und dabei ist er gerade zwanzig geworden, Himmel noch mal.
Er labert etwa eine Minute lang, bis ich mich nicht mehr beherrschen kann und ihn unterbreche.
»Marv«, sage ich, »der Wagen ist einfach nur peinlich, klar? Er hat ja noch nicht mal eine Handbremse. Er steht da draußen mit zwei Backsteinen vor den Hinterrädern.« Ich versuche, so leise wie möglich zu sprechen. »Du machst dir doch meistens noch nicht mal die Mühe, ihn abzuschließen. Wahrscheinlich hoffst du sogar, dass ihn dir jemand klaut, damit du die Versicherung abkassieren kannst.«
»Er ist nicht versichert.«
»Aha.«
»Die Versicherung sagt, das ist er nicht wert.«
»Verständlich.«
In diesem Moment dreht sich der Bankräuber um und schreit: »Wer quatscht dahinten?«
Marv ist das ganz egal. Er kommt jetzt erst richtig in Fahrt.
»Du hast aber ganz offensichtlich nichts dagegen, dass ich dich in diesem Wagen zur Arbeit kutschiere, Ed, du mieser Emporkömmling.«
»Emporkömmling? Was zum Teufel ist das?«
»Ich hab gesagt, Ruhe dahinten!«, schreit der Bankräuber.
»DANN BEEIL DICH GEFÄLLIGST!«, brüllt Marv zurück. Seine gute Laune ist verflogen. Und zwar gänzlich.
Er liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden der Bank.
Die Bank wird gerade ausgeraubt.
Der Frühling ist in diesem Jahr abartig heiß.
Die Klimaanlage ist kaputt.
Sein Wagen wurde soeben beleidigt.
Dem guten Marv ist der Geduldsfaden gerissen und seine Argumentationskette ebenfalls. Und in Mörderstimmung ist er sowieso.
Wir liegen immer noch flach auf dem ausgetretenen, staubigen blauen Teppich in der Schalterhalle. Marv und ich mustern uns mit kampflustigen Blicken. Unser Kumpel Ritchie liegt drüben in der Kinderspielecke, halb unter dem Tisch und unter Legosteinen begraben. Dort hat er sich hineingeworfen, als der Bankräuber hereingestürzt kam und brüllte und mit der Waffe herumfuchtelte. Audrey ist direkt hinter mir. Ihr Fuß liegt über meinem Bein und das wird langsam ganz taub.
Der Bankräuber hat sein Gewehr auf die Nase eines beklagenswerten Mädchens hinter dem Schalter gerichtet. Auf ihrem Namensschild steht »Misha«. Arme Misha. Sie zittert fast genauso stark wie der Bankräuber, während sie darauf wartet, dass ein pickeliger Typ Ende zwanzig mit Schlips und Schweißflecken unter den Achseln die Banknoten in eine Tasche schiebt.
»Dieser Kerl sollte sich ein bisschen beeilen«, meint Marv.
»Das hab ich doch eben gerade gesagt«, erkläre ich.
»Ja und? Kann ich nicht mal mehr meine Meinung sagen?«
»Nimm deinen Fuß von meinem Bein«, sage ich zu Audrey.
»Was?«, fragt sie.
»Ich hab gesagt, nimm deinen Fuß da weg. Mein Bein ist eingeschlafen.«
Sie zieht ihren Fuß weg. Zögernd.
»Danke.«
Der Bankräuber dreht sich um und brüllt erneut seine Frage – zum letzten Mal, wie es scheint: »Welches Arschloch dahinten kann sein Maul nicht halten?«
Eine Sache ist in Bezug auf Marv wirklich erwähnenswert. Man kann ihn bestenfalls als schwierig bezeichnen. Streitsüchtig. Alles andere als liebenswert. Er ist der Typ Freund, mit dem man sich ständig in den Haaren liegt, besonders wenn es um seine Scheißkarre geht. Und er kann ein absolut unreifer Mistkerl sein, wenn er in Stimmung ist.
Mit scherzhafter Stimme ruft er aus: »Das war Ed Kennedy, Sir. Ed hat geschwätzt.«
»Vielen Dank auch!«, sage ich.
(Mein voller Name lautet Ed Kennedy. Ich bin neunzehn Jahre alt. Eigentlich zu jung, um als Taxifahrer zu arbeiten. Ich bin ein typisches Beispiel für viele der jungen Männer, denen man in diesem provinziellen Außenposten der Großstadt begegnet – man hat hier einfach kaum Perspektiven oder Möglichkeiten. Davon abgesehen lese ich mehr Bücher, als ich sollte, und ich bin zugegebenermaßen ein ziemlicher Schlappschwanz in Sachen Sex und auch in Bezug auf die Steuererklärung. – Schön, dich kennen zu lernen.)
»Schnauze, Ed!«, schreit der Bankräuber. »Oder ich komm rüber und schieß dir den Arsch weg!«
Marv grinst hämisch. Es ist fast so wie früher in der Schule, wenn einen der sadistische Mathelehrer von der Tafel aus anbrüllt, obwohl er sich einen feuchten Dreck um die ganze Sache schert und nur darauf wartet, dass der Unterricht zu Ende ist und er nach Hause gehen, Bier trinken und sich vor den Fernseher fläzen kann.
Ich schaue Marv an. Ich könnte ihn umbringen. »Du bist gerade zwanzig geworden, verdammt noch mal. Willst du, dass er uns kaltmacht?«
»Halt’s Maul, Ed!« Diesmal ist die Stimme des Bankräubers noch lauter.
Mein Flüstern wird leiser. »Wenn ich erschossen werde, bist du schuld. Das ist dir doch wohl klar, oder?«
»Ich sagte: HALT’S MAUL, ED!«
»Für dich ist das alles nur ein großer Witz, oder, Marv?«
»Okay, das war’s.« Der Bankräuber hat plötzlich das Interesse an der Frau hinter dem Schalter verloren und marschiert auf uns zu. Er hat die Nase gestrichen voll. Als er vor uns steht, schauen wir alle zu ihm hoch.
Marv.
Audrey.
Ich.
Und all die anderen hoffnungslosen Gestalten, die gemeinsam mit uns auf dem Boden liegen, alle viere von sich gestreckt.
Der Gewehrlauf berührt meinen Nasenrücken. Meine Nase fängt an zu jucken. Ich beschließe, nicht zu kratzen.
Der Bankräuber schaut abwechselnd erst Marv und dann mich an. Durch den Strumpf über seinem Gesicht kann ich seine rotbraunen Koteletten und die Aknenarben sehen. Seine Augen sind klein und er hat große Ohren. Wahrscheinlich raubt er die Bank aus Rache aus, weil er drei Jahre in Folge zum hässlichsten Kerl der Stadt gewählt worden ist.
»Wer von euch ist Ed?«
»Er«, antworte ich und deute auf Marv.
»Oh nein, die Tricks lässt du mal schön bleiben«, sagt Marv entschieden. Sein Gesichtsausdruck sagt mir, dass er nicht halb so viel Angst hat, wie er haben sollte. Er weiß genau, dass wir beide schon längst tot wären, wenn der Bankräuber wirklich vorhätte, Ernst zu machen. Er schaut zu dem strumpfgesichtigen Mann auf und sagt: »Wart mal ’ne Sekunde…« Er kratzt sich am Kinn. »Irgendwie kommst du mir bekannt vor.«
»Okay«, werfe ich ein. »Ich geb’s zu: Ich bin Ed.« Aber der Bankräuber ist viel mehr daran interessiert zu hören, was Marv zu sagen hat.
»Marv«, flüstere ich deutlich hörbar. »Halt den Mund.«
»Halt den Mund, Marv«, sagt Audrey.
»Halt den Mund, Marv!«, ruft Ritchie von der anderen Seite des Raums.
»Wer zum Teufel bist du denn?«, ruft der Bankräuber in Ritchies Richtung und versucht herauszufinden, von wem die Stimme kommt.
»Ich bin Ritchie.«
»Also gut, Ritchie. Dann halt mal schön selbst den Mund. Fang du nicht auch noch an!«
»Kein Problem«, erwidert die Stimme. »Vielen Dank.« Meine Freunde scheinen allesamt richtige Klugscheißer zu sein. Frag mich nicht, warum. Es ist einfach so, wie vieles andere auch.
Wie auch immer, der Bankräuber kocht jetzt so richtig. Der Dampf scheint ihm durch die Haut zu dringen und durch den Strumpf über seinem Kopf. »Ich hab’s jetzt endgültig satt«, knurrt er. Die Stimme auf seinen Lippen glüht.
Doch Marv bringt er damit nicht zum Schweigen.
»Vielleicht«, fährt Marv fort, »sind wir zusammen zur Schule gegangen oder so was in der Art. Kann das sein?«
»Du willst wohl unbedingt sterben«, sagt der Bankräuber nervös, aber immer noch brodelnd vor Zorn. »Stimmt’s?«
»Nun, eigentlich«, erklärt Marv, »will ich nur die Parkuhr füttern. Ich darf da draußen nur eine Viertelstunde stehen. Du hältst mich auf.«
»In der Tat.« Der Kerl richtet seine Waffe auf Marv.
»Kein Grund, gleich so feindselig zu werden!«
Oh Gott, denke ich. Jetzt ist Marv verloren. Der Kerl wird ihm in den Hals schießen.
Der Bankräuber schaut durch die Glasscheibe nach draußen und überlegt, welcher Wagen wohl Marv gehört. »Welcher ist es?«, fragt er mit geradezu höflicher Stimme.
»Der hellblaue Falcon da drüben.«
»Dieses Stück Scheiße? Den würde ich ja nicht mal anpissen, geschweige denn Parkgebühren dafür zahlen.«
»Jetzt mach mal halblang!« Marv gerät schon wieder in Rage. »Wenn du uns schon hier in der Bank festhältst, ist wohl das Mindeste, was du tun kannst, meine Parkgebühren zu zahlen, oder etwa nicht?«
In der Zwischenzeit.
Liegt das Geld am Schalter bereit, und Misha, das arme Hinter-dem-Schalter-Mädchen, ruft zu uns herüber. Der Bankräuber dreht sich um und spurtet zu ihr.
»Beeil dich, blöde Kuh«, kläfft er sie an, als sie ihm den Beutel reicht. Das angemessene Vokabular für einen Bankraub, nehme ich an. Und schon ist er wieder auf dem Weg zu uns, mit dem Geld in der Hand.
»Du da!«, schreit er mich an. Er hat offensichtlich neuen Mut geschöpft, jetzt da er das Geld hat. Er will mir gerade mit seinem Gewehr eins überziehen, als etwas draußen vor der Bank seine Aufmerksamkeit erregt.
Er schaut genauer hin.
Durch die Glastüren der Bank.
Ein Schweißtropfen fällt von seiner Kehle herab.
Er atmet schwer.
Seine Gedanken drehen sich im Kreis und.
Dann dreht er durch.
»Nein!«
Draußen steht die Polizei, aber die Jungs haben keine Ahnung, was in der Bank vor sich geht. Die Sache ist noch nicht bis zu ihnen durchgedrungen. Sie meckern gerade jemanden in einem goldfarbenen Torana an, weil er auf der anderen Straßenseite vor der Bäckerei in zweiter Reihe parkt. Der Wagen fährt weiter und auch die Polizei macht sich wieder auf den Weg. Der belämmerte Bankräuber steht da mit dem Geldsack in der Hand.
Ihm ist gerade sein Fluchtfahrzeug samt Fahrer abhanden gekommen.
Er hat eine Idee.
Wieder dreht er sich um.
Zu uns.
»Du.« Er deutet auf Marv. »Gib mir deine Schlüssel.«
»Was?«
»Du hast mich verstanden.«
»Der Wagen ist ein Oldtimer!«
»Der Wagen ist ein Stück Scheiße!« Ich kann’s nicht lassen. »Gib ihm endlich die Schlüssel oder ich bringe dich eigenhändig um.«
Stinksauer greift Marv in seine Tasche und zieht seine Autoschlüssel hervor.
»Sei gut zu ihm«, fleht er.
»Leck mich«, erwidert der Bankräuber.
»He, das ist doch wirklich nicht nötig!«, ruft Ritchie unter dem Legohaufen hervor.
»Schnauze!«, kläfft der Bankräuber, und dann ist er weg.
Sein einziges Problem wird sein, dass er lediglich eine fünfprozentige Chance hat, Marvs Wagen gleich beim ersten Versuch anzulassen.
Der Bankräuber stürzt zur Tür und auf Marvs Wagen zu. Er stolpert, lässt das Gewehr in der Nähe des Eingangs fallen, beschließt aber, es liegen zu lassen. In dem Bruchteil der Sekunde, in dem er überlegt, ob er das Gewehr aufheben soll oder nicht, kann ich die Panik in seinem Gesicht sehen. Er hat keine Zeit mehr, und deshalb lässt er das Gewehr, wo es ist, und rennt weiter.
Wir erheben uns auf unsere Knie und sehen zu, wie er sich dem Wagen nähert.
»Jetzt passt gut auf.« Marv fängt an zu lachen. Audrey, Marv und ich schauen aufmerksam hin und auch Ritchie ist aufgestanden und auf dem Weg zu uns.
Draußen bleibt der Bankräuber jetzt stehen und versucht herauszufinden, mit welchem Schlüssel er den Wagen aufschließen kann. Angesichts dieser Zurschaustellung von Unfähigkeit müssen wir alle lachen.
Schließlich sitzt er drin und versucht, den Wagen zu starten, wieder und wieder, aber ein ums andere Mal säuft der Motor ab.
Dann.
Aus irgendeinem Grund, den ich nie begreifen werde.
Schnappe ich mir das Gewehr und renne raus. Ich laufe über die Straße auf den Bankräuber zu und unsere Blicke treffen sich. Er will aus dem Wagen springen, aber dafür ist es zu spät.
Ich stehe vor der Windschutzscheibe.
Ich richte die Waffe auf seine Augen.
Er erstarrt.
Wir beide erstarren.
Dann schnellt er hervor und versucht erneut zu fliehen, und ich schwöre, ich hab keine Ahnung, dass ich die Waffe abfeuere, bis ich einen Schritt auf ihn zu mache und höre, wie Glas zersplittert.
»Was machst du denn da?«, schreit mir Marv von der anderen Straßenseite aus schmerzerfüllt zu. Seine Welt liegt in Trümmern. »Das ist mein Wagen, auf den du da schießt!«
Sirenen kommen näher.
Der Bankräuber sinkt auf die Knie.
»Ich bin ja so ein Idiot«, sagt er.
Dem kann ich nur zustimmen.
Einen Moment lang schaue ich ihn an und bemitleide ihn, denn mir wird klar, dass ich den womöglich größten Pechvogel der Welt vor mir habe. Zuerst raubt er eine Bank aus, in der sich so unsagbare Idioten wie Marv und ich befinden. Dann verschwindet sein Fluchtwagen. Dann, als er auf der Sonnenseite zu stehen scheint, weil er weiß, wie er an einen anderen Wagen kommt, erweist sich dieses Gefährt als die erbärmlichste Schrottkarre der südlichen Hemisphäre. Ja, irgendwie tut er mir Leid. Stell dir das mal vor – diese Blamage!
Als die Bullen ihm Handschellen anlegen und ihn abführen, sage ich zu Marv: »Siehst du es jetzt ein?« Immer wieder sage ich es und werde dabei immer lauter: »Siehst du es jetzt endlich ein? Das war gerade der schlagende Beweis für die absolute Jämmerlichkeit deines« – und hier deute ich darauf – »Autos.« Ich mache eine kurze Pause. »Wenn diese Karre auch nur eine Winzigkeit taugen würde, wäre der Kerl davongekommen, oder etwa nicht?«
Marv nickt. »Wahrscheinlich.«
Es ist schwer zu sagen, ob er es tatsächlich vorgezogen hätte, dass dem Bankräuber die Flucht gelungen wäre, sozusagen als Beweis dafür, dass sein Auto nicht vollends schrottreif ist.
Auf der Straße und überall auf den Autositzen liegt Glas. Ich weiß für den Moment nicht, was zerrütteter aussieht – das Fenster oder Marvs Gesicht.
»He«, sage ich, »tut mir Leid wegen der Windschutzscheibe.«
»Schon gut«, erwidert Marv.
Die Waffe in meiner Hand fühlt sich warm und klebrig an, wie geschmolzene Schokolade.
Immer mehr Polizisten tauchen auf und stellen Fragen.
Wir fahren zur Wache, und dort will man alles über den Bankraub wissen, was passiert ist und wie es mir gelungen ist, die Waffe an mich zu bringen.
»Er hat sie einfach fallen lassen?«
»Das habe ich Ihnen doch gesagt.«
»Hör mal, Freundchen«, sagt der Bulle. Er schaut von seinen Papieren auf. »Es gibt keinen Grund, rotzig zu werden, okay?« Er hat einen Bierbauch und einen grau werdenden Schnurrbart. Warum haben fast alle Polizisten, die ich kenne, einen Schnurrbart?
»Rotzig?«, frage ich.
»Ja, rotzig.«
Rotzig.
Das Wort gefällt mir.
»Entschuldigung«, sage ich. »Er hat das Gewehr einfach beim Weglaufen fallen lassen, und ich habe es aufgehoben, als ich ihm nachgerannt bin. Das ist alles. Der Typ war einfach der absolute Idiot.«
»Du sagst es.«
Wir müssen eine ganze Weile dableiben. Das einzige Mal, dass der bierbäuchige Polizist beinahe die Fassung verliert, ist der Moment, als Marv ihn auf Schadensersatz für sein Auto anspricht.
»Der blaue Falcon?«, fragt der Bulle.
»Genau.«
»Ganz ehrlich, Junge – der Wagen ist eine völlige Katastrophe. Eine Schande für die Welt.«
»Ich hab’s dir ja gesagt«, erkläre ich.
»Die Karre hat noch nicht einmal eine Handbremse, Herrgott noch mal!«
»Na und?«
»Du kannst von Glück reden, dass wir dir keine Anzeige dafür aufbrummen. Das Ding ist eine Gefahr für den Straßenverkehr.«
»Na, herzlichen Dank.«
Der Bulle grinst. »Gern geschehen.«
»Ich möchte dir einen guten Rat geben.«
Wir sind schon fast aus der Tür, als wir merken, dass der Polizist noch nicht fertig ist mit uns. Er ruft uns zurück, das heißt, eigentlich ruft er Marv zurück.
»Was ist?«, fragt Marv.
»Warum schaffst du dir keinen neuen Wagen an, Mann?«
Marv betrachtet ihn mit ernstem Blick. »Ich habe meine Gründe.«
»Was denn, kein Geld?«
»Oh, Geld habe ich. Ich arbeite nämlich, müssen Sie wissen.« Aus irgendeinem Grund klingt seine Stimme scheinheilig. »Ich habe nur andere Prioritäten.« Jetzt lächelt er, wie nur jemand lächeln kann, der stolz ist auf einen Wagen wie den seinen. »Außerdem liebe ich mein Auto.«
»Also schön«, sagt der Bulle abschließend. »Macht’s gut.«
»Was für Prioritäten könntest du denn haben? Ausgerechnet du?«, frage ich Marv, als wir uns auf der anderen Seite der Tür befinden.
Marv schaut stur und ausdruckslos geradeaus.
»Halt einfach dein Maul, Ed«, sagt er. »Die meisten Leute mögen dich ja heute für einen Helden halten, aber für mich bist und bleibst du der Dreckskerl, der eine Kugel durch meine Windschutzscheibe gejagt hat.«
»Willst du, dass ich dir den Schaden bezahle?«
Marv schenkt mir ein Lächeln. »Nein.«
Ehrlich gesagt erleichtert mich das. Ich würde lieber sterben, als nur einen einzigen Cent in diesen Falcon zu stecken.
Draußen vor der Polizeiwache warten Audrey und Ritchie auf uns, aber sie sind nicht allein. Jede Menge Journalisten haben sich versammelt und schießen jede Menge Fotos.
»Das ist er!«, ruft jemand, und bevor ich irgendetwas abstreiten kann, hängt mir die ganze Meute am Hals und stellt mir Fragen. Ich antworte, so schnell ich kann, und erkläre noch einmal, was passiert ist. Der Vorort, in dem ich wohne, ist nicht gerade klein, und alle haben sich versammelt: Radio-, Fernseh- und Zeitungsreporter, die die Geschichte aufschreiben und am nächsten Tag der Öffentlichkeit präsentieren werden.
Ich kann schon die Schlagzeilen vor mir sehen.
So was wie »HELDENHAFTER TAXIFAHRER« wäre nett, aber wahrscheinlich steht da eher »TROTTEL HATTE ’NEN GUTEN TAG«. Marv wird sich totlachen.
Nach etwa zehn Minuten Fragerei löst sich die Meute auf und wir gehen zurück zum Parkplatz. Unter dem Scheibenwischer des Falcon steckt ein saftiger Strafzettel.
»Diese Arschlöcher«, kommentiert Audrey. Marv reißt ihn heraus und liest ihn. Wir waren eigentlich zur Bank gegangen, um Marvs Gehaltsscheck einzulösen. Jetzt kann er mit dem Geld den Strafzettel bezahlen.
Wir bemühen uns, so gut es geht, das Glas von den Autositzen zu fegen, und steigen ein. Marv dreht den Zündschlüssel achtmal herum. Der Wagen springt nicht an.
»Na klasse«, sagt er.
»Typisch«, sagt Ritchie.
Audrey und ich sagen gar nichts.
Audrey lenkt und der Rest von uns schiebt. Wir bringen den Wagen zu mir nach Hause, weil das am nächsten ist.
Ein paar Tage später bekomme ich die erste Botschaft.
Sie verändert alles.
Eine Einführung in mein Leben: Sex sollte so sein wie Mathematik
Ich erzähl dir mal ein bisschen was von meinem Leben.
Ein paar Abende in der Woche spiele ich Karten.
So verbringen wir unsere Zeit.
Wir spielen ein Spiel, das »Annoyance« – Nervtöter – heißt. Es ist nicht besonders schwer, und es ist das einzige Spiel, das uns allen Spaß macht und bei dem wir uns nicht ständig streiten.
Da ist zum einen Marv, der keine Sekunde lang die Klappe hält, dasitzt und Zigarre raucht und so tut, als würde es ihm schmecken.
Dann ist da Ritchie, der ewig Schweigsame, der stets die lächerliche Tätowierung auf seinem rechten Arm zur Schau stellt, den ganzen Abend lang an einem einzigen Bier nippt und von Zeit zu Zeit über seine Koteletten streicht, die ungleichmäßig auf seinem Babygesicht aufgeklebt zu sein scheinen.
Dann ist da noch Audrey. Audrey sitzt immer mir gegenüber, egal was wir spielen. Sie hat gelbe Haare, sehnige Beine, das schönste schiefe Lächeln der Welt, herrliche Hüften und sie schaut sich oft Filme an. Sie fährt Taxi, genau wie ich.
Und dann bin da noch ich.
Aber bevor ich näher auf mich eingehe, sollte ich ein paar andere Tatsachen erwähnen:
Mit neunzehn Jahren gastierte Bob Dylan auf den Bühnen von Greenwich Village, New York. Mit neunzehn Jahren hatte Salvador Dalí bereits etliche herausragende, atemberaubende Kunstwerke geschaffen.Mit neunzehn Jahren war Johanna von Orléans die berühmteste Frau der Welt. Sie hatte gerade eine Revolution vom Zaun gebrochen.Und dann ist da noch Ed Kennedy, ebenfalls neunzehn Jahre alt.
Kurz bevor ich in den Bankraub geraten bin, habe ich Bilanz über mein Leben gezogen.
Ein Taxifahrer, der schwindelt, was sein Alter angeht. (Eigentlich muss man zwanzig sein, um Taxi fahren zu dürfen.)
Keine Ausbildung.
Keine Stellung in der Gesellschaft.
Nichts.
Mir ist klar geworden, dass überall auf der Welt Menschen Großartiges leisten, während ich mich von kahl werdenden Geschäftsleuten namens Derek durch die Großstadt jagen lasse und aufpassen muss, dass mir freitagnachts die Besoffenen nicht auf den Sitz kotzen oder abhauen, bevor sie bezahlen. Es war Audreys Vorschlag, dass ich mich als Taxifahrer versuchen soll. Sie musste mich nicht lange überreden, hauptsächlich weil ich seit Jahren in sie verliebt bin. Ich bin nie aus der Vorstadt herausgekommen. Ich bin nicht zur Uni gegangen. Ich ging zu Audrey.
Ständig frage ich mich: »Nun, Ed, was hast du in den neunzehn Jahren deines Lebens erreicht?« Die Antwort ist einfach:
Einen Scheiß.
Ich habe ein paar Leuten davon erzählt, aber alle haben gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Marv nannte mich einen erstklassigen Jammerlappen. Audrey sagte, es sei zwanzig Jahre zu früh für eine Midlifecrisis. Ritchie schaute mich einfach nur an, als würde ich eine fremde Sprache sprechen. Und als ich es meiner Mutter gegenüber erwähnte, meinte sie nur: »Och, warum stellst du dich nicht einfach in die Ecke und weinst dich mal so richtig aus, Ed?« Meine Mutter ist der Kracher. Glaub mir.
Ich wohne in einer Hütte, die ich billig gemietet habe. Kurz nachdem ich eingezogen bin, habe ich von dem Makler erfahren, dass der Eigentümer gleichzeitig mein Boss ist: der stolze Gründer und Besitzer des Taxiunternehmens, für das ich fahre: »FREIE TAXIS«. Es ist, vorsichtig ausgedrückt, eine dubiose Firma. Audrey und ich hatten keine Schwierigkeiten, die Jungs dort zu überzeugen, dass wir alt genug sind und die nötigen Papiere haben, um Personen zu befördern. Vertausche ein paar Zahlen auf deiner Geburtsurkunde und wedele mit einem Papierlappen herum, der aussieht wie ein Führerschein, und schon bist du dabei. Innerhalb einer Woche waren wir im Geschäft, denn es herrschte gerade Fahrerflaute. Keine Kontrolle unserer Papiere. Kein Stress. Es ist überraschend, was man mit Betrug und Tricks alles erreichen kann. Wie Raskolnikow in Dostojewskis »Schuld und Sühne« einmal sagte: »Wo der Verstand nicht hilft, hilft der Teufel.« Wenn ich sonst schon nichts vorweisen kann, so kann ich doch mit Fug und Recht behaupten, der jüngste Taxifahrer in der Gegend zu sein – ein Wunderkind des Taxameters sozusagen. Das ist die Art von Anti-Errungenschaft, die meinem Leben Struktur verleiht. Audrey ist ein paar Monate älter als ich.
Die Hütte, in der ich wohne, ist nicht weit weg vom Zentrum und gleichzeitig einen ordentlichen Fußweg von meiner Arbeit entfernt. (Das Taxi darf ich nicht mit nach Hause nehmen.) Manchmal fährt Marv mich hin. Der Grund, warum ich kein eigenes Auto habe, ist die Tatsache, dass ich bei Tag und bei Nacht Leute durch die Gegend kutschiere. In meiner freien Zeit habe ich keine Lust, noch mehr herumzufahren.
Das Kaff, in dem wir alle leben, ist nichts Besonderes. Es liegt am Rand der Großstadt und hat gute Ecken und schlechte Ecken. Es wird wohl niemanden überraschen, wenn ich dir sage, dass ich aus einer schlechten Ecke stamme. Meine gesamte Familie ist im äußersten Norden unserer Kleinstadt aufgewachsen, eine Abstammung, die jeder, den es trifft, auf ewig als Schandfleck mit sich herumträgt. Schwangerschaften bei Minderjährigen sind dort an der Tagesordnung, und die Gegend wartet mit einer ungesunden Ansammlung von gewalttätigen, arbeitslosen Vätern auf sowie von Müttern, die saufen, rauchen und mit hochhackigen Stiefeln durch die Straßen stolzieren, so wie meine eigene Mutter. Mein Zuhause war ein echt mieses Loch, aber ich blieb da, bis mein Bruder Tommy die Schule beendet hatte und an die Uni ging. Manchmal denke ich, dass ich das auch hätte tun sollen, aber ich war in der Schule zu faul. Immer dann, wenn ich meine Mathehausaufgaben hätte machen müssen und den ganzen anderen Mist, hab ich lieber gelesen. Vielleicht hätte ich eine Ausbildung machen können, aber hier in der Gegend gibt es keine Lehrstellen, besonders nicht für Typen wie mich. Aufgrund der bereits erwähnten Faulheit war ich nicht besonders gut in der Schule, außer in Englisch, wegen meiner Liebe zu Büchern. Und weil mein Vater unser ganzes Geld versoff, bin ich arbeiten gegangen, gleich nachdem ich die Schule abgeschlossen hatte. Angefangen habe ich in einer Fastfood-Kette, die nicht weiter bemerkenswert ist und deren Namen ich aus Scham lieber verschweigen möchte. Danach habe ich in dem staubigen Büro eines Steuerberaters Akten sortiert. Der Laden hat kurz nachdem ich dort angefangen habe dichtgemacht. Und schließlich der Höhepunkt, der Gipfel meiner Karriere.
Taxifahrer.
Ich habe einen Mitbewohner. Er heißt Türsteher und ist siebzehn Jahre alt. Er sitzt vor der Fliegengittertür und die Sonne scheint auf sein schwarzes Fell. Seine alten Augen schimmern. Er lächelt. Er heißt Türsteher, weil er seit frühester Jugend eine Vorliebe dafür hat, neben der Eingangstür zu sitzen. So war es früher zu Hause, und so ist es auch heute noch, hier in der Hütte. Er sitzt gerne dort, wo es hübsch warm ist, und er lässt niemanden herein. Der Grund dafür, dass er sich so ungern bewegt, ist sein stattliches Alter. Er ist ein Rottweiler-Schäferhund-Mischling, und er verströmt einen Gestank, den er einfach nicht loswird, egal was ich versuche. Deshalb besucht mich wohl auch niemand, bis auf meine Kartenspielerfreunde. Kommt jemand an meine Eingangstür, schlägt ihm der Hundegestank wie ein nasser Lappen ins Gesicht, und der Besucher macht auf dem Absatz kehrt. Niemand ist scharf darauf, länger als nötig an der Tür zu bleiben, geschweige denn meine Hütte zu betreten. Ich hab sogar versucht, dem Türsteher ein Deo aufzuschwätzen, habe es ihm in Unmengen unter seine vier Achseln gerieben. Ich hab ihn von oben bis unten mit Raumspray besprüht, aber das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Während dieser Zeit roch er wie ein finnisches Plumpsklo.
Früher gehörte er meinem Vater, aber als der alte Herr vor etwa sechs Monaten starb, hat meine Mutter ihn zu mir abgeschoben. Sie hatte es satt, dass er sein Geschäft immer unter der Wäscheleine machte und ihre Klamotten voll stänkerte.
(»Er könnte seinen Haufen überall im Garten hinsetzen!«, hat sie immer gekeift. »Aber wo macht er es?« Sie beantwortete die Frage selbst. »Ausgerechnet unter der verdammten Wäscheleine.«)
Und so kam es, dass ich ihn mitnahm, als ich auszog.
In meine Hütte.
Zu seiner Tür.
Er ist glücklich.
Und ich auch.
Er ist glücklich, wenn die Sonne ihn mit Wärme verwöhnt, ihn damit durch die Fliegengittertür berieselt. Er ist glücklich, dort zu schlafen und abends, wenn ich die Haustür zumache, gerade so weit wie nötig zur Seite zu kriechen. In solchen Momenten liebe ich diesen Hund abgöttisch. Ach was, ich liebe ihn jederzeit. Aber Himmel noch mal, wie er stinkt!
Ich nehme an, dass er bald sterben wird. Ich bin darauf vorbereitet, immerhin hat er schon siebzehn Jahre auf dem Buckel. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich darauf reagieren werde, wenn es so weit ist. Wenn ich es merke, wird er sich bereits dem eigenen, friedvollen Tod gestellt haben und in aller Ruhe gegangen sein. Meistens stelle ich mir vor, dass ich mich niederkauere, dort neben der Tür, mein Gesicht in seinem stinkenden Fell vergrabe und mir die Augen ausheule. Ich warte darauf, dass er aufwacht, aber das tut er nicht. Ich begrabe ihn, keine Frage. Ich trage ihn nach draußen, fühle, wie seine Wärme sich in Kälte verwandelt, während der Horizont ausfranst und in meinem Hinterhof zu Boden sinkt. Aber im Augenblick geht’s ihm gut. Ich sehe, wie er atmet. Er riecht bloß, als sei er schon tot.
Ich besitze einen Fernseher, der erst mal warmlaufen muss, ein Telefon, das fast nie klingelt, und einen Kühlschrank, der wie ein Radio summt.
Auf dem Fernseher steht ein Foto meiner Familie, das schon ziemlich alt ist.
Ich sehe selten fern, aber von Zeit zu Zeit schaue ich mir das Foto an. Es hat einen ziemlich hohen Unterhaltungswert, obwohl es immer staubiger wird. Es zeigt eine Mutter, einen Vater, zwei Schwestern, mich und einen jüngeren Bruder. Die Hälfte der Personen lächelt, die andere Hälfte nicht. Ich mag es.
Was meine Familie angeht: Meine Mutter ist eine von jenen knallharten Weibern, die man nicht einmal mit einer Axt um die Ecke bringen könnte. Außerdem flucht sie in letzter Zeit ausgiebig, aber davon später mehr.
Wie ich schon sagte, mein Vater starb vor sechs Monaten. Er war ein einsamer, freundlicher, stiller, versoffener Verlierer. Ich könnte zwar sagen, dass das Leben mit meiner Mutter nicht einfach war und sie ihn in den Suff trieb, aber in Wirklichkeit gibt es keine Entschuldigung dafür. Man kann Ausreden finden, aber man glaubt nicht daran. Er war Möbelpacker. Er starb in einem alten Ohrensessel, der immer noch im Möbelwagen stand. Dort hat man ihn gefunden. Er saß einfach nur da, entspannt und tot. Der Möbelwagen war noch fast voll, heißt es. Die anderen haben gedacht, er hätte sich verzogen, weil er sich vor der Arbeit drücken wollte. Seine Leber hat versagt.
Mein Bruder Tommy hat das meiste in seinem Leben richtig gemacht. Er ist ein Jahr jünger als ich und geht wie gesagt an die Uni.
Meine Schwestern heißen Leigh und Katherine.
Als Katherine mit siebzehn schwanger wurde, habe ich geweint. Damals war ich zwölf. Kurz darauf ist sie ausgezogen. Sie wurde nicht aus dem Haus getrieben oder so etwas in der Art. Sie zog aus und heiratete. Das war eine ziemlich große Angelegenheit.
Ein Jahr später, als Leigh das Haus verließ, gab es keine Probleme.
Sie war nicht schwanger.
Ich bin der Einzige, der noch in unserer Heimatstadt lebt. Die anderen sind alle in die Großstadt gezogen. Besonders Tommy geht es gut. Er ist auf dem besten Weg, Anwalt zu werden. Ich wünsche ihm Glück. Das meine ich ganz ernst.
Neben dem Foto meiner Familie auf dem Fernseher steht ein Bild von Audrey, Marv, Ritchie und mir. Wir haben es letztes Jahr an Weihnachten per Selbstauslöser mit Audreys Fotoapparat geschossen und da sind wir nun. Marv mit seiner Zigarre. Ritchie halb lächelnd. Audrey lachend. Und ich mit meinen Karten in der Hand, dem beschissensten Blatt, das je ein Kartenspieler an Weihnachten aufgenommen hat.
Ich koche.
Ich esse.
Ich wasche meine Wäsche, aber bügele sie nur selten.
Ich lebe in der Vergangenheit und halte Cindy Crawford für das beste Fotomodell aller Zeiten.
Das ist mein Leben.
Ich habe dunkle Haare, leicht gebräunte Haut, kaffeebraune Augen. Meine Muskulatur ist ziemlich normal. Ich sollte mich aufrechter halten, aber ich tue es nicht. Ich stehe immer mit den Händen in den Hosentaschen da. Meine Stiefel fallen auseinander, aber ich trage sie trotzdem, weil ich sie liebe und schätze.
Ziemlich oft ziehe ich diese Stiefel an und gehe nach draußen. Manchmal gehe ich zum Fluss, der durch unsere Stadt fließt, oder ich gehe auf dem Friedhof spazieren und besuche dort meinen Vater. Der Türsteher begleitet mich, wenn er zufällig mal wach ist.
Am liebsten laufe ich mit den Händen in den Hosentaschen und dem Türsteher an meiner Seite herum und stelle mir vor, dass Audrey auf der anderen Seite neben mir geht.
Ich sehe uns immer nur von hinten.
Die Dämmerung wandelt sich in Dunkelheit.
Da geht Audrey.
Da geht der Türsteher.
Da gehe ich.
Und ich halte Audreys Hand in meiner.
Noch habe ich keinen Song von der Klasse eines Bob Dylan geschrieben oder meine ersten surrealistischen Versuche auf die Leinwand gebannt, und ich bezweifle, dass ich je in der Lage sein werde, eine Revolution anzuzetteln, selbst wenn ich es versuchen würde, denn abgesehen von allem anderen tauge ich zu so etwas überhaupt nicht, obwohl ich schlank und wendig bin. Und schwach.
Ich glaube, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich Karten spiele oder wenn ich jemanden irgendwo abgesetzt habe – vielleicht in der Großstadt oder noch weiter im Norden – und wieder auf dem Heimweg bin. Das Seitenfenster ist runtergekurbelt, der Wind fährt mir mit schmalen Fingern durchs Haar und ich grinse den Horizont an.
Dann fahre ich auf den Parkplatz des Taxiunternehmens.
Manchmal hasse ich den Knall, mit dem die Autotür ins Schloss fällt.
Ich habe es, glaube ich, schon erwähnt: Ich bin schrecklich in Audrey verliebt.
Audrey, die schon mit einer Unmenge Männern Sex hatte, aber noch nie mit mir. Sie sagt immer, dass sie mich zu sehr mag, um es mit mir zu machen, und ehrlich gesagt habe ich noch nie den Versuch unternommen, sie nackt und fremd und zitternd in mein Bett zu kriegen. Ich habe zu viel Angst. Ich hab ja schon erzählt, dass ich in Sachen Sex nicht viel vorzuweisen habe. Ich hatte ein, zwei Freundinnen und die haben mir in dieser Beziehung keine Bestnoten gegeben. Eine sagte mir, ich wäre der ungeschickteste Typ, der ihr je untergekommen ist. Die andere fing jedes Mal an zu lachen, wenn ich sie anfasste, was meinem Selbstbewusstsein nicht gerade zuträglich war. Sie hat mir ziemlich schnell den Laufpass gegeben. Kein Wunder.
Ich persönlich finde, dass Sex wie Mathe sein sollte.
In der Schule.
Keinen kümmert es, wenn er in Mathe ein Versager ist. Man brüstet sich sogar damit. Man sagt jedem, der es hören will: »Klar, Bio und Englisch sind ganz okay, aber in Mathe bin ich die Vollniete!« Und die anderen lachen und sagen: »Geht mir nicht anders. Diesen ganzen Logarithmusscheiß kapier ich im Leben nicht.«
Genau das Gleiche sollte man zum Thema Sex sagen können.
Man sollte stolz verkünden dürfen: »Diesen ganzen Orgasmusscheiß kapier ich im Leben nicht, echt jetzt. Alles andere ist ja ganz okay, aber in dieser Beziehung habe ich keinen blassen Schimmer.«
Aber das sagt niemand.
Das kann man nicht sagen.
Besonders als Mann nicht.
Wir Männer glauben, dass wir beim Sex gut sein müssen, aber ich stelle mich jetzt vor dich hin und sage, dass ich es nicht bin. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich davon überzeugt bin, dass auch meine Fähigkeiten im Küssen ziemlich zu wünschen übrig lassen. Eine von den beiden Freundinnen hat versucht, es mir beizubringen, aber irgendwann aufgegeben. Offenbar ist meine Zungenfertigkeit einfach hoffnungslos, aber was soll ich machen?
Es ist doch nur Sex.
Das sage ich mir immer wieder.
Ich lüge ziemlich oft.
Um auf Audrey zurückzukommen: Ich sollte mich wirklich geschmeichelt fühlen, dass sie mich nicht mal anfassen will, weil sie mich mehr mag als jeden anderen sonst. Ich finde das jedenfalls völlig nachvollziehbar.
Wenn sie mal schlecht drauf ist oder deprimiert, dann sehe ich ihren Schatten im Fenster meiner Hütte auftauchen. Sie kommt rein und wir trinken ein Bier oder ein Glas Wein oder schauen uns einen Film an oder alles drei. Einen alten, ellenlangen Film wie »Ben Hur«, der bis tief in die Nacht läuft. Dann sitzt sie neben mir auf dem Sofa in ihrem Flanellhemd und in Jeans, die sie kurz oberhalb der Knie abgeschnitten hat. Wenn sie eingeschlafen ist, hole ich eine Decke und kuschle sie ein.
Ich küsse sie auf die Wange.
Ich streiche ihr übers Haar.
Ich denke daran, dass sie allein lebt, genauso wie ich, und dass sie nie eine richtige Familie hatte und ständig mit Männern ins Bett geht. Dass sich die Liebe bei ihr einschleicht, lässt sie nicht zu.
Ich glaube, sie hatte einmal eine Familie, aber vermutlich war es eine, in der jeder jeden verprügelt hat. Davon gibt es hier in der Gegend jede Menge. Ich glaube, sie hat ihre Familie geliebt, aber die haben ihr nur wehgetan.
Das ist der Grund, warum sie nicht lieben will.
Niemanden.
Wahrscheinlich denkt sie, dass sie so besser dran ist, und wer kann es ihr verdenken?
Wenn sie auf meinem Sofa schläft, denke ich über all diese Dinge nach. Jedes Mal. Ich decke sie zu, gehe ins Bett und träume.
Mit offenen Augen.
Das Karo-Ass
Die Zeitungen bringen wirklich ein paar Berichte über den Banküberfall. Darin steht, dass ich den Typen gejagt und ihm dann während eines Kampfes die Waffe entrissen hätte. Typisch. Ich hätte darauf wetten können, dass sie die Sache aufbauschen.
Ich sitze am Küchentisch und lese ein paar von den Artikeln und der Türsteher schaut mich an wie immer. Ihn juckt es überhaupt nicht, ob ich ein Held bin. Solange er pünktlich sein Abendessen bekommt, ist die Welt für ihn in Ordnung.
Meine Mutter kommt vorbei und ich mache ihr ein Bier auf. Sie ist stolz auf mich, sagt sie. Ihrer Meinung nach haben es all ihre Kinder zu etwas gebracht, bis auf mich, aber jetzt kann sie auch von mir mit glänzenden Augen sprechen, wenigstens ein paar Tage lang.
Ich stelle mir vor, wie sie die Leute auf der Straße anspricht: »Das war mein Sohn. Ich hab euch ja immer gesagt, dass aus ihm eines Tages noch was wird.«
Natürlich kommt auch Marv vorbei und dann noch Ritchie.
Selbst Audrey stattet mir mit der Zeitung unter dem Arm einen Besuch ab.
In jedem Artikel steht, dass ich der zwanzigjährige Taxifahrer Ed Kennedy wäre, weil ich jeden einzelnen Reporter angelogen habe, was mein Alter angeht. Wenn man einmal anfängt zu lügen, muss man auch dabei bleiben. Regel Nummer eins.
Mein verblüfftes Gesicht klebt auf den Titelseiten der Zeitungen und sogar ein Mann vom Radio klopft bei mir an und nimmt ein Interview mit mir auf. Wir sitzen im Wohnzimmer und trinken Kaffee, allerdings ohne Milch. Ich wollte gerade welche einkaufen gehen, als er vor der Tür stand.
Am Dienstagabend komme ich von der Arbeit heim und hole die Post aus dem Briefkasten. Zwischen der Strom- und der Gasrechnung und ein paar Werbeblättchen steckt ein kleiner Umschlag. Ich werfe ihn mit dem ganzen Stapel auf den Tisch und vergesse ihn. Auf dem Umschlag steht mein Name hingekritzelt, und ich frage mich, was wohl drinsteckt. Immer wieder, auch als ich mir ein Steak-Sandwich mit Salat mache, denke ich, dass ich unbedingt ins Wohnzimmer gehen und nachschauen muss. Und ständig vergesse ich es wieder.
Es ist schon ziemlich spät, als ich endlich dazu komme.
Ich fühle es.
Ich fühle etwas.
Etwas strömt zwischen meinen Fingern hindurch, während ich den Umschlag in meinen Händen halte und ihn schließlich aufreiße. Die Nacht ist kühl, typisch für den Frühling.
Ich erschauere.
Ich sehe mein Spiegelbild im schwarzen Bildschirm des Fernsehers und in dem Foto meiner Familie.
Der Türsteher schnarcht.
Die Brise vor der Tür kommt näher.
Der Kühlschrank summt.
Einen Moment lang habe ich den Eindruck, als stünde alles still, als ich in den Umschlag greife und eine alte Spielkarte herausziehe.
Es ist das Karo-Ass.
Ich sitze im Schimmer der Wohnzimmerlampe und halte die Karte vorsichtig zwischen den Fingern, als ob sie zerbrechen oder in meinen Händen zu Staub zerfallen könnte. Auf der Karte stehen drei Adressen, geschrieben mit derselben krakeligen Handschrift wie mein Name auf dem Umschlag. Ich lese sie langsam, aufmerksam. Ein Schauder überzieht meine Hände. Er bahnt sich seinen Weg in mein Inneres und wandert weiter, nagt leise an meinen Gedanken. Ich lese die Adressen noch einmal:
Edgar Street 45, Mitternacht
Harrison Avenue 13, 18 Uhr
Macedoni Street 6, 5.30 Uhr morgens
Ich öffne den Vorhang und schaue hinaus.
Nichts.
Ich schiebe mich am Türsteher vorbei und gehe auf die Veranda.
»Hallo?«, rufe ich.
Aber wieder – nichts.
Die Brise wendet sich ab, als sei es ihr peinlich, gelauscht zu haben. Und ich bleibe allein vor meiner Hütte stehen. Ich habe immer noch die Karte in der Hand. Ich kenne die Adressen nicht, jedenfalls nicht direkt. Ich weiß zwar, wo die Straßen sind, habe aber keine Ahnung, welche Häuser gemeint sind.
Das ist zweifellos das Seltsamste, was mir je passiert ist.
Wer würde mir so etwas schicken?, frage ich mich. Was habe ich angestellt, dass mir jemand eine alte Spielkarte in den Briefkasten steckt, auf der fremde Adressen geschrieben stehen? Ich gehe wieder rein und setze mich an den Küchentisch. Ich versuche herauszufinden, was los ist und wer mir diese merkwürdige, unheimliche Post beschert hat. Etliche Gesichter wirbeln in meinem Kopf umher.
War es Audrey?, überlege ich. Marv? Ritchie? Ma? Ich habe keine Ahnung.
Etwas in meinem Herzen rät mir, die Karte wegzuwerfen, in den Müll zu befördern und die ganze Sache zu vergessen. Aber aus irgendeinem Grund fühle ich mich bereits schuldig, dass ich so etwas überhaupt in Erwägung ziehe.
Vielleicht ist es Schicksal, denke ich.
Der Türsteher trottet zu mir und schnüffelt an der Karte.
So ein Mist, kann ich in seinen Augen lesen, ich dachte, es wär was zu fressen. Nachdem er noch einmal kurz geschnüffelt hat, hält er einen Moment inne und überlegt, was er als Nächstes tun könnte. Wie immer trottet er zurück zur Tür, dreht sich einmal um die eigene Achse und legt sich dann hin. Er macht es sich in seinem schwarzgoldenen Fell bequem. Seine großen Augen glänzen und Dunkelheit steigt in ihnen auf. Seine Pfoten liegen breit auf dem alten, dreckstarrenden Teppich.
Er glotzt mich an.
Ich glotze zurück.
Was?, sehe ich in seinen Augen. Was zum Teufel willst du?
Nichts.
Gut.
Prima.
Und dabei belassen wir es.
Es ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass ich noch immer das Karo-Ass in meiner Hand halte. Ratlos.
Ruf jemanden an, sage ich zu mir.
Das Telefon ist schneller als ich. Es klingelt. Vielleicht ist dies die Antwort, auf die ich gewartet habe.
Ich nehme den Hörer ab und presse ihn gegen mein Ohr. Es tut fast ein bisschen weh, aber ich lausche dennoch angestrengt. Leider ist es meine Mutter.
»Ed?«
Diese Stimme würde ich überall erkennen. Außerdem brüllt diese Frau so sehr ins Telefon, dass sie es eigentlich gar nicht braucht. Sie könnte sich auch einfach an den Straßenrand stellen und ein Gespräch mit dem anderen Ende der Stadt führen.
»Ja, hallo, liebste Mutter!«
»Fang bloß nicht so an, du kleiner Scheißer.« Klasse. »Hast du nicht was vergessen?«
Ich denke nach, versuche, mich zu erinnern. Aber weder Gedanken noch Erinnerungen tauchen auf. Alles, was ich sehen kann, ist die Karte, die ich in meiner Hand hin und her drehe. »Ich wüsste nicht, was.«
»Typisch!« Sie klingt jetzt ein bisschen angespannt. Verärgert, gelinde gesagt. »Du hättest mir heute den Beistelltisch aus dem Möbelladen holen sollen, Ed.« Sie spuckt die Worte durch die Leitung. Laut und nass klatschen sie mir ins Ohr. »Du Volltrottel.« Ist sie nicht süß?
Wie ich vorhin schon angedeutet habe, ist meine Mutter dem Fluchen zugeneigt. Sie flucht den lieben langen Tag, von morgens bis abends, egal ob sie sich glücklich, traurig, gleichgültig oder sonst wie fühlt. Natürlich gibt sie die Schuld dafür meinem Bruder Tommy und mir. Sie sagt, dass wir als Kinder ständig geflucht hätten, wenn wir im Garten Fußball gespielt haben.
»Ich hab’s aufgegeben, es euch abgewöhnen zu wollen«, erzählt sie mir immer. »Und da dachte ich mir: Wenn du sie nicht unterkriegen kannst, mach einfach mit.«
Wenn ich mit ihr ein Gespräch führen kann, ohne dass sie mich auch nur einmal Trottel oder Wichser nennt, ist das ein Ereignis, das rot im Kalender angestrichen werden muss. Das Schlimmste daran ist der Nachdruck, mit dem sie ihre Flüche ausspricht. Immer wenn sie mich mit einem Schimpfwort bedenkt, spuckt sie es von den Lippen und schlägt es mir förmlich um die Ohren.
Sie wettert immer noch, obwohl ich nicht zugehört habe.
Ich schalte meine Lauscher wieder ein.
»… und was soll ich machen, wenn morgen früh Mrs Faulkner zum Frühstück rüberkommt, Ed? Soll ich ihr sagen, dass sie ihren Becher auf dem Boden abstellen kann?«
»Sag einfach, dass es meine Schuld ist, Ma.«
»Darauf kannst du Gift nehmen«, kläfft sie. »Ich sage ihr einfach, dass der verblödete Ed vergessen hat, meinen Beistelltisch abzuholen.«
Der verblödete Ed.
Ich hasse es, wenn sie mich so nennt.
»Alles klar, Ma.«
Sie macht noch eine Weile weiter und ich kehre in Gedanken wieder zu dem Karo-Ass zurück. Es schimmert in meiner Hand.
Ich berühre es.
Halte es.
Ich lächle.
Es an.
Von dieser Karte geht eine Aura aus und sie ist mir zugedacht. Nicht dem verblödeten Ed. Mir – dem wahren
cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
1. Auflage 2006
© 2006 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2002 by Markus Zusak
Die australische Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel
»The Messenger« bei Pan Macmillan Australia Pty Ltd., Sydney.
Übersetzung: Alexandra Ernst
Umschlaggestaltung: init.büro für gestaltung, Bielefeld lf · Herstellung: WM
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN: 978-3-641-03 416-0
www.cbj-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe