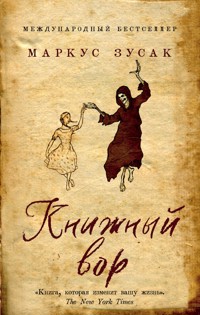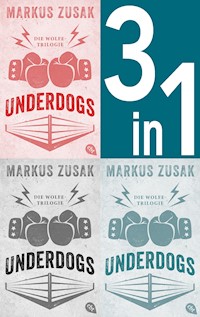
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Wolfe-Trilogie von Markus Zusak – zum ersten Mal auf Deutsch in einem Band!
Cameron und Ruben Wolfe leben am Rand der Stadt, in einer Welt der Hunderennen und illegalen Boxkämpfe. Sie sind Weltmeister darin, in eine Schlägerei zu geraten, unausgegorene Ideen zu haben und ganz allgemein sowohl Mädchen als auch ihre Eltern und die viel erfolgreicheren älteren Geschwister zu enttäuschen. Die beiden halten immer zusammen, Brüder in guten und schlechten Zeiten. Aber als sich Cameron Hals über Kopf in Rubens Freundin verliebt, wird die Stärke ihrer Beziehung auf eine Zerreißprobe gestellt.
Diese Ausgabe enthält alle drei Wolfe-Romane: Underdog, Vorstadtfighter und When Dogs Cry.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
© Hugh Stewart
DER AUTOR
Der Bestsellerautor Markus Zusak hat sechs Romane geschrieben, darunter »Die Bücherdiebin« und »Der Joker«. Seine von Publikum und Presse gleichermaßen gefeierten Bücher sind in mehr als vierzig Sprachen übersetzt. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Sydney.
Weitere Informationen zum Autor unter www.markuszusak.com
@Markus_Zusak
/markuszusak
@markuszusak
Tumblr: http://www.zusakbooks.com
Mehr über cbj auf Instagram unter @hey_reader
Markus Zusak
Underdogs
Die Wolfe-Trilogie
Underdog • Vorstadtfighter • When Dogs Cry
Aus dem australischen Englisch von Alexandra Ernst (Underdog, When Dogs Cry) und Ulrich Plenzdorf (Vorstadtfighter)
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Underdog
© 1999 by Markus Zusak
Die australische Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel »The Underdog« bei Omnibus Books in der Verlagsgruppe Scholastic Australia Pty Limited, Sydney.
Diese Ausgabe wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Übersetzung: Alexandra Ernst
Vorstadtfighter
© 2000 by Markus Zusak
Die australische Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Fighting Ruben Wolfe« bei Omnibus Books in der Verlagsgruppe Scholastic Australia Pty Limited, Sydney.
Diese Ausgabe wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Übersetzung: Ulrich Plenzdorf
When Dogs Cry
© 2001 by Markus Zusak
Die australische Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »When Dogs Cry« bei PanMacmillan Australia Pty Limited, Sydney
Übersetzung: Alexandra Ernst © 2019 für diese deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst und Ulrich Plenzdorf
Covergestaltung: Suse Kopp, Hamburg
Covermotive: © iStockphoto (serazetdinov); Getty Images (Barein)
kk · Herstellung: eR
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24243-5 V002 www.cbj-verlag.de
1 Underdog
Aus dem australischen Englischvon Alexandra Ernst
1
Wir saßen gerade vor der Glotze, als wir beschlossen, den Zahnarzt auszurauben.
»Den Zahnarzt?«, fragte ich meinen Bruder.
»Klar, warum nicht?«, erwiderte er. »Hast du eine Ahnung, wie viel Geld so ein Zahnarzt am Tag verdient? Das ist schon fast pervers. Wenn der Premierminister ein Zahnarzt wäre, hätte der Staat keine Probleme, das kannst du mir glauben. Es gäbe keine Arbeitslosigkeit, keinen Rassismus und keine Diskriminierung. Nur einen Haufen Geld.«
»Klar, warum nicht?«, erwiderte er. »Hast du eine Ahnung, wie viel Geld so ein Zahnarzt am Tag verdient? Das ist schon fast pervers. Wenn der Premierminister ein Zahnarzt wäre, hätte der Staat keine Probleme, das kannst du mir glauben. Es gäbe keine Arbeitslosigkeit, keinen Rassismus und keine Diskriminierung. Nur einen Haufen Geld.«
»Ja.«
Ich stimmte meinem Bruder Ruben nur zu, um ihn glücklich zu machen. Dabei spielte er sich mal wieder maßlos auf. Das war einer seiner schlimmsten Fehler.
Der Überfall war eine Tatsache. Aber es gab noch eine zweite.
Die zweite Tatsache war, dass wir zwar beschlossen hatten, unserem Zahnarzt eins über den Schädel zu ziehen und ihn auszurauben, dass wir es aber niemals tun würden. Bislang hatten wir in diesem Jahr schon die Bäckerei überfallen wollen, den Obst- und Gemüseladen, das Haushaltswarengeschäft, die Imbissbude und den Optiker. Nichts davon ist jemals wahr geworden.
»Und diesmal meine ich es ernst.« Rube beugte sich vor. Er muss mir angesehen haben, was ich dachte.
Wir würden niemanden ausrauben.
Wir waren hoffnungslos.
Hoffnungslos, bemitleidenswert und zum Kopfschütteln erbärmlich.
Ich war gerade aus meinem Job, bei dem ich zweimal in der Woche Zeitungen ausgetragen hatte, gefeuert worden, nachdem ich ein Küchenfenster eingeschlagen hatte. Es war nicht einmal ein besonders harter Wurf gewesen. Es passierte einfach. Das Fenster stand halb offen, ich warf die Zeitung, und krach! Das Ding flog durch das Glas. Der Typ kam aus dem Haus gerannt und schäumte vor Wut. Er hat mich mit den wüstesten Beschimpfungen überschüttet, während ich nur dastand mit diesen blöden Tränen in den Augen. Den Job war ich los. Ich hätte es wissen müssen – ich kann nichts richtig machen.
Mein Name ist Cameron Wolfe.
Ich wohne in der Stadt.
Ich gehe in die Schule.
Ich bin nicht beliebt bei den Mädchen.
Ich bin eigentlich ganz clever.
Ich bin eigentlich gar nicht clever.
Ich habe dickes, pelziges Haar, das zwar nicht besonders lang ist, aber immer unordentlich aussieht und ständig in alle Richtungen absteht, egal wie sehr ich mich auch bemühe, es glatt zu bürsten.
Mein älterer Bruder Ruben bringt mich unentwegt in Schwierigkeiten.
Ich bringe Rube in mindestens ebenso viele Schwierigkeiten wie er mich.
Ich habe noch einen Bruder, Steve, der älteste von uns. Steve ist der Sonnenschein bei uns in der Familie. Er hatte schon ein paar Freundinnen und hat einen richtig guten Job. Er ist derjenige von uns, den die Leute mögen. Und zu allem Überfluss ist er auch noch ein ziemlich guter Rugbyspieler.
Ich habe auch eine Schwester namens Sarah, die ständig mit ihrem Freund auf dem Sofa sitzt und sich von ihm seine Zunge in den Hals stecken lässt, wann immer es irgend möglich ist. Sarah ist die Zweitälteste.
Ich habe einen Vater, der Rube und mir ständig sagt, dass wir uns waschen sollen, denn er hält uns für schmutzig und behauptet, dass wir wie wilde Tiere stinken würden, die sich im Schlamm gesuhlt hätten.
(»Ich stinke nicht, verdammt noch mal!«, schreie ich ihn an. »Und ich dusche mich regelmäßig, verdammt!«
»Hast du schon mal was von Seife gehört? … Ich war auch mal so alt wie du und ich weiß, wie dreckig Jungs in deinem Alter sind.«
»Ach, tatsächlich?«
»Aber sicher. Ansonsten würde ich es nicht sagen.«
Es hat keinen Sinn, mit ihm zu streiten.)
Ich habe eine Mutter, die sehr wenig sagt, aber dennoch das Härteste ist, was man bei uns im Haus finden kann.
Ich habe eine Familie, stimmt genau, eine Familie, die ohne Tomatensoße nicht funktionieren würde.
Ich mag den Winter.
Ja, also, das bin ich.
Oh, und ja, zu dem Zeitpunkt, an dem meine Geschichte hier beginnt, hatte ich noch niemals in meinem Leben irgendjemanden ausgeraubt oder irgendetwas gestohlen. Ich hatte lediglich mit Rube darüber geredet, genau wie an jenem Tag im Wohnzimmer.
»Hey!«
Rube gab Sarah, die auf dem Sofa saß und diesen Typ knutschte, einen Klaps auf den Arm.
»Hey – wir ziehen jetzt los und rauben den Zahnarzt aus.«
Sarah machte eine kurze Pause.
»Wie bitte?«, fragte sie verständnislos.
»Ach, vergiss es.« Rube wandte seinen Blick ab. »In diesem Haus kriegt man keine Unterstützung. Überall nur Ignoranten, die alle zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, um sich um andere zu kümmern.«
»Hör schon auf zu jammern«, sagte ich zu ihm.
Er schaute zu mir runter. Das war alles, was er tat. Sarah wandte sich wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung zu.
Ich schaltete den Fernseher aus und wir verließen das Haus. Wir wollten die Zahnarztpraxis ausspionieren, der wir später »einen Besuch abstatten wollten«, wie Rube das nannte. (Der wahre Grund, warum wir nicht länger zu Hause bleiben wollten, war, dass Sarah und ihr Macker es im Wohnzimmer immer toller trieben und unsere Mutter in der Küche Pilze kochte, deren Gestank die ganze Wohnung verpestete.)
»Schon wieder diese widerlichen Pilze«, brummte ich, während wir auf die Straße gingen.
»Ja.« Rube verzog das Gesicht. »Man muss sie einfach in Tomatensoße ertränken, dann schmeckt man sie nicht.«
»Verdammt richtig.«
Was für Jammerlappen, wir zwei!
»Und hier wären wir schon.« Rube lächelte und bog in die Main Street ein. Es war Juni und die Luft war winterlich düster. »Dr. med. dent. Thomas G. Edmunds, Zahnarzt. Perfekt.«
Wir begannen uns einen Plan zurechtzulegen.
Einen Plan auszuarbeiten, bedeutete, dass ich Fragen stellte und Rube sie beantwortete. Es lief folgendermaßen:
»Brauchen wir kein Gewehr oder so etwas? Oder ein Messer? Die Spielzeugpistole haben wir ja verloren.«
»Die ist nicht weg. Die liegt hinter dem Sofa.«
»Bist du sicher?
»Klar bin ich sicher. Außerdem brauchen wir die nicht. Alles, was wir brauchen, ist der Kricketschläger. Und wir können uns noch den Baseballschläger von nebenan leihen, oder etwa nicht?« Er lachte und es hörte sich sehr sarkastisch an. »Wir spielen ein bisschen mit diesen Holzklötzchen herum und sie können uns unmöglich etwas abschlagen.«
»Okay.«
Okay.
Klar, sicher.
Die Sache sollte am nächsten Nachmittag über die Bühne gehen. Wir organisierten die Schläger und gingen alles noch mal durch, was wir uns merken mussten. Wir wussten beide genau, dass wir es nicht tun würden. Sogar Rube wusste es.
Trotzdem gingen wir am nächsten Tag zum Zahnarzt. Und zum ersten Mal während unserer ganzen Pseudo-Räuberkarriere betraten wir tatsächlich den Schauplatz des geplanten Verbrechens.
Uns erwartete ein Schock, denn hinter dem Empfangstisch stand die wunderschönste Zahnarzthelferin der Welt. Ehrlich. Sie schrieb etwas mit ihrem Kuli auf und ich konnte meine Augen nicht von ihr abwenden. Der Baseballschläger, den ich in der Hand hielt, war vergessen. Es würde kein Überfall stattfinden. Wir standen einfach nur da, Rube und ich.
Rube und ich und die Zahnarzthelferin, alle zusammen in einem Zimmer.
»Ich bin gleich für Sie da«, sagte sie höflich, ohne aufzublicken. Guter Gott, war sie schön. Vollkommen. Herrlich.
»Hey«, flüsterte Rube ihr zu, ganz leise. Er wollte sicher sein, dass nur ich ihn hören konnte. »Hey … Das ist ein Überfall.«
Sie hörte nichts.
»Blöde Kuh, verdammt!« Er schaute mich an und schüttelte seinen Kopf. »Man kann heutzutage nicht einmal mehr einen Zahnarzt überfallen. Meine Güte! Was soll aus dieser Welt noch werden?«
»So, jetzt.« Endlich sah sie auf. »Was kann ich für euch Jungs tun?«
»Ähm …« Ich war mir nicht sicher, was ich sonst noch sagen sollte. Rube sagte gar nichts. Es herrschte Totenstille. Ich musste sie brechen. Ich lächelte und sackte in mich zusammen. »Ähm … wir wollten einen Termin vereinbaren.«
Sie lächelte zurück. »Wann wäre es euch recht?«
»Ähm … morgen?«
»Wäre vier Uhr in Ordnung?«
»Klar.« Ich nickte. Verwirrt.
Sie sah in mich hinein. Direkt in mich hinein. Abwartend. Hilfsbereit. »Ich brauche noch eure Namen.«
»Oh, sicher.« Ich lachte dümmlich. »Cameron und Ruben Wolfe.«
Sie schrieb die Namen mit ihrem Kuli auf, lächelte wieder und blickte dann fragend auf den Kricket- und den Baseballschläger.
»Oh, wir üben nur ein bisschen.« Ich hob den Baseballschläger an.
»Mitten im Winter?«
»Wir können uns keinen Fußball leisten«, warf Rube ein. Dabei besaßen wir einen Fußball und auch einen Rugbyball, die irgendwo in unserem Hinterhof herumlagen. Er schob mich in Richtung Ausgang. »Bis morgen dann.«
Sie grinste ihr fröhliches Freut-mich-dass-ich-helfen-konnte-Lächeln und sagte: »Okay. Tschau-tschau!«
Ich zögerte noch eine Sekunde und sagte dann: »Tschau!«
Tschau!
Fiel mir denn gar nichts Besseres ein?
»Du verdammter Idiot«, stöhnte Rube, als wir wieder draußen waren. »Wir hätten gerne einen Termin – so was!«, jaulte er. »Der Alte will zwar, dass wir nach Rosen duften, aber unsere Zähne sind dem doch scheißegal. Der kümmert sich einen Dreck um unsere Zähne.«
»Wer hat uns denn überhaupt da reingeschleppt? Wessen Idee war es denn, den Zahnarzt auszurauben? Meine jedenfalls nicht, Kumpel!«
»Okay, okay.« Rube lehnte sich an eine Hauswand. Der Verkehr rollte an uns vorbei.
»Und was zum Teufel sollte dieses Flüstern?«
Jetzt, wo er mit dem Rücken an der Wand stand, war ich entschlossen, ihn fertigzumachen. »Das Einzige, was du vergessen hast, war das kleine Wörtchen ›Bitte‹. Vielleicht hätte sie es dann gehört. Hey, das ist ein Überfall.« Ich äffte sein Flüstern nach. »Absolut erbärmlich.«
»Also gut«, fauchte Rube. »Ich hab’s vermasselt. Aber hast du vielleicht irgendwas gemacht? Deinen Baseballschläger geschwungen zum Beispiel?« Rube wurde jetzt wieder lauter, weil es nun darum ging, zu vergleichen, wer mehr Mist gebaut hatte. »Du hast rein gar nichts geschwungen, Bruder … Du warst viel zu beschäftigt, in Blondies große blaue Augen zu schmachten und ihre … ihre Brüste anzustarren.«
»Hab ich nicht!«
Brüste.
Das war doch wohl nicht sein Ernst.
So was zu sagen.
»Aber klar doch«, lachte Rube. »Ich hab’s doch genau gesehen, du schmutziges kleines Ferkel.«
»Nichts als Lügen.« Aber das stimmte nicht. Während wir die Main Street entlangschlenderten, wurde mir klar, dass ich in die wunderschöne blonde Zahnarzthelferin verliebt war. Ich stellte mir bereits vor, ich läge auf dem Behandlungsstuhl und sie säße auf meinem Schoß.
»Liegst du auch bequem, Cameron?«, würde sie fragen. »Fühlst du dich gut?«
»Großartig«, würde ich antworten. »Einfach großartig.«
»Hmmm.«
»Hey!« Rube stieß mich an. »Hörst du mir noch zu?«
Ich wandte ihm den Rücken zu. Er redete immer noch.
»Und kannst du mir vielleicht mal sagen, wo wir das Geld für die Untersuchung hernehmen sollen, he?« Er dachte einen Moment lang nach, während wir wieder lostrabten und jetzt schneller liefen, um nach Hause zu kommen. »Wir sagen am besten ab.«
»Nein«, entgegnete ich. »Kommt nicht infrage, Rube.«
»Schmutzfink«, höhnte er. »Vergiss doch die Schwester. Sie treibt’s wahrscheinlich gerade mit dem Herrn Doktor, während wir uns hier unterhalten.«
»Hör auf, so über sie zu reden«, warnte ich ihn.
Rube blieb wieder stehen.
Dann starrte er mich an.
Und dann sagte er: »Du bist einfach jämmerlich, weißt du das?«
»Ich weiß.« Mir blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen. »Wahrscheinlich hast du recht.«
»Wie immer.«
Wir gingen weiter. Mal wieder.
Mit eingekniffenem Schwanz.
Alle beide.
Und übrigens: Wir haben nicht abgesagt.
Wir überlegten zunächst, ob wir unsere Eltern um das Geld bitten sollten, aber sie hätten nur wissen wollen, warum wir überhaupt dorthin gegangen waren, und über diesen Punkt wollten wir doch lieber Stillschweigen bewahren.
Ich selbst nahm das Geld, das ich für meine Untersuchung brauchte, von meinem Ersparten, das unter der ausgefransten Ecke des Teppichs in unserem Zimmer lag.
Wir gingen wieder hin.
Ich gab mir alle Mühe, meine Haare glattzubekommen. Für die Zahnarzthelferin.
Wir gingen am nächsten Tag wieder hin.
Es klappte nicht – mit dem Haar.
Wir gingen am nächsten Tag wieder hin, und da stand eine Schreckschraube von einer Zahnarzthelferin, die ungefähr vierzig Jahre alt war.
»Na, die ist doch bestimmt deine Kragenweite, oder?«, flüsterte mir Rube im Wartezimmer zu. Er grinste wie der hundsgemeine Teenager, der er immer gewesen war. Er widerte mich an, aber auf der anderen Seite widerte ich mich oft auch selbst an.
»Hey!«, sagte ich zu ihm und zeigte mit dem Finger. »Ich glaube, du hast da was zwischen deinen Zähnen.«
»Wo?«, fragte er panisch. »Hier?« Er öffnete seinen Mund und verzog seine Lippen zu einem breiten Clownsgrinsen. »Ist es weg?«
»Nee – weiter nach rechts. Da drüben.« Da war natürlich nichts, und als er sein Spiegelbild in dem Aquarium betrachtet hatte, das in der Ecke des Zimmers stand, und sich selbst davon überzeugt hatte, dass nichts mit seinen Zähnen war, kam er zu mir zurück und gab mir einen Schlag auf den Hinterkopf.
»Ha.« Er ließ sich einfach nicht ablenken. »Du Ferkel!« Er kicherte. »Aber ich muss schon zugeben, gestern, die war gut. Die war große Klasse.«
»Hmmm.«
»Nicht so wie die fette Alte da draußen, was?«
Ich lachte. Jungs wie wir – Jungs im Allgemeinen – müssen einfach der Abschaum der Erde sein. Meistens jedenfalls. Ich schwöre es, wir verbrachten die meiste Zeit damit, einfach unmenschlich und widerlich zu sein.
Wir brauchten einen ordentlichen Tritt in den Hintern, wie mein Alter immer sagt (der uns damit auch reichlich versorgt).
Er hat recht.
Die Schwester kam herein. »Also, wer geht als Erstes?«
Stille.
Dann: »Ich.«
Ich stand auf. Ich hatte beschlossen, die ganze Sache so schnell wie möglich hinter mich zu bringen.
Am Ende war es gar nicht so schlimm. Ich musste mir nur den Mund mit einer eklig schmeckenden Lösung ausspülen und dann hat der große Meister mir noch ein bisschen an den Zähnen herumgekratzt. Kein Bohrer. Nicht für uns. Es gibt keine Gerechtigkeit auf der Welt.
Oder vielleicht doch?
Es war nämlich zum Schluss der Zahnarzt, der uns ausraubte. Er war enorm teuer, gerade für das bisschen Arbeit, das er mit uns hatte.
»Das schöne Geld«, sagte ich, nachdem wir wieder draußen waren.
»Immerhin«, sagte Rube, der sich diesmal offensichtlich entschlossen hatte, die Sache von der positiven Seite aus zu betrachten. »Er hat gar nicht gebohrt.« Er boxte mich in die Schulter. »Kommt wahrscheinlich daher, dass es bei uns keine Süßigkeiten gibt. Zu irgendwas muss es ja gut sein. Und scheinbar ist es gut für die Beißer. Unsere Mum ist ein Genie.«
»Quatsch«, widersprach ich ihm. »Sie ist einfach nur streng.«
Wir lachten, aber wir wussten beide, wie toll unsere Mutter war.
Es war unser Vater, der uns Sorgen bereitete.
Zu Hause war es todlangweilig, wie üblich. Im ganzen Haus roch es nach den Pilzen vom Vortag, die auf dem Herd aufgewärmt wurden. Sarah war wieder auf dem Sofa zugange. Das Wohnzimmer war also so gut wie besetzt.
Ich ging in das Zimmer, das ich mit Rube teilte, und schaute aus dem Fenster auf die Stadt, die ihren schmutzigen Atem bis zum Horizont blies. Dahinter schimmerte blassgelb die Sonne und die Gebäude sahen aus wie die Pranken eines riesigen schwarzen Tieres, das sich niedergelegt hatte.
Es war mitten im Juni und das Wetter wurde langsam richtig mies.
Eigentlich glaube ich nicht, dass in dieser Geschichte besonders viel passiert. Nein, eigentlich passiert nicht viel. Es ist nur ein Bericht, wie die Dinge in meinem Leben während dieses letzten Winters standen.
Klar sind Sachen passiert, aber eben nichts Außergewöhnliches. Ich habe meinen Job nicht wiederbekommen. Mein Vater hat mir eine Chance gegeben. Mein älterer Bruder Steve hat sich den Knöchel verstaucht, mich beschimpft und schließlich sogar etwas begriffen. Meine Mutter hat einen Boxwettkampf in unserer Schule veranstaltet und ist eines Nachts ausgerastet und hat mir den Biomüll vor die Füße gekippt. Meine Schwester Sarah wurde sitzen gelassen. Rube hat sich einen Bart wachsen lassen und ist endlich ein bisschen aufgewacht. Greg, ein Typ, der früher mal mein bester Freund war, hat sich dreihundert Mäuse von mir geliehen. Damit habe ich ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich habe ein Mädchen kennengelernt und mich verliebt (aber zu der Zeit hätte ich mich in alles verliebt, was nur das geringste Interesse geheuchelt hätte). Ich träumte jede Menge abgedrehtes, krankes und perverses Zeug. Manchmal hatte ich auch schöne Träume. Und ich habe überlebt.
Es ist wirklich nicht viel passiert.
Alles war ziemlich normal.
Erster Traum
Es ist später Nachmittag und ich gehe zum Zahnarzt. Da sehe ich jemanden auf dem Dach stehen. Als ich näher komme, erkenne ich den Zahnarzt selbst. Ich kann seinen weißen Kittel und den Schnurrbart erkennen. Er steht direkt am Rand und scheint entschlossen zu sein, sich im nächsten Moment herabzustürzen.
Ich halte direkt unter ihm an und brülle hinauf: »He! Was zum Teufel machen Sie da?«
»Wie sieht es denn aus?«
Diese Antwort macht mich sprachlos.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als in die Passage zu rennen, wo sich die Zahnarztpraxis befindet. Ich gehe hinein und sage der schönen Zahnarzthelferin Bescheid.
»Was?«, schreit sie auf.
Mein Gott, sie sieht so großartig aus, dass ich fast zu ihr sage: »Zum Teufel mit dem feinen Herrn Doktor, lass uns an den Strand gehen oder irgendwo anders hin.« Aber ich sage nichts dergleichen. Ich renne nur den Flur entlang, öffne die Tür und haste die Treppe zum Dach empor.
Als ich am Rand des Dachs ankomme, merke ich, dass mir die Zahnarzthelferin aus irgendeinem Grund nicht gefolgt ist.
Ich trete direkt neben den nachdenklichen, schnurrbartgeschmückten Zahnarzt und schaue auf die Straße hinunter. Da steht sie und versucht ihn dazu zu überreden, nach unten zu kommen.
»Was machen Sie da unten?«, schreie ich ihr zu.
»Ich gehe da nicht rauf!«, schreit sie zurück. »Ich habe Höhenangst.«
Dieser Aussage ist nichts hinzuzufügen. Außerdem ist es mir ganz recht, so kann ich nämlich ihre Beine und ihren Körper in aller Ruhe betrachten. Unter meiner Haut ziehen sich meine Bauchmuskeln zusammen.
»Kommen Sie schon, Tom.«
Sie versucht mit dem Zahnarzt zu verhandeln. »Kommen Sie runter. Bitte!«
»Sagen Sie mal, warum stehen Sie denn nun wirklich hier oben?«, frage ich ihn.
Er dreht sich zu mir um.
Seine Augen sind offen und ehrlich.
Dann sagt er: »Wegen dir.«
»Wegen mir? Was habe ich denn gemacht?«
»Ich habe dir zu viel berechnet.«
»Mann, Kumpel, das war aber nicht sehr nett«, sage ich. Dann regt sich meine sadistische Ader und ich füge hinzu: »Also los, springen Sie – Sie verdienen es nicht besser, Sie verdammter Halsabschneider.«
Auch die wunderschöne Zahnarzthelferin drängt ihn jetzt zu springen. »Kommen Sie schon, Tom!«, ruft sie laut. »Ich werde Sie auffangen.«
Und so geschieht es.
Nach unten.
Nach unten.
Er springt und fällt nach unten. Die wunderschöne Zahnarzthelferin fängt ihn auf, küsst ihn auf den Mund und stellt ihn vorsichtig auf die Füße. Sie hält ihn fest, presst ihren Körper an seinen. Oh, diese weiße Uniform, wie sie sich an ihm reibt. Sie macht mich wahnsinnig. Als sie mir zuruft, dass ich auch springen soll, denke ich keine Sekunde lang nach. Ich tue es und falle …
Ich wache auf. Ich liege im Bett mit dem Geschmack von Blut in meinem Mund und der frischen Erinnerung an den Asphalt unter mir und die Wucht, mit der mein Kopf aufgeschlagen ist.
2
Seit der Sache mit dem Zahnarzt hat sich meine finan-zielle Situation drastisch verschlechtert. Also bin ich auf Knien zu meinem alten Arbeitgeber gekrochen und habe gebettelt, dass er mir meinen Job wiedergibt. Der Typ im Zeitungsladen zeigte sich unbeeindruckt.
»Tut mir leid, Wolfe«, sagte er. »Du bist einfach ein zu großes Risiko. Du bist zu gefährlich.«
Nun hört euch den Kerl an! Man könnte ja glauben, dass ich mit einer abgesägten Schrotflinte in der Gegend herumlaufe oder so was Ähnliches. Verdammt noch mal, ich war nur ein Zeitungsjunge!
»Komm schon, Max«, flehte ich. »Ich bin jetzt älter. Verantwortungsbewusster.«
»Wie alt bist du überhaupt?«
»Fünfzehn.«
»Na ja …« Er dachte angestrengt nach. Blickte auf, traf seine Entscheidung. »Nein.« Er schüttelte seinen Kopf. »Nein. Nein.« Aber ich hatte ihn jetzt, ganz bestimmt. Er hatte zu lange gezögert. Er hatte zu lange nachgedacht. »Fünfzehn ist schon viel zu alt.«
Zu alt!
Leute, es war ein mieses Gefühl, ein ausgedienter Zeitungsjunge zu sein, das könnt ihr mir glauben.
»Bitte!«, heulte ich. Es war zum Kotzen. All das Getue wegen eines lausigen Jobs, wo man Zeitungen austragen musste, während die anderen Typen bereits mit Hamburgern und den fettigen Hähnchenschenkeln von Kentucky Fried Chicken die große Kohle verdienten. Es war einfach demütigend. »Ach, komm schon, Max.« Plötzlich hatte ich eine Idee. »Wenn du mich nicht mehr einstellst, komm ich wieder, und wenn ich wiederkomme, habe ich dieselben Klamotten an wie jetzt (ich trug schmuddelige Trainingshosen, alte Schuhe und eine dreckige alte Bomberjacke) und dann bringe ich meinen Bruder und seine Kumpel mit und wir tun dann so, als wäre das hier eine öffentliche Bücherei. Wir machen keinen Ärger, Gott bewahre. Wir hängen bloß hier rum. Vielleicht stehlen die anderen was, aber ich glaub’s eigentlich nicht. Vielleicht nur ein oder zwei Magazine …«
Max kam einen Schritt näher.
»Drohst du mir etwa, du kleiner Wurm?«
»Jawohl, Sir, genau das tue ich.« Ich lächelte. Ich hatte das Gefühl, dass die Dinge richtig gut liefen.
Ich irrte mich.
Ich irrte mich, denn mein alter Boss Max packte mich am Kragen und entfernte mich von seinem Grund und Boden.
»Und lass dich ja nicht wieder hier blicken«, befahl er.
Ich stand da.
Ich schüttelte meinen Kopf.
Über mich selbst.
Ein Wurm.
Ein Wurm!
Völlig richtig.
Mein raffinierter Plan zur Wiederbeschaffung meines Jobs hatte sich als Schuss in den Ofen entpuppt. Ich spürte den rasenden Puls meiner Halsschlagader und schmeckte das Blut der letzten Nacht in meiner Kehle.
»Du Wurm«, verfluchte ich mich selbst. Im Schaufenster der Bäckerei nebenan betrachtete ich mein Spiegelbild und stellte mir vor, ich würde einen brandneuen, leichten blauen Anzug mit einem schwarzen Schlips tragen, dazu schwarze Schuhe und gut frisierte Haare. Die Wahrheit jedoch sah so aus, dass ich erbärmliche Klamotten anhatte und dass mein Haar schlimmer abstand als je zuvor. Ich schaute mich selbst in diesem Fenster an, ohne die Menschen um mich herum zu bemerken. Ich starrte und lächelte dieses besondere Lächeln. Ihr wisst schon, dieses Lächeln, das einen schier aus den Latschen haut und einem klipp und klar sagt, wie lächerlich und bemitleidenswert man doch ist. Genau dieses Lächeln lächelte ich jetzt.
»Ja«, sagte ich zu mir selbst. »Ja.«
Später schaute ich in die Zeitung – ich hatte Rube in den Zeitungsladen geschickt, um mir eine zu besorgen – und suchte nach einem neuen Job. Aber es war nichts zu kriegen. Die Zeiten waren hart. Alles war knapp. Jobs. Leute. Werte. Niemand war auf der Suche nach etwas oder jemand Neuem. Schließlich war ich so weit, dass ich mir sogar das Undenkbare vorstellen konnte: meinen Vater zu fragen, ob ich samstags bei ihm arbeiten durfte.
»Auf keinen Fall«, sagte er, als ich ihm die Sache vorschlug. »Ich bin Klempner und kein Zirkusclown und auch kein Tierwärter.« Er aß gerade sein Abendessen und hob jetzt sein Messer hoch. »Ja, wenn ich …«
»Ach komm schon, Dad. Ich kann dir helfen.«
Mum gab ihre Meinung zum Besten.
»Na los, Cliff. Gib dem Jungen eine Chance.«
Er seufzte, stöhnte fast.
Die Entscheidung fiel. »Okay«, sagte er und fuchtelte dabei mit seiner Gabel vor meiner Nase herum. »Aber ein einziger Fehlgriff, eine einzige dumme Bemerkung, und du bist draußen. Denk dran, du musst nur einmal Mist bauen …«
»Okay.«
Ich lächelte.
Ich lächelte Mum an, aber die aß ihr Abendessen.
Ich lächelte Mum und Rube und Sarah und sogar Steve an, aber sie alle aßen ihr Abendessen. Die Sache war erledigt und das Ganze berührte sie sowieso herzlich wenig. Alle außer mir.
Selbst noch am Samstag bei der Arbeit schien mein Vater nicht sonderlich von meiner Anwesenheit begeistert zu sein.
Das Erste, was ich machen musste, war, meine Hand in die Tiefen des Klos einer alten Frau zu stecken und all das Zeug zu entfernen, das den Abfluss verstopfte. Ehrlich, ich hätte fast in die Kloschüssel gekotzt.
»Ach du verdammte Scheiße!«, keuchte ich mit angehaltenem Atem. Mein Vater grinste nur.
»Willkommen in der Realität, mein Junge«, sagte er. Und zum letzten Mal an diesem Tag lächelte er. Den Rest der Zeit ließ er mich die ganze Drecksarbeit machen, wie zum Beispiel die Rohre vom Dachgepäckträger seines Transporters holen, einen Graben neben dem Haus ausheben, den Hauptzulauf auf- und zudrehen, seine Werkzeuge einsammeln und aufräumen. Am Ende des Tages gab er mir einen Zwanziger und sagte sogar Danke.
Er sagte: »Danke für deine Hilfe, Junge.«
Das hat mich umgehauen.
Glücklich.
»Obwohl du wirklich etwas langsam bist.« Die Spitze konnte er sich nicht verkneifen. »Und denk dran, dass du dich duschst, wenn wir zu Hause sind …«
Das Mittagessen war spaßig gewesen, denn wir saßen auf zwei umgedrehten Eimern in Dads Transporter und er ließ mich Zeitung lesen. Er nahm den Wochenendteil heraus und warf mir den Rest zu.
»Lies«, befahl er mir.
»Warum?«
»Weil du nichts lernst, wenn du nicht die Geduld hast, zu lesen. Die Glotze macht dumm. Sie stiehlt dir das Hirn.«
Also steckte ich ohne Widerspruch meine Nase in die Zeitung und las sie. Ich hätte gefeuert werden können, wenn ich mich geweigert hätte, seine Anordnung zu befolgen.
Aber das Wichtigste war, dass ich den Tag überlebte und meine Ersparnisse wieder um zwanzig Dollar aufstocken konnte.
»Nächsten Samstag?«, fragte ich Dad, als wir zu Hause ankamen.
Er nickte.
Ich konnte ja nicht ahnen, dass mich diese Arbeitssamstage vor die Füße eines Mädchens führen würden, das sogar noch besser war als die Zahnarzthelferin. Es sollte noch ein paar Wochen dauern, aber als es so weit war, konnte ich fühlen, wie sich tief in mir etwas umdrehte.
An diesem ersten Samstagabend trat ich durch unsere Haustür und war stolz auf mich selbst. Ich ging nach unten in den Keller in Steves Zimmer. Steve geht samstags immer aus. Ich drehte seine alte Stereoanlage auf und zappelte ein bisschen zur Musik herum. Ich sang mir selbst etwas vor, wie es jeder arme Wurm tut, der niemand anderen hat, dem er vorsingen kann, und ich tanzte etwa so gut wie ein Holzklotz. Aber das ist völlig egal, wenn niemand da ist, der zuschaut.
Dann stand Rube in der Tür, ohne dass ich es merkte.
Er schaute zu.
»Jämmerlich.« Seine laute Stimme erschreckte mich zu Tode.
Ich blieb stehen.
»Jämmerlich«, wiederholte er, schloss die Tür und kam langsam und bedächtig die alten, ausgetretenen Stufen herunter.
Mein Vater folgte ihm auf dem Fuße und sagte: »Ich hab euch was zu sagen, Jungs. Erstens: Das Essen ist fertig. Zweitens: Geht unter die Dusche. Drittens«, und er sah Rube dabei direkt an, »du – rasieren.« Ich warf Rube einen Blick zu und bemerkte, dass ihm ein leichter Flaum aus dem Gesicht wuchs. Er wurde gerade dicht und regelmäßig. »Und viertens: Wir werden uns heute Abend ›Zwei glorreiche Halunken‹ anschauen, und wenn jemand was anderes gucken will, hat er Pech gehabt. Der Fernseher ist belegt.«
»Schon in Ordnung«, versicherte Rube.
»Nur damit die Front klar ist.«
»Nur damit die Fronten klar sind«, verbesserte ich den Mann. Großer Fehler.
»Willst du Ärger, oder was?« Er hielt mir seinen ausgestreckten Zeigefinger entgegen und kam auf mich zu.
»Nein, bestimmt nicht.«
Er zog sich wieder zurück. »Dann ist ja gut. Also los dann, kommt zum Abendessen.« Als wir an ihm vorbeigingen, sagte er: »Vergesst nicht, euer alter Herr kann euch immer noch einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpassen, wenn ihr ’ne dicke Lippe riskiert.« Aber er lachte dabei. Glücklicherweise.
An der Tür sagte ich: »Vielleicht spare ich das Geld für eine Stereoanlage, so wie die von Steve. Vielleicht sogar eine bessere.«
Dad nickte. »Keine schlechte Idee.« Egal wie grob der Mann werden konnte, ich glaube, ihm gefiel, dass ich nie um etwas bat. Er merkte, dass ich mir die Dinge verdienen wollte.
Und das wollte ich wirklich.
Ich wollte nichts umsonst haben.
Nicht, dass es bei uns jemals etwas umsonst gegeben hätte.
Rube sprach.
Er fragte: »Wozu brauchst du denn eine Stereoanlage? Damit du in unserem Zimmer so jämmerlich herumstampfen kannst wie hier?«
Dad blieb stehen, schaute ihn an und schnippte ihn ans Ohr.
Er sagte: »Wenigstens will der Junge arbeiten, was mehr ist, als man von dir sagen kann.« Er drehte sich wieder um und sagte: »Jetzt aber ab zum Essen.«
Wir folgten unserem Vater nach oben und ich musste Sarah zum Essen aus ihrem Zimmer holen. Sie stand da gegen den Kleiderschrank gelehnt und war mit ihrem Freund gerade heftig bei der Sache.
Ich bin in einer Filmszene und habe ein Seil um den Hals geschlungen, weil ich gehängt werden soll. Ich sitze auf einem Pferd. Das Seil ist an einen dicken Ast geknotet. In einiger Entfernung sitzt mein Vater im Sattel und wartet mit einem Gewehr in den Händen.
Ich weiß, dass schon seit einiger Zeit ein Preis auf meinen Kopf ausgesetzt ist. Mein Vater und ich haben einen Trick ausgeheckt: Er liefert mich beim Sheriff ab, kassiert die Belohnung, und dann schießt er mich vom Seil ab, genau in dem Moment, in dem ich gehängt werden soll. Irgendwie werde ich dann fliehen und wir werden das ganze Spielchen in der nächsten Stadt wiederholen. Überall im Land.
Ich sitze da mit dem Seil um meinen Hals und habe all diese tollen Cowboyklamotten an. Der Sheriff oder Gesetzeshüter oder was immer er auch ist – er liest mir mein Todesurteil vor, und all die Tabak kauenden Farmer und Siedler jubeln und johlen, weil sie wissen, dass ich gleich sterben werde.
»Noch ein letztes Wort?«, werde ich gefragt, aber ich lache nur.
Dann sage ich, immer noch lachend: »Viel Glück«, und ich füge sarkastisch hinzu: »Gott segne euch.«
Der Schuss müsste jeden Moment kommen.
Aber er kommt nicht.
Ich werde nervös.
Ich zucke.
Ich schaue mich um, und da sehe ich meinen Vater, abwartend.
Das Pferd unter mir bekommt einen Klaps auf den Hintern und macht einen Satz nach vorn. Und dann hänge ich am Seil und werde zu Tode gewürgt.
Meine Hände sind vor meinem Körper gefesselt. Ich greife nach oben, um das Seil um meinen Hals zu lockern. Es funktioniert nicht. Ich keuche, pfeife aus dem letzten Loch. »Komm schon! Komm schon!«
Endlich.
Der Schuss kommt.
Nichts.
»Ich ersticke immer noch!«, zische ich, aber jetzt reitet mein Vater auf den Pöbel zu. Er feuert noch einmal und dieses Mal durchschießt er das Seil und ich falle.
Ich schlage auf dem Boden auf.
Ich hole tief Luft.
Luft.
Herrlich.
Um mich herum wirbeln die Kugeln.
Ich packe die Hand meines Vaters und er zieht mich zu sich aufs Pferd.
Wir fliehen.
Großaufnahme.
Neue Szene.
Alles ist ruhig und Dad hält etwa ein Dutzend Hundert-Dollar-Noten in der Hand. Er gibt mir eine.
»Eine?«
»Ganz recht.«
»Weißt du«, versuche ich zu verhandeln, »ich glaube wirklich, dass ich mehr bekommen sollte. Schließlich ist es mein Hals, der da in der Schlinge steckt.«
Dad lächelt und wirft eine angekaute Zigarre weg.
Er spricht.
»Ja, aber ich bin es, der deinen Hals rettet.«
Überall um mich herum ist Wüste. Mir fällt auf, wie weh mein Rücken tut, weil ich so tief gefallen bin.
Dad ist weg. Allein geblieben küsse ich den Geldschein und sage: »Verdammt sollst du sein, mein Freund.« Ich fange an zu laufen, irgendwohin, warte auf das nächste Mal und hoffe, dass ich lange genug leben werde.
3
Ich hatte völlig vergessen, dass sie da waren.
Ich hatte vergessen, dass sie da waren. Erst als ich am nächsten Tag mit einem fürchterlichen Schmerz im Rücken im Bett lag, den ich den vielen Gräben verdankte, die ich am Vortag gebuddelt hatte, fielen sie mir wieder ein. Ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnerte. Ich tat es einfach. Die Bilder. Die Bilder.
Sie waren unter meinem Bett versteckt.
»Die Bilder«, sagte ich zu mir selbst, und ohne darüber nachzudenken, stand ich in der noch düsteren Dämmerung, die sich nur langsam lichtete, auf und zog die Bilder hervor. Es waren Bilder von Frauen, die ich in einem Katalog für Badeanzüge und Badehosen gefunden hatte, der letztes Jahr Weihnachten in der Post gelegen hatte. Ich hatte ihn aufgehoben.
Wieder im Bett, schaute ich mir die Bilder jener Frauen an, ihre gebogenen Rücken und ihr Lächeln, ihre Haare, ihre Lippen, ihre Hüften, ihre Beine und alles.
Ich sah auch die Zahnarzthelferin – nicht wirklich natürlich. Aber ich dachte sie mir in die Bilder. Sie hätte hineingepasst.
»Allmächtiger Gott«, murmelte ich, als ich eine der Frauen ansah. Ich starrte und schämte mich gleichzeitig, wie ich da in meinem Bett lag, weil … Ich weiß auch nicht. Es schien mir nur so eine schmutzige Sache – Frauen anzugaffen, und das am frühen Morgen, während jeder sonst im Haus noch schlief. Noch dazu in einem Weihnachtskatalog. Weihnachten war erst knapp ein halbes Jahr vorbei. Trotzdem starrte ich weiter und blätterte durch die Seiten. Rube schlief noch und sägte am anderen Ende des Zimmers die Möbel auseinander.
Das Komische daran ist, dass sich ein Typ wie ich beim Anblick dieser Frauen gut fühlen sollte, aber mich machte es nur wütend. Ich war wütend, weil ich so schwach war und wie ein Geisteskranker Frauen angaffte, die mich zum Frühstück verspeisen konnten. Ich dachte auch daran, wie sich ein Mädchen in meinem Alter fühlen würde, wenn es sich dieses Zeug anschaute, doch daran dachte ich nur einen Augenblick lang. Möglicherweise wäre sie noch wütender als ich. Denn während ich diese Frauen nur anfassen wollte, wurde von einem Mädchen erwartet, dass sie zu einer dieser Frauen wurde. Das war es, was Mädchen erreichen sollten. Ganz schön hohe Erwartungen, die sie also erfüllen mussten.
Na ja, ich ließ mich ins Bett zurückfallen. Die Lage war für mich hoffnungslos.
Hoffnungslos.
»Du schmutziges Ferkel«, hörte ich Rube wieder sagen, vor ein paar Tagen beim Zahnarzt.
»Ja, schmutzig«, stimmte ich laut zu. Wenn ich erwachsen war, wollte ich nicht wie diese kaputten, tierischen Kerle enden, die ihre Garage mit Bildern von nackten Frauen aus dem Playboy tapezierten. Ich wollte einfach nicht. Gerade jetzt wollte ich das ganz bestimmt nicht, also zog ich den Katalog unter meinem Kissen hervor und zerriss ihn. Riss ihn einmal durch, dann zweimal, dann noch viele Male. Ich wusste genau, dass ich es bereuen würde. Ich würde es bereuen, wenn ich mir die Bilder das nächste Mal anschauen wollte.
Hoffnungslos.
Als ich aufstand, warf ich die Fetzen der Frauen ins Altpapier. Wahrscheinlich würden sie nächstes Weihnachten wieder zurückkommen. Wieder in einem Stück. Es war unausweichlich.
Eine andere unausweichliche Sache an diesem Tag war, dass ich zum Lumsden-Sportplatz gehen würde, um Rube und Steve beim Rugby zuzusehen. Es war nämlich Sonntag. Steves Mannschaft war eins der besten Teams der Gegend, während Rubes Mannschaft der schwächste Haufen war, den ich jemals zu Gesicht bekommen hatte. Rube und seine Kumpel wurden jedes Wochenende kräftig eingeseift und es tat schon beim Zusehen weh. Rube selbst war gar nicht so schlecht – er und ein paar andere. Der Rest der Mannschaft waren völlige Versager.
Beim Frühstück las er eine Sportzeitschrift und fragte mich: »Wie stehen die Wetten für den Punkte-Endstand? Siebzig zu null? Achtzig zu null?«
»Keine Ahnung.«
»Vielleicht schaffen wir heute eine dreistellige Zahl.«
»Vielleicht.«
Wir kauten.
Wir kauten immer noch, als Steve aus dem Keller auftauchte und fünf Bananen vor sich auf den Tisch legte. Das tat er jeden Sonntag und er aß sie, während er Rube und mich angrunzte.
Es stellte sich heraus, dass Rube mit seiner Schätzung gar nicht so falsch gelegen hatte. Sein Team verlor mit sechsundsiebzig zu zwei. Das gegnerische Team stand wie eine Wand. Jeder einzelne Spieler war größer, stärker und haariger. Rubes Mannschaft ergatterte ihre zwei Punkte erst ganz zum Schluss, als ihnen der Schiedsrichter einen Gnaden-Strafstoß zugestand. Ohne diesen einen Torschuss wäre ihr Mannschaftsname gar nicht auf der Anzeigetafel aufgetaucht. Es gab auch keinen Helfer, der einen Sandhaufen hätte aufschichten können, von wo aus der Ball normalerweise geschossen werden muss; daher zog der Torschütze seine Schuhe aus, legte den Ball obendrauf und schoss das Tor in Strümpfen. Im Vergleich dazu spielte Steves Team ein ziemlich gutes Match und gewann mit vierundzwanzig zu zehn. Wie üblich machte Steve ein fantastisches Spiel.
Insgesamt gibt es aber nur zwei halbwegs interessante Dinge von diesem Tag zu berichten.
Das Erste war, dass ich Greg Fienni begegnete, einem Jungen, der vor gar nicht allzu langer Zeit mein bester Freund gewesen war. Allerdings hatten wir längst aufgehört, beste Freunde zu sein. Es war nicht so, dass wir uns gestritten hätten oder dass es einen anderen Anlass gegeben hätte. Nein. Wir haben nur langsam die beste Freundschaft beendet. Vielleicht kam es daher, dass sich Greg plötzlich für Inlineskating interessierte und sich einem anderen Freundeskreis anschloss. Ich muss ihm sogar zugutehalten, dass er versucht hat mich in der Gruppe zu integrieren, aber ich hatte keine Lust dazu. Ich mochte Greg sehr, aber ich würde ihm nicht nachlaufen. Er fuhr jetzt auf die Skater-Kultur ab und ich … nun, ich wusste nicht genau, worauf ich abfuhr. Vielleicht fuhr ich darauf ab, allein irgendwo rumzuhängen. Auf jeden Fall gefiel es mir so. Als ich auf dem Sportplatz ankam, hatte Rubes Spiel bereits begonnen. In der obersten Ecke der Tribüne saß eine Gruppe Jungen und schaute sich das Match an. Als ich an ihnen vorbeiging, rief mich eine Stimme zurück. Ich erkannte Greg sofort.
»Cam!«, rief er. »Cameron Wolfe!«
»Hallo.« Ich drehte mich um. »Wie geht’s dir, Greg.« (Ich weiß, da gehört eigentlich ein Fragezeichen hin, aber was ich sagte, war eigentlich keine Frage. Es war eine Begrüßung.)
Greg stand auf und bahnte sich einen Weg durch die Gruppe auf mich zu.
Es war eine Angelegenheit von Sekunden.
Er fragte: »Willst du wissen, wie es steht?«
»Ja, ich bin ein bisschen spät dran.« Ich schaute ver-blüfft auf seine gebleichten, verfilzten Haare. »Und, wie steht’s?«
»Zwanzig zu null.«
In diesem Moment schoss die Gegenseite ein Tor.
Wir lachten.
»Vierundzwanzig.«
»He, setz dich hin«, schrie uns jemand aus der Gruppe zu. »Oder geh aus der Sicht.«
»Okay.« Ich zuckte mit den Schultern und erhob meinen Blick zu Greg. Dann schaute ich seine Kumpel für einen Moment lang an und sagte: »Wir sehen uns später, okay?« Mittlerweile waren auch einige Mädchen aufgetaucht und hatten sich zu der Gruppe gesellt. Ein paar davon waren so zuckersüß wie echte Schönheitsköniginnen, während andere eher normal aussahen. Eine normalere Art von Schönheit. Echte Mädchen, dachte ich, die vielleicht, wenn ich viel Glück habe, eines Tages mit mir reden werden.
»Okay.« Greg drehte sich zu seinen Freunden um. »Bis später.« Etwa einen Monat später, wie sich herausstellen sollte.
Komisch, dachte ich, während ich weiterlief und das Seil umrundete, das als Feldbegrenzung diente. Früher waren wir die besten Freunde und heute haben wir uns nichts mehr zu sagen. Es war schon interessant, wie er sich diesen Typen angeschlossen hatte und ich alleine geblieben war. Es war nicht so, dass es mir gefiel oder nicht. Es war einfach nur komisch, dass sich die Dinge so entwickelt hatten.
Die zweite bemerkenswerte Sache passierte zu Hause. Es war schon gegen Abend. Ich saß auf unserer Veranda vor dem Haus und beobachtete den Verkehr, der vorbeirauschte, da tauchten Sarah und ihr Freund in der Straße auf. Sein Auto stand in unserer Einfahrt, aber sie waren spazieren gegangen. Der Wagen war sein ganzer Stolz, ein roter Ford, der jede Menge Pferdestärken unter der Haube hatte. Einige Leute sind ja wahre Freaks, wenn es um Autos geht, aber ich finde das ziemlich dämlich. Wenn ich aus meinem Fenster schaue, kann ich die ganze Stadt sehen, die sich unter einer Decke aus Autoabgasen verkriecht. Und dann gibt es noch diese Kerle, die bis spät in die Nacht unsere Straße auf- und abbrausen und sich für Gottes Geschenk an die Menschheit halten.
Ehrlich gesagt, für mich ist das der letzte Dreck.
Andererseits, wer bin ich schon, dass ich so über andere urteile?
Was tue ich als Erstes, wenn ich sonntagmorgens auf-wache? Ich schaue mir Bilder von halb nackten Frauen an.
Also.
Ich beobachtete sie, wie sie die Straße entlang auf unser Haus zukamen: Sarah und ihr Freund. Ich wusste genau, dass sie es waren, denn ich erkannte Sarahs helle Jeans, die sie ziemlich oft trägt. Vielleicht hat sie auch mehrere davon.
Es war die Art, wie sie und ihr Freund, dessen Name übrigens Bruce war, sich an den Händen hielten, während sie nebeneinander hergingen, die mich nicht losließ. Es war ein schöner Anblick.
Sogar ein Dreckskerl wie ich konnte das sehen.
Konnte ich wirklich.
Ich gestand mir selbst ein, wie ich da auf unserer Veranda vor dem Haus saß, dass meine Schwester und Bruce Patterson einen Anblick reinster Schönheit boten, als sie auf unser Haus zugeschlendert kamen, und es ist mir völlig egal, was ihr von mir denkt, wenn ich so was sage.
Es war genau das, was ich wollte – was meine Schwester und Bruce miteinander hatten.
Klar wollte ich auch diese Frauen aus dem Katalog, aber sie waren einfach nicht … nicht real. Sie waren zeitlos. Sie würden immer so sein – nur etwas, was man hervorholte und wieder wegpackte.
»Wie geht’s?«
»Okay.«
Sarah und Bruce kamen die Einfahrt herauf und gingen ins Haus.
Gerade jetzt denke ich daran, wie sie Hand in Hand gegangen waren. Ich kann sie immer noch so sehen.
Das Schlimme dabei ist, dass es gar nicht lange dauerte, bis Bruce Sarah wegen eines anderen Mädchens sitzen ließ. Ich traf dieses Mädchen später, irgendwo auf den nächsten Seiten, aber ich konnte nur einen kurzen Blick auf sie werfen. Knappe Worte. Knappe Worte an der Haustür …
Sie schien ganz in Ordnung zu sein, aber genau weiß ich es natürlich nicht.
Eigentlich weiß ich gar nichts.
Ich …
Vielleicht ist das Einzige, was ich wirklich weiß, die Tatsache, dass ich an diesem Tag auf unserer Veranda, als ich Sarah und Bruce beobachtete, etwas fühlte und mir schwor, dass ich – sollte ich jemals ein Mädchen bekommen – sie gut behandeln würde und niemals gemein oder niederträchtig zu ihr wäre oder ihr wehtun würde. Niemals. Ich schwor es und war der felsenfesten Überzeugung, dass ich meinen Schwur halten würde.
»Ich würde sie gut behandeln«, sagte ich.
»Das würde ich.«
»Das würde ich.«
»… würde ich.«
Ich sitze auf der Tribüne neben dem Kricketfeld mit einer großen Gruppe Jungs hinter mir. Es regnet leicht und die Spieler haben das Feld verlassen. Jeder ist schlecht gelaunt. Die Jungs hinter mir haben sich bereits den ganzen Tag die Kehle aus dem Leib gebrüllt, das gegnerische Team beschimpft, sich selbst und wen sie sonst noch auftreiben konnten.
Am Anfang haben sie diesen Typen namens Harris niedergebrüllt.
»Hey, Harris! Zeig uns deine Glatze!«
»Böser Harris! Böser Bube!«
Ich stehe unten am Zaun. Ruhig.
Als unsere Mannschaft an der Reihe war, die Fänger zu spielen, haben sie auch uns auf dem Kieker gehabt. Sie brüllten: »Hey, Lehmann – du hast Glück, dass du in unserem Team spielst. Wink uns doch mal!« Er zuckte nicht mit der Wimper, doch die Menge ließ nicht locker. »Hey, Lehmann! Du Blödmann! Wink uns gefälligst oder du kriegst mein Bier über deinen Schädel!«
Nach einer Weile winkte der Spieler und alles jubelte, aber jetzt, während der Regenpause, gerät alles ein bisschen außer Kontrolle.
La Ola wirbelt durch das Publikum.
Die Leute springen auf und werfen alles, was sie haben, in die Luft und pfeifen und buhen, wenn die Welle zur Ehrentribüne kommt und die feinen Leute nicht aufstehen wie alle anderen.
Als die Welle zum Versiegen kommt, entdecken die Jungs einen jungen Sicherheitsbeamten, der etwa zwanzig Meter rechts von uns steht. Er ist einer von vielen Sicherheitsleuten, die in schwarze Hosen, schwarze Stiefel und gelbe Hemden gekleidet sind.
Er ist ziemlich groß und macht einen dümmlichen Eindruck, hat schwarze, fettige Haare und Koteletten, so groß wie Lammkeulen, die bis zu seinen Kieferknochen hinabragen.
Jetzt ist er an der Reihe. »Hey, du da vorne! Sicherheitsmann! Wink uns mal!«
Er sieht uns, erwidert aber nichts.
»Hey, Elvis, wink doch mal!«
Er lächelt und nickt, ganz cool, und teilt mit seinem Knüppel ein paar Schläge aus. Lauter Oohs und Aahs folgen, und was bist du doch für ein Idiot, und dies und das.
Trotzdem machen sie immer weiter.
»Hey, Travolta!«
»Hey, Travolta, wink uns mal. Aber diesmal richtig!«
Gegen Ende des Traums fühle ich mich plötzlich so komisch und mir fällt auf, dass ich ganz nackt bin.
Richtig. Nackt.
»Mann, geht’s dir gut, Kumpel?«, fragt jemand hinter mir.
Dann kommen die üblichen Angebote.
»Komm schon, Kumpel. Ich geb dir ’nen Fünfer, wenn du’s bis auf die andere Seite vom Feld schaffst.«
Ich weigere mich und bei jeder Weigerung erscheint ein weiteres Kleidungsstück an meinem Körper.
Dieser abgefahrene Traum endet damit, dass ich in meinen normalen Kleidern dasitze, lächelnd und überglücklich, dass ich mich weder zu einem Spurt im Adamskostüm noch zu einer anderen Invasion des Spielfelds habe überreden lassen.
Wie dieser Traum eindeutig beweist: Ich mag zwar krank und pervers sein, aber ich bin nicht völlig verblödet.
»Mich wird niemand mit runtergelassenen Hosen erwischen. Jedenfalls nicht länger, als ich zum Pinkeln brauche.«
Niemand hört mich.
Die Spieler kommen zurück.
Der Sicherheitsbeamte muss noch jede Menge Hiebe austeilen.
4
In der folgenden Woche veränderte sich das Wetter und es wurde noch kälter. Bei uns zu Hause war es morgens ziemlich hektisch, wie eigentlich immer.
In ihrem Zimmer machte sich Sarah für ihren Arbeitstag zurecht. Dad und Steve verabschiedeten sich lautstark. Mum erledigte den Abwasch und räumte das Chaos auf, das wir in der Küche hinterlassen hatten.
Am Mittwoch verpasste mir Rube aus Spaß einen Hieb in den Magen und zerrte mich dann ins Badezimmer, damit Mum nicht sah, wie ich mich vor Schmerz auf dem Boden wand. Ich lachte und heulte gleichzeitig, während er mich hineinschubste.
»Du willst doch nicht, dass Mum uns hört.« Er hielt mir den Mund zu. »Denk dran, sie sagt es Dad, und dann bin nicht nur ich dran. Dann sind wir beide fällig.«
Das war Regel Nummer eins bei uns. Wenn es Ärger gab, traf es alle, die damit zu tun hatten. Der alte Herr kam dann in den Flur und hatte diesen Blick aufgelegt, der uns sagte: Ich hatte einen höllisch harten Tag und ich habe keine Lust, mir meinen Feierabend von euch versauen zu lassen. Dann setzte es was mit der flachen Hand, entweder in die Rippen oder auf die Ohren. Da gab es keine Diskussionen. Wenn es Rube traf, traf es automatisch auch mich. Und daher blieb ein Streit oder eine Prügelei, egal wie schlimm sie war, immer unter uns. Meistens taten uns die Knochen schon genug weh von der Schlägerei. Das Letzte, was wir gebrauchen konnten, war Dad, der sich einmischte.
»Okay, okay.« Sobald wir im Bad waren, fuhr ich Rube an: »Warum hast du das denn überhaupt gemacht, verdammt?«
»Weiß nicht.«
»Ich glaub das einfach nicht.« Ich schaute zu dem hirnverbrannten Idioten hoch. »Du gibst mir ohne Grund Saures. Das ist echt das Letzte.«
»Ich weiß.« Sein Grinsen brachte mich dazu, ihn in die Badewanne zu schubsen. Dort versuchte ich ihn zu erwürgen, kam aber leider nicht dazu. Sarah hämmerte an die Tür.
»Raus da!«, brüllte sie.
»Schon gut.«
»Sofort!«
»Schon gut!«
Auf dem Weg zur Schule trafen wir ein paar von Rubes Kumpeln.
Simon.
Jeff.
Cheese.
Wir luden sie nachmittags zu einem Spiel ein, das in unserem Haus Einhandboxen genannt wird. Der Name kam zustande, weil wir nur ein Paar Boxhandschuhe in unserer Garage haben. Das Ganze ist mehr oder weniger ein Boxkampf, bei dem beide Kämpfer nur einen Handschuh anhaben.
Einhandboxen.
Wir spielten es an diesem Mittwoch und wir waren heiß. Sehr heiß. Heiß darauf, Schläge auszuteilen. Heiß darauf, Schläge einzustecken. Heiß darauf, mit dem verbotenen Spiel durchzukommen, auch wenn das bedeutete, dass wir uns vom Rest der Familie fernhalten mussten. Ihr wärt überrascht, wie gut man eine Prellung in einer dunklen Ecke des Wohnzimmers verbergen kann.
Rube ist Linkshänder, daher nimmt er am liebsten den linken Handschuh. Ich bekomme den rechten, denn das ist meine gute Hand. Es gibt drei Runden, und es wird fair und gerecht entschieden, wer der Sieger ist. Manchmal kann man recht schnell sagen, wer gewinnt. Manchmal nicht.
An diesem Mittwochnachmittag lief es für mich ziemlich mies.
Wir holten die Boxhandschuhe raus und Rube war der Erste, der gegen mich antrat. Normalerweise sind die Kämpfe zwischen Rube und mir die besten. Wir nahmen keine Rücksicht aufeinander. Ein guter Schlag von mir, und Rube versuchte mit allen Kräften, mich k. o. zu schlagen. Ein Treffer von Rube, und ich sah Sternchen und rief nach der Letzten Ölung. Trotzdem gab ich mir alle Mühe, stehen zu bleiben.
»Ding, ding«, sagte Cheese ohne große Begeisterung. Der Kampf hatte begonnen.
Wir umkreisten uns in dem kleinen Hinterhof, der zur Hälfte aus Betonboden und zur anderen Hälfte aus Rasen besteht. Es ist eine Hasenkiste, ein typischer Innenhof, wie man ihn zuhauf hier in der Stadt findet, nicht viel größer als ein richtiger Boxring. Man hat nicht sonderlich viel Platz, um auszuweichen, und dann ist da noch der massive Beton …
»Komm schon.« Rube trat in den Ring und zielte mit einem Hieb auf meinen Kopf, täuschte an und schlug mir in die Rippen. Der nächste Schlag sollte wirklich auf meinem Kopf landen, streifte aber nur mein Ohr. In diesem Moment achtete er nicht auf seine Deckung und ich landete einen direkten Treffer auf seiner Nase. Perfekt.
»Klasse!«, jubelte Simon, aber Rube ging nicht zu Boden. Er kam wieder in den Ring, völlig furchtlos. Auch mein angeberisches Herumgehopse brachte ihn nicht aus der Fassung. Er beugte sich vor und hämmerte seine Faust in Richtung meines Auges. Ich blockte ihn ab und schlug dann selbst zu. Er wich aus, schnappte mich, wirbelte mich herum und stieß mich gegen die Wand. Dann zog er mich zurück und stieß mich erneut gegen die Mauer. Er warf mich auf das Gras und jagte seine Faust in meine Schulter. Oh ja. Er traf. Und wie. Es war wie eine Axt, die sich in mein Fleisch bohrte. Im nächsten Moment holte er mit der Faust aus, ließ sie nach vorne sausen und schmetterte sie gegen mein Kinn.
Mit voller Wucht.
Es passierte.
Der Himmel stürzte über mir zusammen.
Sternchen.
Die Letzte Ölung war fällig.
Der Boden schwankte.
Der Boden.
Der Boden.
Ich holte zu einem Schwinger aus.
Verfehlte mein Ziel.
Rube verzog sein Gesicht mit den immer länger werdenden Bartstoppeln zu einem Grinsen. Er lachte, sobald ich in die Knie ging und mich gerade noch in meine Ecke schleppen konnte. Das Auszählen machte ihm sichtlichen Spaß: »Eins, zwei, drei …«
Nachdem ich wieder auf die Füße gekommen war und die Jubelschreie von Simon, Jeff und Cheese nicht mehr länger wie aus weiter Entfernung, sondern klar und deutlich hören konnte, tauschten wir noch ein paar leichte Hiebe aus, und dann war die erste Runde vorbei.
Ich setzte mich in eine Ecke des Hofs in den Schatten.
Runde zwei.
Alles lief etwa so wie in Runde eins, bis auf die Tatsache, dass auch Rube diesmal zu Boden ging.
Runde drei war ein echter Hundekampf.
Sobald die Runde eingeläutet war, hämmerten wir drauflos wie die Wilden. Ich weiß noch, dass ich Rube etwa sieben- oder achtmal in den Rippen erwischte und mir selbst mindestens drei Volltreffer auf den Kieferknochen einfing. Es war brutal. Der Nachbar links von uns hält sich Papageien im Käfig und hat auch einen Hund, einen echten Winzling. Auf der anderen Seite des Zauns kreischten die Vögel, und der Zwergenhund kläffte und sprang gegen die Zaunlatten, während mein Bruder und ich uns windelweich prügelten. Seine Faust war nur noch ein großer brauner Schatten, der beständig an seinem Arm vor- und zurückschwang, gegen mich hämmerte und ein singendes Geräusch von sich gab, wenn er meine Haut gegen meine Knochen schlug. Ich sah alles nur noch verschwommen und verzerrt und von einem zitternden Dunkelorange überzogen. Ich spürte, wie mir der metallische Geschmack von Blut aus meiner Nase über die Lippen rann, über meine Zähne und dann auf die Zunge. Oder blutete ich im Mund? Ich wusste es nicht. Ich wusste rein gar nichts mehr, bis ich wieder am Boden lag, völlig benommen und mit dem Gefühl, dass ich mich jeden Moment übergeben musste.
»Eins, zwei …«
Das Auszählen hatte diesmal keine Bedeutung für mich.
Ich ignorierte es.
Ich lehnte mich nur gegen den Zaun und wartete, bis das Leben in mich zurückkehrte.
»Alles in Ordnung?«, fragte Rube kurze Zeit später. Sein wildes Haar hing ihm in die Augen.
Ich nickte.
Es stimmte ja auch.
Im Haus sah ich mir den Schaden genauer an. Es war kein sonderlich schöner Anblick.
In meiner Nase war kein Blut. Es stellte sich heraus, dass ich tatsächlich im Mund geblutet hatte. Und ich hatte ein blaues Auge. Ein echtes Veilchen. Eins, das man nicht verstecken konnte. Heute jedenfalls nicht. Ich brauchte es nicht einmal zu versuchen. Mum würde uns umbringen. Und das tat sie auch.
Sie warf nur einen Blick auf mich und fragte: »Was ist denn mit dir passiert?«
»Ach, nichts.«
Dann sah sie Rube, dessen Lippe leicht geschwollen war.
»Oh, ihr Jungs«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Ihr widert mich an, ganz ehrlich. Könnt ihr nicht eine Woche lang miteinander auskommen, ohne euch andauernd zu verletzen?«
Nein, konnten wir nicht.
Wir verletzten uns ständig gegenseitig, sei es beim Boxen oder wenn wir im Wohnzimmer mit einem zusammengerollten Paar Socken Fußball spielten.
»Haltet euch bitte mal eine Weile voneinander fern«, wies sie uns an, und wir gehorchten. Wir versuchten wirklich auf unsere Mutter zu hören, denn sie war eine tolle Frau. Sie putzte die Häuser von reichen Leuten und arbeitete sehr hart, um uns ein gutes Zuhause zu geben. Daher fühlten wir uns nicht sonderlich gut, wenn sie von uns enttäuscht war.
Doch es sollte noch schlimmer werden.
Am nächsten Tag spitzten sich die Dinge zu, denn einige meiner Lehrer zeigten sich recht besorgt wegen des Zustands meines Gesichts und aufgrund der Tatsache, dass ich mindestens jede zweite Woche mit einer Prellung oder einem Schnitt oder einer Schürfwunde ankam. Sie stellten alle ganz merkwürdige Fragen, wie die Dinge zu Hause lägen, wie ich mit meinen Eltern auskäme und solche Sachen. Ich sagte ihnen, dass wir uns alle ganz gut verständen und dass es nichts Besonderes zu erzählen gäbe. Alles wäre okay.
»Bist du ganz sicher?«, fragten sie mich. Als ob ich lügen würde. Vielleicht hätte ich ihnen erzählen sollen, dass ich in eine Tür gerannt oder die Kellertreppe hinuntergefallen war. Damit hätte ich zumindest einen guten Lacher geerntet. So aber sagte ich ihnen nur, dass ich Boxen als Ausgleichssport betriebe und noch nicht sonderlich gut wäre und daher noch viel üben müsste.
Offensichtlich glaubten sie mir kein Wort, denn am Dienstagnachmittag erhielt meine Mutter einen Anruf von der Schule. Sie sollte sich mit dem Schulleiter und einer Mitarbeiterin des Jugendamts treffen.
Das Treffen fand am Freitag in der Mittagspause statt und meine Mutter sorgte dafür, dass Rube und ich ebenfalls anwesend waren.
Kurz bevor sie in das Büro des Schulleiters ging, sagte sie: »Ihr wartet hier draußen und rührt euch nicht vom Fleck, bis ich euch rufe.« Wir nickten und setzten uns hin. Es dauerte keine zehn Minuten, da öffnete sie die Tür und sagte: »Also gut, rein mit euch.« Wir standen auf und trotteten hinein.
Im Büro saßen der Schulleiter und die Frau vom Jugendamt und maßen uns mit einem halb amüsierten, halb angeekelten Blick. Genauso wie Mum. Der Grund hierfür war mir sofort klar, als sie in ihre große Handtasche griff und unsere Boxhandschuhe hervorzog. Ihre Stimme klang fröhlich. »Na los, zieht sie an.«
»Ach, komm schon, Mum«, protestierte Rube.
»Nein, nein«, mischte sich Mr Dennison, der Schulleiter, sofort ein. »Wir alle möchten das wirklich sehr gerne sehen.«
»Na kommt schon, Jungs«, ermunterte uns meine Mutter. »Ihr müsst euch nicht schämen …« Doch genau darum ging es. Sie wollte uns bloßstellen. Uns demütigen. Uns in den Staub zwingen. Jeder konnte sehen, was los war, als Rube und ich unsere Handschuhe anzogen, jeder einen.
»Meine Söhne«, wandte sich meine Mutter dem Schulleiter zu. Dann drehte sie sich zu uns um und sagte noch einmal: »Meine Söhne.«
Auf dem Gesicht unserer Mutter lag ein Ausdruck bitterster Enttäuschung. Sie sah so aus, als würde sie jeden Moment anfangen zu weinen. Die Falten um ihre Augen wirkten wie dunkle, trockene und erwartungsvolle Flussbetten. Doch es kam kein Wasser. Sie sah uns nur an. Sah weg. Dann blickte sie uns wieder direkt ins Gesicht, und ich hatte einen Moment lang Angst, sie würde uns vor die Füße spucken und uns beide enterben. Ich hätte es ihr nicht verübelt.
»Das also ist es, was sie anstellen«, sagte sie zu den beiden anderen Anwesenden im Raum. »Es tut mir leid, dass Sie deswegen Ihre Zeit verschwendet haben.«
»Das macht doch nichts«, versicherte ihr Dennison. Sie schüttelte ihm und der Frau vom Jugendamt die Hände.
»Es tut mir leid«, sagte sie noch einmal und verließ das Zimmer. Sie sah uns nicht einmal dabei an. Sie ließ uns einfach stehen. Mit unseren Boxhandschuhen sahen wir aus wie zwei lächerliche Tiere, die vom Winter überrascht worden waren.
Fragt mich nicht, warum, aber ich bin in Russland, genauer gesagt in Moskau, und sitze in einem alten, klapprigen Bus.
Der Bus ist voll.
Der Bus bewegt sich sehr langsam.
Es ist eiskalt.
Der Typ neben mir sitzt am Fenster und hat irgendein Nagetier auf dem Schoß, das mich jedes Mal anzischt, wenn ich meinen Blick in seine Richtung wende. Der Typ schubst mich an, sagt etwas und lacht. Als ich ihn frage, ob dies tatsächlich Moskau ist (denn ich war natürlich noch niemals da), zwingt er mir dieses lange, nicht enden wollende Gespräch auf, das ziemlich einseitig verläuft, weil ich kein Wort erwidern kann, da ich ja der Sprache nicht mächtig bin.
Er ist einfach unglaublich.
Er redet.
Er redet und lacht und redet, und als er endlich fertig ist, habe ich ihn richtig gern. Ich lache über all seine Witze oder vielmehr über die Falten, die sein Gesicht wirft, wenn er sie erzählt.
»Langsamer Bus«, sage ich, aber natürlich weiß er nicht, wovon ich rede.
Russland.
Kann mir jemand mal sagen, was um aller Welt ich in Russland mache?
Es ist eiskalt im Bus – habe ich das schon erwähnt? Ja? Nun, ihr könnt mir glauben, das ist die reine Wahrheit. Die ganzen Fenster sind angelaufen.
Zittern.