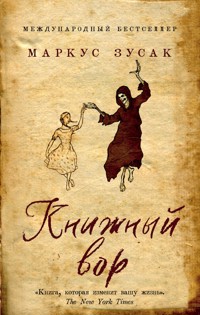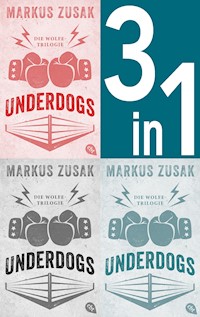5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nach harten Kämpfen haben die beiden Wolfe-Brüder das Boxen hinter sich gelassen. Der gut aussehende Ruben hat eine Freundin nach der anderen, während Cameron nur davon träumt, ein Mädchen zu finden, das er lieben kann. Doch eines Tages tritt Octavia in Camerons Leben. Sie ist Rubens neuste Eroberung. Eine von vielen, aber doch ganz anders als alle Mädchen, die Cameron bisher kenngelernt hat. Und plötzlich sind die beiden Brüder wieder Rivalen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Markus Zusak
When Dogs Cry
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst
DER AUTOR
Markus Zusak, 1975 geboren, lebt und arbeitet in Sydney, spielt Fußball und schreibt Romane, die international für Furore sorgen. Für »Der Joker« wurde er dutzendfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2007. Sein Roman »Die Bücherdiebin« stürmte die internationalen Bestsellerlisten über Nacht und wurde 2009 ebenfalls mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Zusaks Bücher wurden bis jetzt in über zwanzig Sprachen übersetzt.
1. Auflage Erstmals als cbj Taschenbuch März 2013 Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform © 2001 der Originalausgabe by Markus Zusak © 2008 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel When Dogs CryPan Macmillian Australia Pty Limited. Übersetzung: Alexandra Ernst Lektorat: Luitgard Distel Umschlaggestaltung: init.büro für gestaltung, Bielefeld unter Verwendung eines Bildes von Gettyimages (Petrea Alexandru/Vetta; Photo Alto/RF) KK · Herstellung: ReD Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN: 978-3-641-19547-2V001
www.cbj-verlag.de
www.randomhouse.de
Für Scoutund für Mum und Dad
Besonderen Dank an Anna McFarlanefür ihr Vertrauen in mein Schreiben
Inhaltsverzeichnis
1
Die Sache mit dem Biereis war die Idee von Rubes Freundin, nicht meine.
Das wollen wir mal klarstellen.
Nur war ich derjenige, der es ausbaden musste.
Wisst ihr, ich hatte immer geglaubt, dass ich irgendwann mal an den Punkt käme, wo ich erwachsen werden würde, aber bisher hatte ich ihn nicht erreicht. Es war immer noch alles beim Alten.
Ganz ehrlich, ich fragte mich, ob je eine Zeit käme, wo Cameron Wolfe (das bin ich) sich zusammenreißen würde. Ab und zu hatte ich schon einen Blick auf mein anderes Ich erhascht. Es war deshalb anders, weil ich in jenen Sekundenbruchteilen, in denen es aufblitzte, tatsächlich glaubte, ich könnte ein Sieger sein und aus mir könnte mal etwas werden.
Die Wahrheit allerdings war niederschmetternd.
Es war eine Wahrheit, die mir mit innerlich ätzender Brutalität klarmachte, dass ich ich war und dass mir das Gewinnen nicht in die Wiege gelegt worden war. Es musste erkämpft werden, in den Echos und den ausgetretenen Spuren meines Geistes. Es war so, als müsste ich dort nach Momenten suchen, in denen ich mit mir im Reinen war.
Ich fasste mich an.
Ein bisschen.
Okay.
Okay.
Ein bisschen viel.
(Es gibt Leute, die mir weismachen wollen, dass man so etwas nicht so unverblümt zugeben sollte, weil man damit andere Menschen vor den Kopf stoßen würde. Dazu kann ich nur sagen: Warum nicht? Warum soll man nicht die Wahrheit sagen? Alles andere macht doch verdammt noch mal keinen Sinn, oder?
Oder?)
Es war nur so, dass ich mir wünschte, eines Tages von einem Mädchen angefasst zu werden. Ich wollte, dass sie in mir nicht den schmutzigen, zerlumpten, halb grinsenden, halb schmollenden Underdog sah, der versuchte, Eindruck auf sie zu machen.
Ihre Finger.
In meiner Vorstellung waren sie immer sanft, fielen von meiner Brust weich herab auf meinen Bauch. Ihre Nägel auf meinen Beinen, nicht zu fest, ließen meine Haut erbeben. Das alles stellte ich mir vor, die ganze Zeit. Trotzdem wollte ich nicht glauben, dass es nur eine Sache von Lust und Sex war. Denn in meinen Tagträumen kamen die Hände des Mädchens immer über meinem Herzen zur Ruhe. Jedes Mal. Ich sagte mir, dass das die Stelle war, wo ich ihre Berührung am meisten spüren wollte.
Natürlich war da auch Sex.
Nacktheit.
Enge. Härte. Rein und raus in meinen Gedanken.
Aber wenn es vorbei war, sehnte ich mich nach ihrer flüsternden Stimme und einem menschlichen Körper, der sich in meine Arme kuschelte. Allerdings bekam ich nicht einmal ein kleines Stück Wirklichkeit davon zu schmecken. Ich schwelgte in Visionen, ergötzte mich an meinen Gedanken, immer mit dem Gefühl, dass mich nichts glücklicher machen würde, als in einer Frau zu ertrinken. Gott, wie sehr ich mir das wünschte.
Ich wollte in einer Frau ertrinken, wollte die Liebe, die ich ihr geben konnte, spüren und schmecken. Ich wollte, dass ihr Puls mich mit seiner Heftigkeit zerquetschte. Das war es, was ich wollte. So wollte ich sein.
Aber.
Ich war es nicht.
Ich bekam nur hin und wieder einen Mundvoll verstohlener Blicke und meine eigene enttäuschte Hoffnung. Und meine Visionen.
Das Biereis.
Na klar.
Ich wusste, da war noch was.
Gemessen an der Tatsache, dass wir Winter hatten, war es ein schöner Tag gewesen, obwohl der Wind noch frisch war. Die Sonne schien warm und irgendwie pulsierend.
Wir saßen im Garten und hörten uns die sonntägliche Footballübertragung im Radio an. Ich gebe offen zu, dass ich mehr an den Beinen, Hüften, dem Gesicht und den Brüsten der neuen Freundin meines Bruders interessiert war.
Besagter Bruder ist Rube (Ruben Wolfe), und in dem Winter, von dem hier die Rede ist, schleppte er alle paar Wochen ein neues Mädchen an. Manchmal konnte ich sie hören, wenn sie es in unserem Zimmer trieben – ein Ausruf, ein Schrei, ein Stöhnen oder sogar ein erregtes Flüstern. Ich weiß noch, dass ich diese neue Freundin auf Anhieb mochte. Ihr Name gefiel mir. Octavia. Sie war eine Straßenkünstlerin und eine nette Person, verglichen mit ein paar von den Schlampen, die Rube vor ihr aufgegabelt hatte.
Wir lernten sie an einem Samstagnachmittag im Spätherbst unten am Hafen kennen. Sie spielte auf ihrer Mundharmonika, und Passanten warfen Geld in eine alte Jacke, die ausgebreitet zu ihren Füßen lag. Es war ziemlich viel Geld in der Jacke. Rube und ich schauten ihr zu, denn sie war ziemlich gut und brachte die Mundharmonika zum Heulen. Manchmal blieben die Leute stehen und klatschten, wenn ein Lied zu Ende war. Sogar Rube und ich warfen Geld in die Jacke, direkt nach einem alten Mann mit einem Gehstock und vor einem japanischen Touristen.
Rube sah sie an.
Sie sah ihn an.
Mehr war meist nicht nötig, denn immerhin ging es hier um Rube. Mein Bruder musste nie etwas sagen oder tun. Es reichte, wenn er irgendwo stand, sich kratzte oder auch nur über die Bordsteinkante stolperte, und sofort flogen die Mädchen auf ihn. So war es immer und so war es auch bei Octavia.
»Kommst du aus der Gegend?«, hatte Rube sie gefragt.
Ich erinnere mich, wie das Ozeangrün ihrer Augen aufgetaucht war. »Unten, im Süden, in Hurstville.« Er hatte schon gewonnen, das kann ich euch sagen. »Und du?«
Rube hatte sich umgedreht und mit dem Finger gedeutet. »Kennst du die beschissene Gegend hinter der Central Station?«
Sie nickte.
»Tja, da wohnen wir.« Bei Rube hörte es sich so an, als sei die »beschissene Gegend« der beste Ort auf Erden – und mit diesen Worten fing die Sache zwischen Rube und Octavia an.
Was mir am besten an ihr gefiel, war die Tatsache, dass sie mich tatsächlich wahrnahm. Sie behandelte mich nicht, als sei ich lediglich das fünfte Rad am Wagen, nichts als ein Störenfried. Sie fragte mich immer: »Wie geht’s denn so, Cam?«
Die Wahrheit ist.
Rube liebte keine von ihnen.
Sie waren ihm alle egal.
Er wollte sie nur, weil jede von ihnen am Anfang neu war, und warum sollte man nicht etwas Neues nehmen, wenn es besser war als das Alte?
Es muss wohl nicht betont werden, dass Rube und ich völlig unterschiedlich über Frauen denken.
Trotzdem.
Diese Octavia gefiel mir.
Es gefiel mir, wie wir an jenem Tag ins Haus gingen und den Kühlschrank öffneten, wo uns der Anblick einer drei Tage alten Suppe, einer Karotte, eines grünen Etwas und einer Bierflasche überrumpelte. Wir alle beugten uns vor und starrten in den Kühlschrank.
»Na klasse.«
Es war Rube, der das sagte. Sarkastisch.
»Was ist denn das?«, wollte Octavia wissen.
»Was?«
»Dieses grüne Ding.«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Eine Avocado?«
»Zu groß«, erklärte ich.
»Was zum Teufel ist das?«, fragte Octavia noch einmal.
»Wen kümmert’s?«, gab Rube zurück. Er hatte ein Auge auf die Bierflasche geworfen. Das einzig Grüne, worauf er starrte, war das Etikett der Flasche.
»Die gehört Dad«, sagte ich zu ihm. Ich schaute immer noch in den Kühlschrank. Keiner von uns rührte sich.
»Na und?«
»Na, er ist doch mit Mum und Sarah zu Steves Footballspiel gegangen. Er will sie vielleicht trinken, wenn er heimkommt.«
»Vielleicht. Vielleicht kauft er sich auch auf dem Heimweg eine neue.«
Eine von Octavias Brüsten streifte meine Schulter, als sie sich wegdrehte. Es fühlte sich so gut an, dass ich eine Gänsehaut bekam.
Rube griff in den Kühlschrank und schnappte sich die Bierflasche. »Einen Versuch ist es wert«, erklärte er. »Der alte Herr ist derzeit immer gut gelaunt.«
Er hatte recht.
Letztes Jahr um diese Zeit war es ihm ziemlich mies gegangen, weil er keine Arbeit hatte. Dieses Jahr hatte er jede Menge Aufträge, und wenn er mich fragte, ob ich ihm samstags helfen würde, tat ich es. Rube ebenfalls. Mein Vater ist Klempner.
Wir setzten uns an den Küchentisch.
Rube.
Octavia.
Ich.
Und das Bier stand auf der Tischplatte und schwitzte.
»Und?«
Das war Rube.
»Und was?«
»Und was zum Henker stellen wir jetzt mit dem Bier an, du dämlicher Bastard?«
»Mach mal halblang, okay?«
Wir alle grinsten schief.
Sogar Octavia lächelte, denn sie hatte sich mittlerweile an die Art gewöhnt, wie Rube und ich miteinander umgingen, besser gesagt, wie Rube mit mir umging.
»Teilen wir es durch drei?«, fuhr Rube fort. »Oder lassen wir die Flasche einfach kreisen?«
In diesem Moment hatte Octavia ihre grandiose Idee.
»Wie wär’s mit Biereis am Stiel?«
»Soll das ein Witz sein?«, fragte Rube.
»Nein.«
»Biereis am Stiel?« Rube zuckte mit den Schultern und dachte darüber nach. »Warum eigentlich nicht? Warm genug ist es ja. Haben wir noch welche von den Plastikdingern? Du weißt doch, die mit dem Stiel, mit denen man Eis macht.«
Octavia hatte schon die Tür des Küchenschranks geöffnet. Dann griff sie hinein und drehte sich zu uns um. »Gefunden!«, frohlockte sie grinsend (und sie hatte einen herrlichen Mund mit geraden weißen, sexy Zähnen.)
»Okay.«
Jetzt wurde es ernst.
Rube öffnete die Flasche und wollte gerade das Bier in die Plastikbehälter füllen, gerecht aufgeteilt natürlich.
Unterbrechung.
Von mir.
»Wollen wir die Dinger nicht vorher auswaschen?«
»Warum?«
»Wahrscheinlich stehen die seit ungefähr zehn Jahren im Schrank.«
»Na und?«
»Na, die sind bestimmt ganz siffig und staubig und …«
»Kann ich jetzt bitte das verdammte Bier eingießen?«
Wieder lachten wir, lachten die Anspannung weg und schließlich goss Rube mit quälender Genauigkeit drei gleiche Bierportionen in die Plastikbehälter. Er befestigte die Stiele, sodass sie alle in der Mitte steckten.
»Okay«, sagte er. »Das wäre geschafft.« Langsam ging er zum Kühlschrank.
»Du musst sie ins Gefrierfach stellen«, erinnerte ich ihn.
Er erstarrte mitten in der Bewegung, drehte sich langsam zu mir um. Dann sagte er: »Glaubst du im Ernst, ich bin so blöd, das Bier, das ich gerade aus dem Kühlschrank geholt habe, um Eis daraus zu machen, einfach wieder in den Kühlschrank zu stellen?«
»Kann man nie wissen.«
Er ging weiter. »Octavia, mach doch mal das Gefrierfach auf.«
Sie tat es.
»Danke, Süße.«
»Gern geschehen.«
Dann hieß es warten.
Wir saßen eine Weile in der Küche herum, bis Octavia etwas sagte, zu Rube.
»Hast du Lust, was anzustellen?«, fragte sie ihn. Bei den meisten Mädchen wäre das mein Stichwort, mich zu verziehen. Bei Octavia allerdings war ich mir nicht so sicher. Ich verzog mich trotzdem.
»Wo gehst du hin?«, fragte Rube.
»Weiß nicht genau.«
Ich verließ die Küche, nahm meine Jacke und ging auf die Veranda. Im Türrahmen sagte ich über die Schulter hinweg: »Vielleicht zur Hunderennbahn. Vielleicht einfach nur spazieren.«
»Alles klar.«
»Bis später, Cam.«
Mit einem letzten Blick zurück konnte ich das Begehren in ihren Augen sehen. Octavia begehrte Rube. Rube begehrte lediglich ein Mädchen. Ziemlich einfach.
»Bis später«, sagte ich und ging hinaus.
Die Fliegengittertür knallte hinter mir zu.
Meine Füße schleppten sich vorwärts.
Ich schob meine Arme durch die Jackenärmel.
Warme Ärmel.
Zerknitterter Kragen.
Hände in den Taschen.
Okay.
Ich ging.
Kurze Zeit später arbeitete sich der Abend in den Himmel vor und die Stadt kauerte sich nieder. Ich wusste genau, wohin ich gehen würde. Ohne zu wissen, ohne zu denken, wusste ich es. Ich ging zum Haus eines Mädchens. Es war ein Mädchen, das ich letztes Jahr auf der Hunderennbahn kennengelernt hatte.
Sie mochte.
Sie mochte.
Nicht mich.
Sie mochte Rube.
Sie hatte mich sogar mal einen Loser genannt, als sie mit ihm redete, und ich hatte gelauscht, wie mein Bruder sie mit Worten niedergeschlagen und beiseitegeschoben hatte.
In letzter Zeit stand ich oft vor ihrem Haus. Auf der anderen Straßenseite. Ich stand und starrte und schaute und hoffte. Und ich ging wieder, nachdem die Vorhänge zugezogen worden waren. Ihr Name war Stephanie.
An diesem Abend, den ich mittlerweile den »Biereis am Stiel«-Abend nenne, stand und starrte ich etwas länger als gewöhnlich. Ich stand da und stellte mir vor, wie ich sie nach Hause begleiten und ihr die Tür aufhalten würde. Ich stellte mir dieses Bild so lange vor, bis der Schmerz mein Innerstes nach außen riss.
Ich stand.
Meine Seele außen.
Das Fleisch innen.
»Ach, was soll’s!«
Es war ein ganz schönes Stück Weg, denn sie wohnte in Glebe und ich in der Nähe der Central Station, in einer kleinen Straße mit löchrigem Asphalt. Die Bahngleise direkt dahinter. Ich war es gewohnt – sowohl die Entfernung als auch die Straße. Auf gewisse Weise bin ich sogar stolz darauf, wo ich herkomme. Das kleine Haus. Die Wolfe-Familie.
Viele Minuten schlurften dahin, während ich heimging. Als ich den Lieferwagen meines Vaters vor unserem Haus stehen sah, lächelte ich sogar.
Die Dinge hatten sich in letzter Zeit für uns alle ganz gut entwickelt.
Für Steve, meinen anderen Bruder.
Für Sarah, meine Schwester.
Für Mrs Wolfe – die unverwüstliche Mrs Wolfe, meine Mutter, die bei Privatleuten und im Krankenhaus putzt, um Geld zu verdienen.
Für Rube.
Für Dad.
Und für mich.
Aus irgendeinem Grund empfand ich, als ich an jenem Abend heimging, einen tiefen Frieden. Ich fühlte mich glücklich, glücklich für jeden in meiner Familie, weil alles für sie gut zu laufen schien. Für jeden einzelnen.
Ein Zug fuhr vorbei, und mir war, als könnte ich in seinem Fahrtwind den Klang der ganzen Stadt hören.
Er kam auf mich zu und glitt wieder von mir weg.
Immer schien alles von mir wegzugleiten.
Etwas kommt zu dir, bleibt eine Weile und geht dann wieder.
Der Zug kam mir an diesem Tag wie ein Freund vor. Als er weitergefahren war, merkte ich, wie etwas in mir stolperte. Ich war allein auf der Straße, und obwohl ich immer noch diesen Frieden verspürte, war das kurze Glücksgefühl verschwunden. Eine Traurigkeit riss mich entzwei, langsam und bedächtig. Stadtlichter schienen, streckten ihre Arme nach mir aus, aber ich wusste, dass sie mich nie erreichen würden.
Ich riss mich zusammen und trat auf die vordere Veranda. Drinnen war ein Gespräch über Eis am Stiel und eine fehlende Bierflasche im Gange. Ich freute mich regelrecht darauf, meinen Teil davon abzubekommen, obwohl ich es nie schaffe, eine Bierflasche ganz auszutrinken. (Irgendwann mittendrin habe ich einfach keinen Durst mehr, worauf Rube einmal meinte: »Das geht mir genauso, Kumpel, aber ich trinke trotzdem weiter.«) Die Idee mit dem Biereis am Stiel war jedoch ganz interessant, und ich beschloss, hineinzugehen und einen Versuch zu wagen.
»Ich wollte dieses Bier heute Abend trinken.«
Ich hörte die Stimme meines Vaters in dem Augenblick, als ich das Haus betrat. Sie bekam einen falschen Unterton, als er fortfuhr: »Und wessen brillante Idee war es eigentlich, Eis am Stiel aus meinem Bier zu machen, sorry – aus meinem letzten Bier?«
Stille.
Eine lange.
Stille.
Dann, schließlich die Antwort: »Meine«, als ich ins Zimmer kam.
Bleibt nur noch die Frage, wer diese Antwort gab.
War es Rube?
Octavia?
Nein.
Ich war es.
Fragt mich nicht, warum, aber ich wollte Octavia die (selbstverständlich rein verbalen) Ohrfeigen von Clifford Wolfe, meinem Vater, ersparen. Wahrscheinlich wäre es gar nicht so weit gekommen. Wahrscheinlich wäre er die Höflichkeit selbst gewesen, aber trotzdem wollte ich das Risiko nicht eingehen.
Es war viel besser, wenn er glaubte, ich sei es gewesen. Dämliche Ideen war er von mir gewohnt.
»Warum überrascht mich das nicht?«, fragte er und wandte sich mir zu. Er hielt die besagten Eisbehälter in der Hand.
Er lächelte.
Ein herrliches Lächeln, das könnt ihr mir glauben.
Dann lachte er und sagte: »Tja, Cameron, du hast wohl nichts dagegen, wenn ich deinen Teil esse, oder?«
»Natürlich nicht.« In so einer Situation sagt man immer »natürlich nicht«, denn man findet ziemlich schnell heraus, dass mein alter Herr in Wirklichkeit fragt: »Werde ich dieses Eis essen oder werde ich dir stattdessen dein Leben auf hundert verschiedene Arten schwer machen?« Da ist es nur normal, wenn man den Kopf einzieht.
Das Biereis am Stiel wurde verteilt und zwischen Octavia und mir huschte ein kleines Lächeln hin und her, dann zwischen mir und Rube.
Rube hielt mir sein Eis hin. »Willst du mal beißen?«, bot er mir an, aber ich lehnte ab.
Ich verließ die Küche und hörte meinen Vater gerade noch sagen: »Gar nicht schlecht, wirklich gar nicht schlecht.«
Mistkerl.
»Wo warst du vorhin?«, wollte Rube später von mir wissen, nachdem Octavia gegangen war. Wir lagen in unserem Zimmer in unseren Betten und unterhielten uns.
»Nur spazieren.«
»Doch nicht zufällig in Glebe, oder?«
Ich schaute zu ihm. »Was soll das heißen?«
»Es soll heißen«, seufzte Rube, »dass Octavia und ich dir einmal gefolgt sind, nur aus Neugier. Wir haben dich vor einem Haus stehen sehen. Du hast durchs Fenster gestarrt. Du bist irgendwie ein armes Schwein, was?«
Die Momente verdrehten und verbogen sich. Weit weg konnte ich den Verkehr hören, der fast lautlos dröhnte. Weit weg von alldem hier. Weit weg von Cameron Wolfe und Ruben Wolfe, die darüber sprachen, was zum Teufel ich vor dem Haus eines Mädchens zu schaffen hatte, dem ich völlig egal war.
Dann schluckte ich, atmete ein und antwortete meinem Bruder.
»Ja«, sagte ich. »Ich denke, das bin ich.«
Es gab nichts, was ich sonst hätte sagen können. Nichts, um die Sache zu vertuschen. Es gab nur einen kurzen Augenblick des Wartens, der Wahrheit und des Fühlens, dann einen Riss, und ich sagte: »Es ist diese Stephanie.«
»Die Schlampe«, spuckte Rube hervor.
»Ich weiß, aber …«
»Ich weiß«, unterbrach Rube mich. »Es ist egal, ob sie sagt, dass sie dich hasst oder dich für einen Verlierer hält. Man fühlt, was man fühlt.«
Man fühlt, was man fühlt.
Es war einer der wahrsten und wahrhaftigsten Sätze, die Rube jemals über die Lippen gekommen waren. Danach erdrückte Stille den Raum.
Von nebenan konnten wir Hundegebell hören. Es war Miffy, der erbärmliche Spitz, den wir mit unserer ganzen Liebe hassten, aber trotzdem ein paarmal in der Woche ausführten.
»Hört sich an, als wäre Miffy aufgeregt«, sagte Rube nach einer Weile.
»Ja«, sagte ich und lachte ein bisschen.
Irgendwie ein armes Schwein. Irgendwie ein armes Schwein …
Rubes Stimme vibrierte in mir, bis sich seine Worte anfühlten wie ein Hammer.
Später, als ich aufstand, mich auf die Veranda setzte und zusah, wie das Licht der Autoscheinwerfer vorbeisickerte, sagte ich mir, dass es in Ordnung sei, so zu sein, solange ich hungrig blieb. Es fühlte sich an, als käme etwas in mir an. Etwas, das ich nicht kannte, das ich weder sehen noch begreifen konnte. Es war einfach da und mischte sich in mein Blut.
Sehr schnell, ganz plötzlich flogen Worte durch meinen Kopf. Sie landeten auf dem Boden meiner Gedanken und dort, dort unten, fing ich an, die Worte aufzuheben. Sie waren Fragmente der Wahrheit, gesammelt in meinem Inneren.
Sogar mitten in der Nacht, im Bett, weckten sie mich auf. Sie malten sich an die Zimmerdecke.
Sie brannten sich in die Laken der Erinnerung, die in meinem Geist ausgebreitet waren.
Als ich am nächsten Tag erwachte, schrieb ich die Worte auf einen Papierfetzen. Und in meinen Augen veränderte die Welt an diesem Morgen ihre Farbe.
Worte von Cameron
Einem Menschen wie mir fällt nichts leicht.
Das ist keine Klage.
Nur eine Wahrheit.
Das Problem ist, dass ich Visionen auf dem Boden meiner Gedanken verschüttet habe. Ich habe dort Worte, die ich herauszubekommen versuche. Um sie aufzuschreiben.
Worte, die ich für mich aufschreiben werde.
Eine Geschichte, für die ich kämpfen werde.
Und so beginnt sie …
Es ist Nacht und ich laufe durch die Stadt in meinem Geist. Durch Straßen und Gassen. Zwischen Gebäuden hindurch, die frösteln. Zwischen Häusern, die sich, mit den Händen in den Taschen, niederkauern.
Während ich durch diese Straßen laufe, habe ich manchmal das Gefühl, sie laufen durch mich. Gedanken in mir fühlen sich an wie Blut.
Ich gehe.
Ich begreife.
Wohin gehe ich?, frage ich mich.
Wonach suche ich?
Dennoch gehe ich weiter, dringe tiefer zu einem unbekannten Ort in dieser Stadt vor. Ich werde förmlich davon angezogen.
An verwundeten Autos vorbei.
Spärlich beleuchtete Treppen hinunter.
Bis ich da bin.
Ich fühle es.
Weiß es.
Ich weiß, dass ich mein Herz in einer schattengeprügelten Gasse gefunden habe, in einer Seitenstraße in dem Irgendwo dieses Ortes.
Da unten wartet etwas.
Zwei Augen glühen.
Ich schlucke.
Mein Herz erschlägt mich.
Und jetzt gehe ich weiter, um herauszufinden, was es ist … Schritt.
Herzschlag.
Schritt.
2
Mein ältester Bruder Steve Wolfe ist das, was man einen knallharten Typen nennt. Er ist erfolgreich. Er ist clever. Er ist zielstrebig.
Steve lässt sich durch nichts aufhalten. Niemals. Es steckt nicht nur in ihm. Es ist an ihm, um ihn herum. Man kann es riechen, kann es fühlen. Seine Stimme ist fest und bestimmt. Alles an ihm sagt: »Du wirst mir nicht im Weg stehen.« Wenn er mit Leuten spricht, ist er freundlich, aber in dem Moment, in dem sie versuchen, ihn hereinzulegen, ist es mit der Freundlichkeit vorbei. Wenn jemand ihm eins auswischt, kann man seinen Arsch darauf verwetten, dass er es ihm doppelt und dreifach heimzahlt. Steve vergisst nie etwas.
Ich andererseits.
Ich bin nicht wie Steve.
Ich laufe oft herum.
Das tue ich.
Ich glaube, es kommt daher, dass ich nicht viele Freunde habe, genauer gesagt, gar keine.
Es gab eine Zeit, da wäre ich zu gerne Teil einer Meute gewesen. Ich wollte einen Haufen Kumpels, für die ich mein Herzblut geben konnte. Es kam nie dazu. Als ich jünger war, hatte ich einen Kumpel namens Greg. Er war ganz in Ordnung. Wir machten viel zusammen. Dann lebten wir uns auseinander. Das passiert ziemlich oft, nehme ich an. Da ist nichts dabei. In gewisser Weise bin ich Teil der Wolfe-Meute und das ist genug. Ich weiß ohne den Hauch eines Zweifels, dass ich für jeden in meiner Familie mein Herzblut geben würde.
Überall.
Jederzeit.
Mein bester Kumpel ist Rube.
Steve andererseits hat jede Menge Freunde, aber er würde für keinen von ihnen bluten, denn er glaubt nicht daran, dass sie dasselbe für ihn täten. Irgendwie ist er genauso allein wie ich.
Er ist allein.
Ich bin allein.
Er ist nur von Leuten umgeben, das ist alles. (Leute, die er Freunde nennt, meine ich.)
Wie auch immer, der Grund, warum ich euch das erzähle, ist der, dass ich manchmal, wenn ich abends herumlaufe, zu Steves Wohnung gehe, die etwa einen Kilometer von unserem Haus entfernt ist. Meistens dann, wenn ich es nicht mehr ertrage, vor dem Haus dieses Mädchens zu stehen. Wenn der Schmerz zu sehr schmerzt.
Steve hat eine schöne Wohnung im zweiten Stock, und er hat ein Mädchen, mit dem er zusammenlebt. Allerdings ist sie oft nicht da, denn sie arbeitet in einer Firma, die sie ziemlich viel auf Dienstreisen und so was schickt. Ich fand sie immer ganz nett. Ich denke, weil sie nicht sauer wurde, wenn ich zu Besuch kam und sie da war. Ihr Name ist Sal und sie hat schöne Beine. Schönen Beinen kann ich nicht widerstehen.
»Hallo Cam.«
»Hallo Steve.«
So begrüßten wir uns, jedes Mal wenn ich zu ihm kam.
Und so war es auch an dem Abend nach der Sache mit dem Biereis am Stiel. Ich klingelte unten. Er ließ mich rein. Wir sagten, was wir immer sagten.
Das Komische ist, dass wir im Lauf der Zeit immer besser miteinander reden können. Anfangs saßen wir nur da, tranken schwarzen Kaffee und sprachen kein Wort. Wir ließen unsere Augen lediglich in den Kaffeetassen kreisen. Unsere Stimmen blieben betäubt und stumm. Steve hegt gegen alle in der Wolfe-Familie einen seltsamen Groll, weil er sich als den Einzigen von uns betrachtet, der es zu etwas gebracht hat. Er tat so, als hätte er guten Grund, sich für uns zu schämen. Ich war mir bei ihm nie so sicher.
In letzter Zeit, genauer gesagt, seit Steve sich entschlossen hat, noch ein Jahr in seinem Football-Team dranzuhängen, gehen wir manchmal auf den Sportplatz und kicken. (Um bei der Wahrheit zu bleiben: Steve schießt den Ball ins Tor und ich hole ihn wieder.) Wir gingen dorthin, er machte das Flutlicht an und wir blieben immer eine Weile da, selbst wenn es saukalt und die Erde mit Frost bedeckt war und unsere Lungen von der Winterluft getreten wurden. Wenn es zu spät wurde, fuhr er mich sogar nach Hause.
Er fragte nie, wie es den anderen ging. Nie. Steve drückte sich viel konkreter aus.
»Schuftet sich Mum immer noch zu Tode?«
»Ja.«
»Hat Dad genug Arbeit?«
»Ja.«
»Streunt Sarah immer noch durch die Kneipen, lässt sich volllaufen und stinkt nach Schweiß, Rauch und Suff?«
»Nein, ich glaube, das ist vorbei. Sie macht viele Überstunden. Ihr geht’s gut.«
»Ist Rube immer noch Mr Obercool? Ein Mädchen nach dem anderen? Eine Prügelei nach der anderen?«
»Nein, es gibt niemanden, der sich traut, sich mit ihm anzulegen.« Rube ist zweifellos einer der besten Kämpfer in diesem Teil der Stadt. Er hat es bewiesen. Unzählige Male. »Aber mit den Mädchen hast du recht«, ergänzte ich.
»Na klar«, nickte er, und das war der Augenblick, in dem die Sache kritisch wurde – wenn das Gespräch auf mich kam.
Was konnte er fragen?
»Immer noch keine Freunde, Cameron?«
»Immer noch völlig allein, Cameron?«
»Immer noch auf den Straßen unterwegs, Cameron?«
»Immer noch eifrig mit der Hand unter der Bettdecke an der Arbeit, Cameron?«
Nein.
Jedes Mal vermied er es, genauso wie an dem Abend, von dem hier die Rede ist.
Er fragte: »Und du?« Ein Atemzug. »Kommst du klar?«
»Ja«, nickte ich. »Wie immer.«
Danach herrschte wieder Schweigen, bis ich ihn fragte, gegen wen er am Wochenende spielen würde.
Ich habe euch ja schon erzählt, dass Steve sich entschlossen hatte, noch ein Jahr länger Football zu spielen. Am Anfang der Saison hatte seine Mannschaft ihn angefleht zurückzukommen. Sie bettelten und bettelten und am Ende gab er nach. Seitdem haben sie kein einziges Spiel mehr verloren. So ist Steve.
An diesem Montagabend hatte ich meine Worte in der Tasche, weil ich beschlossen hatte, sie überallhin mitzunehmen. Sie standen immer noch auf diesem Papierfetzen, und in regelmäßigen Abständen schaute ich nach, ob sie noch da waren. Einen Augenblick lang, an Steves Tisch, stellte ich mir vor, wie ich ihm davon erzählen würde. Ich sah mich, hörte mich, fühlte mich, wie ich ihm erklärte, dass ich dadurch etwas wert zu sein glaubte, okay zu sein glaubte. Aber ich sagte nichts. Rein gar nichts. Obwohl ich dachte: Wahrscheinlich sehnen wir uns alle von Zeit zu Zeit danach. In Ordnung zu sein. Okay zu sein. Es war, wie in einen Spiegel zu schauen und nichts zu wollen, nichts zu brauchen, weil alles schon da war … So fühlte ich mich, mit den Worten in meinen Händen.
Ich nickte.
In der Erwartung.
»Was ist?«, fragte mich Steve.
»Nichts.«
»Na dann.«
Das Telefon klingelte.
Steve: »Hallo?«
Am anderen Ende: »Hey, ich bin’s.«
»Wer zum Henker ist ich?«
Es war Rube.
Steve wusste es.
Ich wusste es.