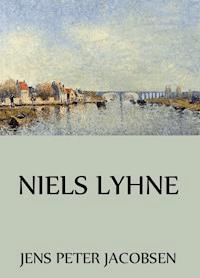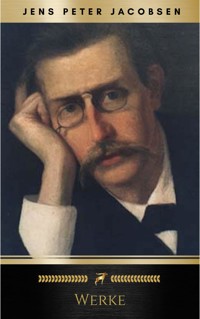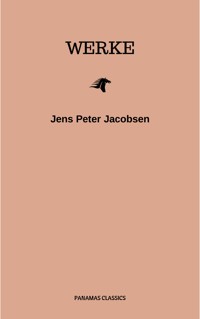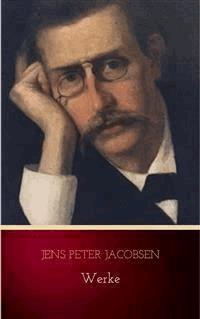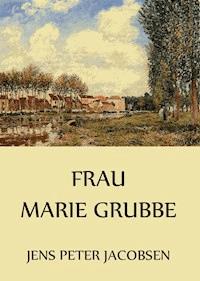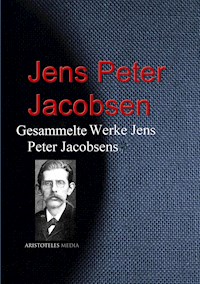0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Niels Lyhne ist eingefleischter Atheist und bekehrt mit viel Aufwand auch seine Frau zu seinem "Glauben". Doch auf dem Totenbett ruft sie den Pfarrer. Und sein Sohn schämt er sich, dass er Gott anruft, als auch er im Sterben liegt. Niels Lyhne verzweifelt, ist einsam – ohne Gott. Zum unbestrittenen Kanon der Weltliteratur gehört dieses Meisterwerk eines Ausnahmekünstlers mit anhaltendem und vielfältigem Einfluss auf den lesenden Menschen und die Literaturgeschichte – bis heute. Spannend und unterhaltend, vielschichtig und tiefgründig, informativ und faszinierend sind die E-Books großer Schriftsteller, Philosophen und Autoren der einzigartigen Reihe "Weltliteratur erleben!".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jens Peter Jacobsen
Niels Lyhne
Vorwort
Jens Peter Jacobsen wurde am 7. April 1847 in Thisted, einem Städtchen unweit des Lim Fjords, als Sohn eines wohlhabenden kleinen Kaufmanns geboren. Kaum 40 Jahre alt starb er am 30. April 1885 in Kopenhagen. Das Leben, das zwischen diesen beiden Daten spielt, war ohne große Ereignisse. Mit 16 Jahren verläßt Jacobsen seine Heimatstadt, um in Kopenhagen ein Privatgymnasium zu besuchen. Weder Fleiß noch besondere Leistungen zeichnen ihn aus. Er gilt als Sonderling, der stundenlang draußen im Stadtgraben liegt und Algen fischt. So besteht er die Reifeprüfung nicht und kommt erst 1867 zur Universität, um Naturwissenschaften zu studieren. Vorher aber macht er schon seinen ersten literarischen Versuch, der – herzlich unbedeutend – als Kuriosum nicht unerwähnt bleiben soll. Er gibt im Jahre 1864 die Wochenschrift »Kvas« heraus, die über einen Abonnenten nie herauskam.
In den Jahren 1871–1873 veröffentlicht Jacobsen in naturwissenschaftlichen Zeitschriften bemerkenswerte Arbeiten über die Lehren Darwins, für die er sich als einer der ersten in Dänemark einsetzte. Er übersetzt Darwins »Über die Entstehung der Arten« und »Die Abstammung des Menschen«. In diese Zeit fällt auch die von der Universität preisgekrönte Abhandlung: » Aperçu systematique et critique sur les desmidiacees du Danemark«, von der er selbst sagt, daß sie »außerordentlich gründlich ist; ob irgendein Mensch sie gelesen haben sollte, ist dagegen zweifelhaft«.
Jacobsen hatte inzwischen Anschluß an die junge Dichtergeneration Dänemarks gefunden, die sich um Georg Brandes scharte. Er schreibt jetzt Gedichte, zwar ohne besondere Originalität – die durch Mahlers Vertonung später so berühmten Gurrelieder befinden sich darunter –, aber sie zeigen doch schon, daß Jacobsen ein festes Ziel hat, um das er kämpft. Endlich erreicht er, was er will: den eigenen Stil, das Originelle seines Schaffens, die Realität seines Erlebens. Und so gelingt ihm 1872 der große Wurf: er veröffentlicht die Novelle »Mogens«.
Mit dieser Novelle stellte sich Jacobsen mit einem Schlag an die Spitze der jungen dänischen Literatur, deren erwählter Führer er wurde. Der Erfolg nimmt ihm die letzten Zweifel an seinem dichterischen Beruf, und er ist glücklich und voller Pläne. Es beginnen die Vorarbeiten zu seinem ersten großen Roman, zu »Frau Marie Grubbe, Interieurs aus dem 17. Jahrhundert«. Tag um Tag sitzt er jetzt in der Bibliothek und sammelt aus alten Chroniken und Pergamenten Material und Stimmungen zu seinem Werk, das möglichst schnell fertig werden soll. Doch mitten in der Arbeit macht sich das furchtbare Leiden bemerkbar, das bestimmend wurde für das weitere Leben und Schaffen des Dichters und für seinen frühen Tod. Eine Erkältung zunächst, eine Folge des stundenlangen Umherwatens im Sumpf beim Fischen von Algen; dann auf einer Italienreise in Florenz 1873 der erste Blutsturz.
Eiligst reist der Dichter zurück nach Thisted, »um zu arbeiten, und um gesund zu werden«. Er selbst will nicht an seine Krankheit glauben. »Ich werde schon eine Anstrengung machen,« schreibt er, »vorläufig ist nur etwas mit der Brust.« Aber bald darauf heißt es schon: »– Gesundheitszustand nicht gut, Schmerzen keine, aber Arbeitskraft ebensowenig.« Und wenn er auch später (1874) wieder schreibt: »Es ist indessen nicht die Brust, es ist nur die Verdauung, und das wird schon besser werden«, so versucht er damit sich und seine Umgebung über seinen Zustand zu täuschen. Elf Jahre Lebens- und Arbeitszeit läßt ihm die Krankheit noch, und in diesen elf Jahren entstehen die wenigen Werke, die das dichterische Schaffen Jacobsens darstellen. Langsam und mühevoll sind sie dem kranken, arbeitsunfähigen Körper von einem zähen Geist abgerungen. So wird »Frau Marie Grubbe« erst 1876 vollendet. Schon vor dem Abschluß dieses ersten Romans war der Plan zum zweiten, zu »Niels Lyhne«, entstanden, aber erst 1877 beginnt der Dichter mit der eigentlichen Arbeit, die er auf Reisen nach der Schweiz (1877/78) und Italien (1879) in Montreux und Rom fortsetzt.
Zwischendurch war er eine Zeitlang wieder in der Heimat, und nach der endgültigen Rückkehr wird der Roman hier in Thisted im Dezember 1880 fertig und noch im gleichen Monat veröffentlicht. »Niels Lyhne, die Geschichte einer Jugend«, wurde kein lauter Erfolg. Das Publikum hatte wieder eine Kulturschilderung wie in »Marie Grubbe« erwartet; mit diesem neuen Werk konnte es nicht fertig werden. Alles daran war ihm fremd, und selbst die Freunde des Dichters mußten erst lernen, es zu verstehen, bevor sie es bewundern konnten. Jetzt sollte nach Jacobsens Plänen ein historischer Roman folgen, »etwas Helles, Leichtes – voll Lebensfreude und Laune«, eine Geschichte, die aus der pietistischen Zeit Christians VI. hinüberreichte in die lustigen Tage Friedrichs V. Aber daraus wurde nichts mehr. Mogens, die beiden Romane und die Novellen: »Der Schuß im Nebel«, »Zwei Welten«, »Die Pest im Bergamo«, »Dort müßten Rosen blühen« und »Frau Fönß«, stellen das ganze Ergebnis seines dichterischen Schaffens dar. Im Winter 1884 finden wir den Dichter in Kopenhagen, immer kränker, einsamer und von stolzer Verschlossenheit. »Er war stolz auf die Art, wie man sich ehedem Königssöhne stolz dachte, wenn das Unglück über ihnen war.« Im Sommer 1884 hatte er zum letzten Male die neunzehnstündige Reise nach Thisted gemacht, die ihm fast den Tod brachte. Aber er erholt sich noch einmal. Noch einmal kann er nach Kopenhagen zurückkehren, erlebt noch einmal den Frühling und die herrliche Zeit der ersten Kirschenblüte. Dann stirbt er am 30. April 1885 in den Armen seiner Mutter. Ihr galt sein letztes Gefühl, sein letztes Lebewohl.
Als man Jacobsen einst um eine Schilderung seines Lebens bat, schrieb er: »... was Begebenheiten anlangt, so weiß ich mich wirklich an keine zu erinnern, die Interesse haben könnten und zu erwähnen wären; die hingegen, die nicht erwähnt werden können, sind natürlich interessant genug.« Wir haben den äußeren Lebenslauf des Dichters geschildert, und wir müssen ihm in seiner Behauptung recht geben: Große Begebenheiten, die sein Leben bestimmen, die es in schicksalhaftes Auf und Ab verflechten, die sein Schaffen bestimmend beeinflussen, ihm Richtung und Ziel geben, sind nicht vorhanden. Es bleibt, »was nicht erwähnt werden kann«: Das innere Leben, das dieser scheue, vornehme Mensch tief und leidenschaftlich lebt, die zarte, empfindliche Seele, deren Regungen der Umwelt in ständiger Abwehr verborgen gehalten werden hinter der Maske der Ironie. Wir wissen nichts vom Werden der Welt in ihm, wissen nicht, wie dieser Dichter wurde, wie das Werk entsteht und wächst. Keine Tagebuchblätter, kaum Briefe gestatten Einblick in sein Schaffen. Nur das Werk bleibt uns, um den Menschen daraus kennenzulernen.
Dieses Werk zeigt uns einen Menschen, der zugleich Phantast ist und Realist; der fest auf der Erde steht und die Dinge so sieht, wie sie sind – und der alle Wahrnehmungen und alle Ergebnisse seines Forschens nur benutzt, um den Gestalten seiner Träume Inhalt zu geben. Er ist Forscher und Dichter zugleich. Er sieht deutlich jede Einzelheit einer Erscheinung und weiß ihren Charakter scharf zu umschreiben; aber niemals verliert er sich in Einzelheiten. Punkt für Punkt setzt er hin, und alles vereinigt er zu einem Gemälde, das lebendig ist, und das die Stimmung trägt, die der Dichter, der Künstler ihm aus eigenem gibt.
In seinem Erstlingswerk läßt Jacobsen einmal Thora den Mogens fragen, ob er die Natur liebe, »die Natur am Werkeltage?«
»Gradeso,« antwortet Mogens, »gradeso; jedes Blatt, jeder Zweig, jeder Lichtstrahl, jeder Schatten kann mich erfreuen. Kein Hügel ist so kahl, keine Torfgrube so viereckig, keine Landstraße so langweilig, daß ich mich nicht einen Augenblick darin verlieben könnte.«
»Welche Freude können Sie dann aber an einem Baum, an einem Busch haben, wenn Sie sich nicht vorstellen, daß ein lebendes Wesen darin wohnt, das die Blumen öffnet und schließt und die Blätter glättet? Wenn Sie einen See sehen, einen tiefen, klaren See, lieben Sie ihn dann nicht deshalb, weil Sie sich vorstellen, daß tief, tief unten Wesen wohnen, die ihre Freuden und ihre Sorgen haben, ihr eigenes seltsames Leben mit seltsamem Sehnen; und was ist zum Beispiel am Bredbjerg Grünhügel Schönes, wenn Sie sich nicht denken, daß ganz, ganz kleine Gestalten darin wimmeln und summen; die seufzen, wenn die Sonne aufgeht, jedoch zu tanzen und zu spielen beginnen, wenn der Abend kommt.«
»Wie wundersam schön das ist! Und dies sehen Sie?« »Und Sie?«
»Ich kam es nicht erklären, aber es liegt in der Farbe, in der Bewegung und in der Form, und dann in dem Leben, das darin ist; der Saft, der in Bäume und Blumen steigt, der Regen und die Sonne, die ihnen Wachstum bringen, der Sand, der in Haufen zusammenweht, und die Regenschauer, die die Abhänge furchen und zerklüften! Ach! Das läßt sich gar nicht begreifen, wenn ich es erklären soll.«
»Und ist das genug für Sie?«
»Es ist oft zuviel! – allzuviel! Und wenn nun Form und Farbe und Bewegungen so reizend sind und so leicht, und hinter all dem eine seltsame Welt liegt, die lebt und jubelt und seufzt und verlangt und das alles sagen und singen kann, dann fühlt man sich so verlassen, wenn man jener Welt nicht nahekommen kann, und das Leben wird so matt und so schwer.«
Das ist die Art, in der Jacobsen die Natur sieht, genau so, wie er es durch Mogens sagen läßt. Er ist kein Romantiker, der die Dinge lebendig werden läßt, indem er sie zu Geistern und Elfen macht. – Er sucht das Leben in der Natur selbst, und jede Blume, jeder Strauch, jeder Berg und jeder Stein hat seine eigene Seele, sein eigenes Leben, das man erkennen muß. Und wo die Sinne zum Erkennen nicht ausreichen, da muß die Traumkunst helfen; da erkennt der Dichter, der Künstler kraft seiner Intuition das Wesen der Dinge. So wie ein Maler die Natur und das Leben und die Menschen malt – so schreibt Jacobsen, und das war das Neue an seiner Kunst. Dieses Neue, dieses Malen mit Worten brachte ihm den großen Erfolg, als er »Frau Marie Grubbe« veröffentlichte. Hier sind wirkliche »Interieurs des 17. Jahrhunderts« entstanden, Bilder von einer Treue des Zeitkolorits, die sich bis in den Stil und die Aufstellung ganz neuer Worte ausprägt. Episodenhaft steht Gemälde neben Gemälde. Alle sind unendlich fein gemalt, jedes in sich einheitlich geschlossen; aber die Komposition des Ganzen, der einheitliche künstlerische Aufbau fehlt. Das ist der Fehler in allen Werken des Dichters, dem alle Technik unwichtig und nebensächlich erschien.
»Niels Lyhne«, der Roman, dem diese Einleitung vorangeht, ist Jacobsens größtes Werk. Es sollte die Geschichte einer »Jugend« werden, »eine psychologische Schilderung jener Gruppe freidenkend angelegter Romantiker«, »jener Jugend, die jetzt alt ist«. Aber es wurde schließlich doch nur das, was der Dichter nicht wollte, »eine Jugendgeschichte«, die Geschichte des einzelnen Menschen »Niels Lyhne«. Niels Lyhne ist die Gestalt des großen Träumers, der, hin und her geworfen zwischen Traum und Leben, das Leben nicht zwingen kann, weil er, ewig ein Träumer, nie sich selbst ganz fand, und der den Traum, die Illusion nicht entbehren kann, weil nur im Traum Glück ist, weil er weiß, daß Sehnen mehr ist als Erfüllung.
Und das ist schließlich das Wesen und der Kern aller Gestalten, die der Dichter schuf. Und das ist schließlich der Mensch Jacobsen selbst. Ein Realist, der aus des Lebens Wirklichkeit sich seine Träume schuf, der mit beiden Füßen fest auf der Erde stand und ewig den Traum von Schönheit und Glück träumte.
In Sehnsucht, in Sehnsucht ich lebe.
Dieser Ausklang eines seiner Gedichte waren die Musik und das Leitmotiv seines Lebens.
1. Kapitel
Sie hatte der Blider schwarze, strahlende Augen mit den feinen, schnurgeraden Brauen, sie hatte ihre stark ausgebildete Nase, ihr kräftiges Kinn und ihre schwellenden Lippen. Auch den seltsamen, schmerzlich sinnenden Zug um die Mundwinkel und die unruhigen Kopfbewegungen hatte sie geerbt; ihre Wange aber war bleich und weich wie Seide war ihr Haar, das sich glatt und leicht um die Form des Kopfes legte.
So waren die Bliders nicht; ihre Farben waren Rosen und Bronze. Ihr Haar war struppig und kraus, wie eine Mähne so dicht; und tiefe, volle, biegsame Stimmen hatten sie, seltsame Zeugnisse für die Überlieferungen ihrer Familie – von lärmenden Jagdfahrten, feierlichen Morgenandachten und den tausend Liebesabenteuern ihrer Vorfahren.
Aber ihre Stimme war matt und klanglos.
Ich erzähle von ihr, wie sie als Siebzehnjährige war; ein paar Jahre später, als sie verheiratet war, hatte ihre Stimme mehr Fülle, die Farbe der Wangen war frischer, und das Auge zwar matter, zugleich aber größer und dunkler geworden.
Mit siebzehn Jahren aber war sie sehr verschieden von ihren Geschwistern, und es bestand auch eigentlich kein nahes Verhältnis zwischen ihr und ihren Eltern. Die Bliders nämlich waren ein praktisches Geschlecht und nahmen das Leben so, wie es war; sie taten ihre Arbeit, schliefen ihren Schlaf und verlangten nie nach anderen Vergnügungen als nach dem Erntefest und drei, vier Weihnachtsschmäusen. Religiös bewegt waren sie nicht; aber es hätte ihnen ebenso leicht einfallen können, ihre Steuern nicht zu zahlen, als Gott nicht zu geben, was Gott gebührte; und deshalb sprachen sie ihr Abendgebet, gingen an hohen Feiertagen in die Kirche, sangen am Weihnachtsabend ihren Choral und nahmen zweimal im Jahr das heilige Abendmahl. Sie waren auch nicht wißbegierig, aber ihr Sinn war durchaus nicht unempfänglich für kleine, sentimentale Lieder, und wenn der Sommer kam, und das Gras dicht und üppig auf den Wiesen wuchs, und die Ähren auf den weiten Äckern wogten, dann sagten sie wohl zueinander, daß die Zeit schön sei, um über Land zu fahren; aber sie waren keine besonders poetischen Naturen; Schönheit berauschte sie nicht, sie hatten keine unbestimmte Sehnsucht, kannten keine wachen Träume.
Aber mit Bartholine war es anders; sie hatte durchaus kein Interesse für die Ereignisse im Stall und auf den Feldern, kein Interesse für Meierei und Haushalt – nicht das geringste.
Sie liebte Gedichte.
In Gedichten lebte sie, in Gedichten träumte sie, und an Gedichte glaubte sie beinahe mehr als an alles andere. Eltern und Geschwister, Nachbarn und Bekannte sprachen nie ein Wort, das anzuhören gelohnt hätte, denn ihre Gedanken erhoben sich nie über das Fleckchen Erde oder über die Arbeit, die sie unter den Händen hatten; ebensowenig wie ihre Blicke jemals über Verhältnisse und Begebenheiten hinaussahen, die sie vor Augen hatten. –
Aber ihre Gedichte! Die waren für sie voll neuer Gedanken und tiefsinniger Weisheit vom Leben draußen in der Welt, wo der Kummer schwarz, und die Freude rot ist; sie funkelten von Bildern, schäumten und perlten in Rhythmen und Reimen; – sie handelten immer von jungen Mädchen, und die jungen Mädchen waren edel und schön, sie wußten selbst kaum wie sehr, ihre Herzen und ihre Liebe waren mehr wert als alle Reichtümer der Welt; und die Männer trugen sie auf Händen, hielten sie hoch empor in den wonnigen Glanz des Glücks, ehrten sie und beteten sie an, waren glücklich, ihre Gedanken und Pläne, Sieg und Ehre mit ihnen teilen zu dürfen, und sagten dann noch obendrein, daß diese glücklichen jungen Mädchen ihnen alle Pläne ersonnen und alle Siege errungen hätten.
Und warum sollte man nicht selbst solch ein Mädchen sein können? Diese sind so – und jene so – sie selbst aber wissen es nicht; weiß ich denn, wie ich bin? und die Dichter sagen ausdrücklich, dies sei das Leben, und leben bedeute nicht nähen und stricken, den Haushalt führen und dumme Besuche machen.
Eigentlich lag, genau genommen, in all dem nur der ein wenig krankhafte Trieb, sich selbst zu fühlen, das Streben, sich selbst zu finden, das so oft bei einem jungen, mehr als gewöhnlich begabten Mädchen erwacht; schlimm aber war, daß sich in ihrer Umgebung keine einzige überlegene Natur befand, an der sie ihre eigene Begabung hätte messen können; nicht einmal eine verwandte Natur gab es, und so kam sie dazu, sich selbst als etwas Merkwürdiges, Einzigartiges, als tropisches Gewächs zu betrachten, das unter rauhem Himmelsstrich emporgeschossen nur kümmerlich seine Blätter zu entfalten vermag, während es in wärmerer Luft, unter einer heißeren Sonne schlanke Stengel mit einem wunderbar reichen, strahlenden Blumenflor getrieben hätte. Das, meinte sie, sei ihr eigentliches Wesen, und das hätte rechte Umgebung aus ihr machen können, und sie träumte tausend Träume von diesen sonnigen Gegenden, verzehrte sich vor Sehnsucht nach ihrem wahren, reichen Ich und vergaß, was zu vergessen so nahe liegt, daß selbst die schönsten Träume, das tiefste Sehnen den menschlichen Geist nicht um einen Zoll fördern.
Dann kommt eines Tages einer und freit um sie. Es war der junge Lyhne auf Lönborghof. Letzter männlicher Sprosse seines Geschlechts, das während drei Generationen zu den intelligentesten in der Provinz gehört hatte. Als Bürgermeister, Amtsverwalter oder königliche Kommissarien, häufig mit dem Justizrattitel bedacht, dienten sie in reiferem Alter ihrem König und ihrem Vaterland. In ihren jungen Jahren hatten sie auf vernünftig geordneten und gründlich durchgeführten Studienreisen in Frankreich und Deutschland ihren leichtempfänglichen Geist mit den Kenntnissen, Kunstgenüssen und Lebenseindrücken bereichert, die ihnen die fremden Länder in so reichem Maße boten; und wenn sie dann heimkehrten, so wurden die Erinnerungen an jene Jahre im Ausland nicht beiseite gelegt, wie man die Erinnerung an ein Fest abtut, dessen letztes Licht und letzter Ton leise verschweben; nein, das Leben in der Heimat wurde auf diesen Jahren aufgebaut und die einmal geweckten Interessen ließ man nicht in Verfall geraten, sondern pflegte und förderte sie durch alle Mittel, die zu Gebote standen; so waren denn ausgesuchte Kupferstiche, kostbare Bronzen, deutsche Dichterwerke, französische Rechtsabhandlungen und französische Philosophie Alltagsdinge und Alltagsgespräche im Hause der Lyhne.
Was ihr Wesen betraf, so bewegten sie sich mit einer altmodischen Leichtigkeit und stilvollen Liebenswürdigkeit, die oft eigentümlich genug abstach von der plumpen Majestät und unbeholfenen Stattlichkeit ihrer Standesgenossen. Ihre Rede war breit abgerundet, zierlich pointiert, aber ein wenig affektiert rhetorisch, das ließ sich nicht leugnen; aber sie paßte ausgezeichnet zu diesen großen, breiten Gestalten, mit den hohen, gewölbten Stirnen, dem dichten lockigen Haar, den hellen, ruhig lächelnden Augen und den feingeformten, ein wenig gebogenen Nasen; der untere Teil des Gesichts hingegen war zu grob, der Mund zu breit, und die Lippen waren auch zu voll.
Doch wie diese äußeren Züge schwächer bei dem jungen Lyhne hervortraten, so war auch gleichsam die Intelligenz in ihm müde geworden; und sowohl die geistigen Aufgaben als auch die ernsten Kunstgenüsse, die er auf seinem Wege getroffen, hatten keinerlei Eifer oder Streben in ihm geweckt; seiner Pflicht getreu hatte er sich mit ihnen beschäftigt und Anstrengungen gemacht; die Anstrengungen jedoch wurden keineswegs durch die Freude erträglicher, die er etwa darüber empfand, seine Kräfte in Schwung kommen zu fühlen, und kein stolzes Selbstgefühl belohnte sie, als es sich zeigte, daß diese Kräfte ausreichten. Die Befriedigung darüber, daß er überhaupt gerungen hatte, war der einzige Lohn, den er erhielt.
Sein Gut Lönborghof hatte er von einem kürzlich verstorbenen Onkel geerbt; deshalb war er von der traditionellen Auslandsreise zurückgekehrt, um der Bewirtschaftung der Besitzung selbst vorzustehen. Und da die Bliders seine nächsten Gutsnachbarn waren, und sein Onkel in vertrauten Beziehungen zu der Familie gestanden, machte er dort einen Besuch, sah Bartholine und verliebte sich in sie.
Daß sie sich in ihn verliebte, war beinahe selbstverständlich.
Das war endlich einmal einer aus der Welt da draußen, einer, der in den großen, fernen Städten gelebt hatte, wo Wälder von Türmen sich vom sonnenklaren Himmel abhoben, wo die Luft erzitterte vom Klang der Glocken, vom Brausen der Orgel, von den Tönen der Mandoline, während glänzende Aufzüge in Gold und Farben festlich durch die breiten Straßen wallten; wo Marmorpaläste schimmerten, und die bunten Wappenschilder stolzer Geschlechter paarweise über hohen Toren prangten, während oben auf gewölbten steinernen Balkonen Schleier wehten und Fächer blitzten. Der hatte doch jene Gegenden durchwandert, wo siegreiche Heere des Weges gezogen waren; wo gewaltige Schlachten die Namen von Dörfern und Feldern mit unsterblichem Glanz umgaben; wo der Rauch von den Lagerfeuern der Zigeuner weit über die Kronen der Wälder aufstieg, während rote Ruinen von weinumkränzten Höhen in ein lächelndes Tal hinabblickten, wo das Mühlrad brauste, und die Herden mit läutenden Glocken über hochgewölbte Brücken heimwärtszogen.
Von all diesen Dingen erzählte er, aber nicht wie die Dichter, sondern ganz natürlich und so vertraut damit, ganz wie sie zu Hause von den Städten und Nachbargemeinden des Stifts redeten. Er sprach auch von den Malern und Dichtern, und er hob Namen bis in den Himmel, die sie niemals hatte nennen hören. Er zeigte ihre Bilder und im Garten drunten auf dem Hügel, von wo sie auf die blanken Wasser des Fjords und die braunen Wogen der Heide sehen konnten, las er ihre Gedichte vor; – die Liebe machte ihn poetisch, die Gegend wurde schön, die Wolken wurden zu den Wolken, die durch die Gedichte zogen, und die Bäume des Gartens hatten das Laub, das in den Balladen so wehmütig rauschte.
Bartholine war glücklich, denn ihre Liebe löste Tag und Nacht in eine Reihe poetischer Situationen auf. So war es Poesie, wenn sie den Weg hinunter ihm entgegenschritt; die Begegnung war Poesie, der Abschied war es; es war Poesie, wenn sie oben auf dem Hügel stand, im Schein der Abendsonne, und ihm ein letztes Lebewohl zuwinkte und dann wehmütig froh auf ihre einsame Kammer ging, um ungestört an ihn zu denken; und wenn sie in ihrem Abendgebet für ihn betete, dann war auch das Poesie.
Jetzt empfand sie nicht mehr jenes unbestimmte Sehnen; das neue Leben mit seinen wechselnden Stimmungen genügte ihr, und ihre Gedanken und Anschauungen waren klar geworden, denn da war jetzt einer, vor dem sie sich rückhaltlos geben konnte, ohne Furcht, mißverstanden zu werden.
Auch in anderer Hinsicht hatte sie sich verändert; das Glück hatte sie Eltern und Geschwistern gegenüber liebenswürdiger gemacht, und sie fand, daß alle eigentlich verständiger waren und mehr Gefühl besaßen, als sie geglaubt hatte.
Dann heirateten sie.
Das erste Jahr glich sehr der Brautzeit; aber als sie länger zusammenlebten, konnte Lyhne es allmählich vor sich selbst nicht mehr verbergen, daß er müde wurde, seiner Liebe beständig neuen Ausdruck zu verleihen, ständig gehüllt in das Flügelkleid der Poesie, die Schwingen auszubreiten, zum Flug durch alle Himmel der Stimmungen und alle Tiefen der Gedanken; er sehnte sich danach, in behaglicher Ruhe still auf seinem Zweig zu sitzen und sein müdes Haupt zum Schlummer im weichen Flaum der Flügel zu bergen. Er stellte sich die Liebe nicht vor wie eine ewig lebendig lodernde Flamme, die mit ihrem mächtigen, flackernden Schein in alle ruhigen Falten des Daseins hineinleuchtete und phantastisch alles größer und fremder erscheinen ließ, als es war – für ihn war die Liebe eher still wie die ruhig glimmende Glut, die vom weichen Aschenlager ihre gleichmäßige Wärme ausstrahlt und in gedämpftem Dämmerlicht das Ferne sanft verhüllt und das Nahe doppelt nah und doppelt heimatlich erscheinen läßt.
Er war müde, ermattet; er konnte diese ewige Poesie nicht ertragen, er sehnte sich nach dem festen Boden des Alltags wie ein Fisch, der in der heißen Luft erstickt, sich nach der klaren, frischen Kühle der Wogen sehnt. Es mußte aufhören, es mußte von selbst aufhören; Bartholine stand dem Leben und den Büchern nicht mehr unerfahren gegenüber, sie war ebenso vertraut damit wie er; er hatte ihr alles gegeben, was er erhalten hatte, und jetzt sollte er immer noch geben; weiter und weiter, das war unmöglich, er hatte nichts mehr; – sein einziger Trost war, daß Bartholine sich Mutter fühlte. Schon lange hatte Bartholine mit Kummer bemerkt, daß sich Lyhnes Bild in ihr mehr und mehr veränderte, daß er nicht mehr auf der schwindelnden Höhe stand, wohin sie ihn in der Verlobungszeit gestellt hatte. Sie zweifelte noch nicht daran, daß er das war, was sie eine poetische Natur nannte; aber sie war ängstlich geworden, denn die Prosa hatte begonnen, zuweilen den Pferdefuß hervorzustecken. Desto eifriger jagte sie der Poesie nach und versuchte, den alten Zustand wiederherzustellen, indem sie ihn mit noch mehr Stimmung umgab, mit noch größerer Begeisterung; aber sie fand so geringen Widerklang, daß sie sich selbst fast sentimental und affektiert vorkam. Eine Zeitlang versuchte sie noch, den widerstrebenden Lyhne mitzuziehen; sie wollte nicht an das glauben, was sie ahnte; aber als das Fruchtlose ihrer Anstrengung allmählich Zweifel in ihr erweckte, ob ihr Geist und ihr Herz wirklich solch großen Reichtum bargen, wie sie geglaubt hatte, da ließ sie ihn plötzlich fallen, wurde kalt, still und verschlossen und suchte die Einsamkeit, um in Ruhe über ihre zerstörten Illusionen zu trauern. Denn sie sah nun, daß sie bitter getäuscht war, und daß Lyhne sich innerlich eigentlich gar nicht von den Menschen ihrer alten Umgebung unterschied; und was sie betrogen hatte, schien ihr das ganz gewöhnliche zu sein: seine Liebe hatte ihn für eine kurze Stunde mit einer flüchtigen Glorie von Geist und Hoheit umgeben, was sooft bei niederen Naturen geschieht.
Diese Veränderung in ihrem Verhältnis beängstigte und betrübte Lyhne, und er bemühte sich, es gutzumachen durch unglückliche Versuche, noch einmal den alten schwärmerischen Flug zu fliegen; aber das diente nur dazu, Bartholine noch klarer zu beweisen, wie groß ihr Irrtum gewesen war.
So stand es zwischen den Eheleuten, als Bartholine ihr erstes Kind zur Welt brachte. Es war ein Knabe, und sie nannten ihn Niels.
2. Kapitel
In gewisser Weise führte das Kind die Eltern wieder zusammen, denn an seiner Wiege fanden sie sich stets in gemeinsamer Hoffnung, in gemeinsamer Freude und in gemeinsamer Furcht; an das Kind dachten sie und von ihm sprachen sie gleich gern und gleich oft; und dann war einer dem andern so dankbar für das Kind und für seine Freude darüber und seine Liebe zu ihm.
Aber es lag doch eine weite Kluft zwischen ihnen.
Lyhne ging ganz auf in seiner Landwirtschaft und in Gemeindeangelegenheiten, ohne doch in irgendeiner Weise führend oder reformierend aufzutreten; aber er arbeitete sich gewissenhaft in das Bestehende hinein, sah als beteiligter Zuschauer zu und gab sein Einverständnis zu den vernünftigen Verbesserungen, die sein alter Großknecht oder der Gemeindeälteste nach genauer Überlegung, nach sehr genauer Überlegung vorschlugen.
Die Kenntnisse zu verwerten, die er in früherer Zeit erworben hatte, das fiel ihm niemals ein; dazu hatte er viel zu wenig Vertrauen zu dem, was er Theorie nannte und allzu viel Achtung vor den durch alten Brauch geheiligten Erfahrungssätzen, die die andern das wirklich Praktische nannten. Überhaupt deutete nichts an ihm darauf hin, daß er nicht Zeit seines Lebens an diesem Ort und in dieser Weise gelebt hatte. Eine Kleinigkeit jedoch ausgenommen. Nämlich diese, daß er oft halbe Stunden lang an einer Hecke, oder auf einem Grenzstein sitzen und in seltsam vegetativer Ergriffenheit auf den üppig grünenden Roggen, oder den goldnen, ährenschweren Hafer starren konnte. Das hatte er anderswoher; das erinnerte an den früheren Lyhne, den jungen Lyhne.
Bartholine, in ihrer Welt, fand sich nicht so schnell zurecht, nicht so auf einmal, ohne Aufhebens und Herumtasten. Nein, erst klagte sie in den Versen von hundert Dichtern, in der weitschweifigen Breite jener Zeit über die tausend Fesseln, Bande und Schranken des menschlichen Lebens; bald kleidete die Klage sich in laute Wut, die ihren Wortgeifer gegen die Throne der Kaiser und die Gefängnisse der Tyrannen schleudert, bald in den stillen, mitleidigen Kummer, der das reiche Licht der Schönheit zurückweichen sieht von einem blinden und sklavisch gesonnenen Geschlecht, geknechtet und niedergebeugt von der gedankenlosen Geschäftigkeit des Tages; – und dann wieder war das Gewand dieser Klage wie das stille Seufzen nach dem freien Flug des Vogels oder nach der Wolke, die so leicht in die Ferne segelt.
Aber sie wurde zu klagen müde, und die aufreizende Ohnmacht der Klage stachelte sie an zu Zweifel und Bitterkeit; und wie gewisse Gläubige ihren Heiligen zertrümmern und ihn mit Füßen treten, wenn er seine Macht nicht zeigen will, so verspottete sie jetzt die vergötterte Poesie und höhnisch fragte sie sich wohl selber, ob nicht nächstens der Vogel Rock sich unten auf dem Gurkenbeet zeigen oder Aladins Höhle sich unter dem Fußboden des Milchkellers auftun würde; in kindischem Zynismus belustigte sie sich damit, die Welt übertrieben prosaisch zu machen, nannte den Mond einen grünen Käse und die Rosen Potpourri, alles in dem Gefühl, daß sie sich räche, aber zugleich auch mit dem halb ängstlichen, halb aufreizenden Bewußtsein, daß dies Blasphemie sei.
Der Befreiungsversuch, der hierin lag, mißglückte. Sie versank wieder in ihre Träume, Träume aus der Mädchenzeit; aber es bestand der Unterschied, daß nun keine Hoffnung aus ihnen hervorleuchtete; und dazu kam dann noch: sie hatte gelernt, daß alles nur Träume waren, ferne, betörende Luftgebilde, die keine Sehnsucht der Welt zu ihrer Erde herabzuziehen vermochte; und wenn sie sich ihnen jetzt hingab, so geschah es nur mit Unruhe, und trotz einer strafenden Stimme in ihrem Innern, die ihr sagte, daß sie dem Trinker gleiche, der weiß, daß seine Leidenschaft verderblich ist, und daß jeder neue Rausch seiner Schwäche Kräfte nehme und sie der Macht seiner Leidenschaft hinzufüge. Aber die Stimme sprach vergebens, denn ein nüchtern gelebtes Leben ohne das süße Laster der Träume war kein mögliches Leben – das Leben hatte ja nur den Wert, den die Träume ihm verliehen.
So verschieden waren des kleinen Niels Lyhne Vater und Mutter, die beiden freundlichen Mächte, die ohne es zu wissen, einen Kampf um seine junge Seele kämpften, von dem Augenblick an, wo sich nur ein Schimmer von Intelligenz zeigte, mit der etwas anzufangen war; und je älter das Kind wurde, desto heftiger wurde der Kampf, denn um so reicher wurde die Auswahl unter den Waffen.
Die Eigenschaft des Sohnes, durch die die Mutter auf ihn einzuwirken suchte, war seine Phantasie, und Phantasie besaß er in vollem Maß; aber schon als ganz kleines Kind zeigte er, daß für ihn ein bedeutender Unterschied bestand zwischen der Fabelwelt, die der Mutter Worte schuf und der, die wirklich war; denn es geschah mehr als einmal, wenn die Mutter ihre Märchen erzählte, und die große Bedrängnis des Helden schilderte, daß Niels, der gar keinen Ausweg aus all diesem Jammer zu finden vermochte, und nicht mehr wußte, wie all diesem Elend abgeholfen werden könne, das sich in undurchdringlichem Ring enger und enger um ihn und seinen Helden auftürmte, – ja, da geschah es manches Mal, daß Niels plötzlich seine Wange an die der Mutter preßte und mit Tränen in den Augen und bebenden Lippen flüsterte: »Aber dies ist doch nicht wirklich wahr?« Und wenn er dann die tröstende Antwort erhalten, die er erhoffte, so seufzte er tief erleichtert auf und lauschte der Geschichte in ruhigem Wohlbehagen zu Ende.
Aber die Mutter liebte eigentlich diese Fahnenflucht nicht.
Als er zu groß geworden war für die Märchen, und sie müde wurde, immer neue zu erdichten, erzählte sie ihm mit kleinen Ausschmückungen von all den Heroen aus Krieg und Frieden, deren Leben geeignet war, darzutun, welche Macht einer Menschenseele innewohnt, wenn sie nur das Eine, das Große will und sich nicht mutlos abschrecken läßt von dem kurzsichtigen Zweifel des Tages, noch herabsinkt in weichen, tatenlosen Frieden. Das war der Ton ihrer Erzählungen, und da die Weltgeschichte nicht Helden genug hatte, die paßten, so erwählte sie sich einen Phantasiehelden, über dessen Taten und Schicksale sie frei verfügen konnte – so recht einen Helden nach ihrem eigenen Herzen, Geist von ihrem Geiste, Fleisch von ihrem Fleische, Blut von ihrem Blute genährt. Einige Jahre nach Niels Geburt hatte sie nämlich einen toten Knaben zur Welt gebracht, und eben diesen wählte sie; all das, was er hätte werden und vollbringen können, wurde nun dem Bruder in wildem Wechsel vorgeführt, Prometheussehnen, Messiasmut und Herkuleskräfte, naive Travestien voll unbändiger Verschrobenheit, eine Welt wohlfeiler Phantastereien, die von dem, was Wirklichkeit war, nicht mehr in sich trugen, als eben dieses arme, kleine Kinderskelett, das dort oben auf dem Lönborger Friedhof in Staub und Asche zerfiel.
Niels irrte sich nicht in der Moral dieser Erzählungen; er begriff vollkommen, daß es verächtlich sei, so zu werden, wie die Menschen im allgemeinen waren; er war auch bereit, das harte Schicksal auf sich zu nehmen, das den Heroen zufiel; und in der Phantasie litt er willig unter den aufreibenden Kämpfen, dem harten Mißgeschick, dem Martyrium des Verkanntwerdens und der friedlosen Siege, – aber es war ihm doch eine unvergleichliche Erleichterung, daß es bis dahin noch gute Weile habe – daß all das erst kommen sollte, wenn er groß war.
Wie die Traumbilder, Traumtöne einer Nacht eingehen in den wachen Tag und in Nebelformen, im verklingenden Ton den Gedanken anrufen können, so daß er eine flüchtige Sekunde gleichsam aufhorcht, verwundert fragt, ob ihn Wirklichkeit rief – so flüsterten die Vorstellungen jener traumgeborenen Zukunft leise durch Niels Lyhnes Kindertage und erinnerten ihn sanft doch unaufhörlich daran, daß dieser glücklichen Zeit eine Grenze gesetzt sei, und daß sie endlich eines Tages nicht mehr sein würde.
Solches Bewußtsein erweckte den Drang, das Leben der Kindheit in seiner ganzen Fülle zu genießen, es durch alle Sinne einzusaugen, nicht einen Tropfen zu vergeuden, nicht einen einzigen, und darum lag in seinen Spielen eine Innerlichkeit, die sich zur Leidenschaft steigerte unter dem Druck des unruhigen Gefühls, daß die Zeit für ihn verrann, ohne daß er aus ihren vollen Wellen alles hätte bergen können, was sie Welle auf Welle brachte; und darum konnte er sich zu Boden werfen und vor Verzweiflung schluchzen, wenn er sich an einem freien Tage langweilte, weil ihm dies oder jenes fehlte, Spielkameraden, Erfindungsgabe oder trockenes Wetter; und darum ging er stets so ungern zu Bett, denn der Schlaf war das Ereignislose, das völlig Empfindungslose. Aber nicht immer war es so.
Es geschah auch, daß er sich müde lief, und daß seine Phantasie keine Farben mehr hatte. Dann fühlte er sich ganz und gar unglücklich, fühlte sich zu klein und nichtig für seine ehrgeizigen Träume, ja, es erschien ihm, daß er ein unwürdiger Lügner sei, der sich frech den Anschein gegeben hatte, das Große zu lieben und zu verstehen, während er in Wirklichkeit nur Gefühl für das Gemeine hatte, während er das Alltägliche liebte, und alle, alle niedrigen Wünsche und Begierden lebendig in sich trug; ja, es geschah auch, daß er gegen das Erhabene den Klassenhaß des Gewürms empfand, und voll Freude diese Heroen gesteinigt hätte, die von besserem Blute waren als er, und die wußten, daß sie es waren.
An solchen Tagen mied er seine Mutter, und mit dem Gefühl, daß er einem unedlen Instinkt folge, suchte er den Vater und hatte ein williges Ohr und einen empfänglichen Sinn für dessen erdgebundene Gedanken und traumlose Erklärungen. Er fühlte sich dann so wohl beim Vater, war so froh, daß sie einesgleichen waren und vergaß beinahe, daß dies derselbe Vater war, auf den er von den Zinnen seines Traumschlosses voll Mitleid herabgesehen hatte. Natürlich stand dies nicht mit der Klarheit und Bestimmtheit vor seinem kindlichen Bewußtsein, die das gesprochene Wort den Dingen verleiht – aber es war doch da, unfertig, ungeboren, als unbestimmter, ungreifbarer Keim; es glich der seltsamen Vegetation eines Meeresgrundes, durch fahles Eis gesehen; schlagt das Eis in Stücke oder zieht das dunkel Lebende an das Licht der Worte: das gleiche geschieht – das, was ihr dann sehen und greifen könnt, ist in seiner Klarheit nicht das Dunkle, das gewesen.
3. Kapitel
Und die Jahre schwanden dahin, eine Weihnacht folgte der andern und füllte die Luft mit ihrem strahlenden Festesglanz bis weit über den Dreikönigstag; Pfingstferien folgten auf Pfingstferien im Lauf über blumensprießende Frühlingswiesen; Sommerferien auf Sommerferien kamen heran, feierten ihre Orgien in freier Luft, ihre Sommergelage und gossen ihren Sommerwein aus vollen Schalen; dann eines Tages, mit der sinkenden Sonne liefen sie fort, und zurück blieb nur die Erinnerung mit sonnverbrannten Wangen, verwunderten Augen und tanzendem Blut.
Und die Jahre schwanden, und die Welt war nicht mehr die Wunderwelt, die sie früher gewesen; diese dunkeln Winkel hinter morschen Holunderbäumen, diese geheimnisvollen Bodenkammern und jener unheimliche Steinsarg unter dem Klastrupwege, – die Schrecken des Märchens wohnten nicht mehr darin; und jener lange Hügel, der sein Gras beim ersten Schlag der Lerche unter den purpurgeränderten Sternen des Tausendschöns und den gelben Glocken der Himmelsschlüssel verbarg, der Bach mit seinen phantastischen Schätzen an Tieren und Pflanzen und die wilden, bergigen Abhänge der Sandgrube mit ihren schwarzen Feuersteinen und silberglänzendem Granitboden – das alles waren nur noch armselige Blumen, Tiere und Steine; das strahlende Gold der Fee war wieder zu welkem Laub verblaßt.