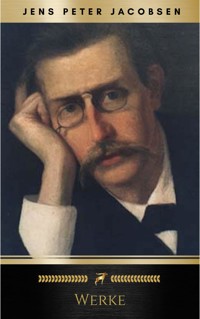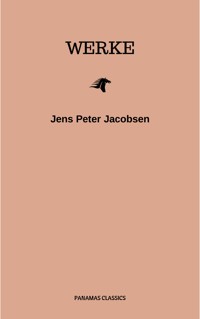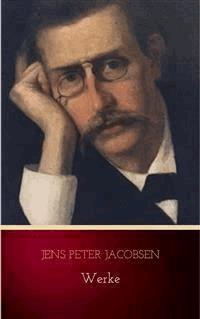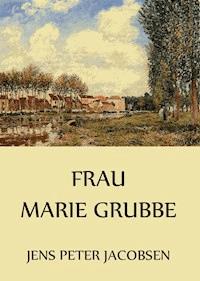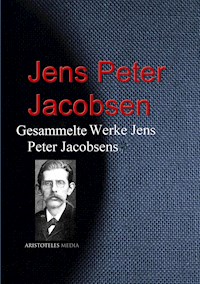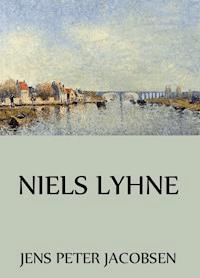
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jacobsens größtes Werk ist die Geschichte des Niels Lyhne, eines Jugendlichen, der immer wieder nach der Erschaffung von etwas Großem strebt aber genau so oft an seinen Träumen scheitert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Niels Lyhne
Jens Peter Jacobsen
Inhalt:
Jens Peter Jacobsen – Biografie und Bibliografie
Niels Lyhne
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Niels Lyhne, Jens Peter Jacobsen
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849628642
www.jazzybee-verlag.de
Jens Peter Jacobsen – Biografie und Bibliografie
Dän. Schriftsteller, geb. 7. April 1847 zu Thisted in Jütland, gest. daselbst 30. April 1885, beobachtete von frühester Kindheit an Natur und Menschen mit großer Objektivität und versuchte, seine Ideen und Phantasien nach dem Muster von Andersens Märchen in der schlichten Sprache des Alltags wiederzugeben. Seit 1868 betrieb er in Kopenhagen naturwissenschaftliche Studien, gewann mit einer Abhandlung über Tangarten die goldene Medaille der Universität und wirkte als einer der ersten Vorkämpfer des Darwinismus (mit Vilh. Möller veröffentlichte er das Werk »Darwin, hans Liv og hans Lære«, 1893). Zugleich betrieb er Literaturstudien; man kann in seiner Dichtung die großzügige Menschendarstellung Shakespeares, die minutiöse Seelenanalyse Flauberts und Beyles und die Nachwirkung der Ideen Georg Brandes' verspüren. Allmählich hatte er eine seinen strengen Kunstforderungen genügende Form gefunden; 1872 veröffentlichte er die Novelle »Mogens« (deutsch, 2. Aufl., Berl. 1897) nebst andern Kleinigkeiten und 1876 »Frau Marie Grubbe« (deutsch, unter andern von Strodtmann, 2. Aufl., das. 1893). »Niels Lyhne« erschien 1880, 1882 eine kleine Sammlung meist älterer Novellen und 1886 ein schmächtiger Band nachgelassener Gedichte und Prosastücke (deutsch von Arnold, Leipz. 1897), geschrieben oder bearbeitet, während ihn die Schwindsucht aus Krankenzimmer fesselte. In diesen wenigen Werken hat I. der dänischen Literatur eine neue Prosa geschaffen. Noch niemals hatte ein Dichter das Menschenschicksal, wie es von der eignen psychologischen Veranlagung, von Umgebung und Zeitgeist bedingt ist, so sein zergliedert, so objektiv überzeugend und aus innerster Erfahrung heraus dargestellt, noch niemals die dänische Prosa so schlicht und rhythmisch, so mild schwermütig, so neu an Wort und Melodie geklungen. Diese Vereinigung von objektiver Naturbeobachtung des Menschen und auserlesener künstlerischer Form ist im Verein mit dem sehnsüchtigen, schönheitsdurstigen Stimmungsgehalt der Schilderung für den ganzen Norden vorbildlich geworden. Seine »Gesammelten Schriften« erschienen 1888 in 2 Bänden (4. Aufl. 1902); sie sind alle wiederholt ins Deutsche übersetzt (in Reclams Universal-Bibliothek: »Sechs Novellen« und »Niels Lyhne«, mit Einleitung von Wolff), als »Gesammelte Werke« von M. Herzfeld (Leipz. 1898–99, 3 Bde.). Seine »Briefe« gab E. Brandes heraus (2. Ausg., Kopenh. 1899).
Niels Lyhne
Erstes Kapitel.
Sie hatte die schwarzen, strahlenden Augen der Bliders mit den feinen, schnurgeraden Brauen, sie hatte ihre stark ausgebildete Nase, ihr kräftiges Kinn, ihre üppigen Lippen. Den eigentümlich schmerzlich sinnlichen Zug um den Mundwinkel und die unruhigen Bewegungen mit dem Kopfe hatte sie auch geerbt, aber ihre Wangen waren bleich, und ihr seidenweiches Haar schloß sich sanft und glatt den Formen des Kopfes an.
So waren die Bliders nicht; ihre Farben bestanden aus Rosa und Bronze, das Haar war dick und kraus, dicht wie eine Mähne, und dann hatten sie volle, tiefe, biegsame Stimmen, die in wunderbar gutem Einklang standen mit den Familiensagen von den lärmenden Jagdfahrten der Väter, von ihren feierlichen Morgenandachten und ihren tausenderlei Liebesabenteuern. Ihre Stimme aber war matt und klanglos.
Ich erzähle von ihr, wie sie in einem Alter von siebzehn Jahren war; wenige Jahre später, nachdem sie sich verheiratet hatte, gewann ihre Stimme an Fülle, die Farbe ihrer Wangen war frischer, das Auge aber matter geworden, doch erschien es fast noch größer und dunkler als vormals.
Mit siebzehn Jahren war sie sehr verschieden von ihren Geschwistern, auch bestand kein innigeres Verhältnis zwischen ihr und ihren Eltern. Die Bliders waren nämlich ein praktisches Geschlecht, das das Leben hinnahm, so wie es nun einmal war; sie verrichteten ihre Arbeit, schliefen ihren Schlaf, und nie fiel es ihnen ein, mehr oder andere Zerstreuungen zu beanspruchen als das Erntefest und drei bis vier Festlichkeiten in der Weihnachtszeit. Eigentlich religiös waren sie nicht, aber sie hätten ebenso leicht auf den Gedanken kommen können, ihre Steuern nicht zu bezahlen, als Gott vorzuenthalten, was Gottes war, darum beteten sie ihr Abendgebet, besuchten an den Festtagen die Kirche, sangen am Heiligenabend ihre Weihnachtslieder und gingen zweimal im Jahre zum Tisch des Herrn. Sie waren nicht sonderlich wißbegierig, und was ihren Schönheitssinn betraf, so waren sie keineswegs unempfänglich für kleine empfindsame Lieder, und wenn der Sommer kam, wenn das Gras auf den Wiesen dicht und üppig wurde und die Saat auf den breiten Äckern Ähren ansetzte, dann sagten sie wohl zueinander, daß es eine schöne Zeit sei, über Land zu gehen. Aber besonders poetisch angelegte Naturen waren sie nicht; die Schönheit berauschte sie nicht, sie kannten ebensowenig ein unbestimmtes Sehnen wie wache Träume.
Mit Bartholine jedoch war es etwas anderes; sie hatte kein Interesse für das, was sich in den Ställen und auf den Feldern zutrug, kein Interesse für Meierei und Wirtschaft – auch nicht das allergeringste. Sie liebte Verse.
In Versen lebte sie, in ihnen träumte sie, an Verse glaubte sie wie an nichts mehr auf der ganzen Welt.
Die Eltern und Geschwister, die Nachbarn und Bekannten sagten selten ein Wort, das sie tiefer berührte, denn ihre Gedanken schwangen sich fast nie von der Erde auf oder von den Geschäften, die sie gerade unter den Händen hatten, ebensowenig wie ihre Blicke jemals von den Verhältnissen und Ereignissen, die vor ihren Augen lagen, fortschweiften. Dagegen die Verse! Die waren für sie voll neuer Gedanken und tiefsinniger Lehren über das Leben da draußen in der Welt, wo die Sorge schwarz ist und die Freude rot; sie strahlten von Bildern, sie perlten und schäumten in Rhythmen und Reimen; alle handelten sie von jungen Mädchen, und die jungen Mädchen waren so edel und schön, sie wußten selber nicht wie sehr; ihre Herzen und ihre Liebe waren mehr als aller Reichtum der Welt, und die Männer trugen sie auf den Händen, hoben sie hoch empor, empor zu dem Sonnenglanze des Glücks, ehrten sie und beteten sie an, waren glücklich, ihre Gedanken und Pläne, ihre Siege, ihren Ruhm mit ihnen teilen zu können.
Und warum sollte man nicht selber solch ein Mädchen sein? Sie sind so – sie sind so – und sie wissen es nicht; weiß ich denn vielleicht, wie ich bin? Und die Dichter sagten doch ausdrücklich, das heiße leben! Darin bestehe das Leben nicht, daß man nähe, stricke, die Wirtschaft besorge und langweilige Besuche mache. Bei Licht betrachtet waren die Selbstgespräche Bartholinens nichts anderes als der etwas krankhafte Drang, sich selber zu fühlen, das Sehnen, sich selber zu finden, das so häufig bei einem mehr als durchschnittlich begabten jungen Mädchen erwacht; das Schlimme dabei war nur, daß sich in ihrem ganzen Umgangskreise auch nicht eine einzige überlegene Natur fand, an der ihre Begabung sich hätte messen können; da war ja nicht einmal eine verwandte Natur, und so kam Bartholine dazu, sich als etwas Merkwürdiges, einzig Dastehendes zu betrachten, als eine Art tropischen Gewächses, das, unter rauhem Himmel entsprossen, seine Blätter nur kümmerlich entfalten könne, während es in einer wärmeren Luft, unter einer glutvolleren Sonne schlanke Stengel mit wunderbarem Blütenschmuck würde treiben können. Das, meinte sie, sei ihr eigentliches Wesen, sei das, wozu die richtige Umgebung sie machen würde, und sie träumte tausend Träume von jenen sonnigen Gefilden und verzehrte sich vor Sehnsucht nach ihrem eigenen reichen Ich, und darüber vergaß sie, was man so leicht vergißt, daß selbst die schönsten Träume, selbst die heißeste Sehnsucht den Wuchs des Menschengeistes auch nicht um einen Zoll zu erhöhen vermögen.
Da geschah es denn eines Tages, daß ein Freier für sie erschien.
Es war der junge Lyhne von Lönborggaard, der letzte männliche Sproß eines Geschlechts, das drei Generationen hindurch zu den begabtesten der Provinz gezählt hatte. Als Bürgermeister, Amtsverwalter oder königliche Kommissare, oft mit dem Justizratstitel begnadet, dienten sie in reiferen Jahren ihrem König und Vaterland in pflichtgetreuer Wirksamkeit. In der Jugend hatten sie auf vernünftig geregelten und gewissenhaft ausgeführten Studienreisen in Frankreich und Deutschland ihren empfänglichen Geist mit den Kenntnissen, Schönheitsgenüssen und Lebenseindrücken bereichert, die die fremden Länder in so reichem Maße darboten, und wenn sie dann heimkehrten, wurden jene im Auslande verlebten Jahre nicht beiseite gelegt, zu den alten Erinnerungen, gleich dem Andenken an ein Fest, dessen letzte Kerze und letzter Ton erloschen und verklungen war, nein, das Leben in der Heimat wurde auf diesen Wanderjahren aufgebaut; was sie an Interessen geweckt und gezeitigt hatten, durfte unter keinen Umständen verloren gehen, sondern wurde mit allen Mitteln genährt und weiter entwickelt; auserlesene Kupferstiche, kostbare Bronzen, deutsche Dichterwerke, französische Rechtsverhandlungen und französische Philosophie waren alltägliche Dinge und alltägliche Unterhaltungsstoffe im Hause der Lyhnes.
Was ihre Art und Weise betraf, so bewegten sie sich mit einer altväterischen Leichtigkeit und einer stilvollen Liebenswürdigkeit, die zu der plumpen Majestät und unbehilflichen Förmlichkeit ihrer Standesgenossen oft einen eigentümlichen Gegensatz bildeten. Ihre Rede war breitlich abgerundet, zierlich zugespitzt, aber ein wenig gesucht rhetorisch, das ließ sich nicht leugnen; doch paßte sie gut zu diesen großen, breiten Gestalten mit den hohen, gewölbten Stirnen, den freien Schläfen, dem dichten, lockigen Haar, den hellen, ruhig lächelnden Augen, den feingeformten, ein wenig gebogenen Nasen; das Untergesicht aber war zu schwer, der Mund zu breit, die Lippen zu voll.
Wie diese äußeren Züge bei dem jungen Lyhne schwächer hervortraten, so war auch die Intelligenz in ihm gleichsam erschlafft, und die geistigen Anregungen wie die edeln Kunstgenüsse, die er auf seinem Wege getroffen, hatten nicht die geringste Strebsamkeit in ihm hervorgerufen. Zwar hatte er sich pflichtgetreu damit beschäftigt, aber seinem Eifer kam nicht das freudige Bewußtsein zugute, daß sein Inneres in Fluß und Schwung gerate, noch wurde er durch die stolze Erkenntnis belohnt, daß er mit seinen Kräften dem Dargebotenen gewachsen sei; in dem befriedigenden Gefühl, das Vorhaben ausgeführt zu haben, bestand sein ganzer Lohn.
Er hatte sein Gut Lönborggaard von einem kürzlich verstorbenen Bruder seines Vaters geerbt und war von der hergebrachten Auslandsreise heimgekehrt, um selbst die Verwaltung des Gutes zu übernehmen. Da die Bliders jetzt seine nächsten ebenbürtigen Nachbarn waren, und der Onkel stets in einem sehr freundschaftlichen Verhältnis zu der Familie gestanden hatte, machte er seinen Besuch dort, sah Bartholine und verliebte sich in sie.
Daß sie sich in ihn verliebte, war ja selbstverständlich.
Das war doch endlich einmal einer aus der Welt da draußen, einer, der in den großen, fernen Städten gelebt hatte, wo sich Wälder von Türmen und Zinnen gegen den sonnenklaren Himmel abhoben, wo die Luft erzitterte von dem Klange der Glocken, dem Brausen der Orgeln, den süßen Tönen der Mandolinen, während farbenstrahlende, goldstrotzende Aufzüge festlich durch die breiten Straßen wallten; wo Marmorpaläste schimmerten und die Wappenschilder der stolzen Geschlechter paarweise über den weißen Toren prangten, während oben auf den geschweiften, mit steinernen Girlanden verzierten Balkonen Fächer blitzten und Schleier wehten. Das war einer, der jene Gegenden durchwandert hatte, wo siegreiche Heere des Weges gezogen waren, wo glorreiche Schlachten die Namen der Dörfer und Felder mit unsterblichem Glanz umgeben hatten, wo der Rauch aus dem Zigeunerlager über den Wipfeln des Waldes aufstieg, während rote Ruinen von weinbekränzten Höhen in das lächelnde Tal herabschauten, wo das Mühlrad braust und klingende Herden blökend über breitbogige Brücken heimziehen.
Von alledem erzählte er, aber nicht wie die Dichter, sondern weit natürlicher und dabei so vertraulich, ganz wie man hierzulande von den umliegenden Dörfern und dem benachbarten Pfarrhofe spricht. Er wußte auch von Malern und Dichtern zu sagen, deren Namen er in die Wolken erhob, und von denen sie niemals hatte reden hören. Er zeigte ihr die Bilder der einen und las die Gedichte der andern mit ihr im Garten auf dem Hügel, von wo sie die blanke Wasserfläche des Fjords und die braunen Wellen der Heide überschauen konnten. Die Liebe machte ihn poetisch, die Gegend gewann an Reizen, die Wolken nahmen die Gestalt von jenen Wolken an, die in den Dichtungen dahinzogen, und die Bäume trugen das Laubwerk, das in den Balladen so wehmutvoll erschauerte.
Bartholine war glücklich, denn ihre Liebe verwandelte Tag und Nacht in eine Reihe poetischer Stimmungen. Es lag Poesie darin, wenn sie ihm entgegenging, die Bewegung war Poesie, wenn sie im Scheine der Abendsonne auf dem Hügel stand, ihm ein letztes Lebewohl zuwinkte und dann in wehmütiger Wonne in ihr einsames Kämmerlein ging, um ungestört an ihn zu denken; und wenn sie ihn in ihr Abendgebet schloß, so war auch das Poesie.
Jetzt empfand sie jenes unbestimmte Sehnen und Verlangen nicht mehr; das neue Leben mit seinen wechselvollen Stimmungen war ihr genug, ihre Gedanken und Anschauungen waren klarer geworden, hatte sie jetzt doch jemand, an den sie sich unverhohlen wenden konnte, ohne fürchten zu müssen, sie könnte mißverstanden werden.
Auch in anderer Hinsicht hatte sie sich verändert: Das Glück hatte sie den Eltern und Geschwistern gegenüber liebenswürdiger gemacht, sie fand, daß diese verständiger waren, und auch mehr Gefühl besaßen, als sie bis dahin angenommen hatte.
Und dann heirateten sie sich.
Das erste Jahr glich der Brautzeit. Als aber das Zusammenleben allmählich älter wurde, konnte Lyhne es sich nicht länger verhehlen, daß er es müde war, seiner Liebe immerwährend neue Ausdrücke zu geben, sich unablässig in das Federgewand der Poesie zu hüllen, die Flügel ausgebreitet zu halten zum Fluge durch alle Stimmungshimmel und alle Gedankentiefen; er sehnte sich danach, in gemütlicher Ruhe stillzusitzen auf seinem Zweig und schlummernd sein müdes Haupt unter der warmen Federdecke seiner Flügel zu bergen. Er stellte sich die Liebe nicht als eine ewig flackernde, lodernde Flamme vor, die mit ihrem starken, glühenden Scheine die ruhigsten Falten des Daseins erhellt und alles phantastisch größer und ferner erscheinen läßt, als es ist, die Liebe war für ihn vielmehr eine stille, glühende Kohle, die ihrem weichen Aschenbette eine gleichmäßige Wärme entsendet und in gedämpftem Zwielicht das Entferntere verschleiert und das Nahe doppelt nah und doppelt heimisch macht.
Er war müde, ermattet, es war ihm unmöglich, alle die Poesie zu ertragen, und wie ein Fisch, der in der heißen Luft erstickt, nach der klaren, frischen Kühle des Wassers schmachtet, so schmachtete er danach, festen Fuß zu fassen auf dem sicheren Boden des alltäglichen Lebens. Es mußte ein Ende haben, es mußte von selber ein Ende nehmen. Bartholine war nicht länger unerfahren, was das Leben und die Dichtung betraf, sie war ebenso erfahren darin wie er selber, er hatte ihr alles gegeben, was er empfangen hatte, und nun sollte er fortfahren zu geben; das war aber ein Ding der Unmöglichkeit, er hatte selber nicht mehr. Sein einziger Trost war, daß Bartholine das Glück bevorstand, Mutter zu werden.
Schon lange hatte Bartholine mit Kummer bemerkt, daß sich ihre Ansicht über Lyhne allmählich veränderte, daß er nicht mehr auf jener schwindelnden Höhe stand, auf die sie ihn in ihrer Brautzeit gestellt hatte. Sie war freilich noch fest überzeugt, daß er das war, was sie eine poetische Natur nannte, aber sie war aufgeschreckt worden, denn die Prosa hatte angefangen, ihren Pferdefuß hin und wieder einmal vorzustrecken. Desto eifriger jagte sie nach der Poesie, war sie bestrebt, den alten Zustand wieder herzustellen, indem sie ihn mit noch größerem Stimmungsreichtum, mit noch größerer Begeisterung überschüttete; aber sie fand einen so geringen Widerklang, daß sie sich selber fast sentimental und geziert vorkam. Sie bemühte sich noch eine Zeitlang, den widerstrebenden Lyhne mit sich fortzureißen, sie wollte nicht glauben, was sie nur zu gut ahnte. Als aber endlich die Fruchtlosigkeit ihrer Anstrengungen in ihrer Seele Zweifel zu erwecken anfing, ob denn ihr Geist und ihr Herz wirklich einen so unendlichen Reichtum enthielten, wie sie geglaubt hatte, da ließ sie ihn plötzlich unbeachtet, wurde kühl, schweigsam und verschlossen und suchte die Einsamkeit auf, um in Ruhe über ihren getäuschten Illusionen zu trauern. Denn das sah sie ein – sie war bitter getäuscht worden, Lyhne unterschied sich im Innersten seines Herzens durch nichts von ihrer früheren Umgebung; das, was sie betört hatte, war eine ganz gewöhnliche Erscheinung, seine Liebe hatte ihn für eine kurze Weile mit einer flüchtigen Glorie von Geist und Hoheit umgeben, wie das bei niederen Naturen so oft der Fall ist.
Lyhne war bekümmert und ängstlich über diese Veränderung, die in ihrem Verhältnis eingetreten war, er bemühte sich in unglücklichen Versuchen, den alten schwärmerischen Flug zu fliegen, das Verhältnis wieder herzustellen; aber das trug nur dazu bei, Bartholine noch deutlicher zu zeigen, wie groß ihr Irrtum gewesen war.
So stand es um das Ehepaar, als Bartholine ihr erstes Kind zur Welt brachte. Es war ein Knabe, und sie gaben ihm den Namen Niels.
Zweites Kapitel.
In gewisser Weise führte das Kind die Eltern wieder zusammen, denn an seiner kleinen Wiege begegneten sie einander stets in gemeinsamer Hoffnung, gemeinsamer Freude und gemeinsamer Furcht; an ihn dachten sie, und von ihm sprachen sie gleich gern und gleich häufig, und dann waren sie einander so dankbar für das Kind und für die Freude an ihm und für die Liebe zu ihm.
Lyhne ging ganz in seiner Landwirtschaft und in seinen Gemeindeangelegenheiten auf, ohne doch irgendwie zu leiten oder einzugreifen; er arbeitete sich aber gewissenhaft in das schon Bestehende ein, er schaute voll Teilnahme zu und war mit den vernünftigen Verbesserungen einverstanden, die sein alter Verwalter oder der Älteste der Gemeinde nach gründlicher, sehr gründlicher Erwägung in Vorschlag brachten.
Es fiel ihm niemals ein, die Kenntnisse, die er in früheren Zeiten erworben hatte, praktisch zu verwerten, dazu hatte er zu wenig Zutrauen zu dem, was er mit dem Namen Theorie bezeichnete, und einen viel zu großen Respekt vor den durch althergebrachte Gewohnheit geheiligten Erfahrungssätzen, welche die anderen das wahrhaft Praktische nannten.
Genau genommen war nichts an ihm, was darauf hindeutete, daß er nicht sein Lebenlang hier gelebt, und zwar unter diesen Verhältnissen gelebt hatte. Mit Ausnahme von einer Kleinigkeit. Und diese bestand darin, daß er oft halbe Stunden lang regungslos auf einem Balken oder einem Stein am Wege sitzen und in seltsamer Benommenheit über den üppig grünenden Roggen oder den goldenen, schwerbefruchteten Hafer vor sich hinstarren konnte. Das hatte er anderwärts her, das erinnerte an den alten Lyhne, an den jungen Lyhne.
Bartholine fand sich in ihrer Welt nicht so auf einmal und ohne Straucheln zurecht. Nein, zuerst klagte sie sich durch die Verse von hundert Dichtern hindurch, dann stöhnte sie mit der ganzen breiten Alltäglichkeit jener Zeit über die tausenderlei Schranken des Menschenlebens, über seine Fesseln und Bande; bald kleidete sie ihre Klagen in den edeln Zorn, der seinen Wortschwall gegen den Thron der Kaiser und gegen die Gefängnisse der Tyrannen schleudert, bald erschienen sie als stiller, mitleidvoller Kummer, der das reiche Licht der Schönheit von einem blinden, knechtisch gesinnten Geschlecht entweichen sieht, fast erliegend unter der gedankenlosen Geschäftigkeit der Tage; und ein andermal war das Gewand ihrer Klage nur ein stiller Seufzer nach dem freien Fluge des Vogels oder nach den Wolken, die so leicht dahinschweben in die unendliche Ferne.
Aber sie ward der Klagen müde, und die Machtlosigkeit der Klagen erweckte Zweifel und Bitterkeit in ihr; und wie gewisse Gläubige ihren Heiligen schlagen oder ihn mit Füßen treten, wenn er seine Macht nicht zeigen will, so spottete sie jetzt der vergötterten Poesie und fragte sich selber höhnisch, ob sie wohl glaube, daß sich der Vogel Phönix bald im Gurkenbeete niederlassen oder daß sich Aladdins Wunderhöhle unter dem Milchkeller erschließen würde, ja in kindischer Übertreibung vergnügte sie sich daran, den Mond einen grünen Käse und die Rosen Potpourri zu nennen. Dabei hatte sie ein Gefühl, als räche sie sich, nicht ohne die ängstliche Zwischenempfindung, daß sie sich einer Blasphemie schuldig mache.
Der Befreiungsversuch, der diesem Bestreben zugrunde lag, mißglückte. Sie versank wieder in ihre Träume, in die Träume ihrer Mädchenzeit, aber es war nur der eine Unterschied da, daß jetzt keine Hoffnung diese Träume mehr erhellte; sie hatte gelernt, daß es nur Träume waren, ferne, verführerische Luftspiegelungen, die keine Sehnsucht der Welt auf ihre Erde herabzuziehen vermochte. Gab sie sich also diesen Träumen jetzt hin, so geschah es nur mit innerer Unruhe und trotz einer mahnenden Stimme, die ihr vorhielt, daß sie dem Trinker gleiche, der weiß, daß seine Leidenschaft verderblich ist, daß jeder neue Rausch seine Kräfte schwächt und die Macht seiner Leidenschaft vermehrt; aber die Stimme erklang vergebens, denn ein nüchtern gelebtes Leben, ohne das süße Laster der Träume, war ihr kein Leben, das wert war, gelebt zu werden – das Leben hatte ja nur den Wert, den ihm die Träume gaben.
So verschieden waren der Vater und die Mutter des kleinen Niels Lyhne, die beiden freundlichen Mächte, die, ohne sich dessen bewußt zu sein, einen Streit um seine junge Seele stritten, schon von dem Augenblicke an, wo sich ein Funke von Verstand in ihr zeigte; und je älter das Kind wurde, desto heftiger entbrannte der Streit, denn desto reicher wurde die Auswahl der Waffen.
Die Eigenschaft des Sohnes, durch die die Mutter auf ihn einzuwirken suchte, war seine Phantasie, und Phantasie hatte er vollauf, aber schon in frühester Jugend zeigte er, daß es für ihn einen himmelweiten Unterschied gab zwischen der Fabelwelt, die auf das Wort der Mutter entstand, und der wirklichen Welt; denn unzählige Male geschah es, wenn ihm die Mutter Märchen erzählte und ihm schilderte, wie traurig es dem Helden ergangen war, daß dann Niels, der keinen Ausweg aus all der Not finden konnte, der nicht absah, wie all das Elend zu überwinden wäre, das sich gleich einem undurchdringlichen Ring um den Helden zusammenschloß und ihn enger und enger in seine Kreise bannte – ja dann geschah es oft, daß Niels plötzlich seine Wange gegen die Mutter preßte und mit tränenden Augen und bebenden Lippen flüsterte: Aber das ist doch nicht wirklich wahr? Und wenn er dann die trostreiche Antwort erhielt, auf die er gehofft hatte, dann atmete er wie von einem schweren Druck befreit auf und hörte in geborgener Sicherheit das Ende der Geschichte an. Aber der Mutter war dies Fragen und Unterscheiden eigentlich gar nicht recht.
Als er zu groß für die Märchen geworden war, und als auch sie müde wurde, immer neue zu erfinden, erzählte sie ihm mit kleinen Ausschmückungen von all den Helden in Krieg und Frieden, deren Lebenslauf zum Beweis dienen konnte, welche Macht in einer Menschenseele wohnt, wenn sie nur das eine will – das Große, wenn sie sich weder von den kurzsichtigen Zweifeln der Gegenwart abschrecken, noch von ihrem sanften, tatenlosen Frieden verlocken läßt. In dieser Tonart bewegten sich die Erzählungen, und da die Geschichte nicht genug Helden besaß, die geeignet waren, wählte sich die Mutter einen Phantasiehelden, über dessen Taten und Schicksale sie frei verfügen konnte, so recht einen Helden nach ihrem eigenen Herzen, Geist von ihrem Geist, Fleisch von ihrem Fleisch, und auch Blut von ihrem Blut. Einige Jahre nach Niels' Geburt hatte sie nämlich einen toten Knaben zur Welt gebracht. Was dieser hätte werden können, was er alles in der Welt hätte ausrichten können, gleich einem Prometheus, einem Herkules, einem Messias, das schilderte sie jetzt dem Bruder in phantastischen Bildern, die nicht mehr Fleisch und Blut besaßen, als das arme kleine Kinderskelett, das dort oben auf dem Lönborger Kirchhof zu Erde und Asche vermoderte.
Und Niels verfehlte nicht, die Moral dieser Geschichten zu erfassen; er sah vollkommen ein, wie verächtlich es sei, so zu werden, wie die Menschen im allgemeinen waren; er war auch bereit, das harte Los auf sich zu nehmen, das den Helden beschieden war, und willig litt er im Geiste unter den zehrenden Kämpfen, dem herben Mißgeschick, dem Martyrium der Verkennung und den friedlosen Siegen. Aber es war doch ein großer Trost für ihn, daß es noch gute Weile damit hatte, daß dies alles erst kommen würde, nachdem er groß geworden.
Wie die Traumgebilde und Traumtöne einer Nacht am hellen Tage wiederkehren und in Nebelgestalt den Gedanken anrufen können, so daß dieser eine flüchtige Sekunde gleichsam lauscht und sich staunend fragt, ob es wohl wirklich gerufen habe – so zogen die Vorstellungen von jener traumhaften Zukunft leise über Niels Lyhnes Kindheitstage hin und erinnerten ihn ohn' Unterlaß, daß dieser glücklichen Zeit ein Ziel gesteckt sei, und daß sie eines Tages nicht mehr sein werde.
Dies Bewußtsein erzeugte den brennenden Wunsch, das Kindheitsleben in seiner ganzen Fülle zu genießen, es mit allen Sinnen einzusaugen, keinen Tropfen zu vergeuden, auch nicht einen einzigen, und so kam es, daß eine Innigkeit in seinen Spielen lag, die sich unter dem Drucke des beängstigenden Gefühls, daß ihm die Zeit entrann, ohne daß er aus ihren reichen Wogen alles, was sie Welle auf Welle brachte, hatte bergen können, zu einer wahren Leidenschaft steigerte. Er konnte sich auf die Erde werfen und vor Verzweiflung schluchzen, wenn er sich einmal an einem Ferientage langweilte, weil ihm irgend etwas fehlte, ein Spielkamerad, Erfindungsgabe oder gutes Wetter. Aus diesem Grunde ging er auch stets so ungern zu Bette, weil der Schlaf das Ereignislose, das völlig Empfindungslose war. Aber es war nicht immer so.
Es geschah auch wohl, daß er ermüdete, daß seine Phantasie nicht die geringsten Farben mehr besaß. Dann fühlte er sich unsagbar elend, er fühlte sich zu klein, zu nichtig für jene ehrgeizigen Träume, ja, es schien ihm, als sei er ein unwürdiger Lügner, der sich in frechem Übermut den Schein gegeben habe, als liebe er das Große und Edle, als verstehe er es, während er doch in Wirklichkeit das Alltägliche liebte, während alle niedrigen Wünsche und Begierden in ihm lebten; oft war es ihm sogar, als empfinde er den ganzen Klassenhaß der Niedriggeborenen gegen die Höhergestellten, als würde er sich mit Wonne an der Steinigung dieser Herren beteiligen können, die aus edlerem Geblüt waren als er, und die wußten, daß sie es waren.
In solchen Zeiten mied er seine Mutter, und mit einem Gefühl, als folge er einem weniger edeln Instinkt, hielt er sich zu dem Vater. Er hatte dann ein williges Ohr und einen empfänglichen Sinn für alle seine an der Erde klebenden Gedanken und traumlosen Erklärungen. Und er fühlte sich so wohl bei dem Vater, war so glücklich, daß er beinahe vergaß, daß dies derselbe Vater war, auf den er sonst von den Zinnen seines Traumschlosses als einen Unebenbürtigen mitleidig herabgesehen hatte.
Freilich stand dies alles vor seinem kindlichen Bewußtsein nicht mit der Klarheit und Bestimmtheit, die ihm durch das ausgesprochene Wort verliehen wird; es war in einer nicht greifbaren, erst werdenden Form vorhanden, gleichsam unfertig, ungeboren, nicht unähnlich der wunderbaren Pflanzenwelt auf dem Meeresgrunde, durch trübes Eis gesehen; zerschlage das Eis oder beleuchte das dunkel Lebende mit dem Licht der Worte, und das Gleiche wird sich ereignen: das, was du nun sehen und fassen kannst, ist in seiner Klarheit nicht mehr das Dunkle, das es vorher gewesen ist.
Drittes Kapitel.
Und die Jahre schwanden dahin: ein Weihnachtsfest folgte dem anderen, die Luft noch lange nach dem heiligen Dreikönigstage mit seinem strahlenden Festglanz erfüllend; eine Pfingstzeit nach der anderen lächelte auf die blütenduftenden Frühlingswiesen; Sommer auf Sommer rückte heran, feierte seine Sonnenscheingelage und schüttete seinen Sommerwein aus vollen Schalen aus, und dann eines Tages, mit der sinkenden Sonne, lief er davon, und es blieb nur die Erinnerung zurück, mit den sonnverbrannten Wangen, den verwunderten Augen und dem erregten Blute.
Und die Jahre schwanden dahin, und die Welt war nicht mehr die Wunderwelt, die sie zuvor gewesen war; in den dunkeln Winkeln hinter den morschen Holunderbäumen, in den geheimnisvollen Bodenkammern und in jener düstern Steinkiste am Klastrupwege wohnte nicht mehr das märchenhafte Grauen; und jener breite Hügel, der beim ersten Lerchenschlag sein Gras unter den purpurränderigen Sternen der Tausendschönchen und den gelben Glocken der Himmelsschlüsselchen barg, der Bach mit seinen phantastischen Tier- und Pflanzenschätzen und die wilden Bergabhänge der Sandgrube mit ihren schwarzen Steinen und den silbern schimmernden Granitblöcken, das alles waren nur armselige Blumen, Tiere und Steine; das strahlende Goldhaar der Feen war wieder in Laub verwandelt.
Ein Spiel nach dem anderen war alt und langweilig, dumm und sinnlos geworden wie die Bilder in der Fibel, und doch waren sie einmal so neu gewesen, so wunderbar neu!
Dort hatten sie mit dem Leitseil gespielt, Niels und des Pfarrers Frithjof, und der Reifen war ein Fahrzeug gewesen, das strandete, sobald er auf die Seite fiel, ergriff man ihn aber noch rechtzeitig, so warf das Schiff seine Anker aus. Den schmalen Steig am Meeresufer entlang, der so beschwerlich zu begehen war, nannten sie Bab el Mandeb oder die Pforte des Todes, auf die Stalltür hatten sie mit Kreide geschrieben, daß hier England sei, und auf der Scheunentür stand: Frankreich; die Gartenpforte war Rio de Janeiro und die Schmiede Brasilien. Sie hatten auch ein Spiel, welches Holger Danske hieß, das konnten sie zwischen den großen Klettenblättern hinter der Scheune spielen; aber oben im Felde hinter der Mühle befanden sich mehrere Erdhöhlen, dort hauste Prinz Beomund in höchsteigener Person, und jene wilden Sarazenen mit rotgrauen Turbanen und gelben Helmbüschen – Kletten und Königskerzen von mächtigem Wuchs; dort war das richtige Mauretanien, denn diese grenzenlose Üppigkeit, diese unübersehbaren Massen wuchernden Lebens reizten den Zerstörungsgeist, berauschten den Sinn mit der Wollust des Vernichtens, und die hölzernen Schwerter blitzten mit dem Glanze des Stahles, der grüne Pflanzensaft färbte die Klingen blutrot, und die abgehauenen Stengel, welche die Füße zermalmten, waren Türkenleiber, die von Pferdehufen zerstampft wurden.
Unten am Meeresstrande hatten sie gespielt; sie sandten Muschelschalen aus, das waren Schiffe, und wenn ein Stückchen Seetang ihren Lauf hemmte oder wenn sie an einer Sandbank landeten, so stellte das Kolumbus im Sargassomeere vor oder die Entdeckung von Amerika. Hafenanlagen wurden gemacht und mächtige Dämme, sie gruben den Nil in dem festen Sande am Strande aus, und einmal bauten sie aus Kieselsteinen das Schloß Gurre, ein kleiner, toter Fisch in einer Austernschale war die tote Tove, und sie selber waren König Waldemar, der trauernd an dem Leichnam der Geliebten saß.
Aber das war alles vorbei.
Niels war jetzt ein großer Knabe, er war zwölf Jahre alt und brauchte nicht mehr auf Disteln und Kletten loszuhauen, um seinen Ritterphantasien zu genügen, wie er denn auch nicht mehr nötig hatte, seine Entdeckungsträume in Muschelschalen aussegeln zu lassen; jetzt genügten ihm ein Buch und eine Sofaecke, und reichte auch das nicht aus, wollte ihn das Buch nicht an eine Küste tragen, die ihm lieb war, so suchte er Frithjof auf und erzählte ihm die Geschichte, die das Buch ihm versagt hatte. Arm in Arm gingen sie dann den Weg entlang, der eine erzählend, beide lauschend; wollten sie aber so recht genießen, der Phantasie ihren freien Lauf lassen, so versteckten sie sich in dem duftigen Halbdunkel des Heubodens. Doch bald wurden diese Geschichten, die ja immer endeten, wenn man sich eben in sie hineingelebt hatte, zu einer einzigen, langen Geschichte, die niemals ein Ende nahm, sondern eine Generation nach der anderen zu Grabe trug; denn war der Held zu alt geworden oder hatte man ihn unvorsichtigerweise umkommen lassen, so gab man ihm einen Sohn, der die Erbschaft des Vaters antrat und den man zugleich mit all den neuen Eigenschaften ausstatten konnte, auf die man in dem Augenblicke ein besonderes Gewicht legte.
Alles, was Eindruck auf Niels gemacht hatte, was er gesehen, was er verstanden, und was er mißverstanden hatte, was er bewunderte, sowie das, wovon er wußte, daß man es bewundern sollte, alles dies kam in die Geschichte. Wie ein fließendes Wasser von jedem Bilde gefärbt wird, das sich seinem Spiegel nähert, und je nachdem der Zufall es will, das Bild in ungestörter Klarheit wiedergibt, oder es verzerrt und verunstaltet, oder es in wellenförmigen, unsicher zitternden Umrissen zurückwirft, oder auch es ganz im Spiel der eigenen Farben und Linien ertränkt: so ergriff die Geschichte des Knaben Gefühle und Gedanken, eigene wie fremde, ergriff Menschen wie Begebenheiten, Leben und Bücher, so gut sie sie ergreifen konnte. Es war gleichsam ein Leben, das neben dem wirklichen Leben gespielt wurde, es war ein trautes, heimliches Versteck, wo sich so süß von den wildesten Abenteuern träumen ließ, es war ein Märchengarten, der sich auf den leisesten Wink öffnete, der den Knaben einließ in seine ganze Herrlichkeit, der alle anderen ausschloß. Von oben war dieser Garten durch säuselnde Palmen geschlossen, und unten zwischen Blumen aus Sonne und Blättern, auf Sternen, auf Korallenzweigen, da eröffneten sich tausend Wege zu allen Ländern und allen Zeiten; schlug man den einen Weg ein, so gelangte man hierhin, und auf dem anderen gelangte man dorthin – zu Aladdin, zu Robinson Crusoe, zu Vaulunder und Henrik Magnard, zu Niels Klim und Mungo Park, zu Peter Simpel und zu Odysseus – und sobald man es nur wünschte, war man wieder daheim.
Ungefähr einen Monat nach Niels' zwölftem Geburtstage waren zwei neue Gesichter auf Lönborggaard erschienen.
Das eine war das des neuen Hauslehrers, das andere gehörte Edele Lyhne.
Der Hauslehrer, Herr Bigum, war Kandidat der Theologie und stand auf der Schwelle der Vierziger. Er war klein, aber kräftig, von fast lasttiermäßigem Bau, mit breiter Brust, hochschultrig und stiernackig. Seine Arme waren lang, die Beine stark und kurz, die Füße breit. Sein Gang war langsam, schwer und energisch, seine Armbewegungen waren unbestimmt, ausdruckslos und erforderten viel Platz. Er war rotbärtig wie ein Wilder, und seine Haut war mit Sommersprossen bedeckt. Seine große, hohe Stirn war flach wie eine Wand, zwischen den Augenbrauen hatte er ein paar lotrechte Runzeln, die Nase war kurz und plump, der Mund groß mit dicken, frischen Lippen. Das schönste an ihm waren seine Augen, sie waren hell, sanft und klar. An den Bewegungen der Augäpfel konnte man sehen, daß er ein wenig schwerhörig war. Dies verhinderte ihn aber nicht, die Musik zu lieben und ein leidenschaftlicher Violinspieler zu sein; denn er sagte, man höre die Töne nicht mit den Ohren allein, der ganze Körper höre, die Augen, die Finger, die Füße, und ließe uns auch das Ohr einmal im Stich, würde doch die Hand den rechten Ton zu finden wissen, auch ohne Hilfe des Gehörs. Und schließlich seien doch alle hörbaren Töne falsch, wem aber einmal die Gnadengabe der Töne beschert sei, der besitze in seinem Innern ein unsichtbares Instrument, gegen das die herrlichste Cremoneser Geige nur wie die Ralebaßvioline der Wilden sei, und auf diesem Instrumente spiele die Seele, auf seinen Saiten erklängen die idealen Töne und auf ihm hätten die großen Tondichter ihre unsterblichen Werke komponiert. Die äußerliche Musik, die die Luft der Wirklichkeit durchbebt und die man mit den Ohren vernimmt, sei nur eine armselige Nachahmung, ein stammelnder Versuch, das Unaussprechliche zu sagen, sie sei im Vergleich zu der seelischen Musik dasselbe, was die Statue, die mit den Händen gebildet, mit dem Meißel ausgehauen, mit dem Maße gemessen sei, im Vergleich zu des Bildhauers wunderbarem Marmortraume sei, den zu schauen sterblichen Augen nicht vergönnt wird.
Übrigens war die Musik keineswegs das Hauptinteresse des Herrn Bigum; er war vor allem Philosoph, nicht aber einer jener produktiven Philosophen, welche neue Gesetze erfinden und Systeme bauen; er lachte über ihre Systeme, diese Schneckenhäuser, die man über das unendliche Feld des Gedankens in dem einfältigen Glauben mit sich herumschleppt, daß das, was sich im Innern des Schneckenhauses befindet, das Feld sei. Und diese Gesetze! Gedankengesetze, Naturgesetze! als wäre ein Gesetz entdecken etwas anderes als einen bestimmten Ausdruck für das Bewußtsein finden, wie beschränkt man im Grunde sei; so weit kann ich sehen und nicht weiter, das ist mein Horizont, das und weiter nichts bedeutete die Entdeckung; denn war nicht ein neuer Horizont hinter dem ersten, und ein neuer und abermals ein neuer, Horizont hinter Horizont, Gesetz hinter Gesetz bis in die Unendlichkeit hinaus? Herr Bigum war nicht auf diese Weise Philosoph. Er glaubte nicht, daß er eingebildet sei, daß er sich selber überschätze, aber er konnte seine Augen nicht vor der Tatsache verschließen, daß seine Intelligenz sich über weitere Felder erstreckte als die anderer Sterblichen. Wenn er sich in die Werke der großen Denker vertiefte, so war es ihm, als bewege er sich zwischen einer Schar schlummernder Gedankenriesen, die, vom Lichte seines Geistes überströmt, erwachten und ihrer Stärke inne wurden. Und so war es mit allem: jeder fremde Gedanke, jede Stimmung, jedes Gefühl, dem es vergönnt war, in ihm zu erwachen, das erwachte mit seinem Stempel auf der Stirn, geadelt, geläutert, gestärkt zu neuem Fluge, mit einer Größe in sich, mit einer Macht an sich, von welcher der Schöpfer desselben niemals geträumt hatte!
Wie oft hatte er nicht beinahe demütig gestaunt über diesen wunderbaren Reichtum seiner Seele, über diese selbstbewußte, göttliche Ruhe seines Geistes, denn es konnte Tage geben, an denen er die Welt und die Dinge in der Welt von ganz entgegengesetzten Standpunkten beurteilte, wo er die Welt und die Dinge unter Voraussetzungen betrachtete, die so verschieden voneinander waren wie Tag und Nacht, ohne daß diese Standpunkte und Voraussetzungen, die er zu seinen eigenen gemacht hatte, ihn jemals, auch nur auf eine Sekunde, zu ihrem Eigentum gemacht hätten, ebensowenig wie der Gott, welcher die Gestalt des Stieres oder des Schwanes annahm, dadurch einen Augenblick zum Stier oder Schwan ward und aufhörte Gott zu sein.
Es gab niemand, der von dem, was in Herrn Bigum wohnte, eine Ahnung gehabt hätte. Alle gingen sie blind an ihm vorüber, er aber freute sich über diese Blindheit, in Verachtung der Menschheit. Es werde der Tag kommen, meinte er, da sein Auge erlöschen, da die Pfeiler zu dem herrlichen Gebäude seines Geistes schwanken, zusammenbrechen, da er selber vergehen würde, als sei er niemals gewesen, ohne ein Werk von seiner Hand zu hinterlassen, nicht ein geschriebenes Titelchen, das von dem, was an ihm verloren war, Kunde geben könnte. Er jubelte bei dem Gedanken, daß Geschlecht auf Geschlecht kommen und gehen würde, daß die Größten dieser Geschlechter ihr Leben einsetzen würden, um das zu gewinnen, was er hätte geben können, wenn er nur seine Hand hätte öffnen wollen.
In einer so untergeordneten Stellung zu leben, bereitete ihm einen eigenartigen Genuß, denn welche Verschwendung lag darin, daß sein Geist dazu verwendet werden sollte, Kinder zu unterrichten! War es nicht ein wahnsinniges Mißverhältnis, eine riesige Ungereimtheit, daß man seine (des genialen Bigums) Zeit mit dem armseligen täglichen Brot bezahlte, daß er dies Brot auf Empfehlung gewöhnlicher Menschen verdienen durfte, die sich für seine Fähigkeit verbürgten, den jämmerlichen Platz eines Hauslehrers auszufüllen?
Und man hatte ihn durchfallen lassen, als er sein Staatsexamen machte! Daß der brutale Unverstand der Welt ihn beiseite warf wie elende Spreu, während man das Leere, Inhaltlose für goldenes Korn achtete, welchen Genuß mußte ihm das bereiten, ihm, der sich sagen durfte, seine geringsten Gedanken seien eine ganze Welt wert!
Aber es gab auch Zeiten, in denen die Größe seiner Einsamkeit schwer und erdrückend auf ihm lag. Ach wie oft, wenn er Stunde auf Stunde in heiligem Schweigen auf die Stimme in seinem Innern gelauscht hatte, dann Auge und Ohr wieder dem Leben öffnete, das ihn umgab, und sich nun so fremd fühlte in dem Elend und der Vergänglichkeit des irdischen Daseins – wie oft war ihm da nicht zumute wie jenem Mönch, der im Klosterwalde gelauscht hatte, während der Paradiesvogel einen einzigen Triller sang, und der, als er zurückkehrte, hundert Jahre entschwunden fand! Denn fühlte sich schon der Mönch einsam zwischen dem unbekannten Geschlecht, wie ungleich einsamer mußte nicht er sich fühlen, dessen wahre Zeitgenossen noch nicht einmal geboren waren! In solchen Augenblicken der Verlassenheit konnte sich Bigum über dem feigen Wunsche ertappen, hinabsinken zu können zu dem Schwarm der gewöhnlichen Sterblichen und ihr niederes Glück zu teilen, ein Bürger zu werden auf ihrer großen Erde, ein Bürger in ihrem kleinen Himmel. Aber bald war er wieder er selber.
Der andere Gast des Hauses, Fräulein Edele Lyhne, Lyhnes sechsundzwanzigjährige Schwester, hatte viele Jahre hindurch in Kopenhagen gelebt, zuerst bei der Mutter, die, nachdem sie Witwe geworden, in die Hauptstadt gezogen war, und seit dem Tode der Mutter bei ihrem reichen Onkel, dem Etatsrat Neergaard. Der Etatsrat machte ein großes Haus und nahm regen Anteil am geselligen Leben, so daß Edele in einen wahren Wirbel von Bällen und Festen hineingeriet.
Überall wurde sie bewundert, und die Mißgunst, der getreue Schatten der Bewunderung, verfolgte auch sie. Sie war eine so viel besprochene Persönlichkeit, wie es unbeschadet des guten Rufes irgend möglich ist, und wenn die Herren untereinander über die drei Schönheiten der Stadt sprachen, erhoben sich stets viele Stimmen, die den einen der drei Namen ausstreichen und den von Edele Lyhne an die Stelle setzen wollten; man konnte nur nicht einig werden, welche von den beiden Schönheiten das Feld zu räumen hätte, von der dritten konnte natürlich gar keine Rede sein.