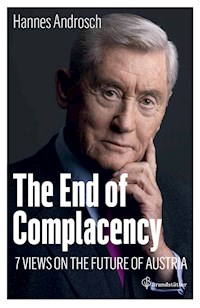18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Legendärer Finanzminister der Ära Kreisky, Chef der CA Creditanstalt Bankverein, Industrieller, Mäzen und Elder Statesmen, der offen seine Meinung sagt. Hannes Androsch zieht zum ersten Mal sehr privat und ausführlich Bilanz. Er liefert ein einzigartiges Zeitdokument, das nicht nur Einblicke in Österreichs vielleicht bewegteste Jahrzehnte gibt, sondern auch einer jüngeren Generation Orientierung bietet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hannes Androsch
NIEMALS AUFGEBEN
Lebensbilanz und Ausblick
Aufgezeichnet von Peter Pelinka
© 2015 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing,
eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Gesamtherstellung: Buch.Bücher Theiss, www.theiss.at
Umschlaggestaltung: Frank Behrendt
Umschlagabbildung: Langbein & Partner
Abbildungen Innenteil: Langbein & Partner
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software
ISBN 978-3-7110-5125-7
Meinen Kindern und Enkelkindern gewidmet
Prolog
Ich gehöre der ersten glücklichen Generation an, die den größten Teil ihres Lebensweges in Frieden, Freiheit, steigendem Wohlstand und einigermaßen gesicherter Wohlfahrt gestalten konnte. Meine Generation ist zwar eine, die das »Zeitalter der Extreme«, wie mein Freund Eric Hobsbawm das 20. Jahrhundert charakterisiert hat, in ihren Grundzügen miterlebt hat, aber eben nicht in allen grauenvollen Konsequenzen. Wer wie ich vor 1945 geboren ist, gehört zur Generation, die zwar den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen noch erlebt hat, aber danach ohne Unterbrechung auch den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg Österreichs. Das ist Grund zur Demut und Dankbarkeit. Aber auch ein Grund, sich selbst sowie Alters- und Weggefährten in Form einer rückblickenden Zusammenschau Rechenschaft abzulegen. Und ein Grund, ja eine Verpflichtung, den nachkommenden Generationen persönliche Erfahrungen nahezubringen, aus denen sie ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Ich will, dass unsere Kinder und Enkel stolz sind auf die Erfolgsstory der Zweiten Republik und sie verstehen. Wir tragen auch die Verantwortung, den nachkommenden Generationen ähnliche Möglichkeiten zu bereiten.
Es gibt zwei unschöne Dinge im Leben: das Erinnern und das Vergessen. Und es gibt zwei schöne Dinge: Erinnern – und Vergessen. Über meinen Lebensweg spannt sich der Bogen von den Überlieferungen aus der Habsburgermonarchie und ihrem Zerfall im und nach dem Ersten Weltkrieg, dem Bedeutungsverlust des »Staates, den keiner wollte« (Helmut Andics) und dem daraus resultierenden suizidären Bürgerkrieg samt autoritärer Ausschaltung der Demokratie, der Weltwirtschaftskrise, der Nacht des Nazifaschismus, Zweiter Weltkrieg inklusive, bis hin zur Wiederauferstehung eines »Staates, den jeder wollte«, eines Österreich, das freier und wohlhabender werden sollte als je ein Gebilde auf diesem Gebiet. Ich habe als Kind die Leiden und die Opfer, die Vertreibungen und die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs mitbekommen, als Jugendlicher die Erholung Österreichs und sein Aufblühen. Ich konnte sein Geschick eine Zeitlang politisch und wirtschaftlich als Finanzminister und Vizekanzler mitgestalten, nicht die schlechteste Periode der Zweiten Republik; dann als Generaldirektor der CA und als Industrieller eine andere wesentliche Rolle spielen; und hoffentlich weiter eine Zeitlang als politischer Mensch, der dazu kein politisches Amt benötigt.
Die Jahrzehnte meines bisherigen Lebens waren auch für mich persönlich höchst bewegt, eine Sammlung zahlreicher Erfolge und mancher Niederlagen, wobei ich mich stets bemüht habe, nie von Triumphen verblendet oder von Resignation übermannt zu werden. Ich kann für mich in Anspruch nehmen, auch in den bittersten Stunden nie aufgegeben zu haben, stets wieder aufgestanden zu sein. Persönliche Eigenschaften, die ihre Wurzeln haben: geprägt von einer glücklichen Kindheit in einer liebevollen Familie, von zahlreichen Jugend- und Studienfreunden, regional stets gut verankert in Wien-Floridsdorf, später im steirischen Ausseerland. Und geistig in den humanistischen Grundwerten der Sozialdemokratie. Verpflichtet den Zielen der Aufklärung, heute aktualisiert: Frieden, Freiheit, Toleranz, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Achtung der Menschenrechte, der Marktwirtschaft und der sozialstaatlichen Sicherheit und Verantwortung in dem Sinn, dass keiner zurück- oder alleingelassen wird, wenn er Pech hat, aus welchem Grund auch immer. Und verpflichtet jenem weltoffenen Internationalismus, der oft genug kleingeistigem Provinzialismus und opportunistischem Populismus geopfert wurde und wird. Mehr denn je bin ich seit dem Ende des Kalten Kriegs überzeugt: Österreich hat von der trotz aller Rückschläge zunehmenden westeuropäischen Integration enorm profitiert, Europa wird nur dann (s)eine positive Rolle im globalen Konzert spielen können, wenn trotz aller realpolitisch bedingten Verzögerungen diese Integration auf alle Teile unseres Kontinents ausgedehnt wird – und auf alle Ebenen. Seit 1989 ist mehr als ein Vierteljahrhundert mit großen Umwälzungen vergangen, dramatischen Veränderungen, schrecklichen neuen Gefahren, alles in rasantem, stets noch zunehmendem Tempo. Die folgenden Generationen haben dennoch die gleiche Herausforderung wie die meine: das nächste halbe Jahrhundert für sich und gemeinsam erfolgreich zu gestalten. Unter Berücksichtigung des allzeit gültigen Mottos von Willy Brandt: »Friede ist nicht alles. Aber ohne Frieden ist alles nichts.«
Ich habe viele Gründe, dem Schicksal dankbar zu sein. Und allen, die diesen Weg in unterschiedlicher Länge und Weise ermöglicht haben, Großeltern und Eltern, meiner Gattin Brigitte und meiner Schwester Sonja, meinen Töchtern Claudia und Natascha, ihren Kindern – meinen Enkelkindern Maximilian, Niklas, Clemens und Valerie –, meiner Partnerin Claudia und dem gemeinsamen Sohn Gregor sowie zahlreichen Freunden und Weggefährten aus dem In- und Ausland. Ihr Verdienst kann man erst voll ermessen, wenn sich der Lebensweg durch stürmische Schlechtwetterfronten bewegte. Ihnen allen möchte ich danken und mich entschuldigen, wenn ich sie gekränkt habe. Es mag nicht immer leicht gewesen sein, mich zu begleiten, ich bin wahrlich nicht frei von Fehlern. Zu meiner Entschuldigung bleibt mir nur, mit Pablo Neruda zu sagen: »Ich bekenne, ich habe gelebt!«
1. Die frühen Jahre: 1938–1959
Ich wurde am 18. April 1938, einem Ostermontag, in eine wild bewegte Welt hinein geboren, in einem wild bewegten Land: 37 Tage zuvor war Österreich vom nationalsozialistischen Deutschland annektiert worden, die Regierung Kurt Schuschnigg hatte sich dem übermächtigen Diktator Adolf Hitler ergeben. Geschwächt durch interne Auflösungserscheinungen, durch hohe Arbeitslosigkeit, den Druck der Straße, vor allem auch durch die selbst betriebene Spaltung des Landes: Nach dem Bürgerkrieg vom Februar 1934 hatte Schuschniggs Vorgänger Engelbert Dollfuß, dessen christlich-soziale Partei zuvor schon autoritär unter Ausschaltung der parlamentarischen Demokratie seit dem März 1933 regiert hatte, die sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) aufgelöst und ihre Anhänger in den Untergrund oder ins Exil gedrängt. Auch nach der Ermordung von Dollfuß im Zuge des nationalsozialistischen Putschversuches im Juli 1934 verabsäumten es die regierenden Austrofaschisten, auf die »roten« Erzfeinde zuzugehen und gemeinsam die Chance zu wahren, den Ansturm der Nationalsozialisten abzuwehren und damit das Ende der österreichischen Eigenstaatlichkeit mindestens hinauszuzögern.
Die illegalen Sozialdemokraten wollten wenigstens knapp vor dem militärisch erzwungenen – wenn auch von Teilen der heimischen Bevölkerung begrüßten – »Anschluss« Österreichs an Nazi-Deutschland einen versöhnlichen Handschlag versuchen: Bei ihrer geheimen »Vertrauensleutekonferenz« im Floridsdorfer Arbeiterheim am 7. März 1938 (auch mein Vater war Teilnehmer) beschlossen sie, die von Schuschnigg angekündigte Volksabstimmung für die Unabhängigkeit Österreichs trotz ihrer eigenen Unterdrückung zu unterstützen.
Bekanntlich ist es dazu nicht mehr gekommen: Fünf Tage später marschierte die deutsche Wehrmacht ein, Hitler ließ sich wieder drei Tage später, am 15. März, am Heldenplatz unter dem Jubel Tausender Österreicher triumphal feiern, während Tausende andere besorgt daheim saßen und weinten und sich wieder Tausende andere auf dem Weg in Gefängnisse und Konzentrationslager befanden. Allein zwischen dem Tag des »Anschlusses« Österreichs an Hitler-Deutschland und dem 10. April, dem Tag der inszenierten positiven Volksabstimmung darüber, wurden – wenn sie sich nicht gerade noch in die Emigration retten konnten – 76.000 oppositionelle Österreicher von der Gestapo festgenommen, 360.000 von jeglicher Wahl ausgeschlossen, ab 1. April rollten die ersten Züge mit Österreichern in das KZ Dachau. Wer von den 58.000 Angehörigen des österreichischen Bundesheeres den Fahneneid auf Hitler verweigerte, wurde gleich hingerichtet.
Die sozialdemokratisch geprägte Familie
Schon zuvor haben diese Entwicklungen in meiner sozialdemokratisch geprägten Familie ihre tiefen Spuren hinterlassen. Sowohl mein Vater Johann (Hans), Jahrgang 1903, als auch meine Mutter Julia (Lia), Jahrgang 1912, wurden in Wien geboren. Sie hatten mährische und auch böhmische Wurzeln. Mütterlicherseits lassen sich die Wiener Wurzeln bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurückverfolgen. Meine aus Mähren gekommenen Großeltern haben ihre kleinen Ersparnisse mit der Kriegsanleihe des Ersten Weltkriegs verloren, aus ihren Erzählungen habe ich die Probleme von Weltwirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit kennengelernt. Sie zählten zu den Anhängern Victor Adlers, des Arztes und Parteigründers der österreichischen Sozialdemokratie. Ein Urgroßvater war bei deren von berittener Polizei gewaltsam aufgelöster ersten Arbeiter-Demonstration am 1. Mai 1890 im Wiener Prater dabei, mein Großonkel, der Konsum-Direktor Georg Sailer, kandidierte 1913 noch für den Reichsrat und war in der Ersten Republik von 1922 bis 1930 sozialdemokratischer Abgeordneter zum Nationalrat für das Burgenland. Also bin ich in der vierten Generation sozialdemokratisch sozialisiert.
Er war es auch, der seiner Nichte Lia Sailer, meiner späteren Mutter, 1932 eine Anstellung bei der eigentlich »schwarzen« Wiener Molkerei WIMO vermitteln konnte. Deren Filialen in der Windmühlgasse und in der Liechtensteinstraße leitete sie bis 1937, dort vertrieb sie nicht nur Milch, sondern auch »unter der Budl« die verbotene, aus Tschechien nach Österreich geschmuggelte »Arbeiter-Zeitung«, das frühere Zentralorgan der SDAP. Zuvor hatte sie, Tochter eines Schlossers bei der Straßenbahn, das Kindergartenseminar besucht und unter anderem Vorlesungen der heute weltberühmten Psychologen Alfred Adler und Charlotte Bühler verfolgt. Kindergärtnerin konnte sie aber nur ein Jahr in einem Hort der Kinderfreunde sein, dann musste der Hort aus finanziellen Gründen geschlossen werden. Daneben nahm sie an der Wiener Urania Schauspielunterricht und konnte mit einigen Engagements ihr kleines Einkommen aufbessern.
Die Eltern
Bei solch einer Aufführung anlässlich des 100. Todestages von Franz Schubert lernte sie im November 1928 als 16-Jährige meinen Vater kennen und lieben. Lia spielte in einem von einer Freundin verfassten Stück über Schubert eine griechische Göttin, der neun Jahre ältere Fünfhauser Kinderfreunde-Funktionär Hans Androsch einen Lebzelter. Aufgrund einer Rückgratverkrümmung war er nur etwas größer als eineinhalb Meter, die Behinderung bescherte ihm zusätzlich eine Herzschwäche, an der er 1965 schließlich verstarb. Er hatte die Handelsakademie absolviert und war als Prokurist bei einer Textilhandelsfirma tätig. Zu seinem Leidwesen konnte er das begonnene Welthandelsstudium nicht beenden, umso mehr war es ihm ein Anliegen, dass dies sein Sohn tun möge.
Meine späteren Eltern kamen einander rasch näher, auch familiär: Lias Onkel Georg Sailer vermittelte auch Hans Androsch eine Stelle, diesmal – politisch passend – beim »roten« Konsum. Lia wiederum half beim Hausbau der künftigen Schwiegereltern auf einem Grundstück an der Gerasdorfer Straße, ebenso im Bezirk Floridsdorf – heute Donaustadt – gelegen wie ihre kleine elterliche Wohnung in einem Straßenbahnerhaus in der Wagramer Straße.
Am 28. Dezember 1933 wurde geheiratet, natürlich »nur« standesamtlich im Wiener Rathaus. Meine Mutter – ihr Vater Rudolf Sailer war als Atheist bei den Freidenkern – hatte die katholische Kirche aus Protest gegen deren politische Ausrichtung verlassen, mein Vater war nie gläubig. Beide traten bald darauf wie viele andere Sozialdemokraten der altkatholischen Kirche bei, im Ständestaat war speziell in einem »christlich-sozialen« Unternehmen wie der WIMO generelle Konfessionslosigkeit nicht gern gesehen. Sie hatten das Glück, noch vor den Februarkämpfen eine Gemeindewohnung im Speiserhof nahe dem Wasserpark an der oberen Alten Donau zu bekommen, ein Musterexempel für das 60.000 Wohnungen umfassende Erfolgsprogramm des »Roten Wien«. Es war eine von zahlreichen Wohnungen, die 1934 von der Artillerie des Bundesheeres beschossen und schwer beschädigt wurden – ein Schock, ebenso wie die zeitweilige Verhaftung des Vaters von Lia, die Hinrichtung eines seiner Freunde sowie die Tatsache, dass der verwundete Schutzbund-Gruppenführer Karl Münichreiter auf einer Bahre zum Galgen getragen und justifiziert wurde.
»Onkel Gusti«
In der Folge erlitt mein Vater zweimal eine Lähmung. Sie wurde ursprünglich als Multiple Sklerose behandelt. Die schlimme Diagnose bestätigte sich erfreulicherweise nicht, mein Vater musste aber aus diesen gesundheitlichen Gründen seine Stelle beim Konsum aufgeben und ließ sich zum Steuerberater ausbilden. Die eigene Kanzlei konnte er freilich erst 1941 als »Helfer in Buchführungs- und Steuerfragen« eröffnen. Behandelt wurde er vom Arzt Gustav Steiner, dessen Eltern in der Floridsdorfer Hauptstraße ein kleines Geschäft betrieben, ehe sie in ein KZ gebracht und dort getötet wurden. Meine Großmutter konnte ihnen davor noch gelegentlich Lebensmittel bringen. Gustav Steiner selbst konnte 1938 als Jude gerade noch mit seiner Frau nach England emigrieren.
Nach ihrer Rückkehr entwickelte sich zwischen beiden Familien wieder eine enge Freundschaft. »Onkel Gusti«, der später in meinem Steuerverfahren eine wesentliche Rolle spielen sollte, gründete mit meiner Mutter nach dem Tod ihrer beiden Partner eine Wohngemeinschaft in der Gerasdorfer Straße. Sein Dienst in der Habsburger-Armee hatte ihn sehr geprägt: Anlässlich einer Geburtstagsfeier für meinen Großonkel bat er den Kapellmeister der Blasmusik zu sich, gab ihm ein großzügiges Trinkgeld, ließ ihn den Kaiserjägermarsch spielen und legte die Hände an die Hosennaht, dabei kullerten ihm einige Tränen über die Wangen. Als ich ihn später dazu befragte, erklärte er: »Ich war zwar bei der Akademischen Legion des Schutzbundes. Aber ich habe im Ersten Weltkrieg dem Kaiser die Treue geschworen, die werde ich bis zum Lebensende halten.« Und dann sarkastisch: »Ich war mein ganzes Leben lang ein Schwein, zuerst für die Italiener ein österreichisches, dann für die Nazis ein jüdisches, dann im englischen Internierungslager ein deutsches.« Jedenfalls kehrte er mit seiner Frau nach Ende des Krieges nach Wien zurück, beide nahmen ihre ärztliche Tätigkeit wieder auf.
Die Geburt
Ich wurde im inzwischen aufgelassenen Brigittaspital nahe dem Höchstädtplatz geboren, meine Schwester Sonja folgte 1944 in Piesling an der Thaya in Mähren. Meinen Vornamen Hannes verdanke ich nicht nur meinem Vater, sondern auch Hannes Schneider, dem damals verehrten »Skikönig« vom Arlberg – meine Eltern waren von seinem Film »Sonne über dem Arlberg« begeistert. Zufall oder nicht: Lech am Arlberg zählt bis heute zu meinen winterlichen »Lebensmittelpunkten«, den ich mindestens einmal jährlich – inzwischen meist öfter – besuche. Ein zweiter ergab sich mit meinen Eltern: Erstmals fuhren sie mit mir 1942 nach Altaussee ins steirische Salzkammergut, heute mein zweiter Hauptwohnsitz. Auch meine Schwester, bis zu ihrer Pensionierung Verwaltungsdirektorin der Heilanstalt für Alkoholkranke in Kalksburg, besitzt dort ein Haus, es war auch das meiner Mutter bis zu ihrem Tod 2010. Mit Sonja habe ich mein ganzes Leben eine enge Beziehung, ich dürfte mit sechseinhalb Jahren Altersunterschied doch ein netter großer Bruder sein. Ein einziges Mal habe ich ihr eine körperliche Tortur angetan: Sie hat mich irgendwie sehr geärgert, ich wusste nicht, was tun – man konnte doch ein kleines Mädl nicht schlagen. Ich biss ihr in den Popo, sie lief schreiend zu Eltern und Großeltern. Natürlich bekam dann auch ich meinen Teil ab.
»Trotz oder gerade wegen des Altersunterschiedes von mehr als sechseinhalb Jahren hatten und haben wir ein ungebrochen gutes geschwisterliches Verhältnis. Er hat als großer Bruder stets auch bei meiner Entwicklung mitgeredet. Dass unser Vater nicht normal gewachsen war, war nie ein Thema daheim, zu Hause war er die dominante Person … Wie stark unsere Mutter war, haben wir erst gemerkt, als er schwerkrank wurde und natürlich nach seinem Tod … Ich wurde als Nachfolgerin von Erich Schmidt, dem späteren Minister, Obfrau einer Gruppe bei den Mittelschülern, die Fraktionskämpfe bei den Studenten hab ich nur vom Hannes mitbekommen. Rechts gegen Links, das hieß für uns: Androsch gegen Fischer … Der Vater war schon sehr ehrgeizig und hat den Hannes extrem gepusht. Einmal hat er ihm gesagt: Der Fischer hat schon wieder einen Artikel veröffentlicht, warum veröffentlichst du keinen?«
Sonja Schneider, Jahrgang 1944, Schwester, später unter anderem Verwaltungsdirektorin der Krankenanstalt Kalksburg
Vaters Behinderung
Vaters Behinderung bekam auch ich später immer wieder indirekt zu spüren, direkt zu hören, Kinder können grausam sein: Einmal habe ich einem älteren Buben, der zwei Köpfe größer war als ich, einen großen Stein in den Rücken geworfen – das hätte böse ausgehen können, für ihn wie für mich. Er hatte meinen Vater einen »buckligen Maikäfer« genannt. Dieser war trotz oder gerade wegen seiner Behinderung sehr strukturiert und zielstrebig. Ich habe von meinem Vater eine einzige Ohrfeige bekommen, weil ich »vorlaut« war, es ging um eine Nebensächlichkeit. Tags darauf habe ich mich entschuldigt, aber dazugesagt, ich fühle mich nicht schuldig. Daraufhin ist mein Vater in Tränen ausgebrochen. Eine völlige Ausnahme, sonst wurden Konflikte anders ausgetragen.
Mutters Stärke
Natürlich wurde meine Mutter immer mehr zur starken Persönlichkeit in der Familie, je schlechter es meinem Vater gesundheitlich ging. Ihr Einfluss scheint mir heute im Elternhaus deutlich stärker gewesen zu sein, aber das mag auch daran liegen, dass sie meinen Vater um 45 Jahre überlebt hat. Meine Mutter muss meinen Vater sehr gern gehabt haben, schließlich hat sie ihn trotz seiner körperlichen Behinderung und der Skepsis ihres eigenen Vaters geheiratet. Sie war sicher strenger als er, fast so streng wie die Mutter meines Vaters, die bis zu ihrem Tod 1951 in unserem gemeinsamen Haus lebte. Die Großmutter war sehr sparsam, ist daheim oft in geflickten Kleidern herumgelaufen, hat aber darauf geachtet, dass man immer gut gekleidet aus dem Haus ging. Bürgermeister Karl Seitz sei der bestangezogene Mann von Wien gewesen, daran hätte man sich zu halten. Das predigte meine Oma mir, ähnlich meine Mutter meinem Vater. Diese Predigten wirken bei mir heute noch nach.
1941 waren meine Eltern aus der kleinen Gemeindebauwohnung nahe dem Wasserpark in der Freytaggasse mit den Eltern meines Vaters in das größere Haus in der Gerasdorfer Straße gezogen, das bis dahin vermietet war. Dort lauschte mein Vater, untauglich für den Krieg, dem Schweizer Radiosender Beromünster, ein für die Nazis schweres Verbrechen. Er verfolgte nach diesen Meldungen auf einer großen Landkarte den Frontverlauf des Krieges in Europa, die anfänglichen Erfolge und dann die vorhersehbare Niederlage des Dritten Reiches. Ich erinnere mich auch noch daran, dass meine Mutter ganz aufgeregt mit der Meldung über das Ende der Schlacht um Stalingrad ins Wohnzimmer gekommen ist, im Februar 1943, da war ich knapp fünf Jahre alt. Das alles war schon allein gefährlich – noch gefährlicher war, dass mein Vater Franz Plöch, einen Bekannten aus der Siedlung, warnte, allzu konkret die schrecklichen Erlebnisse zu schildern, die er als Chauffeur für die SS in Polen mitbekommen hatte.
Ich war natürlich von der antinazistischen Einstellung meiner Eltern geprägt, erkannte aber als fünfjähriges Kind nicht die volle Tragik der Entwicklung. Im Gegenteil: Ich hatte mir angewöhnt, stets laut mit »Heil Hitler« zu grüßen, wenn an unserem Haus in der Gerasdorfer Straße Soldaten der Wehrmacht vorbeimarschierten. Dieser »Zauber der Montur« wurde mir aber bald ausgerechnet von einem Hitlerjungen ausgetrieben: Er zwang mich unter Zuhilfenahme seines Dolches, Erde und Gras zu schlucken – eine lehrreiche Erniedrigung, spätestens ab da war ich vor jeder autoritären Verlockung gefeit. Diese Konsequenz entsprach völlig der Tradition meiner Familie: In ihr gab es keine Austrofaschisten, keine Nationalsozialisten, keine Kommunisten. Ihre Sympathie für die Sozialdemokratie hat sich voll auf mich übertragen: Sie war im vergangenen Jahrhundert mit seinen zwei Weltkriegen und zahlreichen autoritären Systemen die einzige politische Bewegung in Kontinentaleuropa, aus der sich nie eine Diktatur entwickelt hat.
Ab Sommer 1944 wurden die alliierten Luftangriffe häufiger und gefährlicher. Meine Mutter war mit meiner Schwester schwanger und wir fuhren im Herbst zu unserem Schutz ins südmährische Piesling, einen kleinen Ort nahe der damals »ostmärkischen« Grenze, wo der Bruder meiner Großmutter väterlicherseits einen Bauernhof besaß. Ich mochte den Ort: Bereits die Jahre zuvor hatte ich mich immer wieder als kleiner Bauer verstanden und versucht. Einmal wurde es für mich dramatisch: Im Herbst 1943 fiel ich in den Feuerwehrteich. Wie ich als Nichtschwimmer herauskam, ist mir bis heute nicht ganz erklärbar. Jedenfalls versteckte ich mich durchnässt und geschockt, bis ein Nachbar vorbeikam und meine Eltern alarmierte: »Euer Bub steht triefend da draußen.« 1944, nach der kurzen Einschulung in der Wiener Brünner Straße, durfte ich das erste verkürzte Schuljahr in Piesling absolvieren. Der Direktor war ein SA-Mann, der seine Gesinnung vor allem an den Schülern demonstrierte, indem er sie mit Weidenruten schlug. Später ereilte ihn die von mir damals als gerecht empfundene Rache der Geschichte: Während der Vertreibung der Deutschsprachigen aus Südmähren wurde er von tschechischen Gendarmen mit einer Hundepeitsche geschlagen.
Kriegsende in Südmähren
In Piesling erlebte ich auch das Ende des Zweiten Weltkriegs. Vorerst dominierte ungetrübte Freude: Zu Ehren der Roten Armee hisste mein inzwischen nachgekommener Vater – wegen seiner Behinderung kriegsdienstuntauglich –, allerdings unter Missbilligung meines Großonkels, auf dem Haus eine rote Fahne, offenbar hatte er das Hakenkreuz herausgeschnitten. Da das Haus über das einzige Badezimmer im Ort verfügte, wurde es zunehmend auch von russischen Offizieren benutzt, meine Mutter musste sich als Bademeisterin bewähren. Die Situation im Ort spitzte sich zu, als alle Deutschsprachigen entsprechend der diesbezüglichen Punkte in den Beneš-Dekreten Südmähren zu verlassen hatten. Am Vormittag des 7. Juni 1945 verkündete das auch in Piesling ein Dorftrommler. Alle Reichsdeutschen sollten in zwei Stunden das Dorf verlassen, sie konnten nur das mitnehmen, was sie am Körper tragend retten konnten, mein Großonkel und meine Großtanten zogen an diesem heißen Tag ihr Sonntagsgewand an und küssten die Türschwelle ihres Hauses, in das sie nie mehr zurückkehren sollten. Ich werde nie vergessen, wie die Bewohner eines Dorfes nach dem anderen um die S-Kurve vor unserem Haus vorbeizogen und die tschechischen Organe über ihre Köpfe hinweg Schüsse abfeuerten. Meine Mutter stellte mich an diesem 7. Juni 1945 aufs Fensterbrett: »Bub, schau dir genau an, was hier passiert. Das darfst du nie vergessen.« Ich habe es auch nicht vergessen: Auch wenn dieses Unrecht eine Reaktion auf ein früheres, »gegenteiliges« Unrecht war, hat es mich später lange einige Überwindung gekostet, in die Tschechoslowakei zu reisen. Nach der Vertreibung aus Südmähren wurde mein Großonkel übrigens Wein-Sensal im Weinviertel. Von ihm lernte ich als Jugendlicher die Weinwirtschaft kennen, noch nicht das edle Getränk: Ich war als Hand- und Fußballer lange Zeit abstinent.
Als Österreicher wurden uns zwei Tage mehr Zeit für die Ausreise gelassen, die tschechischen Gendarmen gaben uns sogar noch Güter aus dem nun enteigneten Haus meines Großonkels ins Gepäck. Wir reisten über mehrere Zwischenstationen nach Wien zurück, zuerst zu Verwandten nach Weikertschlag, dann nach Drosendorf, stets Verbindungen nach Wien suchend. Die gab es zwar, aber die Züge waren so überfüllt, dass sich Menschen sogar auf den Waggondächern drängten, keine Chance auf einen Platz mit einem Kinderwagen. Diese Möglichkeit konnten wir dann auf einem Tankzug in Großsiegharts ergreifen, wohin uns Bekannte mit einem Fuhrwerk gebracht hatten. Aber diese letzte Etappe hätte mir beinahe das Leben gekostet. Die Plattform war überfüllt, meine Mutter band mich und den Kinderwagen mit einem Strick an das Geländer. Groß war mein Entsetzen, als sich in Großjedlersdorf beim Aussteigen das vom Regen durchnässte Seil um meine Hand nicht lösen ließ und ich beinahe mitgeschleift worden wäre. Ein Passagier rettete mich, indem er im letzten Moment vor der Weiterfahrt des Zuges den Knoten mit seinem Messer durchschnitt. Gleich neben mir wurden zwei blutüberströmte Frauen vorbeigetragen – ihnen hatte der Zug die Beine abgetrennt. Seit diesem traumatischen Erlebnis trage ich stets ein Taschenmesser mit mir – in jedem Anzug, in jeder Freizeithose.
Rückkehr nach Wien
Umso freudiger war unsere Rückkehr nach Floridsdorf. Erst recht, als wir sahen, dass unser Haus in der Gerasdorfer Straße unversehrt geblieben war. Wir waren am Bahnhof sitzen geblieben, der Vater mit einem Leiterwagerl zurückgekommen: Haus steht, Großeltern leben! Als wir das Haus verlassen hatten, war die deutsche Wehrmacht in der Kaserne daneben gewesen, nun war in Teilen davon die Sowjetarmee. Wien war zerbombt, ein Bogen der Floridsdorfer Brücke lag in der Donau, der Mangel war allgegenwärtig. Dennoch spürte man bald den Geist eines »Neuen Österreich«, das von den Alliierten sowohl befreit als auch besetzt worden war. Ein sozialdemokratisches Urgestein bildete die erste provisorische Regierung: Karl Renner, bereits nach dem Ersten Weltkrieg österreichischer Staatskanzler der Ersten Republik. Ab Dezember 1945 fungierte er bis zu seinem Tod Ende 1950 als erster Bundespräsident der Zweiten Republik.
Nach den ersten freien Wahlen im November wurde eine Allparteienregierung gebildet: aus der ÖVP (die Nachfolgerin der Christlich-Sozialen erreichte mit 85 Mandaten die absolute Mehrheit von damals 165 und stellte mit Leopold Figl den ersten Bundeskanzler), der SPÖ (sie trug anfangs den Untertitel »Sozialdemokraten und Revolutionäre Sozialisten« und erzielte 76 Mandate, ihr Parteichef Adolf Schärf wurde Vizekanzler) und der KPÖ (sie schnitt mit nur vier Mandaten überraschend schlecht ab und schied zwei Jahre später aus der Regierung aus). Das historisch »dritte« Lager, in dem sich früher Deutschnationale und später Nazis gesammelt hatten, durfte vorerst nicht kandidieren. Es durfte sich erst 1949 im VdU (Verband der Unabhängigen), der 1955 zur FPÖ umgetauft wurde, wieder politisch betätigen.
Schulzeit an mehreren Orten
Nun kehrte ich nach dem »Zwischenspiel« in Südmähren wieder in meinem Heimatbezirk Floridsdorf in die Volksschule Brünner Straße zurück. Eine Reihe vor mir saß der später Weltruhm erlangende Hermann Nitsch. Seine späteren Erfolge als Maler lagen sicher nicht daran, dass ich ihm einmal eine Schachtel Buntstifte überließ, Preis für zahlreiche »Motivationsgutscheine«, die unsere Lehrerin austeilte.
Bereits im Frühjahr 1946 folgte eine neue Volksschulstation. Obwohl wir in unserem Siedlungshaus mit Garten, Obst- und Gemüseanbau sowie Hühnern und Kaninchen vergleichsweise gut ausgestattet waren, zählte auch ich als mageres »Bürscherl« zu jenen Wiener Stadtkindern, die zwecks »Aufpäppelung« in bäuerliche Regionen verschickt wurden. In meinem Fall war das die Ortschaft Andelsbuch, mit etwa 1300 Bewohnern im Bregenzerwald gelegen. Die Bahnfahrt, von Unwettern unterbrochen, war lang, die Aufnahme in eine Bergbauernfamilie freundlich, das Heimweh dennoch sehr groß. Bald war ich dort als »Hüterbub« und beim Heumachen eingesetzt. Ich habe noch heute meine Beziehungen zum Bregenzerwald, immer wieder gibt es Treffen mit den Bekannten von damals in Andelsbuch. Sie besuchen mich auch regelmäßig bei meinen Aufenthalten in Lech.
Im darauffolgenden Herbst setzte ich den Unterricht in der dritten Klasse in der Brünner Straße fort – wieder eine unvollendete »Volksschulkarriere«. Denn zu Jahresbeginn wurde ich als Pflegekind ins Ausland verschickt, nach Molenbeek bei Brüssel, nahe dem Schlachtfeld von Waterloo, zur flämischen Lehrerfamilie Dewilde. Ich war einer von zwei österreichischen »Zusätzen« zu ihren eigenen sieben Sprösslingen. In einer katholischen ganztägigen (!) Schule wurde ich auch von meinem Pflegevater unterrichtet, mit einem seiner »echten« Söhne bin ich heute noch befreundet – uns eint vor allem auch die Erinnerung an die für uns beide erste Zigarette. Es war zwar nicht die letzte meines Lebens, aber wirklich geschmeckt hat mir keine. Mein Vater hat mir zum 16. Geburtstag eine Pfeife geschenkt mit der Erwartung, kein Raucher zu werden. Das bin ich auch nicht geworden.
Nur die vierte Volksschulklasse absolvierte ich ungeteilt daheim. Die Vorliebe unseres Lehrers galt mehr dem Fußballspiel als dem Deutschunterricht. Das gefiel uns zwar, erwies sich aber als weniger gut für unsere Deutschkenntnisse. Lesen allerdings faszinierte mich schon damals (und tut es heute noch, wofür meine große Bibliothek Zeugnis ablegt). Mein damaliger »Favorit« war anfangs – natürlich – Karl May, ich hielt ihn nach einiger Zeit aber für eher langweilig. Spannender fand ich bald Robert Louis Stevenson (mit seiner »Schatzinsel«) und vor allem Jack London. Es spricht nicht gerade für die Qualität meines damaligen Lehrers, dass er über diesen »Schund« verächtlich die Nase rümpfte. Jedenfalls schaffte ich trotz der schwierigen Umstände – netto vielleicht zwei Volksschuljahre in vier Schulen mit acht Lehrern – auf Anhieb die Aufnahmsprüfung in das Gymnasium BRG 21 in der Franklinstraße. Als »Honorar« bekam ich von meinem Großvater Franz Androsch bei einem Besuch des noch weitgehend zerstörten Praters das erste Eis meines Lebens. Leider war es unser letzter gemeinsamer Ausflug, er starb wenige Wochen danach.
Erinnerungen an Floridsdorf
Meine Floridsdorfer Kindheitserinnerungen waren zunächst vom Krieg geprägt: von Luftangriffen, Flaks und Scheinwerfern, denn die Kaserne auf der Gerasdorfer Straße war eine Luftabwehrkaserne. Wenn der Fliegerangriff vorbei war, gingen mein Großvater und ich oft vom Keller auf die Straße und sammelten Bombensplitter ein. Auf dem nun nicht mehr genutzten Kasernengelände lagen unzählige Geschosse. Uns Buben war es natürlich verboten, damit zu spielen. Genau das aber geschah immer wieder – mit dem Ergebnis, dass es zwei nur etwas älteren Jungen das Leben kostete.
Nach Kriegsende kam die Besatzungszeit. Floridsdorf zählte zur russisch verwalteten Zone Wiens, ich persönlich erlebte aber keinen der häufig berichteten Übergriffe. In unserem Haus war ein sowjetischer Offizier einquartiert, der seine Qualitäten als Brückenbauingenieur bei der Wiedererrichtung der Floridsdorfer Brücke einsetzen konnte. Für uns war er ein Schutzschild: Seine Pferdekutsche vor unserer Einfahrt signalisierte den Offizier im Haus, schon deshalb war es für Plünderungen tabu. Als sein russischer Kutscher in unserem Garten saß, reichte ihm die Großmutter einmal böhmische Dalken. Er bedankte sich mit einer Schachtel Zündhölzer – mehr hatte er fern der Heimat selber nicht. Einmal wollten uns zwei Soldaten Hühner entwenden. Meine Großmutter fuhr dazwischen. Sie verstanden und ließen die Hühner zurück: Mit einer so energischen »Babuschka« legt man sich besser nicht an.
Viele Österreicher, vor allem Österreicherinnen, kamen nicht so glimpflich davon. Und fast alle litten unter dem Mangel, den Bundeskanzler Leopold Figl in seiner berührenden Weihnachtsrede 1945 geschildert hatte: »Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben, nicht einmal Glas (für die Fenster), aber glaubt an dieses Österreich!« Es waren Worte von Churchill-hafter Dimension. Die allgemeine Bilanz des Landes wurde erstmals 1960, nach Ende der ersten Wiederaufbauperiode, gezogen: Die Kosten der Kriegsschäden wurden auf 160 Milliarden Schilling geschätzt, die Kosten für die Besatzung und die Konsequenzen aus dem Staatsvertrag auf 100 Milliarden. Demgegenüber betrug das gesamte Bruttonationalprodukt 1960 163 Milliarden, die Gesamtsumme ausländischer Hilfsgüter 60 Milliarden, die Hälfte davon umfasste der amerikanische Marshallplan.
»Mittelstand« in der Nachkriegszeit
Zum Unterschied von manchen meiner Altersgenossen kannte ich keinen Hunger, weil wir einen Garten und »Grabeland« bewirtschafteten und meine Eltern als Steuerberater einmal im Monat Klienten im Wald- und Weinviertel besuchten. Meine Mutter konnte so neben den bis 1. Mai 1953 rationierten Grundnahrungsmitteln wie Erdäpfel oder Hülsenfrüchte auch Spezialitäten wie Speck, Butter und Bauernbrot auf den Tisch stellen – Naturallohn vieler Kleingewerbetreibender für die buchhalterische Beratung. In die Schule bekam ich solche Kostbarkeiten nicht mit, aus Rücksicht auf die Klassenkameraden. Wir waren im Floridsdorfer Milieu wohl das, was man heute Mittelstand nennt, trotz der bäuerlichen und proletarischen Bezüge meiner Großelterngeneration. Als Steuerberaterin nahm mich meine Mutter bereits vor meiner Einschulung mehrmals zu Besuchen aufs Finanzamt mit, ich bekam also diesen Aspekt meiner späteren Berufslaufbahn quasi mit der Muttermilch mit.
Die Eltern nahmen mich auch früh ins Theater und in die Oper mit: Die erste Oper – noch vor der Wiedereröffnung der Staatsoper im November 1955 – empfand ich noch als Strafe (es war der »Fliegende Holländer« und in meiner Erinnerung mindestens vier Stunden lang); aber die nächste (auch im Theater an der Wien) begeisterte mich: »Rigoletto«, wohl auch deshalb, weil die Hauptperson, ein Buckliger, entsprechende Gefühle in Bezug auf meinen Vater hervorrief. Ich war hocherfreut, als ich im Oktober 1955 für eine der ersten Vorstellungen im neuen Burgtheater – Grillparzers »König Ottokars Glück und Ende« mit Ewald Balser und Attila Hörbiger – vom Deutschprofessor eine Stehplatzkarte erhielt. Meine Eltern hatten Abonnements für das Volkstheater und die Volksoper, meine kleine Schwester tanzte in deren Ballett. Das hat mich mein ganzes Leben lang geprägt. Bald faszinierten mich Konzerte, die Salzburger Festspiele habe ich mit Brigitte anlässlich unserer Verlobung zum ersten Mal genossen, ich besuche sie nun seit über 50 Jahren. Und auch das Finanzministerium haben wir – insbesondere Beppo Mauhart – in den Prunkräumen zu einer Kulturstätte gemacht, mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten. Wir öffneten das Prachtgebäude in der Himmelpfortgasse, verwendeten es nicht wie heute als bloßes Museum.
1952 leistete sich unsere Familie sogar eine echt luxuriöse Anschaffung: einen Ford Taunus 12M mit der Weltkugel als Frontemblem. Damals gab es in Österreich nur 82.000 Pkws, heute sind es 4,6 Millionen. Unser Auto kostete 80.000 Schilling, mein Vater benötigte es, weil seine Behinderung zunehmend sein Herz belastete. Es muss ihn getroffen haben, dass das gleiche Auto ein Jahr später nur die Hälfte gekostet hätte. Ein Resultat des die Inflation dämpfenden, 1953 vereinbarten Raab-Kamitz-Kurses, benannt nach Kanzler und Finanzminister – in Wirklichkeit ein Kamitz-Waldbrunner-Kurs: Karl Waldbrunner bildete als sozialistischer »Verstaatlichten-Minister« mit Reinhard Kamitz eine stabile und entscheidende wirtschaftspolitische Achse in dieser Wiederaufbauphase nach 1945. Unterstützt wurde dieser Kurs durch das Schuldenabkommen von Rom 1952, durch das Österreich 71,5 Prozent der Vorkriegsschulden erlassen wurden. Es verblieben 165 Millionen Schilling; die letzte Rate davon wurde aus dem Budget 1978 beglichen.
Das Jahr 1953 war ein Schlüsseljahr. Die schwierigen unmittelbaren Nachkriegsjahre gingen zu Ende, es folgten zwei Jahrzehnte außergewöhnlicher Wohlstandsmehrung, genannt das »Goldene Zeitalter«. Sein »Treibstoff« war bis zum ersten Ölpreisschub im Herbst 1973 vor allem billiges Erdöl, für das bis dahin Überangebot bestand. 1953 verstarb Josef Stalin, auch der Koreakrieg ging zu Ende. In Österreich wurde die SPÖ bei den Nationalratswahlen erstmals stimmenstärkste Partei, blieb aber aufgrund des Wahlrechts ein Mandat hinter der ÖVP, so wie dann noch einmal 1959. Erst 1970 sollte es Kreisky gelingen, seine Partei auch zur mandatsstärksten zu machen und den Kanzler zu stellen.
Bis zum Tod meiner Großmutter 1951 bin ich also in einem Dreigenerationen-Haushalt wohlbehalten aufgewachsen, war sicher besser gestellt als viele meiner Mitschüler. Die meisten von uns führten ein recht unbeschwertes Leben, kurvten mit mehr oder weniger alten Fahrrädern durch die Ortsteile von Floridsdorf. Ich fühlte mich wohl in diesen Gruppen, war aber im Gegensatz zu manchen Schilderungen über meine Jugendzeit den Mädchen gegenüber eher schüchtern – meine erste Liebe lernte ich mit 18 kennen, sie ging in die Klasse von Erika Pluhar.
In der Franklinstraße kam ich nicht mehr in den bereits vollen »englischen« Sprachzweig, sondern in den »russischen« – acht Jahre Russisch schien weniger attraktiv als acht Jahre Englisch, unsere Klasse war deshalb auch halb so groß wie die parallele »englische«. Leider kamen mir diese Sprachkenntnisse im Laufe der Zeit abhanden, geblieben ist mir aber die Bewunderung der russischen Literatur. Die der deutschsprachigen war inzwischen immerhin so gewachsen, dass ich als 14-Jähriger Friedrich Schillers »Glocke« auswendig aufsagte – aus freien Stücken. Mein Vortrag gab den Klassenkollegen reichlich Gelegenheit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen.
Als Halbwüchsiger war ich inzwischen auch fertig »politisiert«. Bei der Wahl 1949 – die »minderbelasteten« und erstmals zur Stimmabgabe zugelassenen ehemaligen NSDAP-Mitglieder verhalfen der FPÖ-Vorläuferpartei VdU zu 16 Mandaten und damit Platz 3 – durfte ich erstmals »Melder-Assistent« sein; die hatten am Wahltag Parteimitglieder, die noch nicht im Wahllokal erschienen waren, dazu zu motivieren. Für mich eine Selbstverständlichkeit: Bei uns gab es schon beim Frühstück nie eine andere Zeitung als die »Arbeiter-Zeitung«, die sich damals unter anderem durch mutige Kritik an Übergriffen sowjetischer Soldaten und Behörden Anerkennung weit über sozialistische Parteigrenzen hinaus erworben hatte.
Die erste politische Funktion
Meine Eltern waren überzeugte, aber niemals orthodoxe Parteigänger, ich erinnere mich an viele lebhafte Diskussionen mit Andersdenkenden. Auch das »praktische« Parteileben an der »Basis«, in der Sektion 11 der Floridsdorfer SPÖ, erlebte ich schon früh. Mein Vater war dort und im »Freien Wirtschaftsverband« aktiv, meine Mutter bei den Frauen. Sie studierte außerdem für und mit Jugendgruppen Sprechchöre und Theaterstücke ein. Zwei ihrer Freunde sollten für mich später besondere Bedeutung erlangen: die spätere Nationalratsabgeordnete Rosa Weber und der spätere Stadtrat und Landtagspräsident Fritz Hofmann. Ich erhielt 1967 das Mandat der am Großglockner tragisch verunglückten Floridsdorfer Nationalratsabgeordneten, Fritz Hofmann wurde im Bezirk mein besonderer Förderer.
»Hannes Androsch hat bei meinem Vater Kinderturnstunden beim WAT (Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein, Anm. P. P.) genommen. Ich lernte ihn kennen, als wir gemeinsam in einer Theatergruppe auftraten, die seine Mutter geleitet hat … Ich wurde dann Obmann der Sozialistischen Jugend in Floridsdorf, er ging später in die Studentenpolitik. Als ich Bezirksobmann der SPÖ wurde, mit 32, habe ich den zehn Jahre jüngeren Androsch 1966 auf die Kandidatenliste für den Nationalrat geholt, er war ja insbesondere bei den Damen ein besonders beliebter Redner … Er wäre der logische Nachfolger Kreiskys gewesen, aber nur mit ihm, nicht gegen ihn, das hat er sicher auch gewusst … Warum er sich mit Franz Vranitzky so entzweit hat, verstehe ich bis heute nicht wirklich.«
Fritz Hofmann, Jahrgang 1928, unter anderem Bezirksparteiobmann der SPÖ Floridsdorf, Wiener Planungsstadtrat
Meine erste politische Funktion übernahm ich 1953, ich wurde mit 15 Jahren Obmann des Floridsdorfer VSM (Verband Sozialistischer Mittelschüler). Diese Funktion klang wichtiger, als sie war: Eigentlich ging es darum, die Bezirksgruppe erst aufzubauen. Das gelang in kleinen Schritten, wir »Transdanubier« hatten kaum Kontakte mit der Wiener Führung des VSM. Oberster »Schülerzampano« war damals Charly Blecha, Heinz Fischer Obmann der viel »ideologischeren« Hietzinger Bezirksgruppe, zu ihr gehörte auch meine spätere Frau Brigitte. Wir rekrutierten eher »pragmatisch«, mit Vorträgen und Ausflügen. Aber erfolgreich: Floridsdorf war bald einer der mitgliederstärksten Bezirke des VSM, auch meine halbe »Russenklasse« wurde geworben.
Kein Musterschüler
Weniger erfolgreich verlief meine eigentliche Mittelschultätigkeit zwischen 1948 und 1956. Ich war alles andere als ein Musterschüler, eher ein mittelmäßiger Schüler. Dazu kamen oft schlechte Betragensnoten, weil ich allzu vorlaut war. Ein besonderes Beispiel dafür war die fünfte Klasse: Zwar erhielt ich im zweiten Trimesterzeugnis acht Einser und einen Dreier, aber zugleich auch »Fleck«. Zwei konnte ich ausbessern, den dritten in Latein nicht, auch nicht bei einer Nachprüfung. Aber angesichts meiner acht Sehr gut ließ mich der Direktor aufsteigen. Meine teilweise bescheidenen schulischen Erfolge waren sicher auch Konsequenz meiner Wanderjahre durch mehrere Volksschulen. Auch deshalb tat ich mir mit der Orthografie schwer, je nach Lehrer mit Mathematik. Diese Hürde konnte ich einige Male nur mithilfe meines besten Freundes Wilhelm Schneider schaffen, später mein Schwager und Professor an der Wiener Technischen Universität. Mehr Freude bereiteten mir Deutsch und Philosophie, überdies genoss ich einen doppelten Religionsunterricht: als einsamer Altkatholik in Gestalt einer Art Ethikunterricht, dazu auch zugelassen zum katholischen Religionsunterricht.
Großen Spaß gemacht haben mir die Theateraufführungen in der Oberstufe, oft zusammen mit Erika Pluhar, ebenfalls ein Floridsdorfer »Urgestein«. Solche Veranstaltungen haben wir als Klasse auch zur Geldbeschaffung genutzt, etwa wenn es darum ging, Mitschüler zu unterstützen, die sich die allerbeliebteste Institution meiner Schulzeit sonst nicht hätten leisten können: Schulskikurse. Beim letzten, in der siebten Klasse, eskalierte eine harmlose Revolte – wir sangen uns im Matratzensaal mit »Gstanzln« gegen einen Professor in den Schlaf – recht böse, eine Ohrfeige und nächtliches »Strafestehen« inklusive. Skifahren und Tennis zählten damals (wie heute) zu meinen Leidenschaften, auch Fußball (damals mehr als heute). Zum Entsetzen meines Vaters war ich Tormann und Stürmer beim UHK (Union Handelskammer) Großjedlersdorf, einem Verein der »schwarzen« Union. Väterliche Abgrenzungsaufforderungen – er musste sich deshalb in seiner Parteisektion einige Kritik gefallen lassen – blieben beim Halbwüchsigen aber wirkungslos.
Mit dem Fußballverein erhielt ich in Limburg, einer niederländischen Provinz, auch eine Lektion in Sachen Kriegsbewältigung: Die Veranstalter eines Turniers erklärten uns, als deutsche Mannschaft hätten wir keine Einladung bekommen – als Österreicher natürlich schon. Noch deutlicher ein Erlebnis drei Jahre später: Ich fuhr mit Willi Schneider (später heiratete er meine Schwester) mit dem Ford meiner Eltern zur Expo nach Brüssel. Bei einem Zwischenstopp in Luxemburg wurde uns aufgrund unserer deutschen Sprache ein Zimmer verweigert – als die Wirtsleute dann aber unser Autokennzeichen sahen, war es plötzlich frei: Österreicherbonus!
»Hannes und ich haben 1948 gemeinsam das Gymnasium in der Franklinstraße begonnen, 21 Burschen in der sogenannten Russenklasse. Erstmals kam ich 1950 in sein Haus, als mir seine Mutter ihr Fahrrad lieh, damit auch ich als Ärmerer bei einem Ausflug auf der Höhenstraße radeln konnte. Er kam regelmäßig zu mir nach Deutsch-Wagram und umgekehrt, später waren es Roller und dazu Freundinnen. Er hat in unserer Gruppe bald eine prägende Rolle gespielt, war hilfsbereit und integrativ, konnte von daheim her früh auf Diskussionskultur bauen und auf Auslandskontakte, war als Allroundsportler angesehen. Nur beim Schwimmen war er schwächer, ich werde nie verstehen, warum er trotz seiner schrecklichen gelben Badehose bei den Mädchen so gut ankam … Wir beide waren eher einseitig interessiert und talentiert, ich eher mathematisch-physikalisch, Hannes geschichtlich-philosophisch. Noch ehe seine Mutter meine Schwiegermutter wurde, lud sie mich einmal zum Mittagessen ein, ich sollte ihn dazu bewegen, endlich seine Dissertation abzuschließen – ich lehnte ab: Für die politische Karriere schien mir ein Doktorat eher zweitrangig zu sein … Hannes hat Kreisky sicher nie auf die Seite drängen wollen, aber er wird schon der logischen Meinung gewesen sein, er könne nach Kreisky dessen Job ausfüllen.«
Wilhelm Schneider, Jahrgang 1938, Jugendfreund und Schwager, später unter anderem Professor an der Technischen Universität Wien
Einen solchen hatte das gesamte Land bereits – allerdings nach zehnjähriger Besatzungszeit – zuvor erhalten, mit dem Staatsvertrag vom 15. Mai 1955. Tausende strömten zur Feier beim Belvedere, ich fuhr mit dem Fahrrad nur bis zum Stephansplatz und hörte selten ergriffen das Geläut der Pummerin. Fast eine ähnliche Bedeutung hatten die Wiedereröffnungen der beiden großen Bühnen: Ich bekam eine Karte für das Burgtheater, der musikalische Willi Schneider ein Ticket für die Staatsoper. Für meine Generation war der Abzug aller Besatzungssoldaten lange der Anlass für die Wahl des 26. Oktober als Nationalfeiertag. Offiziell ist es der damals gefasste Beschluss der »immerwährenden Neutralität«. So problematisch dieser Begriff heute scheint – Tatsache ist, dass die Neutralität von einer politischen Voraussetzung für die Erlangung des Staatsvertrags und damit der eigenen Souveränität zu einer in der Bevölkerung tief verankerten Teilidentität Österreichs wurde, so wie die D-Mark für die Bundesrepublik Deutschland.
Matura geschafft
Am 1. Juni 1956 erhielt ich einen »privaten« Bonus, einen für das ganze Leben: Ich schaffte die Matura mit einem Sehr gut in Deutsch, einem Gut in Physik und einem Genügend in Latein. Nur bei der schriftlichen Russisch-Prüfung fiel ich durch. Gut überlebt haben wir dann auch den Schock bei der Maturareise: Unserem Fahrer missglückte in Osttirol ein Bremsmanöver, der Bus rutschte über eine Böschung und wurde nur durch Bäume von einem weiteren Absturz abgehalten. Unsere Ziele Bozen und Graubünden erreichten wir dann mit einem gemieteten Postautobus.
Im Herbst 1956 begann ich mein Studium an der Hochschule für Welthandel, der heutigen Wirtschaftsuniversität, damals eine vergleichsweise kleine Institution: 1956 gab es 4000 Studenten, heute sind es fast neunmal so viele. Die Studienwahl erfolgte – wie vieles in meinem Leben – letztlich pragmatisch: Jus wurde es dann doch nicht, die Handelswissenschaften kannte ich durch den Beruf meiner Eltern besser. Frühere Jungenträume hatte ich längst abgelegt: Ich studierte weder Atomphysik noch Zahnmedizin. Letztere, recht ungewöhnliche kindliche Sympathie war dem Geschenk eines Familienfreundes geschuldet: Der Zahnarzt hatte mir ein Zahnarztbesteck geschenkt.
Den ersten Teil meines Studiums bis zum Diplom schloss ich schnell ab, in nicht ganz sieben Semestern. Der zweite Teil bis zum Doktorat ging dann viel langsamer, damals hatte ich aber auch schon zwei Berufe: neben dem im Parlament auch den, zu dem ich ursprünglich ausgebildet worden war. Als Steuerberater und beeideter Wirtschaftsprüfer war ich nur wenige Jahre, von 1966 bis Anfang 1970, aktiv, aber die Ausbildung ist mir bis heute hilfreich. Mein späterer Doktorvater Professor Leopold Illetschko hat uns gepredigt: »Wenn Sie Buchhalter werden wollen, verlassen Sie meine Vorlesung, aber Sie müssen so viel davon verstehen, dass Ihnen Ihr Oberbuchhalter nie etwas vormachen kann.« Wenn ich heute in einer Aufsichtsratssitzung einmal nicht ganz aufmerksam bin – das soll gelegentlich vorkommen –, bin ich jedenfalls hellwach, wenn es ums Wesentliche geht. Ich kann Zahlenströme und Bilanzen recht schnell auf den Punkt bringen.
Der Kalte Krieg zwischen den einstigen Verbündeten gegen Nazi-Deutschland erreichte 1956 einen neuen Höhepunkt. Mitte Oktober 1956 schlug die Rote Armee in Ungarn einen Volksaufstand nieder, ein Zeichen dafür, dass auch drei Jahre nach Stalins Tod das sowjetische Regime in seinem Herrschaftsbereich keine Abweichung duldete. Rund 180.000 Flüchtlinge wurden in Österreich aufgenommen, von einer Bevölkerung, die viel ärmer war als die heutige. Damals machte keine Partei, kein Journalist, kein Leserbriefschreiber gegen diese humane Selbstverständlichkeit Stimmung. Das war auch noch so nach Ende des Prager Frühlings 1968 oder im Zuge des Bosnien-Krieges in den Neunzigerjahren. Inzwischen hat sich aber offenbar eine prinzipielle Furcht vor Ausländern oder eine Feindlichkeit ihnen gegenüber so breitgemacht, dass wir nicht einmal einige tausend Asylwerber unterbringen können.
Die Wahl 1957