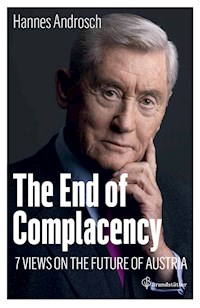Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Österreich hat seit 1945 eine unglaubliche Erfolgsstory hingelegt und ist bisher besser durch die Krise gekommen als die meisten anderen Länder. Doch diese Erfolgsstory schreibt sich nicht von selbst fort. Bequemlichkeit, Reformmüdigkeit und mangelnder Leistungswille drohen das Land zurückfallen zu lassen, schreibt Hannes Androsch. Der frühere Finanzminister belässt es nicht bei der Diagnose des Status Quo. Er beschäftigt sich mit den großen Linien der österreichischen Identitäts-Geschichte und bringt jene Kräfte zum Vorschein, die im Land seit Jahrhunderten bremsend fortwirken: Von der überbordenden Liebe zum Landesfürsten bis hin zum notorisch schwierigen Umgang Österreichs mit seinen herausragendsten Köpfen. Aufbauend auf einer wechselvollen und facettenreichen Vergangenheit stellt Androsch sieben Thesen zur Zukunft des Landes auf. Und diese Zukunft ist untrennbar verbunden mit jener Europas: Warum der europäische Wohlfahrtsstaat reformiert werden muss, wie den neuen Polit-Populisten des Kontinents das Wasser abgegraben werden kann und was ein Europa ohne Euro bedeuten würde, sind deshalb Schlüsselpassagen dieser streitbaren Schrift.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannes Androsch · Das Ende der Bequemlichkeit
Für Claudia, Natascha und Gregor
Hannes Androsch
DAS ENDE DER BEQUEMLICHKEIT
7 Thesenzur Zukunft Österreichs
Inhalt
Eine Erfolgsstory, die sich nicht von selbst fortschreibt
Einleitung
1
Reformen brauchen weiterhin den Anstoß „von oben“
2
Der Glaube an den Staat, die Liebe zum Landesfürsten und der geschützte Sektor – vom Erbe der Monarchie
3
Selbstbewusst die Nähe Deutschlands nutzen – aber auch die anderen Nachbarschaften pflegen
4
Populismus ist die falsche Antwort auf populistische Strömungen
5
Das Bildungswesen muss auf das Leben in der digitalen Revolution vorbereiten
6
Das Wunder der Internationalisierung – und wie man es verlängern kann
7
Mehr Europabewusstsein, weniger Nationalstolz!
EINE ERFOLGSSTORY, DIE SICH NICHT VON SELBST FORTSCHREIBT
Einleitung
„Krise“ ist das Unwort unserer Tage. Wir begegnen ihm seit Jahren an allen Ecken und Enden in unermesslich vielen Variationen: zuerst als in den USA beginnende Immobilienkrise ab 2007, die eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise zur Folge hatte und in vielen Fällen eine schon seit Längerem schwelende Staatsschuldenkrise erst so richtig zum Vorschein brachte; dann als Krise Europas, das um neue Regeln für seine Währungsunion kämpft und deshalb neue Institutionen braucht; zwischendurch als Bankenkrise, Griechenland-Krise, Zypern-Krise …
Das inflationär gebrauchte Wort verschleiert mehr, als es erhellt. Kausalitäten werden ausgeblendet, Gewichtungen fallen unter den Tisch, die Einordnung von aktuellen Problemlagen in historische Zusammenhänge geht verloren. So ist es kein Wunder, dass die Krisenschlagzeilen der letzten Jahre auch den Blick auf etwas verstellt haben, was jüngeren Österreichern meist erst bewusst wird, wenn sie die Geschichtsbücher studieren: die beinahe unglaubliche Erfolgsgeschichte Österreichs nach 1945, der Aufstieg von einem Armenhaus zu einem der wohlhabendsten Länder der Welt.
Wer am Ende des Zweiten Weltkriegs durch Wien streifte, sah eine Stadt in Trümmern, hungernde Menschen, verzweifelte Gesichter, aber auch Hand anlegende Trümmerfrauen. Trotz der vielen Opfer des Krieges, seiner gewaltigen Zerstörungen und der Belastungen durch die folgende zehnjährige Besatzung steht Österreich heute als ein Land da, das in vielen Wirtschaftsvergleichen hervorragende Weltpositionen einnimmt. Beim Wohlstand sind wir weltweit die Nummer elf, in Europa sogar die Nummer drei. Die Verteilung dieses Wohlstands ist, nimmt man den Gini-Index als Maßstab, eine der ausgeglichensten. Wien ist unter den Millionenstädten weltweit eine mit der höchsten Lebensqualität geworden.
Nach einem Knick in Folge der Wirtschaftskrise haben die Exporte im Jahr 2012 mit 123,5 Milliarden Euro bereits wieder einen historischen Spitzenwert erreicht. Seit 2002 erzielt das Land durchgängig Leistungsbilanzüberschüsse, in Summe über 70 Milliarden Euro. Im Vergleich mit anderen starken Volkswirtschaften des Kontinents konnten wir uns in den letzten Jahren überdurchschnittlich gut behaupten: Selbst die Niederländer erwarten 2013 das dritte Mal seit 2009 eine Schrumpfung ihrer Wirtschaft. In Österreich war das Bruttoinlandsprodukt bisher nur im Jahr 2009 rückläufig. Was sind die Gründe für diesen erstaunlichen Aufstieg und für diese Robustheit?
Im Gegensatz zur prekären Lage in der Ersten Republik, einem „Staat, den keiner wollte“ und der den Schock des Zerfalls der Donaumonarchie nie überwand, bestand nach 1945 der unbedingte Glaube an die Überlebensfähigkeit des Landes. Eine große Anzahl österreichischer Politiker aus allen politischen Lagern hatte sich während der nationalsozialistischen Herrschaft in den Konzentrationslagern wiedergefunden – in Dachau oder anderen Schreckensorten etwa die spätere Führungsgarnitur der Zweiten Republik: Leopold Figl, Alfons Gorbach, Fritz Bock, Franz Olah, Rosa Jochmann, Karl Seitz und viele andere. Der Bürgerkrieg 1934, die Erfahrungen unter dem austrofaschistischen Regime, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg hatten einen Gesinnungswandel bewirkt, Grundstein für eine neue Identitätsstiftung. Niemals vergessen werden darf dabei, dass viele, vor allem jüdische Mitbürger, nach dem Anschluss ermordet worden sind oder fliehen mussten. Eine große Zahl der Überlebenden ist zum Glück nach dem Krieg wieder zurückgekehrt.
Wirtschaftlich erwies sich das von US-Außenminister George C. Marshall in seiner berühmten Harvard-Rede am 5. Juni 1947 initiierte „European Recovery Program“ (ERP), ein gigantisches Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekt für den alten, darniederliegenden Kontinent, als Segen insbesondere für Österreich. Zwischen 1948 und 1952 wurden von den USA insgesamt rund 12,4 Milliarden Dollar im Rahmen des Marshallplans bereitgestellt – Österreich erhielt unter allen Empfängerstaaten die zweithöchste Summe an Hilfe pro Kopf, zeitweise in Höhe von zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts, davon einen hohen Anteil in Form von Zuschüssen statt rückzahlbaren Krediten. Insgesamt bekam unser Land zwischen 1945 und 1955 ausländische Hilfsgüter im Wert von über einer Milliarde Dollar. Noch heute spielt der ERP-Fonds eine hilfreiche Rolle in der Wirtschaftsförderung. Wichtiger als die ökonomische war aber wahrscheinlich die psychologische Wirkung, unterstützend kam noch der Konjunkturaufschwung als Folge des Korea-Kriegs dazu.
Außenpolitisch bewirkte der Plan in der heiklen Zeit, als der Eiserne Vorhang fiel, eine Neuorientierung: Die Zweite Republik vollzog mit der Integration in das westliche Wirtschaftssystem eine außen- und wirtschaftspolitische Neuorientierung, weg von Österreichs traditionellen Einflussräumen in Ost- und Südosteuropa, hin zu einer allgemeinen Westorientierung.
Dass die Weichenstellung auch in die andere Richtung hätte führen können, ist den wenigsten bewusst: Weil die USA amerikanische Kontrolleure für die Verteilung der Hilfsgüter und der ERP-Kredite installieren wollten, lehnten die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten die Marshallhilfe ab – und dieses Veto sollte auch für die sowjetischen Besatzungszonen in Österreich, also ganz Ostösterreich, vermutlich auch Wien, gelten. Doch dann, so schreibt Hugo Portisch in seinem lesenswerten Europa-Buch Was jetzt, stimmte der US-Kongress einer einmaligen Ausnahme innerhalb des ERP-Gesetzes zu – nur in der Sowjetzone Österreichs sollte es österreichische statt amerikanische Kontrolleure geben dürfen. Damit war auch das Veto der Sowjets hinfällig, ganz Österreich konnte nun am Marshallplan partizipieren. Eine Zerreißprobe blieb der jungen Zweiten Republik erspart.
Zur Hilfe von außen gesellte sich ein durchdachter innerer Integrationsprozess. Die Große Koalition, die nach dem Regierungsaustritt der Kommunisten 1947 das Land regierte, und die später folgende Einrichtung der Sozialpartnerschaft gewannen von Jahr zu Jahr an Trittsicherheit. Erstmals zum Tragen kam das sozialpartnerschaftliche Konzept in den fünf Preis-Lohn-Abkommen von 1947 bis 1951. In der vom Krieg zerstörten und durch Demontagen beraubten österreichischen Wirtschaft galt es damals, die unabdingbar notwendigen Investitionen zu sichern – darin bestand sozialpartnerschaftlicher Konsens. Die Lohnentwicklung sollte unter der Produktivitätssteigerung liegen, um die Investitionstätigkeit und damit das Wirtschaftswachstum anzuregen. Die Währungsreform 1947 unterstützte diese Beschlüsse: Um inflationäre Tendenzen zu bekämpfen, wurde die Geldmenge, über welche die Haushalte aus kriegswirtschaftlichen Gründen reichlich verfügte, größtenteils eingezogen. Eine große Hilfe war auch der 1953 Österreich gewährte beträchtliche Schuldennachlass.
Selbst die im Oktober 1950 nicht nur von kommunistischer Seite inszenierten Unruhen als Reaktion auf das vierte Preis-Lohn-Abkommen konnten an diesem Konsens nichts ändern. Österreich behauptete sich als pluralistische, neutrale und rechtsstaatliche Demokratie; es hat sich nach 1945 wiedergefunden in seinen Ländern, Parteien und Interessenverbänden – bei gleichzeitig weitgehendem Verzicht auf seine visionäre Sendung und auf die mitteleuropäische Idee eines geistigen, größeren Österreich, wie sie schon Anfang des 20. Jahrhunderts kursiert war. Diese Idee flammte erst im Zuge der engagierten Expansion der österreichischen Wirtschaft in die ehemaligen Kronländer nach der Ostöffnung 1989 in Ansätzen wieder auf.
Mitte der siebziger Jahre gelang mit der Etablierung der Hartwährungspolitik ein weiterer Schritt, der die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs entscheidend verbesserte. Ohne das Festhalten an einem harten Schilling hätte Österreich womöglich niemals vergleichbare moderne Industrienationen wirtschaftlich überflügeln können. In den Neunzigern und den Nullerjahren wurde das Land, das in Monarchiezeiten noch zu den Nachzüglern in der Industrialisierung und im Welthandel gehört und kontinuierlich an Bedeutung verloren hatte, so zu einem – gemessen am Beitrag des Außenhandels zum Bruttoinlandsprodukt – der führenden Exportländer.
Doch das Blatt hat sich in den letzten Jahren gewendet. Ablesbar ist das am Abrutschen in zahlreichen internationalen Standortvergleichen. So ist Österreich in der aktuellen Ausgabe des wichtigsten EU-Innovationsrankings auf den neunten Platz abgerutscht, 2009 hatten wir noch Platz sechs inne. Im Global Innovation Index sind wir zuletzt auf Platz 23 gelandet – nach Rang 15 im Jahr 2009. Im World Competitiveness Report des Schweizer International Institute for Management Development (IMD) rangiert Österreich ebenfalls auf Platz 23, womit unser Land innerhalb von fünf Jahren um zwölf Plätze nach hinten gefallen ist. Im Kapitel „Regierungseffizienz“ dieses Standortvergleichs hat sich unsere Position im letzten Jahrzehnt dramatisch verschlechtert. Was die Gefahr betrifft, dass Forschungs- und Entwicklungszentren abwandern könnten, wird Österreich von IMD besonders kritisch eingeschätzt. Bei aller angebrachten Skepsis gegenüber Rankings aller Art: Diese Zahlen müssen uns alarmieren.
Schon in den Siebzigern wurden die ersten Schattenseiten der Erfolgsstory sichtbar. Der Wohlfahrtsstaat, eine der größten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, war zu geräumig geworden, seine Treffsicherheit verschlechterte sich zusehends. Die „Hackler-Regelung“ im Pensionsrecht ist ein besonders illustres Beispiel dafür: Sie galt praktisch nie für jene Berufsgruppen, deren Erwerbsarbeit tatsächlich schweren körperlichen Einsatz fordert, sondern ist zu einem Beamtenprivileggeworden. Unsere Subventionsquote ist mit 5,4 Prozent doppelt so hoch wie im EU-Durchschnitt, mit 34 Prozent haben wir die höchste Transferquote weltweit. Vieles, was in den letzten Jahrzehnten zur angenehmen Selbstverständlichkeit geworden ist, muss deshalb gründlich hinterfragt werden: Eine ewige Leibrente kann es nicht geben.
Im Jahr 1956, als das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) in Kraft trat, betrug die Sozialquote – das sind alle Sozialausgaben im Verhältnis zur jährlichen Wirtschaftsleistung – 16 Prozent. 1970 lag dieser Wert bei 21 Prozent, 1990 bei 26 Prozent und 2010 bei über 30 Prozent. Umso unverständlicher ist, dass in unserem Land noch immer Armut zu beklagen ist – das lässt nur die Schlussfolgerungzu, dass unser Sozialsystem vielfach ineffizient ist und oft die wirklich Bedürftigen nicht oder nur ungenügend erfasst, sich aber zugleich gegenüber Missbrauch offensichtlich als allzu kulant erweist.
Besonders ins Auge stechen die exorbitant gestiegenen Kosten für alle möglichen Formen von Frühpensionierungen. Vor 30 Jahren hatten wir 50.000 Frühpensionisten in Österreich, jetzt sind es 650.000 – unsere gern gefeierten niedrigen Arbeitslosigkeitszahlen sehen unter diesem Aspekt deutlich weniger feierlich aus. Die Lebenserwartung ist seit Einführung des ASVG um 20 Jahre gestiegen, aber das effektive Pensionsantrittsalter ist von 61 Jahren Mitte der siebziger Jahre auf 58 Jahre zurückgegangen. Mit freiem Auge ist erkennbar, dass sich da eine Lücke auftut, die nicht finanzierbar ist. Die junge Generation, deren Geburtenanzahl von 135.000 Mitte der sechziger Jahre auf 78.000 zurückgegangen ist, wird diese Aufgabe nicht bewältigen können, wenn das System nicht grundlegend umgebaut wird.
Nicht nur national kommen wir mit dem Wohlfahrtsstaat an die Grenzen bzw. haben sie schon überschritten: In der EU werden 25 Prozent der Weltwirtschaftsleistung generiert, aber 50 Prozent der Sozialausgaben von knapp über sieben Prozent der Weltbevölkerung konsumiert. Das wirft nicht nur ein gewaltiges Problem im weltweiten Wettbewerb der Systeme auf, für das die Politiker noch keine Lösung haben. Es schafft auch gewaltige Ungleichheiten zwischen riesigen Bevölkerungsgruppen innerhalb Europas: u. a. zwischen den Beschäftigten im öffentlichen Bereich und dem Bereich, der im Wettbewerb steht; zwischen der Generation, die einen immer größeren Teil der Sozialausgaben auf Pump konsumiert, und jener Generation, die den Großteil der Schulden abbauen muss. Generationengerechtigkeit sieht aber anders aus, ein Vertrag zwischen den Generationen muss anders gestaltet werden. Diese Missverhältnisse müssen repariert werden, auch um den sozialen Frieden in Europa zu wahren. Die gewalttätigen Proteste von Griechenland über Spanien, Portugal und Frankreich bis Schweden müssten Ansporn genug sein, alles zu tun, damit wir nicht auch von ihnen erfasst werden.
Wenn wir vom erreichten Wohlstand sprechen, sollten wir uns noch einmal die Fakten in Erinnerung rufen: Die Wochenarbeitszeit verringerte sich in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg von 48 auf 38 Stunden, der Mindesturlaub erhöhte sich von zwei auf fünf Wochen. 1955 gab es 150.000 PKWs, 500.000 Festnetzanschlüsse – davon 100.000 Viertelanschlüsse – und durchschnittlich 105 Euro auf dem Sparbuch eines jeden Österreichers. Heute beträgt der Fahrzeugbestand 4,6 Millionen Stück. Statistisch gesehen besitzt jeder Österreicher zumindest ein Mobiltelefon. Jeder Bewohner des Landes, vom Kleinkind bis zum Greis, verfügt im Durchschnitt über 19.000 Euro Sparguthaben.
Nicht vergessen sollten wir vor allem, dass das einmal Erreichte keine Ansprüche für die Zukunft begründen kann: Die eindrucksvollen Eckdaten sind das Ergebnis eines beispiellosen wirtschaftlichen Aufstiegs in den vergangenen Jahrzehnten. Garantien für die kommenden Jahrzehnte sind in ihnen nicht enthalten. Die Zukunft muss stets aufs Neue erarbeitet werden.
Das gilt auch für einen zweiten Bereich, dem neben der dringenden Reparatur des Wohlfahrtsstaates politisch viel zu lange viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde: der Bildung und Innovationsfähigkeit des Landes. Nach einem raschen Aufholprozess in den Jahren davor lässt seit 2008 die Forschungsdynamik nach, ablesbar am stagnierenden Wachstum der Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Die Werte, die uns internationale Studien in Bezug auf diese Schlüssel-Standortfaktoren der Zukunft bescheinigen, werden ungünstiger. Die EU-Kommission wie die OECD und der Internationale Währungsfonds haben in einer unmissverständlichen und beschämenden Schelte die mangelnde Effizienz unseres Bildungssystems angeprangert.
Die Klagen aus der Wirtschaft über den zunehmenden Fachkräftemangel und das Manko, auf immer weniger ausbildungsfähige Lehrlinge zurückgreifen zu können, spiegeln diese Versäumnisse wider. Gleiches gilt für die Universitäten und vor allem naturwissenschaftlich-technischen Fächer. Daher ist die Reform unseres gesamten Bildungsbogens überfällig: vom Kindergarten über die Schulen und die berufliche Ausbildung bis hin zu den Universitäten und der Erwachsenenbildung. Die Gesellschaft, die Wirtschaft, das Arbeitsleben haben sich in derart hohem Tempo verändert, dass das Festhalten an alten Strukturen und Inhalten ein Verrat an der Zukunftsfähigkeit ist.
Wissen gilt als Rohstoff der Zukunft – diese Formel wird zur Floskel, wenn man die Schätze nicht hebt. Keine Gesellschaft kann es sich leisten, die Talente ihrer Kinder nicht zu fördern und zu nutzen. Bildung kommt überdies nicht nur für das berufliche Fortkommen, sondern auch für die Gestaltung eines selbstbestimmten, erfüllten Lebens immer größere Bedeutung zu. Eine Bildungsreform muss deshalb auf die Durchsetzung der größten Chancengleichheit bei gleichzeitiger Sicherstellung der sozialen Durchlässigkeit ausgerichtet werden. Ohne Chancengleichheit keine Verteilungsgerechtigkeit, ohne leistungsfähiges Bildungssystem keine entsprechende Wirtschaftsleistung. Eine solche erfordert aber auch eine entsprechende Leistungsgerechtigkeit, und diese eine angemessene Leistungsarchitektur.
Eine dynamische Innovationskultur – eine entscheidende Voraussetzung, um die Wettbewerbskraft im globalen Wettbewerb auszubauen – kann nur im Zusammenspiel aller Bildungsinstitutionen entstehen. Mit unterfinanzierten Universitäten und einer Forschungslandschaft, die Braindrain begünstigt, wird das nicht zu bewerkstelligen sein. Den Ausweg aus diesem Dilemma kann nur eine Politik schaffen, die im Bereich des Sozialstaats und der öffentlichen Verwaltung auf Einsparungen setzt – vor allem durch höhere Effizienz –, zugleich aber in Bildung, Forschung, Wissenschaft investiert, Innovationen begünstigt und damit Wachstum fördert.
Zur großen Bedrohung unseres Wohlstands zählt auch die Schieflage unserer öffentlichen Haushalte. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Staatsschulden erst seit dem Fall der Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008 bzw. dem Beinahe-Zusammenbruch der Versicherungsgruppe AIG und den daraufhin nötigen Bankenhilfssowie Konjunkturstützungspaketen entstanden sind. Die Wahrheit ist: Nach diesen schockartigen Ereignissen hat sich lediglich die Bereitschaft der Geldgeber geändert, die Schulden zu refinanzieren. Die Staatsschulden, aber auch die Schulden der privaten Haushalte waren oft schon davor zu hoch gewesen oder wurden für den falschen Zweck verwendet – nur war es breiter Konsens unter den Investoren gewesen, dass diese Schulden als sicher gelten. Dieses Vertrauen ist in den Jahren ab 2008 nachhaltig erschüttert worden. Eine Griechenlandhilfe zur rechten Zeit hätte eine Ausweitung dieser Vertrauenskrise im Übrigen verhindert.
Am Beispiel Österreichs lässt sich die Entwicklung belegen: Zwischen 1980 und 1995 stiegen die Staatsschulden von 76 Milliarden auf 119 Milliarden Euro an, das entspricht einem relativen Anstieg von 56 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf 68 Prozent. Im Jahrzehnt darauf kam es zu einer leichten Absenkung, die teuer erkauft war: durch Ausgliederungen, Einmaleffekte, Verscherbelung von Staatseigentum und einer Rekordabgabenquote von über 44 Prozent. Darin sind die ausgelagerten Schulden – so genannte Schattenschulden – noch nicht einmal enthalten. Erst 2009 überstieg der Gesamtschuldenstand mit 69 Prozent des BIP wieder die Marke von Mitte der neunziger Jahre. 2012 wurde offiziell ein Höchststand von 75 Prozent erreicht: in absoluten Zahlen 231 Milliarden Euro. Die tatsächlichen Staatsschulden sind als Folge der Ausgliederung von Schulden, „Creative Accounting“ bzw. mangelnder Transparenz deutlich höher.
Zum Vergleich: Schweden hat es durch konsequente Strukturreformen ab Mitte der neunziger Jahre geschafft, diesen Wert auf unter 40 Prozent zu drücken und damit Luft für Zukunftsinvestitionen zu schaffen. Die Schweiz liegt aktuell bei 47 Prozent. Beide Länder haben sich im angesprochenen IMD-Standortvergleich soeben auf die Ränge vier und zwei hochgearbeitet. Wir sollten uns diese europäischen Champions zum Vorbild nehmen, um das Staatsgeld weniger für Zinsen und mehr für Innovation ausgeben zu können.
Ganze Politikbereiche, die in den nächsten Jahrzehnten von entscheidender Bedeutung sein werden, scheinen seit geraumer Zeit wie gelähmt, etwa die Energiepolitik. Unser Land ist längst von einem Strom-Exporteur zu einem Strom-Importeur geworden – mit einem rund zehnprozentigen Anteil an Atomstrom. Durch den zögerlichen Ausbau der Wasserkraft als umweltfreundlichster und ständig erneuerbarer Energiequelle ist viel wertvolle Zeit verstrichen. Weil ein