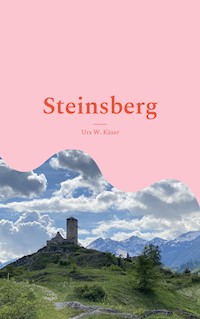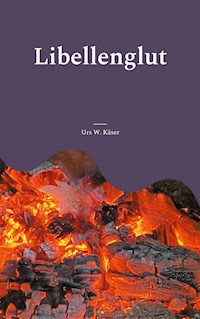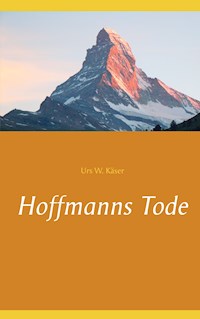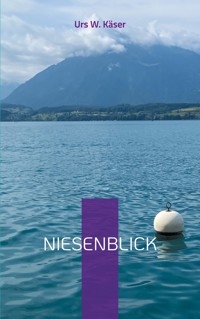
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Mann wird eines Sonntagmorgens, weit draussen auf dem Thunersee, in seinem Ruderboot erschossen. Die Kriminalpolizei deckt nach und nach die Lebensumstände des Mannes und mögliche Motive für den Mord auf. Ja, der Mann war ein Aussenseiter, hat überall angeeckt, sich an mehreren Fronten Feinde geschaffen. Aber welches Motiv war wirklich stark genug für einen kaltblütigen Mord? Nach und nach zeigt sich, dass eine ganz alte Geschichte dahintersteckt. Und der neue Dorfarzt und eine Gruppe vom Jugendnaturschutz spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Samstag, 30. Juni
Sonntag, 1. Juli
Montag, 2. Juli
Dienstag, 3. Juli
Mittwoch, 4. Juli
Donnerstag, 5. Juli
Freitag, 6. Juli
Samstag, 7. Juli
Sonntag, 8. Juli
Montag, 9. Juli
Dienstag, 10.Juli
Mittwoch, 11. Juli
Freitag, 13. Juli
Mittwoch, 5. September
Freitag, 16. November
Prolog
Dank des Schalldämpfers waren die drei Schüsse nicht weit zu hören. Der leblose Körper sackte auf den Boden des Ruderboots, die Angelrute kippte über Bord, und mit einem leisen Plopp verschwand auch die Pistole im Wasser und schwebte langsam zum schlammigen Seegrund hinunter. Das kleine Boot trieb, herrenlos und ganz leise schaukelnd, auf dem See langsam ostwärts.
Eine Schar Möwen flog heran und kreiste mehrmals über dem Boot, bevor sich die Vögel, einer nach dem anderen, auf dem Bootsrand niederliessen. Neugierig blickten sie auf den daliegenden Körper, aber vorerst wagte es keine, sich ihm zu nähern.
Als wenig später ein Motorboot auftauchte, erhoben sich die Möwen, beinahe gleichzeitig und mit lautem Geschrei, in die Luft, drehten noch eine Runde und verschwanden dann als Schwarm in den morgendlich blassblauen Himmel hinein.
Samstag, 30. Juni
Daniel Aebischer fuhr in seinem dunkelroten Mini, den er vor fünf Jahren als günstige Occasion erstanden hatte, hinter dem Transportfahrzeug her. Das Aufladen seiner Möbel und der Kisten frühmorgens war überraschend schnell gegangen, und die Strecke von seinem bisherigen Wohnort Bern bis nach Oberwil war nicht lang, kaum mehr als dreissig Kilometer. Schon vor Mittag erreichten sie das am nördlichen Ufer des Thunersees gelegene Dorf und hielten direkt vor dem auf der rechten Seite des Hauptplatzes gelegenen Doktorhaus. Trotz der Sommerhitze bekam Daniel Aebischer unwillkürlich eine Gänsehaut. Was würde ihn hier erwarten? Hier, in diesem kleinen Dorf, sollte er also fortan wohnen und als Hausarzt tätig sein! Würden ihn die Einheimischen akzeptieren, ihm dasselbe Vertrauen entgegenbringen wie seinem Vorgänger Konrad Schläpfer, der die Praxis während Jahrzehnten geführt hatte? Würde er sich in die Dorfgemeinschaft integrieren können? Daniel Aebischer schoss unvermittelt das Blut in den Kopf. Was, wenn er es nicht schaffte, wenn er als junger Arzt nicht für voll genommen würde, wenn er hier auf ewig fremd bliebe?
Nur keine Panik, versuchte er sich zu beruhigen, ich bin noch jung, und wenn es hier nicht klappen sollte, dann werde ich problemlos anderswo eine Landpraxis übernehmen können. Im ganzen Land mangelt es schliesslich an Hausärzten. Aber was soll das Grübeln, jetzt bin ich hier und muss zunächst einmal meinen Umzug hinter mich bringen! Daniel gab sich einen Ruck, stieg aus seinem Mini, ging die drei Treppenstufen zum Hauseingang hoch und öffnete mit dem Schlüssel die Tür zu seinem neuen Heim. Die grosszügige Doktorwohnung lag im Obergeschoss, während das Erdgeschoss von den Praxisräumen eingenommen wurde.
Drei Stunden später hatten die Umzugsmänner alle Möbel in die neue Wohnung hinaufgeschleppt und montiert, und die mehr als vierzig Schachteln voller Kleider, Bücher und sonstiger Habseligkeiten standen sauber aufgestapelt im Flur. Mit dem Auspacken wollte sich Daniel Zeit lassen. Wichtiger war jetzt die offizielle Übergabe der Hausarztpraxis. Denn übermorgen Montag würde er schon als neuer Dorfarzt im Einsatz stehen müssen! Plötzlich verspürte er grossen Hunger. Kein Wunder, sagte er sich, seit dem Frühstück um sieben Uhr habe ich nichts mehr gegessen. Er setzte sich auf einen Stuhl, packte das mitgebrachte Sandwich aus und biss gierig hinein. Wie gut das tat! Frisch gestärkt, machte er dann einen Rundgang durch die Räume seiner neuen Wohnung. Was für ein Luxus! Sechs grosszügig bemessene Zimmer, dazu eine geräumige Küche und ein hübsches Bad, alles für ihn allein!
Oder… Würde vielleicht Tanja doch irgendwann nachkommen? Daniel sah sie im Geist vor sich: Grossgewachsen, schlank und perfekt gekleidet stand sie vor ihm und lächelte ihm zu. Was für eine attraktive Frau! Warum hatten sie sich eigentlich auseinandergelebt? War es nur der Mangel an Zeit gewesen, die sie gemeinsam hatten verbringen können? Sicher, ihre Wege zum Facharzttitel waren streng gewesen, die Arbeitszeiten unendlich lang und unregelmässig, der emotionale Stress im Spital konstant hoch, die verbleibende Zeit zum Abschalten und Erholen permanent zu kurz, der Schlafmangel chronisch... Aber, waren das wirklich Entschuldigungen für die nach und nach aufgekommene Beziehungskrise? Hätte er sich mehr Mühe geben sollen, um die Beziehung zu retten? Nein, sagte er sich, es bringt nichts, jetzt wieder mit dem Grübeln anzufangen. Das Timeout, das sie gemeinsam vereinbart hatten, war jetzt genau die richtige Lösung. Eine bewusste Zeit der Trennung, so hatten sie es beschlossen. Er zog für seinen Neustart nach Oberwil am Thunersee, und sie blieb vorerst in der Stadtwohnung in Bern. In einigen Monaten würde man dann weitersehen.
Daniel dachte zurück an die aufregende Zeit, als es darum gegangen war, sich für den Kauf einer Landarztpraxis zu entscheiden. Es war für ihn schon länger klar gewesen, dass er sich als Hausarzt in einer ländlichen Umgebung niederlassen wollte. Und weil überall ein Mangel an Landärzten bestand, war es nicht schwierig gewesen, eine zum Verkauf stehende Praxis zu finden. Er hätte seinen künftigen Wirkungsort fast in jeder beliebigen Region der Schweiz auswählen können. Er beschloss aber, im Kanton Bern zu bleiben, und hatte in kürzester Zeit sieben Angebote vor sich liegen, die auch vom Preis her realistisch waren. Drei davon kamen in die engere Wahl, und schliesslich entschied er sich für Oberwil, den Ort, an dem er, noch als Student, sein erstes Praktikum absolviert hatte. Konrad Schläpfer, der erfahrene Landarzt, hatte ihm damals, vor über zehn Jahren, nachhaltigen Eindruck gemacht. Die Verhandlungen zum Kauf des Hauses, mit Praxis und Wohnung, waren in einer sehr kollegialen und fairen Weise verlaufen. Man war sich schnell einig geworden über den Preis und die Modalitäten der Übergabe. Nach der Vertragsunterzeichnung hatte ihn Konrad Schläpfer zu einem gediegenen Abendessen im Hotel Niesenblick eingeladen.
Konrad war auf die Minute pünktlich. Es schlug gerade drei, als er pro Forma die Klingel seiner Praxis betätigte. Der Öffnungsmechanismus surrte, und Schläpfer betrat die Räume, in denen er beinahe dreissig Jahre lang als Dorfarzt von Oberwil tätig gewesen war.
«Herzlich willkommen, Daniel», begrüsste er seinen Nachfolger mit einem kräftigen Handschlag, «ich freue mich sehr, dass meine geliebte Hausarztpraxis dank dir eine Zukunft haben darf. Dies ist ja heutzutage keineswegs selbstverständlich. Ich habe viele Berufskollegen in meinem Alter, die lange vergeblich nach einem Nachfolger gesucht haben und nun ihre Landpraxis schliessen müssen. Leider wollen sich heute die meisten jungen Ärztinnen und Ärzte spezialisieren und sich in einer Stadt niederlassen, wo die Arbeitszeiten geregelter sind und der Verdienst höher ausfällt. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass man als Hausarzt auf dem Land mehr bewirken kann und eine befriedigendere Tätigkeit ausübt.»
«Dieser Meinung bin ich auch. Übrigens ist es ja, unter anderem, auch dein Verdienst, dass ich jetzt hier bin», lachte Daniel. «Das kleine Praktikum, das ich vor zehn oder elf Jahren als Student in deiner Praxis machen durfte, war für mich der Anstoss, überhaupt einmal eine Weiterbildung in Hausarztmedizin ins Auge zu fassen.»
«Das freut mich, Daniel. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass du heute mit etwas gemischten Gefühlen hier angekommen bist. Ein Umzug in eine ganz fremde Umgebung ist doch ein recht grosser Schritt im Leben.»
«Ja, da vermutest du ganz recht. Meine Gefühle waren heute Morgen noch eher gemischt, aber im Augenblick überwiegt die Freude über den Neuanfang.»
«Schön! Übrigens… Ziehst du alleine hierher?»
«Ehm… Ja, bis auf Weiteres schon. Weisst du, ich habe die letzten sechs Jahre mit meiner Partnerin Tanja zusammen in Bern gewohnt. Wir kannten uns schon vom Studium her, und jetzt steht Tanja kurz vor ihrem Abschluss in Kinderchirurgie. Nun, unsere Beziehung hat in letzter Zeit etwas gebröckelt, und zudem will Tanja unbedingt in der Stadt wohnen bleiben. Deshalb haben wir beschlossen, dass sie vorderhand in Bern bleibt und dass wir uns eine gewisse Auszeit nehmen. Aber wer weiss…?»
«Du liebst sie also immer noch?», fragte Schläpfer freundschaftlich und kraulte sich seinen grauen Bart.
«Ja… Irgendwie schon…»
Konrad lächelte. «Dann kommt es gut, so oder so. Aber jetzt sollten wir uns an die Arbeit machen.»
Die beiden Männer gingen ins Sprechzimmer und setzten sich am Schreibtisch gegenüber.
«Ein wenig hast du ja die Praxis damals schon kennengelernt», begann Schläpfer, «und viel hat sich seither nicht verändert. Du weisst ja, alte Leute wie ich haben es am liebsten, wenn alles so bleibt, wie es ist…» Schläpfer zupfte wieder an seinem Bart herum. «Ich habe die Übergabe, wie ich hoffe, seriös vorbereitet. Hier, in den Schubladen auf der linken Seite, ist die Patientenkartei, und hier rechts sind die Unterlagen zur Buchhaltung. Alles übrige, wie Medikamentenschubladen, Verbrauchsmaterial etcetera, wird dir Marianne zeigen.» Er lachte verlegen. «Du siehst, bei mir ist alles noch alte Schule. Viel Papier und noch kaum etwas im Computer…»
«Kein Problem, es funktioniert ja so auch. Aber nach und nach werde ich schon auf die elektronische Methode umsteigen.»
«Aber selbstverständlich. Ihr jungen Leute seid ja sozusagen mit dem PC aufgewachsen. Trotzdem, ich bin der Meinung, dass die klinische Erfahrung und der Kontakt mit den Patienten, der ja gerade auf dem Lande so wichtig ist, nie durch den Computer ersetzt werden können. Und…», fuhr Konrad fort, «wenn du mal bei einer Patientengeschichte unsicher bist, dann kannst du mich gerne jederzeit fragen kommen. Ich bleibe ja im Dorf wohnen.»
«Vielen Dank für dein Angebot, Konrad. Sag einmal, ist es euch denn nicht schwergefallen, aus dem Doktorhaus auszuziehen? Ihr hättet ja auch hier wohnen bleiben können.»
«Nein, das wollten wir nicht. Erstens war die Wohnung, nach dem Auszug der beiden Töchter, für uns sowieso zu gross geworden, und zweitens fanden wir es besser, wenn der neue Arzt, so wie es bei uns im Dorf Tradition hat, auch wieder im Doktorhaus wohnt. Auch wenn natürlich die Sechszimmerwohnung im Moment, für dich allein, schon reichlich luxuriös ist…»
«Ja, das kann man wohl sagen!», lachte Daniel.
Schläpfer schaute auf seine Uhr. «Wo nur Marianne bleibt? Sie sollte doch um halb vier kommen… Oh, ich höre die Haustür gehen, das muss sie sein.»
Wenige Sekunden später betrat eine mittelgrosse, schlanke junge Frau mit langen, hellbraunen, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen Haaren das Sprechzimmer.
«Daniel, darf ich dir Marianne, meine Tochter und gleichzeitig unentbehrliche Praxisassistentin, vorstellen? Ich weiss nicht, ob du dich überhaupt an sie erinnerst. Damals, als du hier dein Praktikum absolviert hast, war sie ja noch in der Ausbildung und hat in Bern gewohnt. Marianne arbeitet seit nunmehr acht Jahren bei mir und kennt sich in allen Belangen der Praxis bestens aus. Sie wird dir alles zeigen und erklären. Sagt euch doch gleich Du, schlage ich vor.»
Marianne streckte ihm, noch ein wenig unsicher lächelnd, die Hand hin. «Willkommen bei uns, Daniel. Dann machen wir doch gleich einen Rundgang durch die Praxis.»
«Und ich ziehe mich jetzt zurück», sagte Schläpfer. «Ich wünsche dir einen guten Start für den Montag, Daniel! Und wie gesagt, du darfst mich jederzeit aufsuchen, wenn du Fragen hast.»
Daniel hatte ein rundum gutes Gefühl, als er in der Abenddämmerung zurück nach Bern fuhr. Einen netteren Empfang am neuen Ort hätte er sich gar nicht vorstellen können! Marianne war offensichtlich kompetent und tüchtig. Sie war mit allem, was die Organisation der Praxis betraf, vertraut und hatte ihm ausführlich und geduldig jedes Detail gezeigt und erklärt. Morgen musste er noch einige Sachen an seinem alten Wohnort erledigen, aber schon jetzt verspürte er eine kribbelnde Vorfreude auf den Start am Montag, als neuer Landarzt in Oberwil am Thunersee!
Sonntag, 1. Juli
Das Klingeln des Telefons riss ihn augenblicklich aus seinem Sonntagmorgen-Halbschlaf. Er blinzelte und nahm den Hörer zur Hand.
«Polizeiposten Thun, Korporal Thomas Meier, guten Morgen.»
«Gottseidank, bin ich doch bei der richtigen Stelle gelandet!»
«Wer ist denn am Telefon, und worum geht es?»
«Wissen Sie, ich bin so schrecklich aufgeregt! Der tote Mann in diesem Ruderboot…»
«Bitte sagen Sie mir Ihren Namen, und erzählen Sie mir, was passiert ist!»
«Oh, Entschuldigung, Herr Polizist. Ich heisse Silvia von Fellenberg und bin gerade mit meinem kleinen Motorboot auf dem Thunersee unterwegs. Und da habe ich ein herrenloses Ruderboot bemerkt. Und wie ich näherkomme… Es ist furchtbar! Da liegt ein toter Mann im Boot…»
«Wo auf dem Thunersee ist das genau?»
«Etwa gegenüber der Ortschaft Oberwil, vielleicht einen Kilometer vom Ufer entfernt.»
«Können Sie bei diesem Ruderboot warten? Und auf keinen Fall etwas anfassen! Wenn Sie unser Polizeiboot dann kommen sehen, stehen Sie auf und winken uns zu, damit wir Sie schnell finden. Wir kommen so rasch wie möglich!»
«Ja natürlich, ich warte hier. Und bitte kommen Sie schnell, ich fühle mich überhaupt nicht wohl hier!»
«Machen wir», bestätigte Thomas Meier und hängte auf. Er war jetzt hellwach, sein Polizisteninstinkt war geweckt. Einen Toten in einem Ruderboot, das hatte er in seiner ganzen Zeit als Polizist noch nie erlebt! Beruhte wohl der Todesfall auf einem banalen Herzinfarkt, oder steckte gar eine Mordgeschichte dahinter? Das konnte ja spannend werden! Er holte seine Bereitschaftstasche und beorderte telefonisch den auf Pikett stehenden Kollegen Wagner zum Polizeiboot, das im Hafen von Thun lag und geduldig auf seinen Einsatz wartete.
Silvia von Fellenberg hatte in ihrem Motorboot mehr als eine halbe Stunde neben dem Ruderboot mit der Leiche ausharren müssen. Endlich kam das Polizeiboot in Sicht! Sie stand auf und winkte mit beiden Armen. Das Polizeiboot kam schnell näher, bremste ab, drehte bei und kam präzise neben ihrem Boot zum Stillstand.
«Korporal Meier», stellte sich der Bootsführer vor, «und das ist Polizist Wagner.» Meier warf nur einen kurzen Blick zu dem auf dem Boden des Ruderbootes liegenden, blutbefleckten Mann. «Offensichtlich tot», bemerkte er trocken. «Und Sie haben also dieses Ruderboot entdeckt, Frau…?»
«Silvia von Fellenberg. Ja, ich habe ihn gefunden, das habe ich doch schon am Telefon gesagt.»
Der Polizist überhörte den leisen Vorwurf. «Haben Sie eine Ahnung, was da passiert sein könnte?»
«Nein, wie sollte ich auch? Ich bin, wie ich es hier jeden Morgen mache, schon vor acht Uhr mit meinem Motorboot losgefahren, um eine gemütliche kleine Runde auf dem See zu drehen. Und da sah ich plötzlich dieses offensichtlich herrenlose Ruderboot…»
Meier besah sich ungeniert die elegant gekleidete und gekonnt geschminkte, ältere Dame von oben bis unten. Eine solche Frau alleine in einem Motorboot unterwegs, das war ja schon ungewöhnlich! «Wohnen Sie denn hier am See?», fragte er sie.
«Nein, ich wohne in der Nähe von Bern, aber ich mache, wie jeden Sommer, in Oberwil Urlaub. Im Hotel Niesenblick, etwas ausserhalb des Dorfes. Eines der hoteleigenen Motorboote miete ich jeweils für die ganze Dauer meines Aufenthalts. Es ist einfach herrlich, nach Belieben meine Runden auf dem See drehen zu können.»
«Das glaube ich Ihnen gern», sagte der Polizeibeamte, «aber weniger herrlich ist es, jetzt diese Leiche vor uns zu sehen. Haben Sie denn gar nichts Verdächtiges bemerkt, als Sie das Ruderboot entdeckten?»
«Nein, gar nichts. Weit und breit war kein anderes Boot zu sehen.»
«Nun ja. Ich werde jetzt die Bergung des Toten und alles Weitere veranlassen. Sie bitte ich, mir Ihre Adresse und Telefonnummer zu geben, damit ich Sie nötigenfalls kontaktieren kann.»
«Selbstverständlich», antwortete Silvia von Fellenberg und nestelte in ihrer Handtasche, «hier ist meine Visitenkarte. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich einfach an. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.» Sie nickte den beiden Polizisten zu, startete den Motor und brauste in einer eleganten Kurve davon.
Meier sah ihr kopfschüttelnd nach. Eine wirklich ungewöhnliche Dame, dachte er sich, und sicher steinreich, der Name von Fellenberg klang doch ganz nach Adelsfamilie… Meier stieg ins Ruderboot hinüber, beugte sich über den Toten, hievte ihn in die Seitenlage und tastete ihn ab.
«Alles klar», sagte er nach wenigen Sekunden, «der Mann wurde erschossen. Drei Schüsse, ich nehme an, er war sofort tot. Und das ist noch gar nicht lange her, allerhöchstens zwei Stunden, schätze ich mal grob. Jetzt ist es fünf vor neun, es muss also heute Morgen passiert sein. Wagner, mach du das Boot bereit zum Abschleppen. Ich verständige unterdessen die Kantonspolizei in Bern und den Spurensicherungsdienst.»
Eine Stunde später wurde der tote Mann im kleinen Bootshafen von Oberwil in den polizeieigenen Leichenwagen verladen.
«Nach Bern in die Pathologie», wies Korporal Meier den Fahrer unnötigerweise an. «Übrigens ist die Identität des Mannes bereits geklärt», ergänzte er, «er hatte nämlich einen Personalausweis auf sich. Er heisst Martin Fankhauser und ist 65 Jahre alt. Aber wo er wohnt, steht natürlich nicht im Ausweis.»
«Das finden wir dann nullkommaplötzlich heraus», revanchierte sich der Fahrer, liess den Motor an und brauste davon.
Die zwei Männer vom kriminaltechnischen Dienst waren zehn Minuten vor dem Leichenwagen angekommen und hatten zuerst die Leiche und dann das Boot minutiös unter die Lupe genommen.
«Und?», fragte Meier, als sie begannen, zusammenzupacken.
«Nicht sehr ergiebig», erwiderte der ältere der beiden missmutig, «ein paar Fingerabdrücke, einige Haare, reichlich Blut… Und für so eine lausige Übung wird man am Sonntagfrüh aus den Federn geholt…»
Meier musste sich Mühe geben, um ein Lachen zu unterdrücken. Sollen die ruhig murren, dachte er amüsiert. Er selber freute sich nämlich darüber, dass endlich mal etwas Aufregendes passierte, wenn er denn schon am Sonntag Pikettdienst schieben musste…
Kurt Fankhauser schritt missmutig zum klingelnden Telefon.
«Was soll denn das, uns am Sonntagmorgen zu stören?», brummelte er vor sich hin.
«Guten Tag Herr Fankhauser», klang es aus der Leitung, «hier ist Bruno Widmer, Kriminalpolizei Bern.»
«Oh je, ist etwas passiert?»
«Leider, ja. Wir haben in einem Ruderboot auf dem See einen Toten gefunden. Er hatte einen Ausweis bei sich, und wir vermuten, dass es sich um Ihren Bruder Martin handelt.»
«Was! Martin soll tot sein? Das ist ja furchtbar!»
«Leider sieht es ganz danach aus. Und wir wären sehr dankbar, wenn Sie den Mann identifizieren könnten.»
«Ehm… Ja… Martin war ja wirklich ständig im Ruderboot draussen… Hatte er etwa einen Herzinfarkt?»
«Tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht am Telefon beantworten, Herr Fankhauser. Aber wie gesagt, wir bitten Sie, heute in die Pathologie des Universitätsspitals Bern zu kommen, um ihn zu identifizieren.»
«Na gut, ich komme so rasch wie möglich.»
Kurt eilte in die Küche, wo seine Frau Heidi am Gemüserüsten war. «Ich verstehe die Welt nicht mehr», sagte er ganz leise, «Martin soll tot sein.»
«Was sagst du da? Martin ist gestorben? Plötzlich und ohne Vorwarnung? Wie traurig! Was ist denn passiert?»
«Ein Herr von der Kriminalpolizei hat angerufen. Martin sei tot in seinem Ruderboot aufgefunden worden.»
«Was! Im Boot! Was hatte er denn?»
«Der Polizist wollte mir keine Auskunft geben. Aber wenn die Kriminalpolizei anruft, kann es wohl kaum ein natürlicher Tod sein. Jedenfalls muss ich jetzt nach Bern fahren, um den Toten zu identifizieren.»
Heidi schlug sich die Hand vor den Mund. «Oh je, so etwas Furchtbares, wenn ich mir das nur vorstelle, eine Leiche anschauen zu müssen! Also ich komme jedenfalls nicht mit! Dann fahre du eben in Gottes Namen!»
Die Räume der Pathologie im Universitätsspital Bern waren kein Ort, um sich wohlzufühlen. Kurt Fankhauser bekam sofort eine Gänsehaut, als ihn der Mitarbeiter in den Raum führte, in dem der Tote aufgebahrt war. Boden, Wände und Decke des fensterlosen Raumes waren in einheitlichem, kaltem Weiss gestrichen, Tische und Stühle waren rein funktionell und strahlten in blankem Metall. Der Tote lag, von einem grossen weissen Leintuch zugedeckt, auf einer Bahre. Kurt schauderte ab der Vorstellung, es könnte tatsächlich sein Bruder sein, der da aufgebahrt war. Musste das wirklich sein? Wie würde er aussehen? Und wenn die Leiche furchtbar entstellt wäre? Oder wenn er sich gar nicht sicher wäre, ob er es war…?
Der Mitarbeiter ging zur Bahre, griff mit Daumen und Zeigefinger einen Zipfel des Leintuchs und hob ihn ganz langsam an. Wie in Zeitlupe näherte sich auch Kurt der Bahre und spähte ängstlich unter das Leintuch. Immer wieder musste er den Blick kurz abwenden. Sekunden verstrichen. Endlich lag der Kopf des Toten offen da.
Kurt wandte sich ruckartig ab. «Ja, es ist mein älterer Bruder Martin», sagte er leise, gegen den Mitarbeiter gerichtet. Dann strebte er zur Tür und eilte, beinahe wie auf der Flucht, mit langen Schritten den Flur hinunter.
«Und? War es schlimm?», fragte Heidi sofort, als Kurt kurz nach Mittag zur Tür hereinkam.
Dieser antwortete nicht, ging stattdessen in die Küche und nahm sich eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank. Als er ins Wohnzimmer zu Heidi kam, hatte er bereits die Hälfte ausgetrunken. «Ja, es war verdammt schlimm», murmelte er und sah zum Fenster hinaus, «Martin war furchtbar zugerichtet. Alles voller Blutflecken…»
«Oh je! Was ist da bloss passiert?»
«Erschossen wurde er! Mit drei Schüssen niedergestreckt. Zum Glück war er sofort tot. Gelitten hat er wenigstens nicht. Das hat jedenfalls der Mitarbeiter in der Pathologie behauptet.»
«Ermordet also! Wer kann so etwas Schreckliches gemacht haben? Und warum? Oder hat er sich etwa selber…?»
«Denk doch mal nach, Heidi! Drei Schüsse! Nein, es muss sich um Mord handeln. Jedenfalls kannst du dich darauf gefasst machen, dass die Polizei überall herumschnüffeln und vielleicht sogar uns verdächtigen wird», brummte Kurt.
«Was! Uns eines Mordes verdächtigen? Spinnst du jetzt komplett?»
«Oh nein, liebe Heidi. Dieser ewige Streit ums Elternhaus zwischen uns Geschwistern, der wird seinen Schatten werfen… Die Polizei wird das doch sofort herausbekommen.»
«Oh je!», stiess Heidi erschrocken aus und hielt sich eine Hand vor den Mund. «Aber wir haben doch mit dem Mord nichts zu tun!»
Kurt ging nicht darauf ein und eilte zum Telefon. «Ich muss sofort Barbara benachrichtigen.»
«Ja, das ist gut», stimmte Heidi zu, «sag deiner Schwester Bescheid.»
Und wie es in einem kleinen Dorf nicht anders sein kann: Die Nachricht von Martin Fankhausers gewaltsamem Tod verbreitete sich im Laufe des Sonntagnachmittags im ganzen Dorf wie ein Lauffeuer, von Quartier zu Quartier, von Strasse zu Strasse, von Haus zu Haus. Nachbarn sprachen miteinander, spekulierten über das Wie und Warum, setzten das eine oder andere Gerücht in Umlauf. Es gab niemanden, den die Nachricht kalt liess. Die ganze Dorfgemeinschaft stand unter einem kollektiven Schock.
Montag, 2. Juli
Marianne Schläpfer war nervös. Wie würde sich die Zusammenarbeit mit diesem neuen Arzt anlassen? Seit ihrem Diplom als Medizinische Praxisassistentin hatte sie stets nur mit ihrem Vater zusammengearbeitet. Sie waren ein wunderbares Team gewesen, sie hatten sich beinahe ohne Worte verstanden, alle Aufgaben waren reibungslos und Hand in Hand vonstattengegangen. Jedenfalls beinahe. Natürlich hatte es ab und zu eine kleine Reiberei gegeben. Vater war ihr manchmal allzu konservativ vorgekommen, zu sehr nach alter Schule. Da hatte sie in ihrer Ausbildung doch zeitgemässere Methoden kennengelernt, aber sie hatte sich gehütet, diese ihrem Vater unter die Nase zu reiben. Nun, das waren ja bloss Kleinigkeiten gewesen. Aber was würde sich jetzt ändern, mit dem neuen Doktor? Würde sie sich dem frischen Wind, den der junge, modern ausgebildete Arzt zweifellos hier einbringt, anpassen können?
Marianne dachte an gestern. Natürlich war auch sie immer noch schockiert über die Nachricht vom Mord an Martin Fankhauser, den sie seit ihrer Kindheit gut gekannt hatte, der einfach immer ein Teil des Dorflebens gewesen war, der sie sogar manchmal in seinem Boot zum Fischen mitgenommen hatte. Ja, er war eher ein Einzelgänger gewesen, vielleicht etwas skurril, aber immer nett zu allen Leuten. Schmunzelnd dachte sie an Martins wechselvolles Liebesleben, an seine alle paar Jahre wechselnden Freundinnen. Wie es wohl der armen Anna jetzt ging nach diesem tragischen Ereignis?
Marianne gab sich einen Ruck und betrat die Praxisräume. Alles kam ihr wie immer vor, und sie wäre nicht erstaunt gewesen, wenn jetzt ihr Vater hereingekommen wäre. Aber nein, ab sofort war ja Daniel ihr Chef!
«Guten Morgen, Marianne!», klang es plötzlich aus dem Sprechzimmer.
Oh, er ist ja schon da! Sie ging hinein und drückte Daniel die Hand zum Gruss. «Hast du es überhaupt schon vernommen?», fügte sie gleich bei. «Ein schrecklicher Mord ist passiert, hier bei uns, an einem Einheimischen, gestern wurde er in seinem Ruderboot erschossen! Das ganze Dorf ist vollkommen schockiert.»
Daniel nickte. «Ja, es kam gestern im Radio. Aber ich hatte noch in Bern zu tun und konnte mich nicht weiter damit befassen. Ich nehme an, du hast das Opfer gekannt?»
«Aber ja. Martin Fankhauser haben doch alle gekannt. Sicher, er war etwas speziell, aber trotzdem…» Marianne wischte sich eine Träne weg. «Ach, es ist so furchtbar, wer kann denn so etwas getan haben…»
«Wirklich tragisch. Aber wir sollten uns trotzdem an die Arbeit machen», lenkte jetzt Daniel ab. «Hast du mir die Liste der für heute angemeldeten Patienten ausgedruckt?»
Marianne wandte verlegen ihren Blick ab. «Ehm… Nein, nicht ausgedruckt. Weisst du… Verzeihung, aber wir haben das bisher einfach von Hand aufgeschrieben…» Sie hielt ihm eine grosse Agenda entgegen.
«Natürlich, kein Problem!», lächelte Daniel und schaute auf das Buch. «Also… Um acht Uhr erwarten wir, als meinen ersten Patienten in Oberwil, einen gewissen Hans Anderegg.»
«Anderegg ist der Inhaber des hiesigen Baugeschäfts», erklärte Marianne. «Ein ziemlich grosser und gutgehender Laden. Hier ist sein Dossier. Übergewicht und Diabetes, du kennst ja das alte Lied. Schon beinahe eine Volkskrankheit…»
«Leider ja. Oh, es klingelt schon!»
«Ja», lachte Marianne, «hier auf dem Land hat man noch Respekt vor dem Doktor und kommt pünktlich.»
Der Mann, der das Sprechzimmer betrat, war grossgewachsen, stämmig und trug einen ansehnlichen Bauch vor sich her.
«Guten Tag, Herr Anderegg», begrüsste ihn der Arzt, «es freut mich, Sie kennenzulernen. Bitte setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun?»
Anderegg kratzte sich verlegen im Haar. «Nun ja, eigentlich fühle ich mich ganz gut, aber meine Blutzuckerwerte… sind eben noch zu hoch.»
«Messen Sie diese regelmässig?»
«Ja, täglich, genau wie es mich Konrad Schläpfer gelehrt hat, immer den Nüchternwert, und auch die Tabletten nehme ich gewissenhaft ein.» Anderegg zog ein Notizheft aus seiner Tasche. «Hier, die Messwerte des letzten Monats. Habe ich alles peinlich genau notiert.»
Der Arzt blätterte die Seiten durch. «Ja, Ihre Blutzuckerwerte liegen, trotz der Tabletten, immer noch leicht über dem Grenzwert. Aber zum Glück ist es nicht so schlimm, dass Sie schon auf Insulinspritzen umsteigen müssten. Ich schlage Ihnen vor, es mit einem anderen, etwas moderneren Tablettenpräparat zu versuchen.»
Anderegg hob seine buschigen Brauen. «So? Hat mir denn Konrad nicht das Richtige gegeben?»
«Doch, Doktor Schläpfer hat das schon korrekt gemacht. Aber manchmal muss man einfach verschiedene Wirkstoffe ausprobieren, bis man den geeignetsten gefunden hat. Das ist ganz normal. Versuchen Sie es mal mit diesem hier. Ich schreibe Ihnen gleich ein Rezept dafür. Wichtig ist, dass Sie jeden Morgen den Nüchtern-Blutzucker messen, so wie Sie es bisher vorbildlich gemacht haben. Und in einem Monat kommen Sie wieder vorbei. Dann schauen wir, wie sich das Ganze entwickelt hat.»
«Und… Zu meinem Gewicht sagen Sie nichts?» Anderegg grinste jetzt beinahe spitzbübisch.
«Nun ja… Ich möchte meine Patienten nicht schon beim ersten Termin mit zu vielen Ratschlägen eindecken», grinste Aebischer zurück. «Aber natürlich wäre es sehr hilfreich, wenn Sie einige Kilos verlieren könnten. Das hilft fast immer, den Diabetes zu verbessern. Sind Sie verheiratet?»
«Ja eben! Und Kathrin kocht ganz ausgezeichnet…»
«Aber das muss doch überhaupt kein Widerspruch sein!», lachte der Arzt. «Entscheidend sind Quantität und Qualität des Essens.»
«Wem sagen Sie das, Herr Doktor? Die sogenannten Patentrezepte kenne ich doch auswendig. Weniger Kohlenhydrate, weniger Süsses, weniger Alkohol, mehr Gemüse und Salat, mehr Ballaststoffe…»
«Na also! Sie wissen doch bestens Bescheid, Herr Anderegg. Und ich bin mir auch bewusst, dass es keineswegs einfach ist, alte Gewohnheiten abzulegen und seine Ernährung umzustellen. Aber ich bin zuversichtlich, dass Sie dies, zusammen mit Ihrer Frau, schaffen werden.»
«Danke, Herr Doktor. Also dann in einem Monat wieder.»
Nachdem Anderegg gegangen war, blickte Daniel auf die Patientenliste. «Also jetzt, nach diesem alltäglichen Routinefall, kommt… eine gewisse Laura Ramseier.»
«Ja, Laura ist die Tochter und gleichzeitig Sekretärin unseres Gemeindepräsidenten, Peter Ramseier», ergänzte Marianne. Dann hob sie plötzlich den Zeigefinger. «Und nimm dich bloss in acht vor ihr!»
Daniel hob die Augenbrauen. «Ehm… Warum denn das?»
«Na, du wirst es gleich sehen…»
«Was meinst denn du zu diesem neuen Fall?», fragte Kriminalkommissarin Veronika Steiger mit harter Stimme und blickte ihren Assistenten herausfordernd an.
Doch Bruno Widmer liess sich nicht irritieren. Er kannte Veronika schon viele Jahre, und er wusste, dass ihre manchmal strenge Miene und ihr harscher Tonfall überhaupt nicht tadelnd gemeint waren, sondern einfach ein Zeichen dafür, dass sie sich konzentriert, ja manchmal etwas allzu verbissen, einer Sache widmete. Bruno Widmer überflog nochmals kurz die vor ihm liegenden Dokumente: Das Protokoll seines Kollegen Thomas Meier aus Thun, den vorläufigen Bericht der Kriminaltechnischen Abteilung und den Obduktionsbericht des Pathologen. Letzterer war erst vor zehn Minuten eingetroffen.
«Eine sehr spezielle Situation haben wir da», begann er. «Ein Mann liegt tot in seinem eigenen Ruderboot auf dem Thunersee, etwa einen Kilometer vom Oberwiler Ufer entfernt. Es ist Martin Fankhauser, 65 Jahre alt, pensioniert, wohnhaft allein in einem Haus in Oberwil. Er wurde gestern früh zwischen sieben und acht Uhr mit drei Schüssen niedergestreckt und war sofort tot. Sein Bruder Kurt hat ihn gestern noch in der Pathologie identifiziert. Im Boot selbst fanden sich nur wenige Spuren. Die sichergestellten Fingerabdrücke stammen vom Opfer selber sowie von einer weiteren Person, die wir noch nicht kennen. Ob auch fremde Haare oder Hautpartikel vorhanden sind, wird noch untersucht. Eine der drei Kugeln ist wieder ausgetreten und steckt im Holz des Bootes. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Opfer bereits tot ins Ruderboot gehievt worden wäre. Der Mann wurde also im Boot umgebracht. Aus der Art der Wunden lässt sich aber schliessen, dass die Schüsse aus einer Distanz zwischen acht und zwölf Metern abgegeben wurden.»
«Aha! Demnach muss der Mörder in einem zweiten Boot gewesen sein.»
«Ausser er hätte vom Ufer aus auf das vertäute Boot geschossen, aber das scheint mir unwahrscheinlich. Einerseits wegen des Risikos, dabei gesehen oder gehört zu werden, andererseits hätte er dann das Ruderboot mit dem Toten weit in den See hinaus schleppen müssen.»
«Einverstanden», meinte Veronika.