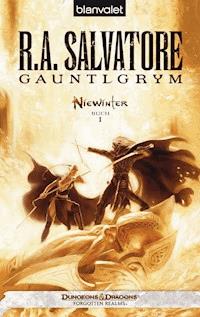
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: NIEWINTER-SAGA
- Sprache: Deutsch
Ein hochdramatisches Fantasy-Epos voller Kämpfe, schwarzer Magie und tödlicher Intrigen
Das uralte Zwergenreich Gauntlgrym war lange verlassen und verschollen. Bis eine Gruppe Abenteurer es wiederentdeckt und unbeabsichtigt eine riesige Feuerkreatur freisetzt, die beinahe ganz Niewinter in Schutt und Asche legt. Als der Dunkelelf Drizzt Do’Urden davon erfährt, brechen er und der Zwerg Bruenor sofort auf, um die Bestie zu stoppen. Um Erfolg zu haben, bleibt ihnen keine andere Wahl, als sich mit ihrem Erzfeind Jarlaxle zu verbünden. Doch können sie ihrem alten Widersacher wirklich ihr Leben anvertrauen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Viele Jahre lang war das uralte Zwergenreich Gauntlgrym dem Vergessen anheimgefallen, lag verlassen und verschollen. Doch dann wird es von einer Gruppe Abenteurer, zu der auch der Dunkelelf Jarlaxle und sein Zwergenfreund Athrogate gehören, wiederentdeckt. Unbeabsichtigt lassen die Abenteurer eine riesige Feuerkreatur frei, die beinahe ganz Niewinter in Schutt und Asche legt. Als Drizzt Do’Urden von diesen Geschehnissen erfährt, brechen er und sein Freund, der alte Zwergenkönig Bruenor Heldenhammer, sofort auf, um die Bestie zu stoppen. Aber wenn sie wirklich Erfolg haben wollen, bleibt ihnen keine andere Wahl, als sich mit ihrem Erzfeind, dem Söldner Jarlaxle, zu verbünden – und ihm gar ihr Leben anzuvertrauen …
Die Legende von Drizzt bei Blanvalet:
Die Dunkelelfen (26754) · Die Rache der Dunkelelfen (26755) · Der Fluch der Dunkelelfen (26756) · Der gesprungene Kristall (24549) · Die verschlungenen Pfade (24550) · Die silbernen Ströme (24551) · Das Tal der Dunkelheit (24552) · Der magische Stein (24553) · Das Vermächtnis (24663) · Nacht ohne Sterne (24664) · Brüder des Dunkels (24706) · Kristall der Finsternis (24931) · Schattenzeit (24973) · Der schwarze Zauber (24168) · Die Rückkehr der Hoffnung (24227) · Der Hexenkönig (24402) · Die Drachen der Blutsteinlande (24458) · Die Invasion der Orks (24284) · Kampf der Kreaturen (24299) · Der König der Orks (26580) · Der Piratenkönig (26618) · Der König der Geister (26619)
Außerdem von R. A. Salvatore:
StarWars: Episode I–III. Die dunkle Bedrohung – Angriff der Klonkrieger – Die Rache der Sith (37630) · Der Speer des Kriegers / Der Dolch des Drachen / Die Rückkehr des Drachenjägers. Drei Romane in einem Band! (24314)
Weitere Titel in Vorbereitung.
R. A. Salvatore
Gauntlgrym
Die Legende von Drizzt
Roman
Aus dem Englischen
von Imke Brodersen
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Gauntlgrym« bei Wizards of the Coast, Renton, USA.
1. Auflage
April 2012 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe
Random House GmbH, München.
Original title: Gauntlgrym © 2010 Wizards of the Coast LLC.
FORGOTTEN REALMS, WIZARDS OF THE COAST,
and their respective logos are trademarks of Wizards
of the Coast LLC in the U.S.A. and other countries.
© 2010 Wizards of the Coast LLC. Licensed by Hasbro.
Published in the Federal Republic of Germany
by Blanvalet Verlag, München
Deutschsprachige Rechte bei der Verlagsgruppe
Random House GmbH, München
Umschlaggestaltung: büro süd, München
Das Cover wurde erstellt
von Todd Lockwood © Wizards of the Coast, LLC
HK · Herstellung: sam
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-07501-9V002
www.blanvalet.de
Prolog
Das Jahr der wahren Vorzeichen (1409 DR)
Über König Bruenor Heldenhammer von Mithril-Halle ließe sich viel berichten. Man konnte ihn mit Fug und Recht als Kämpfer, Diplomat, Abenteurer und Anführer von Zwergen, Menschen und sogar Elfen bezeichnen. Bruenor hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass die Silbermarken zu einer der friedlichsten und wohlhabendsten Regionen von Faerûn wurden. Sein Waffenstillstand mit dem Ork-König Obould Todespfeil war eine geradezu visionäre Leistung gewesen, die kaum ein anderer Zwerg zustande gebracht hätte. Zumal dieser Burgfrieden nach Oboulds Tod auch von dessen Sohn und Nachfolger Urlgen, Obould dem Zweiten, eingehalten wurde.
Dieser wahrhaft bemerkenswerte Erfolg hatte Bruenor seinen Platz in den Legenden der Zwerge gesichert, auch wenn viele Zwerge aus Mithril-Halle noch immer murrten, weil man mit den Orks nun anders umgehen musste als früher. Sogar König Bruenor selbst zog seine Entscheidung weiterhin Jahr für Jahr in Zweifel, doch letztlich stand fest, dass er mit seiner unerschrockenen Sippe nicht nur Mithril-Halle zurückerobert, sondern durch seine Weisheit auch den ganzen Norden verändert hatte.
Aber von all den Titeln, die Bruenor Heldenhammer also für sich beanspruchen konnte, hatten nur zwei stets nahtlos auf seine kräftigen Schultern gepasst: Er war Vater und Freund. Als Freund konnte es niemand mit ihm aufnehmen. Wer Bruenor seinen Freund nannte, wusste ohne jeden Zweifel, dass der Zwergenkönig sich inmitten eines Pfeilhagels oder angesichts eines angreifenden Erdkolosses jederzeit vor ihn werfen würde, ohne es zu bereuen, nur aus Freundschaft. Doch was den Vater anging …
Bruenor hatte nie geheiratet und nie eigene Kinder gezeugt. Stattdessen hatte er zwei Menschen an Kindes statt angenommen.
Zwei Kinder, die er inzwischen verloren hatte.
»Ich habe mein Bestes gegeben«, sagte der Zwerg zu Drizzt Do’Urden, dem Dunkelelfen, dessen Stimme für den Thron von Mithril-Halle erstaunlicherweise am meisten galt – zumindest wenn der Drow tatsächlich einmal dort weilte. »Ich habe sie alles gelehrt, was mein Vater mich gelehrt hat.«
»Das steht ganz außer Frage«, versicherte ihm Drizzt.
Der Drow hatte es sich in dem kleinen Nebenzimmer von Bruenors Gemächern in einem Sessel am Kamin bequem gemacht und warf nun einen prüfenden Blick auf seinen ältesten Freund. Bruenors dichter Bart wirkte weniger rot, sogar weniger orange, denn in die feurigen Locken mischte sich immer mehr Grau. Und seine zottelige Haarpracht begann sich ein wenig zu lichten. Normalerweise funkelten seine grauen Augen jedoch so eindringlich wie damals an den Hängen von Kelvins Steinhügel im Eiswindtal.
Nur nicht heute, und das war verständlich.
Den Bewegungen des Zwergs war die Melancholie, die so deutlich in seinen Augen geschrieben stand, jedoch nicht anzumerken. Er schaukelte energisch mit seinem Stuhl, sprang zwischendurch auf, um nach einem Holzscheit zu greifen, und warf diesen gut gezielt ins Feuer. Das Scheit knisterte und rauchte, ging aber nicht in Flammen auf.
»Das Holz ist verdammt feucht«, knurrte der Zwerg, stampfte auf den eingebauten Blasebalg und ließ einen langen, gleichmäßigen Luftstrom über die Kohlen und das heruntergebrannte Holz streichen. Eine ganze Weile beschäftigte er sich fachmännisch mit dem Feuer, schichtete die Scheite um und pumpte Luft hinein. Für Drizzt war dieses Verhalten ganz typisch für seinen Freund. Denn genauso gründlich kümmerte sich Bruenor um alles andere, vom wackligen Frieden mit den Orks bis hin zur Erhaltung der harmonischen Handlungsfähigkeit seines eigenen Clans. Alles musste genau richtig sein, so wie dieses Feuer es schließlich auch war, als Bruenor sich wieder setzte und nach seinem Krug Met griff.
Der König schüttelte den Kopf. Auf seinem Gesicht zeichnete sich Reue ab. »Ich hätte den stinkenden Ork umbringen sollen.«
Dieses Lied, das Bruenor seit der Unterzeichnung des Vertrags von Garumns Schlucht immer wieder anstimmte, kannte Drizzt nur zu gut.
»Nein«, widersprach der Drow wenig überzeugend.
Bruenor verzog hämisch das Gesicht. »Du hast doch auch geschworen, ihn umzubringen, Elf. Und trotzdem hast du ihn an Altersschwäche sterben lassen.«
»Immer langsam, Bruenor.«
»Immerhin hat er deinen Elfenfreund zerstückelt. Und seine Speerwerfer haben deine niedliche Elfenfreundin mit ihrem geflügelten Pferd vom Himmel geholt.«
In Drizzts Blick waren Schmerz und brodelnder Zorn zu sehen. Bruenor hatte schon zu viel gesagt.
»Aber du hast ihn am Leben gelassen!«, fluchte der Zwerg und schlug mit der Faust auf die Armlehne.
»Ja, und du hast das Abkommen unterschrieben«, erinnerte ihn Drizzt mit ruhiger, beherrschter Stimme. Er wusste, dass er nicht brüllen musste, damit seine Worte ihre vernichtende Wirkung entfalteten.
Bruenor seufzte und stützte sein Gesicht in eine Hand.
Drizzt ließ ihn ein Weilchen schmoren, doch schließlich hielt er nicht länger an sich. »Du bist nicht der Einzige, der sich darüber ärgert, dass Obould so lange in Frieden gelebt hat«, sagte er. »Keiner hätte seinen Tod lieber gesehen als ich.«
»Aber wir haben es nicht getan.«
»Wir haben das Richtige getan.«
»Wirklich, Elf?«, fragte Bruenor ernst. »Jetzt ist er tot, und sie wollen weitermachen, aber ist es ihnen wirklich ernst? Wie lange wird der Frieden halten? Wann verwandeln die Orks sich wieder in Orks und zetteln den nächsten Krieg an?«
Drizzt zuckte mit den Schultern, denn auf diese Frage hatte er keine Antwort.
»Genau das ist es, Elf!«, kommentierte Bruenor seine Geste. »Du weißt es nicht, und ich weiß es nicht, aber du hast mir geraten, den verdammten Vertrag zu unterschreiben, und ich habe den verdammten Vertrag unterschrieben, und … wir wissen es nicht!«
»Aber wir wissen, dass viele Menschen und Elfen und, ja, Bruenor, auch Zwerge in Frieden und Wohlstand leben können, weil du den Mut hattest, den verdammten Vertrag zu unterschreiben. Weil du beschlossen hast, auf den nächsten Krieg zu verzichten.«
»Pah!«, schnaubte der Zwerg und riss die Hände hoch. »Und daran kaue ich nach wie vor herum. Verdammter stinkender Ork! Inzwischen treiben die Handel mit Silbrigmond und Sundabar und den verdammten Feiglingen von Nesmé! Wir hätten ihnen damals in der Schlacht den Garaus machen sollen, bei Clangeddin!«
Drizzt nickte, denn gefühlsmäßig stimmte er Bruenor durchaus zu. Doch sein Kopf wusste es besser. Nachdem Obould einen Waffenstillstand angeboten hatte, hätte Bruenors Sippe allein gegen Zehntausende gestanden. Diesen Kampf hätten sie nie gewinnen können. Nur wenn Oboulds Nachfolger beschloss, den Vertrag zu brechen, würde der daraus resultierende Krieg alle aufrechten Königreiche der Silbermarken gegen die Orks vereinen.
Auf dem Gesicht des Drow zeigte sich ein verschlagenes Grinsen, das allerdings zur Grimasse wurde, als ihm die vielen Orks einfielen, die er inzwischen beinahe zu seinen Freunden zählte. Währte dieser Friede wirklich schon fast vierzig Jahre?
»Du hast das Richtige getan, Bruenor«, erklärte er. »Weil du es gewagt hast, dieses Pergament zu unterzeichnen, hast du Zehntausende davor bewahrt, in einem blutigen Krieg viel zu früh ihr Leben zu lassen.«
»Noch einmal könnte ich das nicht«, erwiderte Bruenor kopfschüttelnd. »Ich bin verbraucht, Elf. Habe alles getan, was ich vermochte, und kann es nicht wiederholen.«
Er tauchte seinen Krug in das offene Fass zwischen den Sesseln und nahm einen großen Schluck.
»Glaubst du, er ist noch da draußen?«, fragte Bruenor mit Schaum am Bart. »Im kalten Schnee?«
»Wenn er noch lebt«, antwortete Drizzt, »dann ist Wulfgar jedenfalls da, wo er sein möchte.«
»Und ich wette, seine alten Knochen protestieren bei jedem Schritt gegen seinen Dickschädel!« Mit dieser Bemerkung sorgte Bruenor für das bisschen Leichtigkeit, das die beiden heute brauchten.
Drizzt lächelte, als der Zwerg kichern musste, doch ein Wort aus Bruenors Seitenhieb machte ihn nachdenklich. Alt. Er selbst war als langlebiger Drow in den letzten Jahren körperlich kaum gealtert. Falls Wulfgar dort draußen in der Tundra des Eiswindtals noch am Leben war, musste der Barbar auf die siebzig zusteuern.
Diese Erkenntnis traf Drizzt bis ins Mark.
»Würdest du sie noch lieben, Elf?«, fragte Bruenor. Er war zu seinem zweiten, verlorenen Kind gesprungen.
Drizzt sah ihn an, als hätte er ihm eine Ohrfeige verpasst. Ein nur zu vertrauter Anflug von Ärger legte sich über seine einst so ausgeglichenen Züge. »Ich liebe sie immer noch.«
»Wenn meine Kleine noch bei uns wäre, meine ich«, sagte Bruenor. »Sie wäre jetzt so alt wie Wulfgar, und viele würden behaupten, sie wäre hässlich.«
»Das hat von dir auch manch einer behauptet, sogar, als du noch jung warst«, entgegnete der Drow, um dieses absurde Gespräch zu beenden. Natürlich würde auch Catti-brie jetzt siebzig werden, wenn sie nicht vor vierundzwanzig Jahren der Zauberpest zum Opfer gefallen wäre. Für einen Menschen war das alt, genau wie bei Wulfgar, aber hässlich? So etwas hätte Drizzt von seiner geliebten Catti-brie niemals denken können, denn in den hundertzwölf Jahren seines Lebens hatte der Drow nie jemand oder etwas Schöneres gesehen als seine Frau. In seinen Augen hätte sie nie etwas anderes sein können als perfekt, ganz gleich, welche Spuren die Zeit auf ihrem menschlichen Antlitz hinterließ, welche Narben sie aus ihren Kämpfen davontrug oder wie sich ihr Haar verfärbte. Für Drizzt würde Catti-brie immer so aussehen wie damals, als er sich in sie verliebt hatte, auf einer lange zurückliegenden Reise ins ferne Calimhafen, wo sie Regis hatten retten müssen.
Regis. Die Erinnerung an den Halbling machte Drizzt zu schaffen. Auch diesen guten Freund hatte er in jenen Tagen des Chaos verloren, als der König der Geister die Schwebende Seele heimgesucht und dieses phänomenale Bauwerk in Schutt und Asche gelegt hatte. Sein Kommen hatte eine große Finsternis eingeleitet, die sich seither über ganz Toril ausgebreitet hatte.
Der Dunkelelf hatte einst den Rat bekommen, sein langes Leben in verschiedene kürzere Zeitspannen einzuteilen, um unmittelbar mit den Menschen in seiner Umgebung leben zu können. Demnach müsste er weiterziehen, um diese Art von Leben, Begehren und Liebe zu wiederholen. Eigentlich war ihm bewusst, dass dies ein guter Rat war, doch in dem Vierteljahrhundert, seit er Catti-brie verloren hatte, hatte er schließlich begriffen, dass manch ein Rat leichter zu hören als zu beherzigen ist.
»Sie ist noch bei uns«, stellte Bruenor nach einer Weile richtig. Er leerte seinen Krug und schleuderte ihn in den Kamin, wo er in tausend Stücke zerbrach. »Nur dieser verdammte Jarlaxle denkt wie ein Drow und lässt sich Zeit, als würde er ewig leben.«
Drizzt lag eine Bemerkung auf der Zunge, mit der er seinen Freund beruhigen wollte, aber er verbiss sich die Antwort. Stattdessen starrte er ins Feuer. Sowohl er als auch Bruenor hatten Jarlaxle, diesen weltgewandtesten aller Dunkelelfen, beschworen, Catti-brie und Regis zu suchen. Wenigstens ihre Seelen sollte er finden, denn sie hatten gesehen, wie ein heiliges Einhorn diese Seelen an jenem schicksalhaften Morgen durch die Mauern von Mithril-Halle davongetragen hatte. Drizzt glaubte, dass die Göttin Mielikki die beiden abgeholt hatte, aber sicher nicht so grausam war, sie zu behalten. Doch vielleicht konnte nicht einmal Mielikki dem Herrn der Toten, Kelemvor, seine hart erkämpfte Beute vorenthalten.
Drizzt sah diesen Morgen vor sich, als wäre es gestern gewesen. Nach einer köstlichen Nacht in den Armen seiner Frau, die aus den Tiefen ihres Wahns zu ihm zurückgekehrt zu sein schien, hatten Bruenors Schreie ihn aus dem Schlaf gerissen.
Und dann hatte sie an diesem schrecklichen Morgen kalt neben ihm gelegen.
»Brich den Frieden«, knurrte Drizzt, der plötzlich wieder an den neuen Ork-König dachte, der nicht annähernd so klug und weitsichtig war wie sein Vater.
Reflexartig glitt Drizzts Hand an seine Hüfte, obwohl er seine Krummsäbel abgelegt hatte. Er wollte das Gewicht der tödlichen Klingen wieder in seinen Händen spüren. Der Gedanke an den Kampf, an den Gestank des Todes oder an seinen eigenen Tod schreckte ihn nicht. Nicht an diesem Morgen. Nicht, solange die Erinnerung an Catti-brie und Regis ihn umschloss und ihm seine ganze Hilflosigkeit zeigte.
»Ich komme nur ungern hierher«, bemerkte die Ork-Frau, als sie den Kräuterbeutel überreichte. Für einen Ork war sie eher klein, doch ihr winziges Gegenüber überragte sie bei weitem.
»Es herrscht Frieden, Jessa«, erwiderte Nanfoodle. Der Gnom öffnete den Beutel, zog eine Wurzel daraus hervor und schnupperte daran. »Oh, die gute alte Alraune«, sagte er. »Die richtige Portion macht schmerzfrei.«
»Und lässt vergessen«, sagte die Frau. »Und macht einen zum Narren … wie einen Zwerg in einem Met-See, der ihn bis zum Grund leer trinken will.«
»Nur fünf?«, fragte Nanfoodle, der in dem großen Beutel herumtastete.
»Die anderen Pflanzen stehen in voller Blüte«, erwiderte Jessa. »Nur fünf, sagst du? Ich hatte damit gerechnet, allenfalls eine zu finden. Auf zwei hatte ich gehofft und um eine dritte gebetet.«
Nanfoodle blickte von dem Beutel auf, ohne die Ork-Frau anzusehen. Sein abwesender Blick schweifte in die Ferne, denn dahinter überschlugen sich seine Gedanken. »Fünf …«, sann er und warf einen Blick auf sein Laboratorium. Sein magerer Finger tippte auf den kleinen weißen Ziegenbart, während er vor sich hin grübelte. Schließlich fasste er einen Entschluss: »Fünf dürften reichen.«
»Sicher?«, vergewisserte sich Jessa. »Du willst es also wagen?«
Der Gnom bedachte sie mit einem verständnislosen Blick. »Ich bin schon dabei«, erklärte er.
Ein durchtriebenes Grinsen zog Jessas Lippen so hoch, dass sie beinahe bis zu den zwei strohgelben Locken zu reichen schienen, die ihr flaches, rundes Gesicht mit der Schweinsnase umrahmten. Ihre hellbraunen Augen glitzerten frech.
»Macht dir das wirklich so viel Spaß?«, schalt der Gnom.
Doch Jessa wandte sich schwungvoll zum Gehen. »Die Aufregung macht mir Spaß«, gab die junge Priesterin zu. »Das Leben ist schließlich so langweilig.« Sie drehte sich noch einmal um und deutete auf den Beutel in Nanfoodles Hand. »Und dir geht es offenbar ebenso.«
Der Gnom betrachtete die giftigen Wurzeln. »Ich habe keine andere Wahl.«
»Hast du Angst?«
»Sollte ich das?«
»Ich habe Angst«, sagte Jessa, doch es klang nicht wie ein unfreiwilliges Eingeständnis. Mit ernster Miene nickte sie dem Gnom anerkennend zu und verabschiedete sich mit einem Knicks. »Lang lebe der König.« Dann ging sie, wobei sie darauf achtete, auf dem Weg zur Botschaft des Reiches Todespfeil möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen, auch wenn ein Ork in den Gängen von Mithril-Halle nie unbeachtet blieb.
Nanfoodle nahm die Wurzeln zur Hand und ging zu seinen Apparaturen auf der breiten Ablage an der Seite des Laboratoriums. Dabei warf er einen Blick in den Spiegel hinter der Ablage und nahm kurz Haltung an, denn für einen Gnom mittleren Alters fand er sich sehr würdevoll – obwohl er das mittlere Alter eigentlich längst überschritten hatte. Abgesehen von den dicken weißen Büscheln über den großen Ohren war sein kleiner Kopf weitgehend kahl, doch er achtete darauf, diese restlichen Haare ebenso sorgfältig zu stutzen wie das spitze Bärtchen und den dünnen Schnurrbart. Den Rest seines großen Schädels hielt er glatt rasiert. Bis auf die Augenbrauen, wie er schmunzelnd feststellte, als ihm auffiel, dass ein paar dieser Haare schon so lang waren, dass sie sich sichtlich lockten.
Schließlich riss sich der Gnom von seinem Spiegelbild los und klemmte sich einen Kneifer auf die Nase. Um durch die kleinen, runden Vergrößerungsgläser besser sehen zu können, legte er den Kopf nach hinten, während er sorgfältig die Höhe des geölten Dochts einstellte.
Wenn er die richtige Menge des kristallklaren Gifts extrahieren wollte, musste die Hitze genau stimmen, schärfte er sich ein.
Er musste absolut präzise arbeiten, doch beim Blick auf das Stundenglas am Ende des Bretts wurde ihm klar, dass er sich dabei sputen musste.
König Bruenors Krug wartete.
Thibbledorf Pwent trug ausnahmsweise nicht seine zerdellte, schartige Stachelrüstung, ohne die man den Zwerg kaum je zu Gesicht bekam. Genau dies war auch der Grund, denn er wollte von niemandem gehört oder gar erkannt werden.
In Sichtweite von Nanfoodles Tür versteckte er sich am Ende eines Gangs im Schatten hinter ein paar Fässern.
Der Schlachtenwüter knirschte mit den Zähnen, um die Flut an Flüchen zurückzuhalten, die ihm in den Sinn kamen, als Jessa Dribble-Obould das Labor betrat, nachdem sie sich zuvor mit schnellem Blick versichert hatte, dass niemand sie bemerkte.
»Orks in Mithril-Halle«, flüsterte Pwent, schüttelte seinen schmutzigen, behaarten Kopf und spuckte aus. Wie hatte er protestiert, als dem Ork-Reich eine Botschaft in den Hallen der Zwerge zugestanden wurde! Natürlich war es kein großer Stützpunkt. Es durften sich nie mehr als vier Orks gleichzeitig in Mithril-Halle aufhalten, und auch diese vier durften sich nicht frei bewegen. Deshalb stand immer ein Trupp Zwergenwachen bereit, zu denen häufig auch Pwents Schlachtenwüter zählten, um die »Gäste« zu eskortieren.
Aber diese aalglatte kleine Priesterin hatte diese Regel offenbar umgangen. Damit hatte Pwent schon lange gerechnet.
Er überlegte, ob er hinübergehen und die Tür eintreten sollte, um die Ratte auf frischer Tat zu ertappen. Dann könnte er sie ein für alle Mal aus Mithril-Halle vertreiben lassen. Doch als er sich erheben wollte, riet ihm ein seltener Anflug von Weisheit zu mehr Geduld. Trotz seiner brodelnden Wut verharrte Thibbledorf Pwent an seinem Platz. Kurz darauf stand Jessa wieder im Gang, sah sich nach beiden Seiten um und huschte in die Richtung zurück, aus der sie gekommen war.
»Was hat das zu bedeuten, Gnom?«, flüsterte Pwent. Das alles ergab einfach keinen Sinn.
Nanfoodle war selbstverständlich kein Feind von Mithril-Halle, sondern hatte sich seit seiner Ankunft vor rund vierzig Jahren als zuverlässiger Verbündeter erwiesen. Noch heute erzählten die Zwerge von Nanfoodles »Elminster-Leistung«, bei welcher der Gnom über ein geniales Rohrsystem ein explosives Gas in Höhlen geleitet hatte, um damit einen ganzen Berg samt den daraufstehenden feindlichen Riesen in die Luft zu sprengen.
Aber was heckte dieser Freund dann in aller Heimlichkeit mit einer Ork-Priesterin aus? Nanfoodle hätte über die üblichen Kanäle nach Jessa schicken können, zum Beispiel direkt über Pwent, und gleich darauf hätte man sie bis vor seine Tür geleitet.
Pwent dachte lange darüber nach, so lange, bis Nanfoodle irgendwann im Gang auftauchte und davoneilte. Erst da wurde dem überraschten Schlachtenwüter bewusst, dass es Zeit für die Gedenkfeier war.
»Bei Moradins hartem Arsch«, knurrte Pwent und kroch hinter den Fässern hervor.
Er wollte direkt zu Bruenor laufen, blieb dann aber doch bei Nanfoodles Kammer stehen, sah sich genauso um wie zuvor Jessa und schob die Tür auf.
Alles erschien ihm wie immer. In den Glasgefäßen auf dem seitlichen Tisch brodelte noch eine weiße Flüssigkeit, die von der Resthitze der eben erst gelöschten Kohlenbecken erwärmt wurde, doch alles andere war das perfekte Chaos – genau wie der zerstreute Nanfoodle es immer arrangierte.
»Hmm«, brummte Pwent und sah sich gründlich um. Er suchte nach einem Hinweis, vielleicht gar nach einem freien Plätzchen, wo Nanfoodle und Jenna womöglich …
Nein, das erschien ihm nun wirklich undenkbar.
»Ach, du bist ein Holzkopf, Thibbledorf Pwent, genau wie dein Bruder, wenn du einen Bruder hättest!«, schalt der Zwerg sich selbst.
Er wollte bereits gehen, denn nun kamen ihm Gewissensbisse, weil er Nanfoodle überhaupt in dieser Weise nachspionierte, doch dann bemerkte er etwas unter dem Schreibtisch des Gnoms: Marschgepäck. Pwents Gedanken kehrten an jenen dunklen Ort zurück, wo er sich ein Techtelmechtel zwischen dem Gnom und der Ork-Priesterin ausmalte, doch diesen Gedanken schüttelte er schnell wieder ab. Die Decken waren fest verschnürt und lagen offensichtlich schon eine Zeitlang dort. Dahinter stand ein Rucksack voller Ausrüstung, von Bandagen bis hin zum seitlich festgeschnürten Kletterpickel.
»Planst du etwa einen Ausflug zu den Orks, Kleiner?«, fragte Pwent ins Leere.
Achselzuckend erhob er sich und ging die wahrscheinlichsten Möglichkeiten durch. Wenn er richtig geraten hatte, war Nanfoodle hoffentlich schlau genug, nicht allein aufzubrechen. König Bruenor hatte sich beim Übergang der Herrschaft von Obould auf dessen Sohn sehr taktvoll benommen und die Spannungen gering gehalten, aber Orks waren letztlich Orks, und wer wusste schon, ob man diesem Obould-Sohn wirklich trauen konnte oder ob dieser überhaupt die Autorität und die Kraft hatte, seine wilden Horden so in Schach zu halten wie sein mächtiger Vater?
Pwent beschloss, möglichst bald unter vier Augen mit seinem Freund Nanfoodle zu sprechen. Vorerst jedoch verdrängte er all das, während er wieder auf den Gang schlüpfte. Er musste dringend zu einem wichtigen Festakt, denn König Bruenor würde seine Unpünktlichkeit mit großem Missfallen zur Kenntnis nehmen.
»… fünfundzwanzig Jahre«, sagte Bruenor gerade, als Thibbledorf Pwent sich zu der Versammlung in dem kleinen Audienzsaal gesellte, zu der nur wenige ausgewählte Gäste geladen waren: Drizzt natürlich, aber auch Cordio als Oberster Priester von Mithril-Halle, Nanfoodle und der alte Banak Starkamboss in seinem Rollstuhl und dessen Sohn Connerad, der zu einem prächtigen jungen Zwerg heranwuchs. Connerad hatte sich sogar bei Pwents Schlachtenwütern ausbilden lassen und sich gegen weitaus erfahrenere Kämpfer behauptet. Um den König waren noch einige weitere Zwerge versammelt.
»Ich vermisse dich, Tochter, und auch dich, mein Freund Regis. Wisset, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht an euch denke, selbst wenn ich noch weitere hundert Jahre leben sollte«, sagte der Zwergenkönig. Er hob seinen Krug und leerte ihn. Die anderen taten es ihm nach. Beim Absetzen fasste er Pwent ins Auge.
»Verzeih mir, mein König«, sagte der Schlachtenwüter. »Habe ich die ganze Sauferei verpasst?«
»Nur den ersten Trinkspruch«, tröstete Nanfoodle und eilte geschäftig los, um alle Krüge einzusammeln, ehe er damit zu dem Fass auf der Seite lief. »Hilf mir«, forderte er Pwent auf.
Nanfoodle füllte die Krüge, und Thibbledorf Pwent teilte sie aus. Pwent bemerkte, dass der Gnom Bruenors persönlichen Krug nicht gleich zu Beginn nachfüllte. Dieser Krug war wirklich nicht zu übersehen, denn er war mit dem Wappen der Sippe Heldenhammer mit dem schäumenden Bierkrug geziert und hatte einen Griff mit Hörnern am oberen Rand, in die der Besitzer seinen Daumen stecken konnte. Eines dieser Hörner war abgebrochen, so wie das eine Horn auf Bruenors Helm. Der Krug war ein Geschenk der Zwerge aus der Zitadelle Adbar, mit dem sie zum zehnten Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Garumns Schlucht ihre Solidarität und ewige Freundschaft bekundet hatten. Niemand außer Bruenor würde es wagen, diesen Krug zum Mund zu führen. Das wusste Pwent, und deshalb begriff er auch, dass Nanfoodle dem König seinen Met persönlich und ganz zum Schluss überreichen wollte. Eigentlich dachte er auch nicht lange darüber nach, doch ihm fiel eben auf, dass der Gnom diesen einen Krug absichtlich nicht von Pwent austeilen ließ.
Hätte Pwent besser auf den Gnom geachtet, so wäre ihm noch etwas aufgefallen, worüber er sich bestimmt gewundert hätte. Der Gnom füllte erst seinen eigenen Krug, ehe er der Gruppe, die sich über die alten Zeiten mit Cattie-brie und Regis unterhielt und ohnehin keinen Blick für ihn hatte, erkennbar den Rücken zuwandte. Aus einem versteckten Beutel an seinem Gürtel zog der Gnom ein kleines Fläschchen, das er geräuschlos entkorkte. Er sah sich nach den anderen um und goss die klare Flüssigkeit rasch in Bruenors prächtigen Krug.
Nachdem die Flüssigkeit sich verteilt hatte, nickte er zustimmend und schloss sich den Feiernden wieder an.
»Darf ich einen Trinkspruch auf meine Herrin Shoudra ausbringen?«, fragte der Gnom. Shoudra war die Szeptrana und Botschafterin von Mirabar gewesen, die er vor all den Jahren nach Mithril-Halle begleitet hatte und die in jenem furchtbaren Krieg von Obould persönlich getötet worden war. »Auf alte, geheilte Wunden«, erklärte er und hob seinen eigenen Krug.
»Ja, auf Shoudra und alle, die bei der Verteidigung der Hallen der Heldenhammer-Sippe gefallen sind«, stimmte Bruenor ihm zu und nahm einen langen Zug Honigwein.
Nanfoodle nickte und lächelte. Er hoffte nur, dass Bruenor das etwas bittere Gift nicht herausschmeckte.
»Wehe, Mithril-Halle! Benachrichtigt alle Grafen, Könige und Königinnen der Silbermarken, dass König Bruenor schwer krank darniederliegt!«, verkündeten die Herolde schon wenige Stunden nach der Gedenkfeier im ganzen Zwergenreich.
Die Kapellen von Mithril-Halle waren ebenso voll wie die aller Städte des Nordens, wo sich die Nachricht herumsprach, denn König Bruenor war sehr beliebt, und seine kräftige Stimme hatte viele gute Veränderungen in den Silbermarken unterstützt. Angesichts des möglichen Verlusts beider Unterzeichner des Vertrags von Garumns Schlucht munkelte man überall sorgenvoll von einem baldigen Krieg mit den Orks.
Die Gebete in Mithril-Halle waren feierlich, aber ohne Schrecken. Immerhin hatte Bruenor ein langes, gutes Leben hinter sich und war von ungemein charakterstarken Zwergen umgeben. Das Wichtigste war die Sippe, und die würde weiterbestehen und gedeihen, wenn die Tage des großen Königs Bruenor längst Geschichte waren.
Dennoch flossen viele Tränen, wann immer einer von Cordios Priestern verkündete, dass der König schwer krank sei und Moradin ihre Gebete noch nicht erhört hätte.
»Wir können ihm nicht helfen«, bekannte Cordio gegenüber Drizzt und einigen anderen, als Bruenor schon die dritte Nacht in Folge litt. »Wir erreichen ihn nicht mehr.«
Er bedachte den Drow mit einem stillen, missbilligenden Blick, doch Drizzt zeigte keine Regung.
»Ach, mein König«, klagte Pwent.
»Wehe, Mithril-Halle«, sagte Banak Starkamboss.
»Moment«, mahnte Drizzt. »Bruenor war sich seiner Verantwortung sehr bewusst. Die Thronfolge ist geklärt.«
»Du redest, als wäre er schon tot, du verdammter Elf!«, schimpfte Pwent.
Drizzt seufzte und nickte dem Schlachtenwüter entschuldigend zu.
Sie gingen hinein und setzten sich an Bruenors Bett. Drizzt hielt seinem Freund die Hand, bis der König kurz vor Tagesanbruch sein Leben aushauchte.
»Der König ist tot. Lang lebe der König«, sagte Drizzt an Banak gewandt.
»Hiermit beginnt die Regentschaft von Banak Starkamboss, dem elften König von Mithril-Halle«, sagte Cordio.
»Ich fühle mich geehrt, Priester«, antwortete der alte Banak schweren Herzens und mit gesenktem Blick. Sein Sohn, der hinter dem Stuhl stand, klopfte ihm auf die Schulter. »Wenn ich nur halb so ein König sein kann wie Bruenor, wird die Welt meine Herrschaft als gut – ach was, als großartig bezeichnen.«
Thibbledorf Pwent trat zögernd vor und ließ sich vor Banak auf ein Knie sinken. »Mein … mein Leben für dich, mein … mein König«, stammelte er, denn er brachte die Worte kaum über die Lippen.
»Gesegnet sei mein Gefolge«, erwiderte Banak und tätschelte Thibbledorf den Schopf.
Der gestählte Schlachtenwüter hob den Unterarm vor die Augen, wich zurück und warf sich über Bruenor, den er fest umarmte. Dann wankte er mit einem Jammerschrei zurück und verließ taumelnd den Raum.
Bruenor wurde neben Catti-brie und Regis beigesetzt, im prächtigsten Mausoleum, das es in diesem alten Zwergenreich je gegeben hatte. Einer nach dem anderen traten die Ältesten der Sippe Heldenhammer vor, um in langen, bewegenden Reden die vielen großen Taten des mächtigen Königs Bruenor zu rühmen, der sein Volk aus der Finsternis der zerstörten Hallen in eine neue Heimat im Eiswindtal geführt hatte, höchstpersönlich ihr altes Zuhause wiederentdeckt und erneut für seine Sippe beansprucht hatte. Etwas vorsichtiger äußerten sie sich über den Diplomaten Bruenor, der die politische Landschaft der Silbermarken so nachhaltig verändert hatte.
Und so ging es drei Tage lang weiter, Tag und Nacht, eine Lobeshymne nach der anderen, die zuverlässig mit einem von Herzen kommenden Trinkspruch auf den würdigen Nachfolger endeten, den großen Banak Starkamboss, der seinen Namen nun offiziell um den Zusatz »Heldenhammer« erweitert hatte: König Banak Starkamboss Heldenhammer.
Aus allen Königreichen der Umgebung trafen Gesandte ein, und selbst die Orks kamen zu Wort. Ihre Priesterin, Jessa Dribble-Obould, hielt eine lange Rede, in der sie nur Gutes über diesen bemerkenswerten König zu berichten hatte, und äußerte die Hoffnung ihres Stammes, dass König Banak sich als ebenso klug und gutwillig erweisen und Mithril-Halle unter seiner Herrschaft gedeihen möge. An den Worten der jungen Ork-Frau war wirklich in keiner Hinsicht etwas auszusetzen, aber dennoch grollten nicht wenige der vielen tausend Zwerge, die ihr lauschten, und spuckten aus – was Banak und die anderen Anführer deutlich daran gemahnte, dass Bruenors Ziel, die Kluft zwischen Orks und Zwergen zu schließen, noch lange nicht erreicht war.
Körperlich erschöpft und innerlich ausgelaugt sanken Drizzt, Nanfoodle, Cordio, Pwent und Connerad schließlich auf die Sessel am Kamin, wo Bruenors Lieblingsplatz gewesen war. Sie stießen noch einige Male auf ihren Freund an und schwelgten dann in persönlichen Erinnerungen an die vielen guten und heldenhaften Ereignisse, die sie mit diesem besonderen Zwerg erlebt hatten.
Pwent hatte die meisten Geschichten parat, alles natürlich weit übertrieben, doch Drizzt Do’Urden blieb erstaunlich still.
»Ich muss mich bei deinem Vater entschuldigen«, sagte Nanfoodle zu Connerad.
»Entschuldigen? Aber, Gnom, er weiß deinen Rat zu schätzen, genau wie jeder andere Zwerg«, erwiderte der junge Prinz von Mithril-Halle.
»Und deshalb muss ich mich bei ihm entschuldigen«, sagte Nanfoodle, was alle im Raum aufhorchen ließ. »Ich kam einst mit Shoudra Sternenglanz und hatte nie vor zu bleiben. Doch inzwischen sind Jahrzehnte ins Land gegangen. Ich bin nicht mehr jung. In einem Monat werde ich fünfundsechzig.«
»Hört, hört!«, unterbrach Cordio, der gleich wieder anstoßen wollte. Alle erhoben ihr Glas auf Nanfoodles Gesundheit.
»Vielen Dank, meine Freunde«, sagte Nanfoodle anschließend. »Ihr wart wie eine Familie für mich, und mein halbes Leben hier war keine kürzere Hälfte als die Jahre zuvor. Oder die Jahre danach, ganz gewiss.«
»Was willst du damit sagen, Kleiner?«, fragte Cordio verwirrt.
»Ich habe Familie«, antwortete der Gnom. »Und die habe ich seit über dreißig Jahren kaum gesehen. Ich fürchte, es wird Zeit, dass ich gehe. Ich möchte meine letzten Jahre in meiner alten Heimat Mirabar verbringen.«
Bei diesen Worten wurde es still im Raum. Es hatte allen die Sprache verschlagen.
»Du musst dich nicht bei meinem Vater entschuldigen, Nanfoodle von Mirabar«, versicherte Connerad dem Gnom schließlich und erhob seinen Krug. »Mithril-Halle wird den Beistand des großen Nanfoodle nie vergessen!«
Diesem Trinkspruch schlossen die anderen sich bereitwillig an, aber dennoch hatte Thibbledorf Pwent ein merkwürdiges Gefühl dabei. Er war allerdings so erschöpft und durcheinander, dass er nicht begriff, was ihm so unangenehm aufstieß.
Noch nicht.
Keuchend und schnaufend krabbelte der Gnom durch einen Trümmerhaufen, dessen große, glatte graue Steine ihm so vorkamen, als hätten Titanen sie hier für ein Katapult gestapelt. Immerhin kannte Nanfoodle die Gegend gut und hatte sie sogar selbst als Treffpunkt ausgewählt. Deshalb war er keineswegs überrascht, als er sich zwischen drei Steinen hindurchgequetscht hatte und Jessa ihn auf einem kleineren Stein erwartete. Vor ihr stand das Mittagessen auf einer Decke bereit.
»Du brauchst längere Beine«, sagte sie zur Begrüßung.
»Ich müsste dreißig Jahre jünger sein«, erwiderte Nanfoodle. Er ließ das Gepäck von seinen Schultern gleiten, nahm gegenüber von Jessa Platz und griff nach dem Teller Suppe, den sie ihm reichte.
»Ist es vollbracht? Bist du sicher?«, fragte Jessa.
»Drei Tage Staatstrauer für den toten König … nicht mehr als drei. Sie haben keine Zeit. Damit ist Banak endlich König. Diesen Titel hatte er schon lange verdient.«
»Er tritt ein großes Erbe an.«
Nanfoodle winkte ab. »Das Beste, was König Bruenor geleistet hat, war die nachhaltige Ordnung in Mithril-Halle. Banak wird nicht wanken, und selbst wenn, gibt es viele kluge Stimmen in seiner Umgebung.« Er hielt inne und sah die Ork-Priesterin forschend an. Ihr Blick schweifte nach Norden, zu dem noch jungen Königreich ihres Volkes. »König Banak wird die Arbeit fortsetzen, genau wie Obould der Zweite die Wünsche und Visionen seines Vorgängers hochhält«, versicherte Nanfoodle.
Jessa sah ihn neugierig, ja geradezu ungläubig an. »Du bist so ruhig«, sagte sie. »Du hast zu viel Zeit mit deinen Büchern und Schriftrollen verbracht und nicht annähernd oft genug den anderen ins Gesicht geschaut.«
Nanfoodle reagierte mit einem fragenden Blick.
»Wie kannst du so gelassen sein?«, fragte Jessa. »Ist dir nicht klar, was du gerade getan hast?«
»Ich habe nur meine Befehle befolgt«, protestierte Nanfoodle, ohne auf ihren ernsten Tonfall einzugehen.
Jessa wollte ihn erneut rügen, um ihn mehr über das Gewicht der Gefühle zu lehren. Nicht alles auf der Welt ließ sich in logische Überlegungen fassen. Man musste auch andere Faktoren berücksichtigen. Doch ein Geräusch auf der Seite, wo Metall an Stein entlangschabte, ließ sie aufhorchen.
»Was ist?«, fragte Nanfoodle, als sie abrupt aufstand.
»Was für Befehle hast du befolgt?«, erklang die schroffe Stimme von Thibbledorf Pwent, und Nanfoodle fuhr in dem Moment herum, als der Schlachtenwüter in voller Montur zwischen den Felsen hervortrat, wobei die Metallkanten misstönend über das Gestein rieben. »Ja, und ich frage mich auch, wer dir irgendwas befohlen hat!« Er schlug die eine Faust in ihrem Metallhandschuh in die andere Hand. »Und das werde ich schon noch herausfinden, du kleine Ratte, darauf kannst du Gift nehmen!«
Als er näher trat, wich Nanfoodle zurück und ließ dabei die Suppe fallen.
»Ihr entkommt mir nicht«, versicherte Pwent den beiden, während er noch näher kam. »Meine Beine sind lang genug, um euch zu verfolgen, und mein Zorn ist mehr als groß genug, um euch zu erwischen.«
»Was soll das?«, rief Jessa, doch Pwent bedachte sie mit einem hasserfüllten Blick.
»Du bist nur noch am Leben, weil du vielleicht etwas zu sagen hast, was ich hören muss«, erklärte der wütende Zwerg. »Und wenn deine Worte mir nicht gefallen, habe ich ganz schnell den richtigen Platz für dich.« Dabei zeigte er auf den langen Dorn, der aus seinem Helm nach oben ragte. Jessa wusste nur zu gut, dass mehr als ein Ork durch diesen Dorn sein Leben gelassen hatte.
»Halt, Pwent!«, rief Nanfoodle und streckte abwehrend die Hände aus, um den Zwerg aufzuhalten. »Du verstehst das nicht.«
»Oh, ich weiß mehr, als ihr glaubt«, versicherte der Zwerg. »Ich war in deiner Werkstatt, Gnom.«
Nanfoodle hob die Hände. »Ich habe König Banak doch gesagt, dass ich gehe.«
»Du warst schon reisefertig, bevor König Bruenor starb«, warf Pwent ihm vor. »Deine Sachen waren bereits gepackt.«
»Nun ja, ich hatte schon eine Zeitlang …«
»Alles gepackt und unter dem Tisch mit dem Gift verstaut, das du für meinen König gebraut hast!«, brüllte Pwent und sprang vor. Nanfoodle wich geschickt aus und versteckte sich hinter einem Stein vor Pwents mörderischem Griff.
»Pwent, nicht!«, schrie Nanfoodle.
Jessa wollte eingreifen, aber Pwent wandte sich ihr zu und ballte die Fäuste, worauf sich die einklappbaren Stacheln auf dem Handrücken seiner Handschuhe aufstellten. »Was hast du der Ratte gezahlt, du Wildsauarsch?«, fauchte er sie an.
Jessa ging rückwärts, stand jedoch irgendwann mit dem Rücken an einem Stein. So in die Enge getrieben, veränderte sich ihr Verhalten augenblicklich. Jetzt ging sie ihrerseits in die Offensive und zog einen schmalen Eisenstab. »Keinen Schritt weiter!«, warnte sie ihn und zielte.
»Pwent, nein! Jessa, nein!«, schrie Nanfoodle.
»Hast wohl einen Kanonenschlag in dem Stecken da, was?« Pwent blieb unbesorgt. »Der wird dir nicht viel helfen! Der macht mich nur noch wütender, und dann schlag ich umso fester zu!«
Er wollte auf sie losgehen. Jessa sprach ihre Zauberworte und zielte mit dem Stab auf das schmutzige Gesicht des Zwergs. Plötzlich stockten beide, und auch Nanfoodle blieb der nächste Schrei in der Kehle stecken. Sie hörten das fröhliche Gebimmel feiner Glöckchen.
»So, jetzt kriegt ihr euer Fett«, sagte Pwent und kniff die Augen zusammen, denn diese Glöckchen kannte er. Jeder in Mithril-Halle kannte das Zaumzeug von Drizzt Do’Urdens magischem Einhorn.
Von den klingelnden Glöckchen am Harnisch angekündigt, trabte das Zauberwesen, dessen schimmernden Leib imposante Muskeln durchzogen, an den Rand des Felshaufens und stampfte mit dem Huf auf. Die goldene Spitze des Elfenbeinhorns strahlte in der Sonne mit seinen blauen Augen um die Wette.
»Du kommst gerade recht, Elf!«, rief Pwent Drizzt zu, der ihn fassungslos anstarrte. »Meine Faust wollte eben …«
Als Thibbledorf Pwent sich Jessa wieder zuwenden wollte, machte er einen Satz nach hinten, denn vor ihm kauerte ein ausgewachsener, fauchender schwarzer Panther!
Und dann zuckte er noch einmal zusammen, denn nun sah er Bruenor Heldenhammer, der hinter Drizzt gesessen hatte, vom Einhorn springen.
»Was bei den Neun Höllen ist hier los?«, wollte Bruenor von Nanfoodle wissen.
Der Gnom konnte nur hilflos mit den Schultern zucken.
»Mein … König?«, stammelte Pwent. »Mein König? Kann das mein König sein? Mein König!«
»Oh, bei Moradins eingekniffenem Arsch«, lamentierte Bruenor. »Was machst du denn hier, du Einfaltspinsel? Dein Platz ist an König Banaks Seite.«
»Was heißt hier König Banak?«, protestierte Pwent. »Nicht solange König Bruenor noch am Leben ist!«
Bruenor stürmte zu dem Schlachtenwüter hinüber und drückte seine Nase gegen die von Pwent. »Jetzt hör mir mal genau zu, Zwerg, damit du diesen Fehler kein zweites Mal machst. König Bruenor gibt es nicht mehr. König Bruenor ist Geschichte, und König Banak regiert Mithril-Halle!«
»Aber … aber … aber mein König«, japste Pwent. »Du bist doch gar nicht tot!«
Bruenor seufzte.
Hinter ihm schwang sich Drizzt aus dem Sattel und glitt geschmeidig auf den Boden. Er tätschelte Andahar den starken Hals, führte eine Einhornfigur an einer silbernen Kette zum Mund und blies sanft in das hohle Horn, um sein Streitross zu entlassen.
Andahar stieg auf die Hinterläufe, so dass seine Vorderhufe durch die Luft wirbelten, wieherte laut und donnerte davon. Mit jedem Satz schien das Tier enorm voranzukommen, denn seine Größe halbierte sich mit jedem Sprung, bis es plötzlich nicht mehr zu sehen war. Nur die Luft vibrierte noch von den Wellen der magischen Energie.
Inzwischen hatte Pwent sich etwas gefasst und sich vor Bruenor aufgebaut. Er stemmte die Hände in die Hüften. »Du warst tot, mein König«, beharrte er. »Ich habe es gesehen. Ich habe es gerochen. Du warst tot.«
»Ich musste tot sein«, erwiderte Bruenor, der sich jetzt ebenfalls aufrichtete und die Hände in die Hüften stemmte. Wieder drückte er seine Nase gegen die von Pwent, wobei er sehr langsam und nachdrücklich hinzufügte: »Damit ich wegkonnte.«
»Weg?«, wiederholte Pwent. Sein Blick zu Drizzt half ihm auch nicht weiter, doch das Grinsen des Dunkelelfen verriet, dass dieser das Schauspiel ungebührlich genoss. Danach sah Pwent Nanfoodle an, der nur mit den Schultern zuckte. Hinter dem Panther Guenhwyvar lachte ihn Jessa herausfordernd an und schwenkte ihren Stab.
»Oh, dein Dickschädel erleichtert Dumathoin wahrlich sein Handwerk«, rief Bruenor den Zwergengott an, der als der Bewahrer der Geheimnisse unter dem Berg galt.
Pwent rümpfte die Nase, denn diese beliebte Redewendung war ein ziemlich ungehobelter Weg, einen anderen Zwerg zum Trottel zu erklären.
»Du warst tot«, beharrte der Schlachtenwüter.
»Ja, und unser Kleiner hier hat mich umgebracht.«
»Das Gift«, erläuterte Nanfoodle. »Es ist tödlich, ja, aber es kommt auf die Dosis an. So wie ich es verwendet habe, hat es Bruenor scheintot wirken lassen. Das können nur die höchsten Priester erkennen – und die wussten, was wir vorhatten.«
»Damit du dich davonmachen konntest?«, fragte Pwent, dem es allmählich dämmerte.
»Damit ich Banak hochoffiziell den Thron übergeben konnte. Sonst hätte er wieder nur als Truchsess gedient, während der ganze Clan meine Rückkehr erwartet. Aber diesmal komme ich nicht zurück. Das ist schon viele Male so geschehen, Pwent. Ein alter Schachzug der Zwergenkönige, um sich noch einmal auf den Weg zu machen, wenn man als Herrscher alles getan hat, was man vermochte. Mein Ur-ururgroßvater hat es so gemacht, und in Adbar könnte ich dir auch zwei Könige nennen. Und das sind bestimmt nicht die Einzigen, oder ich will ein bärtiger Gnom sein.«
»Du wolltest aus der Halle weg?«
»Genau das.«
»Für immer?«
»Für einen Zwerg wie mich ist das nicht mehr so lange.«
»Du bist weggelaufen. Du bist weggelaufen und hast es mir nicht gesagt?« Pwent bebte vor Empörung.
Bruenor warf Drizzt einen Blick zu. Als er Pwents Brustpanzer scheppern hörte, drehte er sich um.
»Du hast es einem stinkenden Ork verraten, aber nicht deinem Knochenbrecher?«, vergewisserte sich Pwent. Er zog einen Handschuh aus und warf ihn neben den Panzer. Nach dem nächsten Handschuh beugte er sich vor, um seine stachelbewehrten Beinschienen abzuschnallen.
»Das hast du denen angetan, die dich liebten? Hast uns alle um dich weinen lassen? Uns das Herz gebrochen? Mein König!«
Bruenor presste die Lippen aufeinander. Er antwortete nicht.
»Mein Leben für meinen König«, murmelte Pwent.
»Ich bin nicht mehr dein König«, sagte Bruenor.
»Ja, das wird mir langsam klar«, fluchte Pwent und schlug Bruenor die Faust aufs Auge. Der Zwerg mit dem orangeroten Bart wankte rückwärts. Unter der Wucht des Schlags verlor er den Helm mit dem einen Horn und seine alte, schartige Axt.
Jetzt zog Pwent seinen Helm vom Kopf. Noch während er ihn beiseitewerfen wollte, ging Bruenor mit trommelnden Fäusten auf ihn los, so dass der Schlachtenwüter rücklings auf dem Boden landete. Wild aufeinander einprügelnd, rollten die Zwerge über die Lichtung.
»Darauf warte ich schon hundert Jahre!«, jaulte Pwent leicht erstickt, weil Bruenor ihm die Faust in den Mund rammte.
»Ja, und ich wollte dir endlich die Gelegenheit dazu geben!«, brüllte Bruenor, dessen Stimme am Ende mehrere Oktaven anstieg, weil Pwent fest zubiss.
»Drizzt!«, schrie Nanfoodle. »Tu doch was!«
»Nein, bloß nicht!«, rief Jessa, die vor Freude in die Hände klatschte.
Drizzts Gesicht verriet unmissverständlich, dass er keineswegs beabsichtigte, sich zwischen die wütenden Zwerge zu werfen. Er verschränkte die Arme vor der Brust, lehnte sich an einen hohen Stein und schien sich in erster Linie zu amüsieren.
Die strampelnden Zwerge wälzten sich weiter herum. Ihr Schwall von Flüchen wurde nur durch ein gelegentliches Grunzen unterbrochen, wenn der eine oder andere einen heftigen Treffer landete.
»Pah, du Sohn eines Orks!«, brüllte Bruenor.
»Pah, Hauptsache nicht dein stinkender Sohn, du verdammter Ork!«, brüllte Pwent zurück.
Rein zufällig rollten sie Jessa dabei so vor die Füße, dass sie im Aufblicken mitbekamen, wie grimmig die Ork-Priesterin ihren Schlagabtausch verfolgte.
»Äh … Goblin«, korrigierten sich beide einmütig, während sie Seite an Seite auf die Beine kamen. Beide bedachten Jessa mit einem halbherzigen, entschuldigenden Schulterzucken, ehe sie ihren Kampf wieder aufnahmen, um nach Herzenslust zu ringen und zu prügeln. Sie stolperten auf ein Stückchen Wiese oberhalb eines Steilufers, wo Bruenor die Oberhand gewann, indem er Pwent hinter dem Rücken den Arm verdrehte.
»Und ich habe die ganzen hundert Jahre darauf gewartet, dass du endlich ein Bad nimmst!«, rief Bruenor.
Mit Schwung schob er Pwent die Böschung hinunter, warf den Zwerg in den kalten, klaren Bergbach und sprang selbst hinterher.
Pwent sprang so entsetzt hoch, dass jeder Umstehende gemeint hätte, der arme Zwerg wäre mit dem Gesicht in einem Säurebad gelandet. Doch er blieb mitten im Bach stehen und schüttelte das Wasser von sich ab. Immerhin hatte Bruenor sein Ziel erreicht. Pwent war die Rauflust vergangen.
»Warum hast du das getan, mein König?«, flüsterte Pwent schließlich todunglücklich.
»Weil du stinkst und weil ich nicht mehr dein König bin«, erwiderte Bruenor, während er zum Ufer zurückwatete.
»Warum?«, fragte Pwent. In seiner Stimme schwang so viel Verwirrung und Schmerz mit, dass Bruenor im kalten Wasser stehen blieb und sich nach seinem treuen Schlachtenwüter umsah.
»Warum?«, wiederholte Thibbledorf Pwent.
Bruenor blickte zu den anderen drei auf – vier, wenn man Guenhwyvar mitzählte –, die von der Böschung aus auf die Zwerge herabsahen. Mit einem tiefen Seufzer streckte der »tote« König von Mithril-Halle seinem alten Schlachtenwüter die Hand hin.
»Es ging nicht anders«, erklärte Bruenor, als er mit Pwent das Steilufer erklomm. »Alles andere wäre Banak gegenüber unfair gewesen.«
»Banak musste nicht König werden«, widersprach Pwent.
»Ja, aber ich konnte nicht mehr König sein. Ich habe damit abgeschlossen, alter Freund.«
Dieses letzte Wort ließ beide innehalten, und als seine Bedeutung sich auf ihre starken Schultern senkte, stapften sie Arm in Arm das letzte Stück nach oben.
»Mein Hintern hat zu lange am Thron geklebt«, erläuterte Bruenor, während sie an den anderen vorbeiliefen und zu den Steinen zurückkehrten. »Ich weiß nicht, wie viele Jahre mir noch bleiben, aber ich suche immer noch nach ein paar Dingen, und die finde ich nicht in Mithril-Halle.«
»Dein Mädchen und den mickrigen Halbling?«, fragte Pwent.
»Ja, aber bring mich nicht zum Heulen«, warnte Bruenor. »Und so Moradin will, werde ich sie eines Tages wiedersehen, wenn nicht in diesem Leben, dann in seinen großen Hallen. Aber es gibt da noch etwas.«
»Was denn?«
Bruenor stemmte noch einmal die Hände in die Hüften und blickte über das weite Land im Westen, das nördlich von hohen Bergen und südlich von deren immer noch beeindruckenden Ausläufern eingerahmt wurde.
»Ich hoffe auf Gauntlgrym«, gestand Bruenor. »Aber letztlich geht es nur um die Straße und den Wind in meinem Gesicht.«
»Du gehst also fort? Du gehst für immer und kommst nie mehr zurück?«
»Das tue ich«, bekräftigte Bruenor. »Ich gehe fort und komme nicht zurück, niemals. Mithril-Halle gehört jetzt Banak, und das kann ich nicht rückgängig machen. Für meine Sippe – unsere Sippe – und in den Annalen aller Könige der Silbermarken wird es für immer heißen, dass König Bruenor Heldenhammer im Jahr der wahren Vorzeichen starb, am fünften Tag des sechsten Monats. So sei es!«
»Und du hast es mir nicht verraten«, stellte Pwent fest. »Du hast es dem Elf erzählt und dem Gnom und einer stinkenden Ork-Frau, aber nicht mir!«
»Ich habe es denen erzählt, die mich begleiten werden«, sagte Bruenor. »In Mithril-Halle weiß es nur Cordio, aber der hält dicht, darauf kann man sich verlassen.«
»Nur dem alten Pwent hast du nicht vertraut.«
»Du brauchtest es nicht zu wissen. Das war das Beste für dich.«
»Zu sehen, wie mein König, mein Freund, unter den Steinen verschwindet?«
Bruenor seufzte. Diesmal wusste er keine Antwort. »Nun, jetzt vertraue ich dir, denn du lässt mir keine andere Wahl. Du dienst jetzt Banak, aber dir sollte klar sein, dass du niemandem in Mithril-Halle einen Gefallen tust, wenn du es ihm erzählst.«
Bei Bruenors letzten Worten schüttelte Pwent nachdrücklich den Kopf. »Ich habe König Bruenor gedient, meinem Freund Bruenor«, sagte er. »Mein Leben für meinen König und für meinen Freund.«
Diesem Schwur wusste Bruenor nichts entgegenzusetzen. Er schaute Drizzt an, der nur lächelnd die Schultern hob, dann Nanfoodle, der eifrig nickte, und schließlich Jessa, die erklärte: »Nur wenn ihr mir hin und wieder eine anständige Rauferei versprecht. Ich liebe es, wenn Zwerge einander den Bierdunst aus den Knochen prügeln.«
»Pah!«, schnaubte Bruenor.
»Und wohin jetzt, mein Kö…, mein Freund?«, fragte Pwent.
»Nach Westen«, sagte Bruenor. »Ganz nach Westen. Für immer nach Westen.«
Teil 1
Weckruf an einen erbosten Gott
Es wird Zeit, das Wasser der Vergangenheit an ferne Küsten fluten zu lassen. Obwohl jene Freunde unvergesslich bleiben, dürfen sie nicht mehr Tag und Nacht durch meine Gedanken spuken. Sie werden da sein. Dieses Wissen tröstet mich. Sie werden mir zulächeln, wenn ich Ermunterung brauche, den Schlachtruf ausstoßen, wenn ein Kampf bevorsteht, mir meine Torheit vorhalten, wenn ich für das Offensichtliche blind bin, und immer bereitstehen, um mir ein Lächeln zu entlocken und mir das Herz zu wärmen.
Aber ich fürchte, sie werden auch immer da sein, um mich an den Schmerz, die Ungerechtigkeit und die hartherzigen Götter zu erinnern, die mir meine Liebe genau zu dem Zeitpunkt entrissen, als ich endlich meinen Frieden gefunden hatte. Das werde ich ihnen nie verzeihen.
»Lebe dein Leben in einzelnen Abschnitten«, riet mir einst eine weise Elfe, denn für so langlebige Geschöpfe wie uns, die das Dämmern und Vergehen der Jahrhunderte miterleben können, wäre es wahrlich ein Fluch, das absehbare Altern mit all seiner verheerenden Wirkung und den unausweichlichen Tod auszublenden.
Und so erhebe ich nach über vierzig Jahren mein Glas auf die, die mir vorangegangen sind: auf Deudermont, auf Cadderly, auf Regis, vielleicht auf Wulfgar, dessen Schicksal ich nicht kenne, und insbesondere auf Catti-brie, meine Liebe, mein Leben – nein, die Liebe dieses einen Lebensabschnitts.
Die Umstände, das Schicksal, die Götter …
Das werde ich ihnen nie verzeihen.
Auch wenn diese Worte so selbstsicher von meiner Freiheit künden, zittert meine Hand beim Schreiben. Seit der Katastrophe durch den König der Geister, dem Einsturz der Schwebenden Seele und dem To…, nein, dem Verlust von Catti-brie, sind so viele Jahre vergangen. Doch an jenem schrecklichen Morgen schien es nur diesen einzigen Morgen zu geben, und während so viele Erinnerungen an mein Leben mit Catti-brie jetzt in so weite Ferne gerückt sind, fast als würde ich auf das Leben eines anderen Dunkelelfen zurückblicken, bleibt dieser Morgen, an dem die Seelen von meiner Liebsten und Regis auf einem Einhorn aus Mithril-Halle fortgetragen wurden, eine offene, blutende, brennende Wunde.
Aber damit ist jetzt Schluss.
Ich übergebe die Erinnerung nun den Gezeiten des Wassers und sehe mich nicht um, wenn es weicht.
Denn ich mache mich mit alten und neuen Freunden auf den Weg. Meine Säbel waren zu lange untätig, meine Stiefel und mein Mantel sind zu sauber. Guenhwyvar ist unruhig, und unruhig ist auch das Herz von Drizzt Do’Urden.
Bruenor behauptet, wir zögen nach Gauntlgrym, auch wenn ich nicht daran glaube. Aber das spielt keine Rolle, denn in Wahrheit will er sein Leben beschließen, und ich suche nach neuen Ufern – einem Neuanfang, fern der Bindungen der Vergangenheit. Einem neuen Lebensabschnitt.
Das ist es, was einen Elfen ausmacht.
Das ist es, was das Leben ausmacht, denn auch wenn dieser Entschluss für die langlebigen Völker am schmerzlichsten und notwendigsten ist, teilen selbst die kurzlebigen Menschen ihr Leben in Abschnitte ein, deren vorübergehende Natur sie jedoch selten erkennen. Jeder, dem ich begegnet bin, redet sich ein, sein gegenwärtiges Leben würde immer so weitergehen, Jahr für Jahr. Es ist so leicht, von den Erwartungen zu sprechen, was vielleicht in zehn Jahren sein wird, und davon überzeugt zu sein, dass die wichtigen Dinge im Leben so bleiben, wie sie sind, oder sich wie gewünscht verbessern werden.
»So wird mein Leben in einem Jahr aussehen!«
»So wird mein Leben in fünf Jahren aussehen!«
»So wird mein Leben in zehn Jahren aussehen!«
Wir alle reden uns sehr überzeugend solche Hoffnungen, Träume und Erwartungen ein, denn das Ziel erleichtert uns den Weg. Doch am Ende dieser Zeitspanne, ob nach einem, nach fünf, nach zehn oder fünfzig Jahren ist es der Weg, nicht das erreichte oder aus den Augen verlorene Ziel, der uns ausmacht. Der Weg ist unsere wahre Geschichte, nicht ob wir am Ende gesiegt haben oder gescheitert sind, und deshalb lautet die wichtigste Aussage meiner Erfahrung nach: »So ist mein Leben im Moment.«
Ich bin Drizzt Do’Urden, früher aus Mithril-Halle, noch früher der geprügelte Sohn einer Oberinmutter, Schützling eines unvergleichlichen Fechtmeisters, einst geliebter Ehemann und Freund eines Königs und anderer, nicht weniger wunderbarer und wichtiger Freunde. Das sind die Ströme meiner Erinnerung, die jetzt an ferne Küsten weiterfließen, denn ich fordere meinen Weg und mein Herz zurück.
Nur nicht mein Ziel, wie ich mit Überraschung feststelle, denn die Welt ist nicht mehr dieselbe. Die Wahrheiten von einst zählen nicht mehr, denn eine neue schreckliche Finsternis ist angebrochen, die jeden zum Narren erklärt, der sich anschickt, die Dinge zurechtzurücken.
Früher hätte ich Licht mitgeführt, um diese Finsternis zu durchbohren. Jetzt bringe ich meine zu lange unberührten Klingen, und ich heiße die Dunkelheit willkommen.
Nie wieder! Die offene Wunde des schlimmen Verlusts ist Vergangenheit!
Ich lüge.
Drizzt Do’Urden
1
Die Verdammte
Im Jahr der Wiederentdeckung (1451 DR)
Es war ein interessantes Gerät, das sie konstruiert hatte: eine Art kegelförmiger Fingerhut aus glattem Zedernholz, spitz zulaufend wie ein winziger Speer und passend für ihren Finger. Sie zog es über, drehte leicht an einem Knoten im Holz, und schon verwandelte sich der Fingerspeer auf magische Weise in einen zauberhaften Saphirring.
Das glitzernde Schmuckstück passte ausgezeichnet zu Dahlia Sin’felles eindrucksvoller Erscheinung. Der Kopf auf ihrem schlanken, geschmeidigen Elfenleib war bis auf eine einzige Strähne rabenschwarzer und leuchtend roter Locken kahl rasiert, und diese Strähne hing, zu einem schmalen Zopf geflochten, auf der rechten Seite ihres fein geschnittenen Gesichts bis in die Mulde ihres täuschend zarten Halses. Die langen Finger, an denen noch weitere Ringe steckten, wiesen perfekt gepflegte, weiß lackierte Nägel auf, die mit winzigen Diamanten besetzt waren. Ihre eisblauen Augen konnten das Herz eines Mannes mit nur einem Blick zu Eis erstarren oder dahinschmelzen lassen. Dahlia wirkte wie der Inbegriff des Adels von Tay, eine große Dame unter den Größten dieses Landes, eine Frau, bei deren Eintreten sich alle Köpfe vor Begehren, Ehrfurcht oder mörderischer Eifersucht der Tür zuwandten.
Sie trug sieben Diamanten im linken Ohr, einen für jeden Liebhaber, den sie umgebracht hatte, und zwei weitere, blitzende Knöpfchen im rechten Ohr für die Liebhaber, deren Tod noch bevorstand. Der Männermode jener Tage gemäß, die jedoch kaum eine Frau aus Tay nachahmte, hatte Dahlia ihren Kopf mit Färberwaid tätowiert. Die rechte Seite ihres nahezu haarlosen Schädels und Gesichts war mit blauen und lila Punkten verziert, deren berückendes Muster so meisterlich gestaltet war, dass es in den Augen des Betrachters immer wieder unterschiedlich wirkte. Wenn die Frau ihren Kopf anmutig nach links drehte, erinnerte sie an eine Gazelle, die durch das blaue Schilf schnellte. Fuhr sie erregt nach rechts, so schien eine große Katze zum Sprung anzusetzen. Blitzte jedoch in ihren blauen Augen die Lust auf, so konnte ihr Opfer, ob Mann oder Frau, sich leicht in den verwirrenden Mustern ihrer Farben verfangen, um womöglich für immer darin festzuhängen.
Dahlia trug ein scharlachrotes ärmelloses und rückenfreies Gewand mit tiefem Ausschnitt, in dem die weichen Rundungen ihrer Brüste einen auffälligen Kontrast zu dem klaren Saum des kostbaren Stoffes bildeten. Ihr Kleid war fast bodenlang, auf der rechten Seite jedoch sehr hoch geschlitzt, womit sie die Augen lüsterner Zuschauer, ob Männer oder Frauen, von ihren glitzernden, rot lackierten Zehennägeln über die feinen Riemen ihrer dunkelroten Sandalen die porzellanweiße Haut ihres wohlgeformten Beins fast bis zur Hüfte hinaufgleiten ließ. Dort wurde das Auge unwillkürlich zur Spitze des Ausschnitts gezogen und wanderte über das glänzende Ende des schwarz-roten Zopfes aufwärts, bis das ganze Bild von dem weiten, geöffneten Kragen abgerundet wurde, der ihren schlanken Hals hervorhob, auf dem ihr perfekt geformter Kopf saß wie ein frisches Blumengebinde in einer kunstvollen Vase.
Dahlia Sin’felle kannte die Macht ihrer Schönheit.
Ein Blick auf das Gesicht von Korvin Dor’crae, der gerade ihr Zimmer betrat, bestätigte ihre Selbsteinschätzung. Mit leuchtenden Augen kam er zu ihr und legte beide Arme um die Frau. Dor’crae war weder groß noch besonders muskulös, aber sein Griff wurde von seinem Begehren verstärkt, und er zog sie unsanft an sich, um ihr Gesicht mit Küssen zu bedecken.
»Du wirst zweifellos bald zufrieden sein, aber was ist mit mir?«, fragte sie mit unschuldiger Stimme, die ihren Sarkasmus nur noch betonte.
Dor’crae wich weit genug zurück, um ihr in die Augen sehen zu können, und lächelte so breit, dass seine Vampirzähne zum Vorschein kamen. »Ich dachte, du teilst meinen Genuss, Herrin«, sagte er und begann, sanft an ihrem Hals zu knabbern.
»Sachte, mein Guter«, flüsterte sie, bewegte sich dabei aber so herausfordernd, dass Dor’crae dazu ganz sicher nicht in der Lage war.
Ihre Finger umspielten sein Ohr und griffen in sein langes, dichtes schwarzes Haar. Immerhin hatte sie ihn die ganze Nacht hingehalten, und da der Sonnenaufgang nahte, blieb ihm in diesem Turm mit den vielen Fenstern nicht mehr viel Zeit. Er versuchte, sie zum Bett zu schieben, doch sie widerstand seinem Ansinnen, worauf er mehr Druck aufwandte und fester zubiss.
»Sachte«, flüsterte sie mit einem Kichern, das ihn noch leidenschaftlicher machte. »Sonst gehöre ich am Ende bald zu euch.«
»Dann kannst du ewig mit mir spielen«, erwiderte Dor’crae und wagte einen noch festeren Biss, bei dem seine Reißzähne Dahlias zarte Haut nun wirklich anritzten.
Die Elfe senkte die rechte Hand, fuhr mit dem Daumen über den Illusionsring an ihrem Zeigefinger und tippte auf den Stein. Dann ließ sie beide Hände auf Dor’craes Brust gleiten, löste die Lederbänder seines Hemds und zog den Stoff auseinander, damit ihre Finger über seine Haut fahren konnten. Stöhnend drängte er sich an sie und biss noch fester zu.
Dahlias rechte Hand betastete seine Brust, bis sie die Mulde darin fand, und bog den Zeigefinger zurück, als wäre er eine zum Biss bereite Schlange.
»Nimm deine Zähne weg«, warnte sie mit noch immer kehlig lockender Stimme.
Er stöhnte, und die Schlange biss zu.
Dor’crae holte tief Luft, obwohl er doch gar nicht atmete, ließ Dahlias Hals los und zuckte mit verzerrtem Gesicht zurück, als die Holzspitze in seinem Fleisch bis zum Herzen vordrang. Er wollte sich losreißen, aber Dahlia folgte seinen Bewegungen und hielt gerade so viel Druck aufrecht, um Todesqualen auszulösen, ohne den Vampir dabei umzubringen.
»Warum muss ich dich so quälen, Liebster?«, gurrte sie. »Was habe ich getan, dass du mich derart beglücken willst?« Bei diesen Worten drehte sie die Hand ein klein wenig, und der Vampir schien vor ihr zu schrumpfen, denn seine Knie gaben nach.
»Dahlia!«, brachte er stammelnd heraus.
»Es ist ein Zehntag verstrichen, seit ich dir deine Aufgabe gestellt habe«, erwiderte sie.
Entsetzt riss Dor’crae die Augen auf. »Ein Todesring«, rief er. »Szass Tam will ihn ausweiten.«
»Das weiß ich bereits.«
»Auf neue Gegenden!«
Verärgert drehte Dahlia die feine Spitze. Dor’crae fiel auf ein Knie.
»Die Shadovar haben sich im Niewinterwald südlich der Stadt Niewinter festgesetzt«, ächzte der Vampir. »Sie haben die Paladine aus Helmsheim vertrieben und ziehen nun ungehindert durch den Wald.«
»Sag bloß«, entgegnete Dahlia sarkastisch. Auch das war allgemein bekannt.
»Es gibt Gerüchte … vom Hauptturm … Zauberrunen und ungezügelte Energie …«
Diesmal neigte Dahlia ihren hübschen Kopf zur Seite und zog den bohrenden Finger ein wenig zurück.
»Die ganze Geschichte kenne ich noch nicht«, sagte der Vampir, dem das Sprechen nun leichter fiel. »Nicht einmal die ältesten Elfen erinnern sich an die Geheimnisse aus einer Zeit lange vor der Erbauung des Hauptturms des Arkanums in Luskan. Es gibt …« Keuchend brach er ab, weil Dahlias Holzspitze wieder tiefer drang.
»Zur Sache, Vampir. Ich habe nicht ewig Zeit.« Sie warf ihm einen warnenden Blick zu. »Und wenn du mir noch einmal die Ewigkeit anbietest, verhelfe ich deiner Existenz zu einem abrupten Ende.«
»Seit dem Einsturz des Hauptturms ist die Magie dort instabil«, stieß Dor’crae hervor. »Es wäre möglich, dass wir ein Blutbad anrichten könnten, das ausreichen würde, um …«
Wieder brachte ihn die Frau zum Schweigen, nachdem sie ihm diese Worte entrissen hatte. Luskan, Niewinter, die Schwertküste. Die Bedeutung dieser Region war Dahlia durchaus bewusst. Allerdings weckte ihre Erwähnung alte Erinnerungen aus ihrer Kindheit, die sie tief in sich verborgen hatte, weil sie die Elfe unablässig an das Elend ihrer Welt erinnerten.
Sie schüttelte die grausamen Bilder ab – mit einem gefährlichen Vampir in Armeslänge Abstand kamen sie zur Unzeit.
»Was noch?«, wollte sie wissen.
Auf dem Gesicht des Vampirs zeichnete sich Panik ab. Offenbar hatte er nichts Wichtiges mehr zu sagen und rechnete damit, dass die gnadenlose Elfe ihm nun den Garaus machen würde.
Aber Dahlia hatte angebissen. Deshalb zog sie die Hand so plötzlich zurück, dass Dor’crae auf allen vieren landete und in stummem Dank die Augen schloss.
»Ich kann dich jederzeit töten, wann immer du dich mir näherst«, betonte die Frau. »Wenn du das noch einmal vergisst und versuchst, mich zum Vampir zu machen, werde ich dich mit Vergnügen vollständig vernichten.«
Dor’crae blickte auf. Seine Miene verriet, dass er ihr jedes Wort glaubte.
»Und jetzt liebe mich, und zwar ordentlich. Um deinetwillen«, verlangte die Elfe.
Es war ein lustiger Ausflug gewesen. Die Kaulquappen waren gerade frisch geschlüpft, und das zwölfjährige Elfenmädchen hatte sich stundenlang damit vergnügt, ihr Gewimmel am Bachufer zu beobachten. Ihre Mutter hatte sie Wasser holen geschickt, aber betont, dass es nicht eilig war. Ihr Vater war sowieso den ganzen Tag auf der Jagd, und das Wasser wurde erst abends benötigt.
Dahlia stieg die Böschung hoch. Sie sah den Rauch, hörte die Schreie und wusste, dass das Verhängnis gekommen war.





























