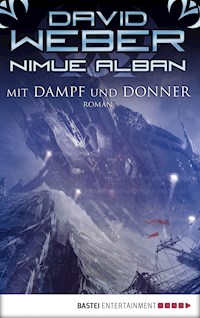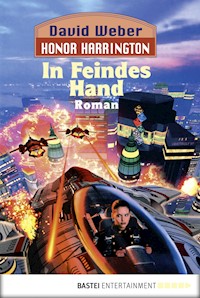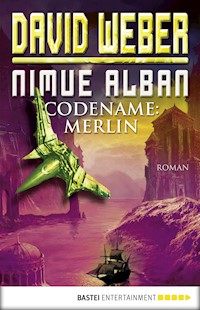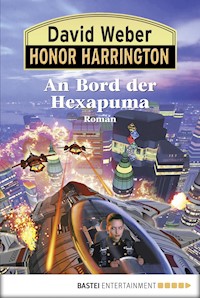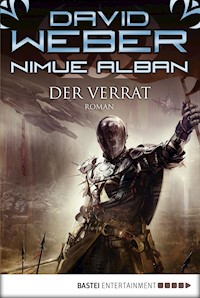
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nimue-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die ehemalige Offizierin Nimue Alban lebt 800 Jahre nach ihrem Tod in einem künstlichen Körper weiter - als Mann. Nimue Albans Geist wurde in den Körper eines Cyborgs verpflanzt. Das war lange bevor die Menschen vor einer außerirdischen Spezies fliehen mussten, um der Auslöschung zu entgehen. Die Menschheit begann daraufhin ein neues Leben auf einer fernen Welt.
Der Kampf gegen die Diktatur geht in die zehnte Runde
Doch die Menschen leben seitdem in einer Diktatur. Im Kaiserreich Charis schrecken die Herrscher vor nichts zurück, um ihre Macht zu erhalten, auch vor der Folterung von Kriegsgefangenen und dem Entsenden von Selbstmordattentätern nicht. Im zehnten Band der Reihe von David Weber stellt sich ihnen Nimue Alban erneut entgegen - ihre Mission: die Rettung der Menschheit. "Der Verrat" wurde von Ulf Ritgen ins Deutsche übersetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
DAVID WEBER
NIMUE ALBAN:DERVERRAT
Aus dem Amerikanischen vonDr. Ulf Ritgen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by David Weber
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»How firm a foundation« (Teil 2)
Originalverlag: Baen Books, Wake Forest
This work was negotiated through
Literary Agency Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen,
on behalf of St. Martin’s Press, L.L.C.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2013/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: Arndt Drechsler, Regensburg
Textredaktion: Beke Ritgen
Lektorat: Ruggero Leò
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN: 978-3-8387-1939-9
Sie finden uns im Internet unterwww.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
In Liebe Alice G. Weber gewidmet.He, Mom, schau! Ich hab’s geschafft!
Juli,im Jahr Gottes 895
.I.
Hospiz der Heiligen Bédardund der Tempel, Stadt Zion,die Tempel-Lande
»Langhorne segne Euch, Euer Exzellenz! Langhorne segne Euch!«
»Danke, Pater«, erwiderte Rhobair Duchairn. »Auch wenn ich Ihr Lob gern höre, haben Sie in all das mehr harte Arbeit gesteckt als ich. Und das«, das Lächeln des Vikars war ein wenig bitter, »auch noch viel länger als ich.«
Er legte Pater Zytan Kwill eine Hand auf die gebrechliche Schulter. Der Oberpriester des Bédard-Ordens war schon hoch in den Achtzigern und wurde Jahr um Jahr gebrechlicher. Dennoch brannte in ihm eine Leidenschaft, um die ihn Duchairn beneidete.
»Das mag wohl sein, Euer Exzellenz«, erwiderte Kwill, »aber in diesem Winter …« Er schüttelte den Kopf. »Ist Euch bewusst, dass wir in diesem Winter nur dreißig Tote zu beklagen hatten – ganz egal, woran sie nun eigentlich gestorben sind? Nur dreißig!«
»Ich weiß.« Duchairn nickte. Dabei wusste er genau, dass insgesamt deutlich mehr als dreißig Einwohner von Zion den vergangenen Winter nicht überstanden hatten. Und doch hatte Kwill nicht ganz unrecht. Es lag in der Verantwortung des Bédard- und des Pasquale-Ordens, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen. Gewiss, eigentlich war dies eine Aufgabe von Mutter Kirche an sich. Doch schon seit Jahrhunderten kümmerten sich vor allem die Bédardisten und die Pasqualaten darum. Gemeinsam sorgten sie für Suppenküchen und Notunterkünfte. Aus den Reihen der Pasqualaten kamen darüber hinaus die Heiler. Deren Aufgabe war es, auch den schwächsten Kindern Gottes genug medizinische Versorgung zukommen zu lassen, um die eisige Kälte in Zion zu überstehen.
Nur hatten Bédardisten und Pasqualaten genau das über einen langen Zeitraum hinweg eben nicht getan.
Duchairn blickte aus dem Fenster von Kwills auffallend bescheiden eingerichtetem Arbeitszimmer. Das Hospiz der Heiligen Bédard befand sich in einem von Zions älteren Gebäuden. Vom Arbeitszimmer des Paters aus hatte man einen herrlichen Blick über die blauen Wellen des Pei-Sees. Doch das Zimmer selbst war so karg und spärlich eingerichtet wie die Zellen der Asketen in den Klöstern, deren Brüder und Schwestern sich vor allem in Meditation übten. Zweifellos ließ die Einrichtung des Zimmers Rückschlüsse auf Pater Zytans Persönlichkeit zu. Aber es war auch Zeichen dafür, dass der Pater in den letzten siebenundvierzig Jahren mit jeder Mark, die er in die Finger bekommen hatte, die Bedürftigkeit seiner Schäfchen zu lindern gesucht hatte. Niemals wäre ein Mann wie er auf die Idee gekommen, auch nur einen winzigen Teil dieses Geldes für sich selbst zu verwenden.
Und in all der Zeit hat Mutter Kirche ihm nie in dem Maße geholfen, wie es bitter nötig gewesen wäre, dachte der Schatzmeister bitter. Nicht ein einziges Mal! Nicht ein einziges Mal haben wir ihn und all die anderen in dem Maße finanziell unterstützt, wie es unsere Pflicht gewesen wäre!
Der Vikar trat an das Fenster und verschränkte die Hände hinter dem Rücken. Er betrachtete das Meer aus Blüten und Grün, das über die Hügel zwischen Zion und dem See wogte. Eine kühle Brise wehte durch das Fenster herein, strich Duchairn sanft über die Wangen. Die warmen Sonnenstrahlen ließen auf den funkelnden Wellen des Sees die Segel von kleinen Booten aufblitzen, von Leichtern und von größeren Handelsschiffen. Weiter vom Ufer entfernt erkannte Duchairn Fischerboote, und über den Himmel zogen wunderschöne Wolkenberge hinweg. An einem solchen Tag konnte selbst der Schatzmeister, der die letzten dreißig Jahre seines Lebens in Zion verbracht hatte, die harten, rauen Winter hier im Norden von Haven vergessen. Er konnte vergessen, wie sich dann über den See eine blaugraue Eisfläche legte, dick genug, um Eissegler von der Größe einer Galeone zu tragen. Duchairn konnte vergessen, dass die Schneeverwehungen in den Straßen der Stadt übermannshoch werden konnten, manche in den Außenbezirken der Stadt zwei oder sogar drei Stockwerke hoch.
Und für uns, die wir den Winter im Tempel verbringen, ist es leicht, all diese Unannehmlichkeiten zu vergessen, gestand er sich selbst ein. Wir brauchen uns darum ja nicht zu scheren, nicht wahr? Wir haben unsere eigene kleine Enklave, von Gott selbst gesegnet. Aus dieser Enklave wagen wir uns nicht heraus … außer vielleicht an den milderen Tagen ohne heulende Schneestürme, die uns um unsere ach so heiligen Ohren pfeifen.
Duchairn wollte gern glauben, dies sei der wahre Grund für seine jahrzehntelange Untätigkeit. Er wollte so gern glauben dürfen, seine zahllosen Pflichten hätten ihn viel zu beschäftigt gehalten. Er wollte glauben dürfen, Pflichteifer habe ihn vergessen lassen, aus dem Fenster zu blicken und zu sehen, was in Wahrheit all jenen widerfuhr, die sich außerhalb des Tempels aufhielten, außerhalb dieses Ortes mit seinen auf geheimnisvolle Weise wohl temperierten Räumlichkeiten. Oh, wie sehr Duchairn sich wünschte, das glauben zu dürfen!
Oh ja, beschäftigt warst du, Rhobair!, dachte er. Er sog die kühle Luft ein, genoss den Duft der Blüten unter Pater Zytans Fenster. Du warst beschäftigt mit gutem Wein, der Feinschmeckerküche des Tempels, bezaubernder weiblicher Gesellschaft und all der Mühe, die es macht, Münzen zu zählen und deine Bündnisse innerhalb des Vikariats zu pflegen. Zu schade, dass du nicht über die wahren Lehren der Erzengel nachgedacht hast, darüber, was die wahren Aufgaben und Pflichten eines jeden Priesters sind! Hättest du das getan, dann hätte Pater Zytan das notwendige Geld und die erforderliche Unterstützung erhalten, um genau diese Aufgaben und Pflichten auch zu erfüllen!
»Ich bin überglücklich, dass wir nur so wenige verloren haben … in diesem Winter, Pater«, sagte Duchairn, ohne sich vom Fenster abzuwenden. »Ich bedauere nur zutiefst, dass wir im letzten Winter so viele Verluste zu beklagen hatten, und ebenso im Winter davor.«
Kwill blickte auf den Rücken des Vikars. Der Pater fragte sich, ob Duchairn wusste, wie viel Schmerz in seiner Stimme mitschwang. Wie ein schwerer Anker schien dieser Schmerz jedes einzelne seiner Worte in die Tiefe zu ziehen. Wie die meisten Diener von Mutter Kirche, die Verwaltungsaufgaben wahrnahmen, gehörte der Vikar dem Chihiro-Orden an. Somit fehlte ihm die Ausbildung, Gefühle und andere emotionale Prozesse zu begreifen. Bei Kwill war das anders. Denn sein Orden lehrte genau diese Dinge. Es war durchaus möglich, dass der Vikar sich seiner eigenen Gefühle nicht bewusst war – und auch, dass sein Tonfall sie so deutlich verriet.
Er schien nicht zu bemerken, wie gefährlich ihm diese Gefühle unter den gegebenen Umständen werden konnten.
»Euer Exzellenz«, sagte der Oberpriester, »ich habe deutlich mehr als die Hälfte meines Lebens damit verbracht, jeden Frühling aufs Neue genau diese Dinge zu bedauern.« Duchairn wandte sich zu ihm um, und Kwill lächelte ihn traurig an. »Eigentlich müsste ich mich also an dieses Gefühl des Versagens gewöhnt haben. Aber jede Leiche, die wir im Schnee finden, jedes Kind, das zur Waise wird, jede einzelne Seele, die wir nicht irgendwo im Hospiz oder in einer der anderen Notunterkünfte unterbringen können, wenn die Temperatur fällt und der Wind über den See heult … jeder einzelne dieser Todesfälle reißt ein winziges Stück meiner Seele mit sich. Ich habe nie gelernt, das einfach hinzunehmen. Aber ich habe lernen müssen, damit zurechtzukommen. Mir selbst zu sagen, dass ich wahrhaftig alles in meiner Macht Stehende getan habe, um die Anzahl von Todesfällen im Winter zu verringern. Mich selbst von der Schuld an eben diesen Todesfällen freizusprechen. Es ist nicht leicht, das zu tun. Wie viel ich auch getan haben mag, ich war und bin stets davon überzeugt, dass ich noch mehr hätte tun können – dass ich noch mehr hätte tun müssen. Hier …«, er tippte sich gegen die Schläfe, »weiß ich ganz genau, dass ich wirklich alles getan habe, was ich konnte. Aber es fällt mir schwer, das auch hier zu akzeptieren.«
Er legte eine Hand an die Brust, und sein trauriges Lächeln verlor den bitteren Beigeschmack.
»Ich habe darin deutlich mehr Übung als Ihr, Euer Exzellenz. Das liegt sicherlich daran, dass ich beinahe fünfunddreißig Jahre älter bin als Ihr. Die meisten hier in Zion, sogar in meinem eigenen Orden, sind fest davon überzeugt, ich hätte diese Aufgabe schon seit dem Tag der Schöpfung erfüllt. Aber in Wirklichkeit war ich schon weit über vierzig, bevor mir überhaupt der Gedanke gekommen ist, genau das solle mein Lebenswerk sein. Gott habe das für mich vorgesehen.« Kwill schüttelte den Kopf. »Bitte glaubt nicht, all die Jahre, die ich verschwendet habe, bevor ich Seine Stimme hörte, würden mich nicht in jedem Winter aufs Neue heimsuchen und plagen! Immer und immer wieder werde ich daran erinnert, wie viele Winter ich untätig habe verstreichen lassen. Mir ist bewusst, dass viele mich für einen Ausbund an Heiligkeit halten – zumindest diejenigen, die in mir nicht nur einen alten, störrischen Spinner sehen! Aber ich war ein deutlich weniger gelehriger Schüler, als jene Menschen denken. Eines Tages aber vernehmen wir Seine Stimme. Und es obliegt alleine Ihm, über uns zu urteilen. Anderen Menschen steht dies nicht zu. Schließlich ist unser eigenes Urteilsvermögen höchst unzuverlässig. Vor allem, wenn es um unser eigenes Handeln geht.«
Lange Zeit schwieg Duchairn. »Damit haben Sie wahrscheinlich recht, Pater«, sagte er schließlich. »Aber wenn nicht einmal wir selbst uns Rechenschaft ablegen, dann missachten wir nicht nur unsere Pflichten, sondern auch uns selbst. Ich habe festgestellt, dass Schuld äußerst bitter schmeckt. Aber nimmt man das nicht einmal mehr wahr, dann ist es nur zu leicht, sich völlig zu verlieren.«
»Natürlich, Euer Exzellenz«, bestätigte Kwill schlicht. »Aber wenn Gott willens ist, uns zu vergeben, wenn wir unsere Fehler erkennen und aufrichtig versuchen, unser Leben zu ändern, warum sollten wir selbst dann nicht das Gleiche tun?«
»Sie sind wirklich aus tiefstem Herzen Bédardist, nicht wahr, Pater?« Duchairn schüttelte den Kopf und verzog die Lippen zu einem schiefen Grinsen. »Und ich werde mich bemühen, Ihren Ratschlag im Hinterkopf zu behalten. Aber die Heilige Schrift lehrt: Wir sollen nach Kräften Wiedergutmachung bei jenen leisten, denen wir, wie uns selbst bewusst geworden ist, Unrecht getan haben. Es wird wohl leider eine Weile dauern, bis ich das schaffe.«
Nun gesellte sich Kwill zu dem jüngeren Vikar ans Fenster. Doch der Oberpriester blickte nicht auf den See hinaus. Stattdessen musterte er mehrere Sekunden lang den Schatzmeister und blickte ihm dabei direkt in die Augen. Dann legte er Duchairn eine von einem langen Leben ausgezehrte Hand auf die Brust.
»Ich glaube, Euer Exzellenz, Eurem Herzen geht es ungleich besser, als Euch bewusst ist. Und es ist viel größer, als Ihr annehmt«, sagte er leise. »Aber seid vorsichtig! Selbst das größte Herz vermag in dieser Welt nichts mehr zu bewirken, wenn es aufhört zu schlagen.«
Kurz legte Duchairn die eigene Hand auf die des Priesters und neigte den Kopf. Es mochte Zustimmung sein oder nur eine Geste der Bestätigung. Dann atmete er tief durch und trat einen Schritt zurück.
»Wie stets, Pater Zytan, war es mir zugleich eine Freude und eine Ehre«, sagte er deutlich forscher. »Ihren Bericht finde ich sehr erfreulich, vor allem, da es mir endlich gelungen ist, neue Gelder aufzutreiben. Für den kommenden Winter können wir weitere Notunterkünfte ankaufen oder bauen. Je nachdem, wo wir sie brauchen, wäre es wahrscheinlich billiger, bereits bestehende Gebäude zu übernehmen und für unsere Zwecke umzubauen. Sollten wir hingegen genötigt sein zu bauen, wäre es gewiss ratsam, so rasch wie möglich damit anzufangen. Also überlegen Sie bitte, wo neue Unterkünfte am nötigsten gebraucht werden! Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir innerhalb der nächsten Fünftage Ihre Empfehlungen für drei oder vier neue Unterkünfte vorlegen könnten.«
»Selbstverständlich, Euer Exzellenz. Und ich danke Euch.« Kwill strahlte über das ganze Gesicht. »Wenn der Schnee kommt, können wir neue Dächer immer gut gebrauchen.«
»Ich werde mein Bestes tun, Pater. Ebenso, wie ich mein Bestes tun werde, Ihren Ratschlag zu beherzigen.« Duchairn streckte dem Oberpriester die Hand mit dem schweren Ring entgegen. Kwill verbeugte sich, um einen Kuss auf das Zeichen der bischöflichen Würde zu hauchen. Als er sich wieder aufrichtete, verabschiedete sich Duchairn: »Dann bis zum nächsten Mal, Pater.«
»Möge die Heilige Bédard Euch segnen und beschützen, Euer Exzellenz!«, erwiderte Kwill leise.
Duchairn nickte und verließ das kleine Arbeitszimmer. Natürlich wartete vor der Tür seine Eskorte der Tempelgarde. Nicht einmal für seine Besprechungen mit Pater Zytan ließen diese Männer ihn gern aus den Augen. Und all ihrer Disziplin zum Trotz war dies ihren Gesichtern auch deutlich anzusehen.
Natürlich gibt es mehr als einen Grund dafür, dass es ihnen nicht passt, wenn ich weiß Langhorne was treibe, dachte Duchairn in verbitterter Belustigung.
»Wohin nun, Euer Exzellenz?«, erkundigte sich der wachhabende Offizier seiner persönlichen Leibwache höflich.
»Zurück zum Tempel, Major Phandys«, antwortete Duchairn dem Mann, den Zhaspahr Clyntahn und Allayn Maigwair persönlich als seinen Hüter ausgewählt hatten. Ihre Blicke trafen sich, und der Vikar lächelte dünn. »Zurück zum Tempel«, wiederholte er.
»Major Phandys ist hier, Eure Eminenz.«
»Danke, Pater. Ich lasse bitten.«
»Sehr wohl, Eure Eminenz.«
Der Sekretär deutete eine Verneigung an und zog sich dann zurück. Kurz darauf betrat Major Khanstahnzo Phandys das erzbischöfliche Arbeitszimmer. Er ging auf Wyllym Rayno zu und beugte sich über die ihm entgegengestreckte Hand, um den bischöflichen Ring zu küssen.
»Sie haben mich rufen lassen, Eure Eminenz?«, fragte der Major gleich darauf.
Eigentlich hätte er als Angehöriger der Tempelgarde salutieren müssen, statt Raynos Ring zu küssen. Doch seit dem verpfuschten Versuch, die Brüder Wylsynn festzunehmen, war Major Phandys kein einfacher Tempelgardist mehr. Es war absolut nicht seine Schuld gewesen, dass diese Festnahme so gründlich schiefgelaufen war. Die Inquisition aber hatte schon immer ein gutes Auge dafür, wer hinreichend Talent für weitergehende Aufgaben besaß, ohne sich offiziell dem Schueler-Orden anschließen zu müssen.
»Ja, das stimmt, Major.« Rayno setzte sich wieder an seinen Schreibtisch, kippte seinen Sessel ein wenig zurück und blickte Phandys nachdenklich an. »Ich habe Ihren jüngsten Bericht gelesen. Wie stets, war er vollständig, knapp und präzise. Ich wünschte wirklich, es würden mehr derartige Berichte auf meinem Schreibtisch landen.«
»Ich danke Euch, Eure Eminenz«, erwiderte Phandys leise, als der Erzbischof nicht weitersprach und ganz offenkundig eine Art Erwiderung erwartete. »Ich mühe mich redlich, Mutter Kirche – und der Inquisition – nach Kräften zu Diensten zu sein.«
»Das stimmt zweifellos, Major.« Raynos Lächeln fiel ungewohnt warmherzig aus. »Ich habe sogar schon darüber nachgedacht, wie sich ein Mann mit Ihren Fähigkeiten und Ihrer Frömmigkeit deutlich besser einsetzen ließe.«
»Ich bin stets bereit, Mutter Kirche in der Weise zu dienen, die ihr am nützlichsten ist, Eure Eminenz«, erwiderte Phandys. »Habt Ihr schon jemanden im Blick, der meine derzeitigen Pflichten übernehmen könnte?«
»Nein, eigentlich nicht.« Raynos Lächeln verschwand. »Nein, leider nicht, Major. Das ist einer der Gründe, warum ich Sie zu mir gebeten habe. Wüssten Sie jemanden aus der Garde zu nennen, der Ihnen dafür geeignet erschiene?«
Mehrere Sekunden lang dachte Phandys angestrengt nach. Die Stirn hatte er in Falten gelegt, die Hände respektvoll hinter dem Rücken verschränkt.
»Aus dem Stehgreif leider nicht, Eure Eminenz.« Bedauernd schüttelte er den Kopf. »Mir fallen gleich mehrere Männer ein, die mir aufgrund ihrer Treue und ihrer Hingabe für diese Aufgabe geeignet erscheinen. Aber keiner davon bekleidet einen hinreichend hohen Rang, um als Vikar Rhobairs wachhabender Gardist zu fungieren. Und bei denjenigen, die den richtigen Rang haben, gibt es leider … doch gewisse Vorbehalte, was deren Eignung betrifft. Vielleicht sind da ein paar, die tatsächlich erfahren genug wären. Aber keiner dieser Männer könnte zum Schutz des Vikars abgestellt werden, ohne dass zuvor einige andere Versetzungen erforderlich wären. Ich kann Euch natürlich gern Namen nennen, Eure Eminenz. Aber ich möchte Euch doch dringend nahe legen, die betreffenden Personen zu einem persönlichen Gespräch zu bitten. Erst danach solltet Ihr in Erwägung ziehen, ihnen meine derzeitige Aufgabe zu übertragen.«
»Bitte begründen Sie das!« Rayno klang aufrichtig neugierig. Phandys zuckte mit den Schultern.
»Ich scheue mich, Euch jemanden für diese Aufgabe zu empfehlen, den ich nicht persönlich kenne – geschweige denn hinreichend gut, Eure Eminenz. Aber wahrscheinlich kennt niemand jemand anderen so gut, wie man das gemeinhin annimmt. Da ich die meisten besagter Personen als Freunde bezeichnen würde oder zumindest als gute Bekannte, bin ich mir nicht sicher, ob mein eigenes Urteilsvermögen hier nicht getrübt sein könnte. Es wäre mir einfach lieber, wenn jemand, der das Ganze mit einem gewissen … Abstand betrachten kann, über ihre Eignung entscheiden würde.«
»Ich verstehe.«
Einen Moment lang dachte Rayno nach. Sogar einen recht langen Moment. Richtig, die Inquisition hatte stets Bedarf nach talentierten, fähigen Männern – und in jüngster Zeit traf das sogar ganz besonders zu. Phandys war schon jetzt recht jung für den Rang, den er bekleidete. Doch Rayno hätte ihn mit Leichtigkeit zum Colonel oder sogar zum Brigadier befördern können. Es war eine schwierige Entscheidung, ein Balanceakt in gewisser Weise. Ein höherer Dienstgrad würde Phandys natürlich deutlich mehr Autorität einbringen. Jedoch fiele er damit unter seinesgleichen noch mehr auf als ohnehin schon. Bedauerlicherweise stimmte es: Bei Offizieren, die im Dienste der Inquisition zu stehen schienen, verspürten Kameraden weniger Neigung, ihm noch zu vertrauen. Abgesehen davon …
»Bitte legen Sie mir eine Liste der Männer vor, die Sie für diese Aufgabe vorschlagen würden, Major!«, sagte Rayno schließlich. »Auch wenn Sie Ihren bisherigen Posten weiterhin bekleiden sollten, kann es doch nie schaden, wenn die Inquisition weitere pflichtbewusste Söhne von Mutter Kirche zu finden weiß. Es kann ja immer sein, dass man sie plötzlich dringend benötigt.«
»Selbstverständlich, Eure Eminenz.« Phandys deutete eine Verneigung an. »Ich könnte Euch die Liste morgen Nachmittag vorlegen. Wäre das rechtzeitig genug?«
»Aber gewiss doch, Major«, erwiderte Rayno und bedeutete Phandys mit einer Handbewegung, sich zurückzuziehen.
»Und?«, fragte Zhaspahr Clyntahn, als Wyllym Rayno sein Arbeitszimmer betrat. »Was hat unser lieber Freund Rhobair denn in letzter Zeit so getrieben?«
»Laut sämtlichen meiner Informanten, Euer Exzellenz, hat er genau das getan, was zu tun er angekündigt hat. Gestern hat er erneut Pater Zytan aufgesucht und für den nächsten Fünftag eine Besprechung mit den leitenden Pasqualaten aller fünf großen Krankenhäuser anberaumt. Dabei will er schon im Vorfeld koordinieren, welche Heiler im kommenden Winter für seine Notunterkünfte und Suppenküchen zur Verfügung stehen.«
Clyntahn verdrehte die Augen. Er hatte nichts gegen ein akzeptables, vernünftiges Maß an karitativer Arbeit. Aber Vikare von Mutter Kirche sollten sich doch nicht dadurch von ihren eigentlichen Pflichten abbringen lassen! Gerade in Zeiten wie diesen musste es für den obersten Finanzverwalter Dutzende anderer Dinge geben, die seine kostbare Zeit ungleich mehr in Anspruch nehmen sollten als ein Winter, der noch Monate auf sich warten ließe!
Der Großinquisitor lehnte sich in seinem Sessel zurück und trommelte verstimmt mit den Fingerspitzen der rechten Hand auf die Schreibtischplatte. Duchairns übertriebene Frömmigkeit ärgerte ihn zunehmend. Doch es half nichts: Potenzielle Gegner der ›Vierer-Gruppe‹ durften nicht einmal vermuten, es gebe in den Reihen der obersten Vikare Unstimmigkeiten. Das war allerdings ein Argument, das zunehmend an Schlagkraft verlor. Schließlich zeigte das Exempel allmählich Wirkung, das der Großinquisitor an den Mitglieder von Wylsynns reformistisch eingestelltem Kreis statuiert hatte. So gern Clyntahn Duchairn losgeworden wäre, er würde sich danach mit jemand anderem herumplagen müssen, der die Aufgaben des Schatzmeisters übernähme. Und besser als Duchairn vermochte diese Aufgabe nun einmal niemand zu erfüllen. Das galt besonders angesichts der derzeitigen, angespannten finanziellen Lage von Mutter Kirche.
Angewidert oder nicht, Clyntahn würde die weichherzige, geistlose Frömmelei dieses Mannes ertragen müssen. Das steigerte den Ärger des Großinquisitors über den Grund dafür – besagte finanzielle Lage der Kirche – noch mehr. Trotz der angespannten Lage gab dieser Idiot von Schatzmeister, wie besessen von der Idee, ›für die Armen zu sorgen‹, das Geld auch noch mit vollen Händen aus! Aber Clyntahn sagte sich, da er keine andere Wahl habe, sollte er das Ganze möglichst positiv sehen. Alle Berichte, die Clyntahn von seinen Agenten erhielt, bestätigten es: Durch Duchairns Forderung, die ›Vierer-Gruppe‹ müsse auch ihre ›sanftmütigere, gütige Seite‹ zeigen, wurde die Moral der Bevölkerung hier in Zion tatsächlich gestärkt. Es war eine erkaufte und damit vergängliche Loyalität. Sie war viel weniger zuverlässig als der sofortige Gehorsam, den die Disziplin der Inquisition jedem Einzelnen einimpfte. Kurzfristig aber war es tatsächlich von Nutzen.
»Was ist mit Phandys?«, fragte Clyntahn. Rayno dachte sehr gründlich nach, bevor er antwortete.
Der Major gehörte mittlerweile unverkennbar zu den Lieblingen Zhaspahr Clyntahns. Das war nicht zu erwarten gewesen. Schließlich hatte der Tempelgardist unfreiwillig dafür gesorgt, dass man an einem dem Großinquisitor besonders wichtigen Gefangenen nicht die verdiente Strafe hatte vollziehen können. Doch selbst Clyntahn hatte akzeptiert, dass man dies kaum dem Captain anlasten durfte. Immerhin hatte sich Phandys mit Hauwerd Wylsynn einen Kampf liefern müssen, Mann gegen Mann und auf Leben und Tod. Und ohne Phandys wäre es den Wylsynns möglicherweise sogar gelungen, aus Zion zu fliehen. Natürlich wären sie nicht weit gekommen. Aber selbst ein nur begrenzt gelungener Fluchtversuch hätte empfindlich die Aura der Unbesiegbarkeit geschwächt, von der die Inquisition nach wie vor umgeben war. Also hatte sich der Großinquisitor dafür entschieden, das Ganze etwas positiver zu sehen, und so war Captain Phandys zu Major Phandys geworden.
»Ich verstehe sehr wohl, dass es Eure Absicht ist, Major Phandys’ Talente möglichst zielführend und umfassend zu nutzen, Euer Exzellenz«, erwiderte der Erzbischof von Chiang-wu schließlich. »Ich suche bereits nach potenziellen Nachfolgern für ihn. Aber mit allem schuldigen Respekt möchte ich darauf hinweisen, dass ich es zumindest derzeit für ratsam halte, ihn nicht von seinen derzeitigen Aufgaben zu entbinden.«
»Warum?«, versetzte Clyntahn nur. Rayno zuckte mit den Schultern.
»Der Major selbst hat es mir gegenüber erst am heutigen Nachmittag angemerkt, Euer Exzellenz: Es dürfte schwierig sein, jemanden von seiner Zuverlässigkeit zu finden, der die Rolle des Hüters von Vikar Rhobair übernehmen könnte. Phandys ist durchaus bereit, mir einige potenzielle Kandidaten zu nennen. Aber Vikar Allayn müsste für eine Ablösung von Phandys einige Posten umbesetzen. Es würde Aufsehen erregen. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf: je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass wir die Sicherheit Vikar Rhobairs einem unsere besten, aufmerksamsten Männer anvertrauen sollten.«
Mürrisch verzog der Großinquisitor das Gesicht, musste Rayno aber recht geben. Duchairn musste man unter allen Umständen im Auge behalten – zumindest bis zu seiner Amtsenthebung. Gewiss wusste Duchairn, dass Phandys ihn im Auftrag der Inquisition beobachtete. Doch der Vikar schien sich damit abgefunden zu haben, und der Major legte wirklich bemerkenswertes Taktgefühl an den Tag. Er gab sich redlich Mühe, Duchairn nicht auf die Füße zu treten. Der Schatzmeister wiederum schien diese Geste der Höflichkeit sehr zu schätzen. Was Raynos anderes Argument betraf: Clyntahn wäre es herzlich egal gewesen, ob Maigwair irgendwelche Posten neu besetzen müsste, um Phandys von seiner derzeitigen Aufgabe entbinden zu können. Doch da war immer noch diese unschöne, ärgerliche Notwendigkeit, nach wie vor den Eindruck zu erwecken, die ›Vierer-Gruppe‹ halte eng zusammen. Es durfte daher nicht zu offensichtlich werden, dass Clyntahn und Maigwair ihre jeweils eigenen Leute auf Duchairn und Trynair angesetzt hatten. Denn das mochte dann zumindest den einen oder anderen der derzeit eingeschüchterten Vikare in gefährlichem – oder zumindest ungünstigem – Maße ermutigen. Duchairn war darüber hinaus noch unberechenbarer als Trynair. Schließlich konnte man sich beim Kanzler stets auf dessen vorhersagbaren – und manipulierbaren – Pragmatismus und Eigennutz verlassen.
Der Großinquisitor kam zu dem Schluss, Rayno habe recht. Es war wirklich besser, einen ihrer besten Männer dort zu belassen, wo er gerade war, bis der Zeitpunkt gekommen wäre, Duchairn loszuwerden.
»Also gut«, grollte er, »Ihre Argumente sind gut – auch wenn es mir nicht passt, jemanden von Phandys’ Qualitäten als besseres Kindermädchen zu verschwenden.«
Einige Sekunden lang blickte er den Erzbischof mit gerunzelter Stirn an. Dann zuckte er mit den Schultern.
»Also gut«, wiederholte er, dieses Mal jedoch in einem gänzlich anderen Tonfall. Mit gewohnter Plötzlichkeit wechselte der Großinquisitor das Thema. »Und was bekommen wir da aus Corisande zu hören?«
»Unsere jüngsten Informationen sind bedauerlicherweise veraltet, Euer Exzellenz – wie immer eben«, antwortete Rayno ein wenig vorsichtig. »Aber laut den neuesten Berichten wurden mittlerweile alle, die im letzten Jahr verhaftet wurden, auch vor Gericht gestellt. Mit der endgültigen Verkündigung der jeweiligen Urteile wird noch gewartet, bis entweder Cayleb oder Sharleyan vor Ort eingetroffen sind – wobei wohl eher mit Sharleyan zu rechnen ist. Aber es sieht sehr danach aus, dass die überwiegende Mehrheit der Festgenommenen …«, selbst der furchteinflößende Rayno legte eine kaum merkliche Pause ein, um sich innerlich zu wappnen, »… für schuldig befunden wurden.«
Clyntahns Miene verfinsterte sich. Das Blut schoss ihm in die fleischigen Wangen. Doch das war auch schon alles. So manchen hätte diese bemerkenswert ruhige Reaktion vermutlich erleichtert. Dafür allerdings kannte Rayno den Großinquisitor mittlerweile zu gut.
»Es hat wohl«, sagte Clyntahn eisig, »keiner aus der sogenannten Kirche dieses Dreckskerls Gairlyng einen Protest gewagt, richtig?«
»So weit ich weiß, nicht, Euer Exzellenz.« Rayno räusperte sich. »Laut unseren Informanten hat Gairlyng eigens Angehörige des Klerus dafür ausgewählt, sich die Anklageerhebung anzuhören. Mir scheint das alles Teil dieser Farce zu sein, es würden sämtliche rechtlichen Vorschriften penibel eingehalten.«
»Aber natürlich!« Clyntahns Kiefermuskeln zuckten. »Wir wussten doch schon, dass dieser abgefeimte Mistkerl Anvil Rock und sein Lustknabe, dieser Tartarian, bereit waren, sich Cayleb und seiner Schlampe in jeder nur erdenklichen Weise anzudienen! Also wird diese ›Kirche von Charis‹ selbstverständlich nur tatenlos dabeistehen und mitansehen, wie an treuen Söhnen und Töchtern von Mutter Kirche ein Justizmord nach dem anderen verübt wird! Stand denn etwas anderes zu erwarten?«
Sein Gesicht wurde dunkler und dunkler. Rayno wappnete sich bereits gegen den unweigerlich folgenden Wutausbruch. Doch zu seiner großen Überraschung krampfte der Großinquisitor mit angespannten Schultern nur die Hände zusammen, die schwer auf der Schreibtischplatte lagen. Offenkundig mühte er sich, seinen Zorn im Zaum zu halten. Leicht fiel es ihm nicht, und es dauerte auch ein wenig. Schließlich aber brachte Clyntahn das Kunststück tatsächlich zuwege.
»Sie sagten, die endgültigen Urteile würden erst verkündet, wenn Sharleyan vor Ort eingetroffen sei?«, fragte er schließlich mit angespannter, hasserfüllter Stimme.
»Jawohl, Euer Exzellenz. Wenn sie sich an den Zeitplan gehalten hat, der uns übermittelt wurde, müsste sie mittlerweile dort eingetroffen sein. Es ist sogar sehr gut möglich, dass sie jetzt schon ihre Rückreise vorbereitet.«
»Mit anderen Worten, Sie sind der Ansicht, die Urteile seien bereits verkündet. Und vermutlich auch vollstreckt, nicht wahr?« Clyntahn fletschte die Zähne. »Dieses Miststück lässt sich doch wohl kaum die Befriedigung entgehen, die alle hinrichten zu lassen, oder?«
»Vermutlich nicht, Euer Exzellenz.«
»Haben wir schon Hinweise darauf, wie die Bevölkerung darauf reagiert?«
»Nun … eigentlich nicht, Euer Exzellenz.« Unglücklich zuckte Rayno die Achseln. »Bislang gibt es keinerlei Informationen über organisierten Protest oder allgemeine Empörung. Aber ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass sämtliche Berichte bereits mehrere Monate alt sind, wenn sie schließlich hier eintreffen. Es ist durchaus möglich, dass das Volk erst die offizielle Bestätigung der Urteile abgewartet hat, bevor es sich zu handeln entschloss.«
»Genauso gut ist es möglich, dass die sich einfach nur die Hintern platt sitzen und das alles geschehen lassen«, gab Clyntahn tonlos zurück.
»Leider ja«, bestätigte Rayno.
»Dann ist es vielleicht an der Zeit, denen wieder ein wenig Rückgrat zu verpassen!« Clyntahns Gesichtsausdruck verriet Bösartigkeit. »Wie sieht es mit Coris aus?«
»In dieser Hinsicht scheint sich nichts geändert zu haben, Euer Exzellenz. Wie Ihr wisst, habe ich einen unserer besten Männer auf ihn angesetzt. Bischof Mytchail hat darüber hinaus einen eigenen Agenten in König Zhames’ Palast eingeschleust. Beide sind der Ansicht, Coris tue genau das, was zu tun wir ihm aufgetragen haben.«
»Und er wird auch weiterhin tun, was unbedingt getan werden muss?«
»Das scheint praktisch sicher, Euer Exzellenz.«
»Nur praktisch sicher?« Clyntahn kniff die Augen zusammen.
»Ich glaube nicht, dass er auch nur einen winzigen Moment lang zögern würde, Euer Exzellenz, wenn er nicht – wie jeder weiß – der Leiter von Hektors Spionageabteilung gewesen wäre. Wir reden hier also von dem Mann, der unter anderem für sämtliche Attentate verantwortlich war, die seinerzeit Hektor befohlen hat. Coris steht in dem Ruf, durchaus einen gewissen Ehrgeiz zu besitzen. Er wird wissen, dass der Verdacht durchaus auch auf ihn fällt, sollte Cayleb die Ermordung Daivyns befehlen. Unter allen Umständen wird Coris also vermeiden, einem solchen Vorwurf zusätzliche Glaubwürdigkeit zu verleihen. Diese Einschätzung seines Charakters basiert im Übrigen auf den Berichten von Meister Seablanket, unserem Agenten in Coris’ Nähe.«
»Hm-hm.« Clyntahn runzelte die Stirn und rieb sich nachdenklich das Kinn. Mehrere Sekunden lang blieb er mit halb geschlossenen Augen reglos sitzen. »Wissen Sie«, sagte er dann, immer noch halb in Gedanken, »das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Dafür zu sorgen, dass man Coris die Schuld anlastet, meine ich.« Er lächelte dünn. »Anvil Rock, Tartarian und er haben doch schließlich alle für Hektor gearbeitet, häufig sogar gemeinsam. Wenn man jetzt Coris die Verantwortung in die Schuhe schiebt – weil er darin zweifellos eine günstige Gelegenheit sieht, in Caylebs Gunst zu steigen, wie alle anderen auch, dann würde das allein schon ausreichen, um die beiden anderen ebenfalls in Misskredit zu bringen, nicht wahr? Ihrer engen Zusammenarbeit in früheren Zeiten wegen. Das sehen Sie doch auch so, oder?«
»Das erscheint mir durchaus möglich, Euer Exzellenz.«
»Meinen Sie, Seablanket bekommt das hin?«
»Ich denke, das bekäme er schon hin. Aber es wäre mir lieber, wenn das jemand anderes übernehmen könnte.«
»Warum nicht Seablanket? Der ist doch schon an genau der richtigen Stelle!«
»Weil er einfach zu wertvoll für uns ist, Euer Exzellenz. Wenn ich Euch gerade eben richtig verstanden habe, dann brauchen wir einen Attentäter, der nach dem Tode des Jungen entweder gefangen genommen wird oder selbst ums Leben kommt. Für einen solchen Auftrag würde ich jemand mit Seablankets Qualitäten nur äußerst ungern opfern – es sei denn, anders ginge es eben nicht.«
»Und an wen hatten Sie gedacht?«
»Mir war der Gedanke gekommen, man könnte einen der Männer nehmen, die für Operation Rakurai ausgewählt wurden. Beispielsweise Männern, denen noch kein konkretes Einsatzgebiet genannt wurde, Euer Exzellenz. Es finden sich gewiss Freiwillige, die bereit sind, sicherzustellen, dass sie der Gegenseite keinesfalls lebendig in die Hände fallen. Wir haben sogar noch mehrere Männer zur Verfügung, die in Charis geboren und aufgewachsen sind.«
Clyntahn neigte den Kopf. Dann nickte er langsam.
»Das hätte natürlich einen ganz besonderen Reiz, nicht wahr?« Sein Lächeln fiel alles andere als freundlich aus. »Das würde aber den Verdacht von Coris ablenken.«
»Nur insofern, als dann feststünde, dass er den Dolch nicht selbst geführt hat, Euer Exzellenz«, gab Rayno zu bedenken. »Auch Ihr selbst spracht eben davon, es bedürfe keines Attentats von Coris persönlich, um ihn in den Verdacht zu bringen, mit Caylebs Einverständnis gehandelt zu haben. Vielleicht ließe sich dieser Eindruck sogar noch verstärken. Wir könnten ihn zum richtigen Zeitpunkt anweisen, die Sicherheitsvorkehrungen für Daivyn … nennen wir es: in kreativer Weise zu ändern und dabei ein wenig zu schwächen, damit unsere Attentäter auch wirklich zuschlagen können. Seablanket ist ja in der idealen Position, ihm diese Anweisungen zukommen zu lassen, wenn es an der Zeit ist. Und es würde überhaupt nicht schaden, wenn wir Coris auf diese Weise sehr eindrucksvoll verdeutlichen, dass wir ihn besser im Auge behalten, als er das bislang geglaubt hat. Anschließend könnten wir Coris immer noch den Peitschenechsen zum Fraß vorwerfen. Die Tatsache, dass ja nun zweifellos der Graf dafür gesorgt hat, dass die Attentäter Daivyn überhaupt erreichen konnten – Attentäter allesamt aus Charis!, wäre nur noch die Krönung des Ganzen. Und sollten wir beschließen, ihn doch nicht den Peitschenechsen zum Fraß vorzuwerfen, dann lassen wir sein Handeln einfach unerwähnt.«
»Das gefällt mir!« Clyntahn nickte. »Also gut, dann suchen Sie sich die richtigen Leute zusammen! Mit dem Einsatzbefehl warten wir dann noch die Reaktionen der Öffentlichkeit von Corisande auf Sharleyans Hinrichtungen ab. Aber es kann überhaupt nicht schaden, geeignete Personen schon vor Ort zu haben, wenn der richtige Zeitpunkt schließlich gekommen ist!«
.II.
Twyngyth,Herzogtum Malikai, Königreich Dohlar
Sir Gwylym Manthyr öffnete die Augen, als er spürte, dass ihn jemand kaum merklich an der Schulter stupste.
Beinahe war es lächerlich, dass eine derart sanfte Berührung ihn wecken sollte. Im Laufe der letzten anderthalb Fünftage hatte Manthyr gelernt, tatsächlich ein wenig Schlaf zu finden – trotz des unerträglichen Schwankens und lautstarken Rumpelns ihrer rollenden Gefängniszelle. Stahlbeschlagene Holzräder sind auf Königlichen Hauptstraßen eigentlich laut genug, um Schlaf gänzlich unmöglich zu machen. Doch Manthyr war sein Leben lang zur See gefahren. Er hatte gelernt, selbst mitten in einem tosenden Sturm noch ein wenig Schlaf zu finden. Dank seiner immensen Erschöpfung fiel es Manthyr hier und jetzt sogar leichter als erwartet. Noch nie in seinem ganzen Leben war er so müde gewesen, so durch und durch ausgelaugt. Er wusste ganz genau, dass die Lage für viele seiner Männer sogar noch schlimmer war.
Er blickte auf und erkannte Naiklos Vahlain. Manthyr wollte schon etwas sagen, musste dann aber erst zweimal schlucken, um die Stimmbänder genug zu befeuchten.
»Was gibt es denn, Naiklos?«
»Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber wir erreichen gerade eine Stadt. Ziemlich groß. Ich nehme an, es ist Twyngyth.«
»Ich verstehe.« Noch einen Moment lang blieb Manthyr liegen. Dann zog er sich an einer der Eisenstangen des Wagens hoch auf die Beine. Kurz musste er um sein Gleichgewicht ringen, so sehr bockte und sprang der ungefederte Wagen. Aber trotz der heftigen Stöße, die schmerzhaft sein ganzes Rückgrat erschütterten, blieb Manthyr aufrecht stehen.
Schon sonderbar, dachte ein winziger Teil seines Verstands. Das Straßennetz von Charis war für charisianische Zwecke voll und ganz ausreichend. Doch mit dem Straßennetz, das viele der Reiche auf dem Festland durchzog, konnten es Charis’ Verkehrswege nicht aufnehmen. Der Grund dafür war, dass Charis entlang der Howell Bay lag. Es brauchte kein Straßennetz wie die Festlandsreiche, weil alles jederzeit auf dem Seeweg befördert werden konnte. Dabei war der Transport über Meer nicht nur deutlich kostengünstiger als der Landweg, sondern auch sehr viel schneller. Unwillentlich war Manthyr von der immensen Ingenieursleistung beeindruckt, die erforderlich gewesen sein musste, um die Königlichen Hauptstraßen von Dohlar anzulegen. Die Fahrbahnen bestanden aus mehreren festgestampften Kiesschichten, auf denen dann glatte Zementplatten verlegt worden waren – ein absolut planer, gut befahrbarer Untergrund.
Und das war das Erstaunliche. Es war kaum zu glauben, dass Wagen über eine derart glatte Oberfläche trotzdem derart heftig rumpeln konnten. Die schmerzhaften Stöße, die immer und immer wieder den ganzen Gefängniswagen erzittern ließen, sprachen eine andere Sprache.
Manthyr rieb sich die schmerzenden, verklebten Augen und spähte zwischen den Gitterstäben hindurch.
Naiklos hatte recht: Sie näherten sich tatsächlich einer beachtlich großen Ansiedlung – einer echten Stadt. In seiner Jugend hatte Manthyr jede Stadt unwillkürlich mit Tellesberg verglichen. Im Laufe der Jahre jedoch hatte er feststellen müssen, dass es auch durchaus noch größere Städte gab. Cherayth im Königreich Chisholm beispielsweise oder auch Gorath hier in Dohlar. Die Stadt, auf die sie jetzt zuhielten, war deutlich kleiner – vielleicht ein Drittel so groß wie Tellesberg. Aber sie war von einer massiven Stadtmauer umgeben, mindestens zwanzig oder gar dreißig Fuß hoch, und ganz offenkundig waren auf der Brustwehr auch zahlreiche Geschütze aufgestellt. Das wiederum ließ vermuten, dass diese Stadt wichtig war. Manthyr wusste nicht, ob er sich richtig an die Karten von Dohlar erinnerte. Schließlich hatten ihn vor allem die Küsten von Dohlar interessiert. Aber wenn er sich nicht irrte, dann war das hier gewiss Twyngyth, wie Naiklos gerade vermutet hatte.
Na, das wird ja ein Spaß werden!, dachte Manthyr grimmig. Um wenigstens die schlimmsten Stöße ihrer rollenden Gefängniszelle abzufedern und seinem erschöpften Körper auf diese Weise ein wenig zu schonen, beugte der Admiral die Knie an. Es war nicht ganz so, als befände er sich an Deck eines Schiffes in rauer See, aber eine gewisse Ähnlichkeit gab es doch. Vor dem Armageddon-Riff musstest du Seiner Majestät ja unbedingt dabei behilflich sein, dieses Arschloch Herzog Malikai umzubringen, nicht wahr, Gwylym? Ich wette, seine geliebte Familie kann es kaum erwarten, dir während deiner Durchreise hier ein bisschen Unterhaltung zu bieten!
»Sorgen Sie dafür, dass das Volk in Bewegung bleibt!«, befahl Pater Vyktyr Tahrlsahn. »Gewiss wird jeder diese Dreckskerle zu Gesicht bekommen wollen, und ich will, dass auch jeder dazu Gelegenheit hat! Sie sollen den verdammten Charisianern ruhig nahe genug kommen, um zu bemerken, wie sehr dieser Abschaum stinkt!«
»Aye, Sir!« Zum militärischen Gruß legte Captain Walysh Zhu die Hand an den Brustpanzer. Doch auch wenn seine Miene verriet, dass er diesen Befehl stoisch hinnahm, überschlugen sich seine Gedanken fast.
Im Laufe der vergangenen Tage hatte Zhu begriffen, dass Tahrlsahn sogar noch … dienstbeflissener und pflichtbewusster war, als der Captain ursprünglich angenommen hatte. Nein, Tahrlsahn war nicht nur dienstbeflissen und pflichtbewusst, er war ein echter Eiferer! Zhu war so orthodox und konservativ, wie ein Harchongese nur sein konnte. Er sah auch überhaupt nicht ein, warum man Ketzern die gleichen Gesten der Höflichkeit erweisen sollte wie ehrenhaften Kriegsgefangenen. Schließlich hatte jeder, der Shan-wei die Treue schwor, wirklich alles verdient, was ihm widerfahren mochte. Andererseits bereitete es Zhu keine sonderliche Freude, selbst Ketzer völlig grundlos zu quälen. Er hatte seine Gardisten angewiesen, den Gefangenen sehr deutlich zu zeigen, warum es für sie mehr als nur ratsam wäre, sich diszipliniert zu verhalten und Gehorsam an den Tag zu legen. Eine gewaltige Tracht Prügel war durchaus dazu angetan, den Ketzern Disziplin einzuimpfen. Wenn Zhu ganz ehrlich war, dann hatte ihm das systematische Verprügeln seiner Gefangenen durchaus persönliche Befriedigung verschafft. Er hielt es für die gerechte Strafe dafür, was die Marine dieses Abschaums der Flotte Gottes und der Kaiserlichen Marine von Harchong in der Markovianischen See angetan hatte. Nur totschlagen musste man sie nicht gleich.
Tahrlsahn hingegen schien ernstlich zu vergessen, dass sie die Gefangenen unbeschadet an den Tempel ausliefern sollten. Zhu vermutete, selbst unter Idealbedingungen würden sie während ihrer langer Reise etwa jeden fünften Gefangenen verlieren – schon aufgrund von Erschöpfung und der Entbehrungen wegen. Von Idealbedingungen aber war Zhus Auftrag weit entfernt. Schon als sie die Gefangenen aus den Gefängnisschiffen in Gorath abgeholt hatten, waren diese so ausgemergelt wie gehäutete Wyvern gewesen. Seitdem hatte sich Tahrlsahn nicht gerade Mühe gegeben, sie wieder aufzupäppeln. Krankheiten, die unter den Gefangenen grassierten, raubten ihnen zusätzlich Kraft. Doch Tahrlsahn hatte strikt das Verbot durchgesetzt, das Bischof-Vollstrecker Wylsynn verhängt hatte. Den ›Dreckskerlen von Simulanten‹ durften keinesfalls die Segnungen der Heiler zukommen. Und die unsanfte Fahrt der Gefängniskarren schwächte die Gefangenen deutlich mehr, als Tahrlsahn bewusst zu sein schien.
Nun also erreichten sie Twyngyth, die größte aller Städte, die sie bislang passiert hatten. Mittlerweile war der Captain angesichts von Tahrlsahns Anweisungen ein wenig beunruhigt. Schon in manchen der anderen Dörfer und der kleinen Städte war es schlimm hergegangen. Zhu erinnerte sich an ein Dorf, in dem zwanzig oder dreißig erwachsene Männer und einige Jugendliche neben den Gefängniskarren hergelaufen waren und die Charisianer mit allen Steinen beworfen hatten, die sich am Wegesrand nur auflesen ließen. Einer der Gefangenen hatte dabei ein Auge verloren, und ein weiterer war bewusstlos geworden, nachdem ihn einer jener Steine unglücklich am Kopf getroffen hatte. Zhu wusste nicht, ob dieser Treffer etwas damit zu tun hatte, was sich am darauffolgenden Tag ereignete. Doch genau jener Mann mit der Kopfverletzung war am nächsten Tag in Raserei verfallen. Mit bloßen Händen hatte er einen der Gardisten angegriffen, als er und seine Mitgefangenen kurz aus den Karren hinausgeführt wurden, um sich auf offenem Feld zu erleichtern. Wäre es nach Tahrlsahn gegangen, hätten die Gefangenen die Karren niemals verlassen, sondern in ihrem eigenen Unrat liegen sollen. Doch Pater Myrtan, Tahrlsahns Stellvertreter, hatte ihn davon überzeugen können, es müssten zumindest einige Rudimente von Pasquales Hygienevorschriften eingehalten werden, wenn der Fluch des Erzengels nicht auch die Gardisten selbst treffen sollte.
Zhu wusste es nicht aus eigener Erfahrung. Aber er hatte doch eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie übel der Gestank der Gefängniskarren für jeden sein musste, der das Pech hatte, sich ihm gegen den Wind zu nähern. Das allein hätte schon ausgereicht, um ihn dazu zu bewegen, Pater Myrtan bei dieser Debatte zu unterstützen. Tahrlsahn jedoch hatte es sich beinahe noch einmal anders überlegt und jegliche Zwischenhalte verboten, nachdem der kreischende Charisianer mit beiden Händen die Kehle eines der Gardisten umklammert und den Schädel des Mannes wieder und wieder auf den Boden geschmettert hatte. Drei weitere Charisianer hatten sich dann ebenfalls auf ihre Wärter gestürzt. Zhu war der Ansicht, dass das weniger in der Hoffnung geschehen war, dadurch tatsächlich etwas zu bewirken. Der Instinkt, einem Kameraden zu helfen, dürfte sie dazu bewogen haben. Obwohl die Gefangenen schon fast verhungert waren, hatten doch mehr als vierzig Gardisten eingreifen müssen, um die zwanzig Charisianer, die sich in dem Gefängniskarren befunden hatten, im Zaum zu halten.
Als das Handgemenge schließlich vorbei war, hatten zwei Gardisten ernste Verletzungen davongetragen. Der Charisianer, der den Kampf begonnen hatte, und einer seiner Kameraden waren tot. Zwei weitere waren im Laufe der nächsten anderthalb Tage ihren Verletzungen erlegen. Sechs weitere hatten Knochenbrüche erlitten … und nicht alle davon während des Kampfes. Sergeant Zhadahng stammte aus der kaiserlichen Provinz Bédard, weit im Westen von West Haven. Niemand war orthodoxer als die Einwohner von Bédard, vor allem Leibeigene wie Zhadahng. Und niemand war mehr daran gewöhnt, Brutalität zu erdulden (und selbst auszuteilen) wie ein Leibeigener aus Bédard. Zhu zweifelte nicht daran, dass Zhadahng eigenmächtig beschlossen hatte, ein gewisses zusätzliches Maß an Disziplin sei dringend geboten.
Der Captain hatten sich dafür entschieden, darauf dieses Mal nicht weiter einzugehen. Vermutlich konnte es nicht schaden, den Gefangenen eine Lektion zu erteilen … außer den Gefangenen selbst, natürlich. Aber das waren schließlich Ketzer und hatten es schlicht und einfach verdient! Zum anderen (und das war hier viel wichtiger) war Zhu davon überzeugt, dass Tahrlsahn die Entscheidung des Sergeanten aus tiefstem Herzen billigte. Denn Pater Myrtans vorherige Bemühungen, die Bedingungen für die Gefangenen wenigstens etwas zu verbessern, hatte er einfach abgetan. Die Diskussion war dann sogar recht hitzig geworden – nach Zhus Meinung sogar gefährlich hitzig, bis Pater Vyktyr Pater Myrtan schließlich äußerst scharf befohlen hatte, den Mund zu halten. Daher war es mehr als unwahrscheinlich, dass Pater Vyktyr Zhu dabei unterstützen würde, Zhadahng für eine derart unbedeutende Kleinigkeit zu disziplinieren, wie den einen oder anderen Ketzer totzuschlagen. Darüber hinaus stand Tahrlsahn beim Großinquisitor hoch in Gunst.
Doch was Zhu im Augenblick beunruhigte, war weniger das, was Zhadahng oder seine eigenen Leute vielleicht unternehmen mochten. Ihm machte die Bevölkerung von Twyngyth Sorgen. Die Wagenkolonne fuhr nur sehr langsam – mit Absicht. Schließlich sollten ja die Einwohner jeglicher Ansiedlungen Zeit haben, die Gefangenen während der Durchfahrt zu beäugen. Das gab reichlich Zeit, Flugblätter und Plakate zu verteilen und auszuhängen. In Dohlar gab es deutlich mehr Männer und Frauen, die lesen und schreiben konnten, als etwa in Harchong. Und selbst noch der ungebildetste Dorfbewohner konnte rasch jemanden finden, der ihm wenigstens die neuesten Plakate vorlas. Damit blieb in den Orten entlang der Transportroute reichlich Zeit, all die Unzulänglichkeiten der charisianischen Ketzer zu diskutieren, die sich wenigstens kurzzeitig in ihrer Mitte befanden. Je näher die Kolonne allerdings Twyngyth kam, desto schärfer fielen die Schmähungen aus und desto hasserfüllter waren die Plakate, die man an den Marksteinen des Weges befestigt hatte.
Ich frage mich, wie viel davon auf die Familie Ahlverez zurückzuführen ist, dachte Zhu. Nach allem, was ich gehört habe, haben die ursprünglich verlangt, die Dohlaraner sollten diese Gefangenen für das aufknüpfen dürfen, was Herzog Malikai vor der Felsnadel widerfahren ist! Und sie wissen, dass zu unseren Gefangenen auch der Offizier gehört, der bei jener Schlacht ›Kaiser‹ Cayleb als Flaggkommandant gedient hat. Ich wette, den wollen die wirklich nur zu gern in die Finger bekommen! Töricht, sehr töricht von denen – alles, was sie ihm hier antun, ist nichts im Vergleich zu dem, was die Inquisition in Zion für ihn bereithält! Aber um Logik scheint sich ja keiner dieser verdammten Dohlaraner sonderlich zu scheren!
Andererseits wollte auch die Inquisition sicherstellen, dass sie Gwylym Manthyr auf jeden Fall in die Finger bekäme. Der Großinquisitor wäre Tahrlsahn – oder auch Captain Walysh Zhu – alles andere als dankbar dafür, wenn das nicht geschähe. Und der Großinquisitor persönlich würde seinen Unmut recht deutlich zur Schau stellen, falls dergleichen eben doch geschähe … ganz egal, wie sehr Tahrlsahn zuvor in seiner Gunst gestanden haben mochte.
»Verzeihen Sie, Pater Vyktyr«, sagte Zhu nach kurzem Nachdenken, »aber ich mache mir ein wenig Sorgen um die … Unversehrtheit der Gefangenen.« Ursprünglich hatte er ›Sicherheit‹ sagen wollen. Das gelang ihm gerade noch hinunterzuschlucken.
»Was meinen Sie?« Tahrlsahn kniff die Augen zusammen.
»Twyngyth ist größer als jede andere Stadt, die wir bislang durchquert haben, Pater«, erklärte ihm Zhu so ruhig und sachlich wie möglich. »Die Zahl der Zuschauer dort wird ungleich größer sein, und wir werden das eigentliche Stadtgebiet durchqueren müssen, auf schmalen Straßen, umringt von Gebäuden.«
»Worauf wollen Sie hinaus, Captain?«, fragte Tahrlsahn ungeduldig nach.
»Wie Ihnen gewiss nicht entgangen ist, Pater, scheint der Zorn der Bevölkerung vor allem hier in Malikai doch deutlich größer zu sein. Ich denke, das hat damit zu tun, was Herzog Malikai bei der Schlacht an der Felsnadel widerfahren ist. Ich mache mir Sorgen, man könnte sich hier durch diesen Zorn dazu verleiten lassen, das Recht, das einzig Gott zusteht, in die eigenen Hände zu nehmen.«
»Sich verleiten lassen? Was meinen Sie damit? Zu was verleiten lassen?«
Zhu war nicht einmal versucht, die Augen zu verdrehen. Doch er ertappte sich bei dem Wunsch – und das beileibe nicht zum ersten Mal, Pater Myrtan möge das Kommando über diesen Gefangenentransport haben. Tahrlsahns brennender Hass auf alles Ketzerische schien von Zeit zu Zeit jegliches logische Denken zu verdrängen.
Die Ketzer müssen noch nicht einmal was tun – ihm reicht es, an sie zu denken!, dachte der Captain trocken.
»Pater, so wie ich das verstanden habe, sollen wir diese Ketzer lebendig und unbeschadet an die Inquisition in Zion ausliefern, ja?« Zhus Tonfall machte aus dieser Aussage eine höflich formulierte Frage. Ungeduldig nickte Tahrlsahn.
»Nun befürchte ich aber, Pater, dass die Gemüter hier in Twyngyth derart erhitzt sein könnten, dass jemand dem einen oder anderen Gefangenen einen Dolch zwischen die Rippen jagen könnte, sobald sich dazu eine Gelegenheit ergibt. Und in einem so beengten Bereich wie einer Stadt ist es deutlich wahrscheinlicher, dass sich eine Art Herdentrieb Bahn bricht. Dann könnte die Bevölkerung meine Männer einfach überrennen und tatsächlich bis zu den Ketzern vorstoßen. Falls das geschieht, könnten wir Dutzende von ihnen verlieren, Pater, zusätzlich zu denen, die wir während der Reise ohnehin schon auf … natürlichem Wege verlieren. Seit wir Gorath verlassen haben, sind bereits acht der Gefangenen gestorben. Wenn das so weitergeht, können wir von Glück reden, wenn überhaupt zwanzig von denen bis Zion durchhalten, um dort der Inquisition überstellt zu werden.« Zhu befürchtete, sich bereits gefährlich unverblümt auszudrücken, doch eine andere Möglichkeit sah er nicht. »Ich möchte einfach nicht noch weitere von denen verlieren, bloß weil die Menschenmenge zu dicht wird oder zu nah an die Karren herankommt.«
Kurz bedachte Tahrlsahn ihn mit einem finsteren Blick. Dann aber kniff der Oberpriester die Augen zusammen. Zhu konnte beinahe sehen, wie das Hirn seines Vorgesetzten die Arbeit aufnahm. Anscheinend hatte der Captain tatsächlich ein Argument gefunden, das durch Pater Myrtans Verweise auf das Buch Pasquale und die Heilige Schrift nicht genügend betont worden war.
»Also gut, Captain Zhu«, sagte der Oberpriester schließlich. »Die genauen Sicherheitsvorkehrungen überlasse ich Ihnen. Aber vergessen Sie nicht: Ich möchte, dass die Dohlaraner genau mitbekommen, was einem jeden Ketzer bevorsteht! Davon lasse ich mich auf keinen Fall abbringen! Aber wahrscheinlich haben Sie recht: Es könnte tatsächlich ein unnötiges, zusätzliches Risiko daraus erwachsen, die Bevölkerung der Stadt zu nah an die Karren heranzulassen. Ich schicke einen Boten voraus. Der soll der Obrigkeit der Stadt unmissverständlich zu verstehen geben, dass einer der größeren Marktplätze geräumt wird. Schließlich brauchen wir ja Platz, um ein Nachtlager aufzuschlagen. Und dann sorgen wir für einen Sicherheitsabstand zu den Wagen – von … tja, was? Fünfzehn Schritt? Zwanzig Schritt?«
»Wenn Sie damit einverstanden sind, Pater, wären mir zwanzig Schritt deutlich lieber.«
»Ach, also gut!« Offenkundig verärgert winkte Tahrlsahn ab. »Dann machen Sie eben zwanzig daraus, wenn Sie das für notwendig halten. Und vergessen Sie nicht, was ich vorhin gesagt habe! Sorgen Sie dafür, dass die Menschen in Bewegung bleiben! Schließlich soll ja jeder eine Gelegenheit haben, die Ketzer auch zu sehen.«
»Selbstverständlich, Pater. Ich versichere Ihnen, dass jeder in ganz Twyngyth weidlich Gelegenheit haben wird, mit eigenen Augen zu sehen, was all jenen bevorsteht, die Mutter Kirche verraten!«
.III.
HMS Destiny, und HMS Destroyer,Kings Harbour, Helen Island,Altes Königreich Charis
»Hieven einstellen! Hieven einstellen!«, brüllte Hektor Aplyn-Ahrmahk. Augenblicklich kam das Spill zum Stillstand.
Der Kraken das neueste Modell hing über dem Deck von HMS Destiny und blitzte in der Sonne. Der Schatten des Geschützes fiel genau auf den jugendlichen Ensign. Aplyn-Ahrmahk stieg über die straff gespannte Trosse hinweg, die vom Flaschenzug an Deck bis zum Spill reichte. Dann stemmte der Ensign die Hände in die Hüften und blickte zu dem drei Tonnen schweren Geschütz samt Auslösevorrichtung empor, das vom Hanger am Großmast und der Vorsegelrahnock herabhing und über Deck schwebte. Mehrere Sekunden lang stand der Ensign reglos da. Dann schüttelte er den Kopf. Verärgert wandte er sich an den Bootsmaat, der das Manöver beaufsichtigte.
»Lassen Sie das Geschütz wieder auf den Pier herab und die Schlinge anständig anlegen, Selkyr!«, fauchte er und deutete mit dem ausgestreckten Zeigefinger aufwärts.
Der angesprochene Bootsmann war mindestens doppelt so alt wie Aplyn-Ahrmahk. Dennoch folgte sein Blick sofort dem ausgestreckten Finger. Erschrocken verzog der Mann das Gesicht. Das Auge des Taus, das man um den Drehzapfen des Geschützes geschlungen hatte, war verrutscht. Deswegen hatte das schwere Rohr das Gleichgewicht verloren. Heftig zerrte es an der zusätzlichen Sorgleine, die von der Traube des Geschützes bis zum Haken am unteren Block der Talje führte. Es drohte, ganz aus der Schlinge herauszurutschen.
»Aye, aye, Sir!«, erwiderte der Bootsmann. »Verzeihen Sie, Sir! Weiß gar nicht, wie das passieren konnte!«
»Lassen Sie es einfach in Ordnung bringen!«, wies ihn Aplyn-Ahrmahk in deutlich ruhigerem Tonfall an. Dann grinste er. »Es gefiele dem Captain wohl kaum, wenn das Ding in den Frachtraum runterkracht und den ganzen Schiffsboden durchschlägt. Schließlich hat die Werft das schöne Schiff noch nicht einmal freigegeben!«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!