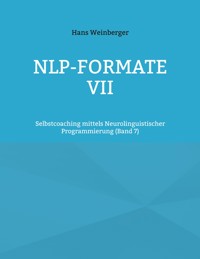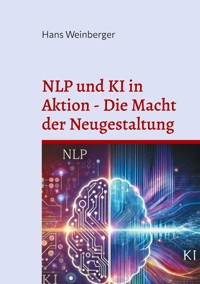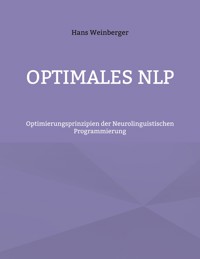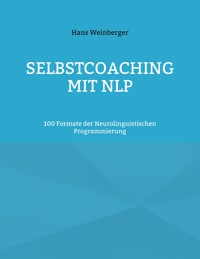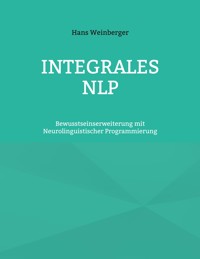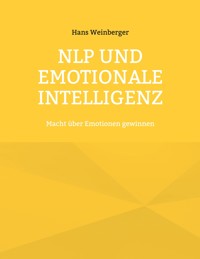
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Emotionen sind wesentliche Zusatzenergien, die die Evolution uns zur Verfügung gestellt hat. Diese Energien klug zu nutzen, ist Emotionale Intelligenz. Dabei sind bestimmte NLP-Techniken ein hervorragendes Werkzeug. Diese Techniken sind Gegenstand des vorliegenden Buches. Mit zahlreichen Anwendungen und Fallbeispielen aus dem täglichen Alltagsleben bietet das Buch dem Leser eine optimale Trainingsanleitung zum Selbstcoaching, um Macht über seine Emotionen zu erlangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Dagmar, in Liebe.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung: Das NLP-Modell
Die Macht der Emotionen
Die Basisstrategie des Emotionssystems
NLP-Formate zur Umformung der Basisstrategie
Formate zur Modifikation der Self-map und Emotionsgleichung
Format1: Modifikation der Self-map
Format2: Das Metamodell der Sprache
Format3: Kontext-Reframing
Format4: Bedeutungs-Reframing
Formate zur Modifikation des inneren Dialogs
Format5: Umgang mit schnellen verwirrenden Bildfolgen
Format6: Entmachtung negativer innerer Bilder
Format7: Entmachtung negativer innerer Stimmen
Format8: Umgang mit negativen Körpergefühlen
Formate zur Modifikation der grundlegenden negativen Emotionen
Format9: Angst
Format10: Ärger
Format11: Trauer
Format12: Ekel
Format13: Scham und Schuld
Format14: Positive Prägung
Ressource-Anker
Format15: Außenwahrnehmung
Format16: Innenwahrnehmung
Format17: Moment of Excellence
Format18: Moment of Importance
Format19: Collapsing Anchors
Format20: Chaining Anchors
Format21: Stacking Anchors
Format22: Sliding Anchors
Format23: Mentor-Modell
Format24: Core-Transformation
Träum ich oder wach ich?
Format25: Reflexionstechnik
Format26: MILD-Technik
Format27: WILD-Technik
Format28: DILD -Technik
Format29: AKE -Technik
Anhang: Schlagworte
Literatur
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlich willkommen zu meinem Buch „NLP und Emotionale Intelligenz“. Ich freue mich, dass du dich auf diese Reise einlässt, denn dieses Buch könnte dein Verständnis über Emotionen und deren Macht grundlegend verändern.
Wir alle wissen: Emotionen sind mächtige Kräfte. Sie motivieren uns, beeinflussen unser Denken und Handeln, treiben uns an oder bremsen uns aus. Doch was wäre, wenn du lernst, diese Kraft bewusst und gezielt zu nutzen? Stell dir vor, du könntest jede Emotion, egal ob positiv oder negativ, so lenken, dass sie dir dienlich ist – wie ein zusätzliches Energiepotenzial, das du nach Belieben einsetzen kannst.
In diesem Buch erkläre ich dir, warum Emotionen viel mehr als bloße Reaktionen sind. Sie sind Energiequellen, die die Evolution in unseren Bio-Computer integriert hat, um uns voranzubringenr. Doch diese Energie bleibt oft ungenutzt oder wird durch unbewusste Reaktionen blockiert. Die Kunst besteht darin, diese Energie freizusetzen und zu lenken. Dies zu beherrschen bedeutet, über emotionale Intelligenz zu verfügen – ein Schlüssel zu Erfolg, Gelassenheit und persönlichem Wachstum.
Mit den richtigen Techniken, die du im Laufe dieses Buches kennenlernst, wirst du in der Lage sein, deine Emotionen bewusst zu steuern. NLP bietet dir dabei effektive Werkzeuge, um die Energie deiner Emotionen in konstruktive Bahnen zu lenken und dein volles Potenzial zu entfalten.
Mein Ziel ist es, dich darin zu unterstützen, diese Techniken zu meistern, um die Kontrolle über deine Emotionen zu erlangen – und somit auch über dein Leben. Denn wenn du verstehst, wie du deine Emotionen gezielt einsetzt, dann erlangst du eine unglaubliche Macht: die Macht, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst.
Ich lade dich ein, dieses Buch als ein persönliches Trainingsprogramm zu betrachten – ein Training, das deine emotionale Intelligenz stärkt und dir hilft, in jeder Lebenslage das Beste aus dir herauszuholen. Lass dich darauf ein, probiere die Techniken aus, experimentiere, und du wirst sehen, wie sich Schritt für Schritt neue Möglichkeiten eröffnen.
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg auf diesem Weg und freue mich, dich beim Training deiner emotionalen Intelligenz durch NLP begleiten zu dürfen!
Einleitung: Das NLP-Modell
Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP) ist ein Modell, das unser subjektives Erleben, also die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und darauf reagieren, in den Mittelpunkt stellt. Es entstand in den 1970er Jahren durch die genaue Analyse von erfolgreichen Psychotherapeuten wie Milton Erickson, Virginia Satir und Fritz Perls. Diese Therapeuten erzielten bemerkenswerte Ergebnisse, und die Begründer des NLP – Richard Bandler und John Grinder – wollten herausfinden, was genau sie so effektiv machte. Durch die Beobachtung ihrer Sprache, ihrer Gesten und ihrer Denkmuster entstand NLP als ein systematischer Ansatz, der die inneren Prozesse des Menschen verständlicher und zugänglicher machen sollte.
Heute findet NLP in zahlreichen Lebensbereichen Anwendung, von Gesundheit und persönlichem Wohlbefinden über effektive Kommunikation bis hin zu Stressmanagement und Partnerschaft. Es wird auch häufig als Werkzeug zur Selbstanalyse und Persönlichkeitsentwicklung genutzt. Menschen setzen NLP ein, um ihre eigenen Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster zu erkennen und, falls gewünscht, positiv zu verändern.
Im Kern beschäftigt sich NLP mit den kognitiven (gedanklichen) und emotionalen Prozessen, die sich aus unserer Sinneswahrnehmung – visuell, auditiv, kinästhetisch (berührungsbezogen) sowie anderen Sinnesmodalitäten wie dem olfaktorischen (Geruch) und gustatorischen (Geschmack) Erleben – zusammensetzen. Diese Sinneseindrücke werden in unserem Gehirn zu inneren Bildern, Klängen und Gefühlen verarbeitet, die dann unsere persönlichen Programme formen. Diese Programme beeinflussen, wie wir die Welt deuten, welche Handlungsoptionen wir wahrnehmen und welche emotionalen Reaktionen wir zeigen.
Durch diese fest verankerten Programme entsteht eine individuelle „Landkarte“ der Realität, die oft unbewusst unsere Entscheidungen und Reaktionen bestimmt. NLP bietet jedoch Methoden und Techniken, mit denen wir diese Landkarte bewusst verändern können. Das bedeutet, dass wir alte, möglicherweise hinderliche Denkmuster und Verhaltensweisen identifizieren und durch neue, zielführendere ersetzen können. So kann NLP nicht nur dazu beitragen, eingefahrene Denk- und Verhaltensweisen zu durchbrechen, sondern auch die emotionale Reaktion auf bestimmte Situationen neu zu gestalten und damit mehr Flexibilität und Freiheit im Denken und Handeln zu erreichen.
Das NLP-Modell
Entwickler:
Richard Bandler, John Grinder
Modell Gegenstand:
Subjektive Erfahrung
Modell Elemente:
Sinnesmodalitäten
V
A
K
O
G
(Auch Repräsentationssysteme genannt:
Visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch)
Indizes
e-für externe Signale
i -für interne Signale
er-für erinnerte Signale
k – für konstruierte Signale
d -für digitales auditives Erleben (Worte)
t – für rein tonales auditives Erleben
Vk=visuell konstruiert
Ver=visuell erinnert
Ak=auditiv konstruiert
Aer=auditiv erinnert
Kk=kinästhetisch konstruiert
Ker=kinästhetisch erinnert
(analog für O und G)
Aid=innerer Dialog
Bei K noch
K+
K-
Submodalitäten
von V:
Helligkeit, SW/Farbe, Entfernung, Größe, Ort, Focus, Kontrast, 3D, Film, Anzahl Bilder, Transparenz, assoziiert/dissoziiert, Rahmen, Form, Proportion etc.
von A:
Ort, Richtung, Lautstärke, Tonalität, Bewegung, Timbre, Rhythmus, Dauer, Tempo, Stimme etc.
von K:
Ort, Größe, Form, Intensität, Bewegung, Dauer, Hitze, Gewicht, Stetigkeit etc.
von O:
Intensität, Richtung, Ort, angenehm/unangenehm, kampferartig, moschusartig, blumig, faulig etc.
von G:
Intensität, süß, sauer, salzig, bitter, würzig, scharf etc.
Verknüpfungen
→
folgt auf (Konsekution)
⇔
Wechselwirkung/Zyklus
/
gleichzeitig (Synästhesie)
Erläuterung
Das NLP-Modell , entwickelt von Richard Bandler und John Grinder in den 1970er Jahren, basiert auf der Erforschung und Strukturierung der menschlichen subjektiven Erfahrung. Das Hauptziel von NLP ist es, Muster und Prozesse zu verstehen, die hinter menschlichem Verhalten, Kommunikation und Denken stehen, um sie zu optimieren.
Die Entwickler:
1. Richard Bandler:
Richard Bandler, geboren 1950, ist Mitbegründer von NLP. Ursprünglich als Mathematiker ausgebildet, beschäftigte er sich später mit Psychologie. Bandler arbeitete eng mit Psychologen wie Virginia Satir und Milton Erickson zusammen, deren therapeutische Arbeit stark von seinem Denken beeinflusst wurde. Seine analytische Herangehensweise an Sprache und Verhalten führte ihn zur Entwicklung von NLP-Techniken, die tief in der Struktur des menschlichen Denkens und der Kommunikation verwurzelt sind.
2. John Grinder:
John Grinder, geboren 1940, ist Linguist und ebenfalls Mitbegründer von NLP. Als Professor für Linguistik hatte er ein tiefes Verständnis für die Struktur der Sprache und wie diese auf die menschliche Erfahrung einwirkt. Durch die Zusammenarbeit mit Bandler trug Grinder wesentlich dazu bei, NLP als Modell zu entwickeln, das auf der genauen Analyse der sprachlichen Muster von Menschen basiert.
Der Modellgegenstand: Die subjektive Erfahrung
Das zentrale Modell des NLP ist die subjektive menschliche Erfahrung, die sich in verschiedenen Sinnesmodalitäten ausdrückt. Diese Modalitäten bilden den Kern dessen, wie wir Informationen verarbeiten und speichern. NLP betrachtet dabei die folgenden Sinnesmodalitäten:
Visuell (V) – Sehen
Auditiv (A) – Hören
Kinästhetisch (K) – Fühlen
Olfaktorisch (O) – Riechen
Gustatorisch (G) – Schmecken
Indizes für interne und externe Signale NLP führt Indizes ein, um zwischen verschiedenen Formen von Sinneserfahrungen zu unterscheiden:
e steht für externe Signale, z. B. Dinge, die wir tatsächlich sehen oder hören.
i steht für interne Signale, also Erinnerungen oder Vorstellungen. Diese Signale können weiter unterteilt werden in:
Erinnert (er): Informationen, die aus der Erinnerung abgerufen werden (z.B. ein visuelles Bild, das wir in der Vergangenheit gesehen haben).
Konstruiert (k): Informationen, die wir uns aktiv vorstellen oder erschaffen, aber nicht real erlebt haben (z.B. eine Zukunftsvision).
Diese Unterscheidung lässt sich auf alle Repräsentationssysteme anwenden..
Neben den fünf Hauptsinnesmodalitäten gibt es im NLP das auditive digitale Erleben, das sich auf den internen Dialog bezieht – also das „Selbstgespräch“. Dies wird durch den Index d gekennzeichnet. Zudem gibt es das auditive tonale Erleben , das sich auf reine Klänge und deren Tonalität bezieht.
Im NLP wird das kinästhetische Repräsentationssystem K verwendet, um eine Vielzahl von körperlichen und emotionalen Empfindungen abzubilden. Es umfasst sowohl körperliche Empfindungen (wie propriozeptive, viszerale und taktile Wahrnehmungen) als auch emotionale Zustände, da diese Aspekte eng miteinander verflochten sind. Um das auseinanderzunehmen und besser zu verstehen, müssen wir uns die Unterkategorien des kinästhetischen Systems genauer ansehen und die Verbindungen zwischen Körperempfindungen und Emotionen verdeutlichen.
1. Propriozeptive und Viszerale Empfindungen
Propriozeption beschreibt die Wahrnehmung der Lage und Bewegung der eigenen Gliedmaßen im Raum. Sie ermöglicht es uns, ohne nachzudenken zu wissen, wo sich unser Körper befindet und wie er sich bewegt. Diese Wahrnehmung ist essentiell für die Körperkoordination und das Gleichgewicht.
Viszerale Empfindungen beziehen sich auf die inneren Organe, wie beispielsweise die Wahrnehmung von Herzklopfen, Magengefühlen oder Atembewegungen. Diese Empfindungen sind oft subtil, aber sie spielen eine große Rolle in unserem allgemeinen Wohlbefinden und in der körperlichen Reaktion auf emotionale Zustände. Zum Beispiel kann Angst mit einem "Knoten im Magen" einhergehen, während Aufregung das Herz schneller schlagen lässt.
Taktile Wahrnehmungen umfassen Berührungen, Druck, Hitze und Kälte, die wir über die Haut wahrnehmen. Diese Empfindungen tragen zu unserem räumlichen Bewusstsein bei und können auch emotionale Reaktionen auslösen, wie das Gefühl von Wärme bei einer Umarmung oder Unbehagen bei einem schmerzhaften Stoß.
2. Emotionen und Psychosomatische Verbindungen
Emotionen sind untrennbar mit diesen körperlichen Empfindungen verbunden. Der Körper reagiert physisch auf emotionale Zustände, was NLP als Grundlage nimmt, um emotionale Zustände über kinästhetische Empfindungen zu verändern.
Emotionen, wie Freude, Traurigkeit, Angst oder Wut, manifestieren sich häufig durch körperliche Symptome. Diese psychosomatische Verbindung bedeutet, dass Gefühle nicht nur im Gehirn, sondern im gesamten Körper erlebt werden. Beispielsweise kann Wut die Muskeln anspannen, Angst die Atmung beschleunigen und Freude ein Gefühl von Leichtigkeit erzeugen. Im NLP wird diese Verbindung genutzt, um emotionale Zustände gezielt zu beeinflussen.
Der Begriff „psychosomatisch“ deutet auf diese Wechselwirkung zwischen Geist (Psyche) und Körper (Soma) hin. Emotionale Zustände haben fast immer eine körperliche Komponente, sei es eine Veränderung der Muskelspannung, des Herzschlags, der Atmung oder der chemischen Balance im Gehirn.
3. Nutzung im NLP: K als Repräsentationssystem
Im NLP werden sowohl die körperlichen als auch die emotionalen Aspekte des kinästhetischen Systems genutzt, um Erlebnisse zu verarbeiten, Emotionen zu verändern oder das Wohlbefinden zu steigern. Techniken wie die Veränderung von Submodalitäten (z.B. die Intensität oder Bewegung eines Gefühls) zielen darauf ab, wie jemand ein Gefühl oder eine körperliche Empfindung erlebt.
Beispiel: Jemand, der Angst hat, könnte diese als ein „enges“ oder „schweres“ Gefühl im Brustbereich beschreiben. Im NLP kann man dieses Gefühl „weicher“ oder „leichter“ machen, um die Angst zu lindern. Dabei wird das Erleben der Emotion direkt über das kinästhetische System beeinflusst (siehe z.B. Format8)
Da sowohl emotionale als auch körperliche Zustände auf kinästhetischen Wahrnehmungen basieren, werden sie im NLP oft gemeinsam behandelt. Emotionale Intelligenz in NLP bedeutet auch, die körperlichen Reaktionen auf Emotionen zu erkennen und zu modifizieren, um eine gewünschte Veränderung herbeizuführen.
4. Die Trennung von Emotion und Körperempfindung im NLP
Auch wenn Emotionen und körperliche Empfindungen eng verbunden sind, kann NLP diese Unterscheidung bewusst nutzen:
Emotionale Empfindungen: Diese werden oft über Metaphern beschrieben (z.B. „ein Kloß im Hals“ für Trauer). Solche Empfindungen sind nicht rein körperlich, sondern eine subjektive Mischung aus psychischer und physischer Reaktion.
Körperliche Empfindungen: Diese sind rein somatisch, wie beispielsweise Druck auf den Körper, Berührung, Schmerzempfinden oder Muskelspannung.
Submodalitäten Submodalitäten sind die feinen Unterschiede innerhalb der Sinnesmodalitäten, die unsere Wahrnehmung beeinflussen. Sie sind zentrale Elemente des NLP, da sie die Art und Weise bestimmen, wie wir Erlebnisse intern kodieren und verarbeiten.
Verknüpfungen NLP ermöglicht es, verschiedene Repräsentationssysteme zu kombinieren und Muster in der Verarbeitung von Sinneseindrücken zu erkennen. Dabei spielen Konzepte wie Konsekution (zeitliche Abfolge), Wechselwirkung und Synästhesie (Überschneidung von Modalitäten, z.B. das Fühlen eines Tons) eine Rolle. Dies hilft dabei, ein besseres Verständnis der inneren Welt und der Verhaltensmuster eines Menschen zu entwickeln.
Mithilfe dieser Modellelemente lassen sich nun NLP-Programme – kurz Strategien genannt – definieren.
Dazu wird die subjektive Erfahrung einer Situation in eine Abfolge von Repräsentationen zerlegt, wobei jeweils nur die Repräsentationssysteme mit der höchsten Verhaltensrelevanz (Primärkontrolle) notiert werden.
Beispiele: (-) schlechte/ineffiziente Strategie
(+) gute / effiziente Strategie
1. Rechtschreibung
(-) Aed → Aid ⇔ Vk ⇔ K+- → Ke
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1): Hören des Wortes
(2): Innerliches Nachsprechen
(3): Konstruktion des Wortes
(4): Gutes/schlechtes Gefühl
(5): Hinschreiben
(+) Aed → Ver → K+ → Ke
(1)
(2)
(3)
(4)
(1): Hören des Wortes
(2): Scharfes erinnertes Wortbild
(3): Gutes Gefühl
(4): Abschreiben
Abbildung 1 (Buchstabier-TOTE=Test, Operate, Test, Exit)
2. Bestellung in einem Restaurant
(-) Ve ⇔ Aid ⇔ K- → Aid → Ke
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1): Lesen der Speisekarte
(2): „Was nehmen Andere? Nein! Denke selber!“
(3): Schlechtes Gefühl
(4): „Nimm irgendwas!“
(5): Bestellung
(+) Ve ⇔ Vi ⇔ Oer/Ger ⇔ K+- → Ke
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1): Lesen der Speisekarte
(2): Gericht, groß, in Farbe
(3): Probeschmecken
(4): Match/Mismatch
(5): Bestellung
Abbildung2 (Bestellstrategie im Zeitverlauf)
3. Konfrontation mit einer Maus
(-) Ve → Vk ⇔ K-- → Ke
(1)
(2)
(3)
(4)
(1) Sehen der Maus
(2) Innerer Horrorfilm
(3) Panik
(4) Flucht
(+) Ve → Aid ⇔ K+- → Ke
(1)
(2)
(3)
(4)
(1) Sehen der Maus
(2) „Oh eine Maus!“
(3) Emotional ausgeglichen
(4) Exit
Der Sinn von NLP besteht darin,
(-)-Strategien in (+)-Strategien zu verwandeln.
Dazu dienen die NLP-Formate.
Diese beinhalten die folgende Standard-Vorgehensweise:
Auspacken der (-)-Strategie
Design der (+)-Strategie
Installation der (+)-Strategie
Diese Vorgehensweise führt von unbewusster Inkompetenz über bewusste Inkompetenz zu bewusster Kompetenz und schließlich zu unbewusster Kompetenz. Es stellt sich jetzt natürlich die entscheidende Frage: „ Wie bekomme ich die (+)-Strategie installiert?“ Betrachten wir dazu die 3 Beispiele:
Beispiel 1 : Installation einer effizienten Rechtschreibungsstrategie: Wo siehst Du Bilder? Stell Dir einen Freund oder Dein Haustier, Deine Wohnung, Dein Auto u.a vor! Wo genau siehst Du diese Bilder? Fange dann zunächst mit einfachen Worten an zu üben. Schreibe sie auf eine Karte und schließe dann die Augen bis Du davon eine klares internes Nachbild siehst (Ver ). Dann schreibe das Wort davon ab und speicher es in Deiner Erinnerung! Gehe zu immer komplizierteren Wörtern über! Wenn Du ein Wort nicht kennst, schlage es nach!
Beispiel2: Installation eine effizienten Bestellstrategie: Betrachte die Schritte der (+)-Strategie. Schritte wiederholen, bis die neue Strategie sitzt. Auf mindestens 3 weitere Situationen anwenden (Generalisierung)!
Beispiel3: Installation einer Angstbewältigungsstrategie: Falls Du Ängste vor Mäusen, Spinnen, Aufzügen, Höhen u.a. hast, siehst Du in der Situation nicht mehr das, was ist (Ve), sondern einen inneren Horrorfilm. Im Beispiel ist eine Mäusephobie dargestellt. Der Zyklus Vk⇔K-- wird auch innerhalb der Verhaltenstherapie „Teufelskreis der Angst“ genannt. Dieser startet ab einem kritischen Punkt (z.B. in einer gewissen Entfernung von der Maus). Die Auflösung/Installation geschieht wie folgt:
Stell Dir vor, Du sitzt im Kino und blickst auf die leere Leinwand!
Trete nun aus Deinem Körper heraus und begebe Dich nach oben in den Vorführraum! Du siehst Dich von dort unten im Saal sitzen und Du siehst auch die leere Leinwand (
Doppelte Dissoziation
).
Nun beginnt der Horrorfilm auf der Leinwand zu laufen. Du siehst im Vorführraum, wie Du Dir unten im Saal ansiehst, wie Du im Film die vorgestellten Schrecken bis zum schlimmsten Punkt erlebst. Hier stoppt der Film und wird zum Standbild. Der Film ist in schwarzweiß.
Nun gehst Du zurück in Deinen Körper im Saal und dann in den Film in Dein Film-Ich in das Standbild (
Reassoziation
)!
Jetzt spürst Du, wie der Film mit Dir zurückläuft und zwar sehr schnell (ca. 1,5 sek.) und in Farbe bis zum kritischen Punkt und davor in Sicherheit.
Wiederhole die Prozedur so oft, bis Du sicher bist, dass der
Rückwärtslauf
fest an den Horrorfilm gekoppelt ist. Du bist dann nicht mehr in der Lage, den ursprünglichen angstauslösenden Horrorfilm zu sehen.
Wir haben es im letzten Beispiel also schon mit einer etwas raffinierteren Installationstechnik zu tun. In meinem Buch „Optimales NLP“ habe ich diese Techniken und ihre Optimierung ausführlich beschrieben und mittels 50 NLP-Formate für den Gebrauch im täglichen Alltagsleben dargestellt.
Die Macht der Emotionen
Im Gegensatz zu einem Roboter-Computer (immer cool) ist unser Bio-Computer zu Emotionen fähig. In dem vorangegangenen Kapitel sind Dir diese als K
-
und K
+
begegnet. In diesem Kapitel beziehe ich mich in erster Linie auf die Ergebnisse der beiden Emotionsforscher Richard Graf und Sean Webb (Literatur 10, 14).
K-:
Ich biege in meinem Auto gedankenverloren in die Seitenstraße ein. Ich merke das der Wagen hinten wegrutscht. Angst schießt in meinen Körper. Ich nehme das Gas weg und bin hellwach und aufmerksam.
Ich versuche den Kabelsalat zu entwirren. Ärger steigt in mir auf und ich schmeiße die Rolle erstmal in die Ecke.
Ich verabschiede mich von der Liebsten am Bahnhof.
Tränen schießen mir in die Augen und Traurigkeit steigt in mir auf.
Ich stecke mir eine Handvoll Nüsse in den Mund. Ich spüre den ekeligen bitteren Geschmack. Sofort spucke ich im hohen Bogen alles aus.
Aus Versehen trete ich meiner Katze auf den Schwanz. Sie schreit vor Schmerz. Ich fühle mich schuldig und gebe ihr ein Leckerchen. Meine Nachbarn sehen, wie ich vergeblich versuche einzuparken.
Sie lachen und ich schäme mich.
6 grundlegende Energien: Angst, Ärger, Trauer, Ekel, Scham, Schuld. Ähnlich wie in der Farbenlehre sind das die Grundfarben, aus denen sich die anderen „negativen“ Emotionen zusammensetzen. So setzt sich beispielsweise Enttäuschung aus Ärger und Trauer zusammen. Wie aus dem Namen „Emotion“ schon hervorgeht, haben wir es hierbei mit Zusatzenergien zu tun, die im Bedarfsfall aktiviert werden und Dich zu etwas bewegen wollen.
Angst:
Zu Achtsamkeit (im Extremfall zu Angriff oder Flucht)
Ärger:
Zu Einflussnahme
Trauer:
Zum Loslassen
Ekel:
Zum Raustreiben
Scham/Schuld
: Zum Ausgleich
K+:
Auf der (+)-Seite erhalten wir dementsprechend:
Mut
Freude
Glück
Genuss
Liebe
Zufriedenheit
Wobei es auch hierbei eine Vielzahl von unterschiedlichen Mixturen und damit Namen gibt.
Wir können auf einer Skala von 1-10 einen funktionalen (4-7) und einen dysfunktionalen (1-3 und 8-10) Bereich der Stärke einer Emotion unterscheiden. Diese können dann wiederum verschiedene Bezeichnungen haben z.B. bei Angst: Leichtsinn, Achtsamkeit, Panik .
Die Basisstrategie des Emotionssystems
Wir verfügen über zwei unterschiedliche Entscheidungssysteme, das Kognitions- und das Emotionssystem. Beide arbeiten parallel, weitgehend autonom und kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf Basis unterschiedlicher Gedächtnissysteme zu unterschiedlichen Entscheidungen. Gleichzeitig interagieren die beiden Systeme miteinander, wodurch sie eher wie ein monolitisches System erscheinen.
Die sensorische Informationen werden im Thalamus zusammengeführt. Der Thalamus doppelt die sensorische Wahrnehmung und leitet sie an beide Entscheidungssysteme weiter. Das evolutionär ältere Emotionssystem erhält weniger und gröbere, das Kognitionssystem mehr und differenziertere sensorische Informationen.
Beide Systeme verleihen dann parallel und weitgehend unabhängig voneinander der sensorischen Information eine Bedeutung. Da die Systeme unabhängig voneinander arbeiten, kann die Bedeutung, die einem Vorgang beigemessen wird unterschiedlich ausfallen. So wird erklärbar, warum wir in der Dämmerung vor einer Schlange wegspringen, um zeitlich später zu erkennen, dass es nur ein Zweig war, auf den wir getreten sind. Das ist keine Verwechslung, sondern es ist das Ergebnis der unterschiedlichen Verarbeitung im Emotions- und Kognitionssystem.
Das Emotionssstem arbeitet schnell, mühelos, ist dem Bewussten nicht zugänglich, non-verbal und sein Wahrnehmungsfokus ist eher umfassend. Es analysiert ununterbrochen unsere gegenwärtige Erfahrung
[V A K O G]ie
und hält Ausschau nach potentiellen Bedrohungen. In diesem Scanning-Prozess stellt sich jetzt aber natürlich die Frage: „Wer genau wird bedroht? Wer oder was muss geschützt werden?“ Die Antwort dazu liefert uns die folgende Abbildung, die ich aus dem hervorragende Buch „Mind Hacking Happiness“ von Sean Webb entnommen habe:
Abbildung3