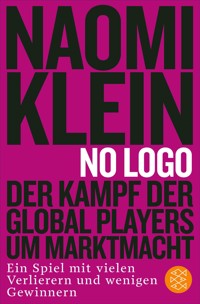
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
+++ Der Klassiker der Globalisierungskritik und Bestseller, jetzt im FISCHER Taschenbuch +++ Die führende Intellektuelle unserer Zeit und Bestsellerautorin Naomi Klein offenbart die Machenschaften multinationaler Konzerne hinter der Fassade bunter Logos. Der von ihr propagierte Ausweg aus dem Markendiktat ist eine Auflehnung gegen die Täuschung der Verbraucher, gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Zerstörung der Natur und kulturellen Kahlschlag. Denn durch ihre Demystifizierung verlieren die großen, global agierenden Marken an Glanz und Macht – zum Wohle aller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Naomi Klein
No Logo!
Der Kampf der Global Players um Marktmacht - Ein Spiel mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern
Über dieses Buch
Naomi Klein, eine der profiliertesten Intellektuellen unserer Zeit, ist die Autorin des internationalen Bestsellers ›No Logo‹. Ihr Manifest gegen einen zügellosen Kapitalismus und die scheinbare Allmacht globaler Marken wurde innerhalb kürzester Zeit in 28 Sprachen übersetzt und von der New York Times die »Bibel einer Bewegung« genannt. Ihr Buch ›Die Schock-Strategie – der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus‹, das 2012 im FISCHER Taschenbuch erschien (Band 17407) wurde in über 30 Ländern der Welt als eines der wichtigsten Bücher des Jahrzehnts gefeiert. Naomi Klein war u.a. Miliband Fellow an der London School of Economics und hält einen Ehrendoktortitel für Zivilrecht der University of King’s College in Neuschottland. Sie schreibt und berichtet regelmäßig für große Sender und Zeitungen wie CNN, BBC, The Los Angeles Times, The Washington Post, RAI, CBC und andere. Ihr neues Buch ›Die Entscheidung. Kapitalismus vs. Klima‹ erscheint bei S. Fischer. Naomi Klein lebt in Kanada.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403153-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
— Für Avi —
An der Oberfläche sieht [...]
Danksagung
Einführung Ein Netz von Marken
No Space
Kapitel 1 Neue Markenwelt
Der Ursprung der Marke
Der Tod der Marke (ein stark übertriebenes Gerücht)
Das Comeback der Marken
Kapitel 2 Markenerweiterung
Das Logo erobert die Hauptbühne
Die Marken erobern das Stadtbild
Die Marken erobern die Medien
Die Marken erobern die Musik
Nike und das Branding des Sports
Schritt 1: Die Schaffung berühmter Sportler
Schritt 2: Vernichte die Konkurrenz
Schritt 3: Verkaufe Teile der Marke, als ob sie von der Berliner Mauer stammten
Der markierte Star
Das Zeitalter des Markensauriers
Kapitel 3 Strg.A – Alles markieren
Der Jugendmarkt und die Vermarktung der Coolness
Der Jugendmarkt als Rettung
Gier nach Coolness: Die Marken gehen wieder zur Schule
Die Change Agents oder Wie man den Wasserspender cool macht
Coolness-Jäger: Auf Pirsch in der Jugendkultur
Der Hip Hop bläht die Marken auf
Tommy Hilfiger: Ins Ghetto und wieder zurück
Indie Inc.
Ironischer Konsum: Kaputtmachen nicht nötig
Verkaufen oder verkauft werden
Rock-’n’-Roll-CEOs
Der Ausweg
Kapitel 4 Das Branding des Lernens
Werbung in Schulen und Universitäten
Hey, Kids! Macht selber Werbung!
Die Marken erobern die Forschung
Wo war der Widerstand?
Kapitel 5 Das Patriarchat wird funky
Der Triumph des Identity-Marketing
Identitätsmarketing
Unterdrückungsnostalgie
Vielfalt und globale Verkaufsstrategie
Der globale Teenager
Interne Grabenkämpfe, während die Welt den Bach runterging
No Choice
Kapitel 6 Markenbombardements
Franchise im Zeitalter der Supermarken
Konstantes Klonen
Preiskriege: Das Wal-Mart-Modell
Clustering: Das Starbucks-Modell
Selektion versus Auswahl
Kapitel 7 Fusionen und Synergie
Die Schaffung kommerzieller Utopien
Superstores: Im Innern der Marke
Markendörfer: Leben in der Marke
Schrumpfende Möglichkeiten auf dem privatisierten Dorfplatz
Die neuen Trusts: Der Angriff auf die Auswahl
Kapitel 8 Die Zensur durch Unternehmen
Die Verbarrikadierung des Markendorfs
Zensur in der Synergie
Zittern vor China
Copyright-Schikane
Die Privatisierung des öffentlichen Raums
No Jobs
Kapitel 9 Die ausrangierte Fabrik
Die Entwertung der Produktion im Zeitalter der Supermarke
Das Nike-Modell wird exportiert
»Hier geht es nicht um Arbeitsplatzexport«
Die unerträgliche Leichtigkeit von Cavite: Die Arbeit in den Freihandelszonen
»Das wäre ein anderes Rosario geworden«
Die Arbeit in Klammern
»Keine Gewerkschaft, kein Streik«
Was mit Carmelita geschah …
Entwurzelte Arbeitskräfte
Das andere Produkt der Zonen: Eine neue Art Fabrikarbeiter
Wanderfabriken
Die Käufer ergreifen die Flucht
Kapitel 10 Drohungen und Aushilfskräfte
Von der unentgeltlichen Arbeit zur »Nation der Selbständigen«
Die Arbeit im Markenzeitalter: Hobbys statt Arbeitsplätze
Die Zerschlagung der McGewerkschaft
Unentgeltliche Arbeit: Mehr Scheinjobs dank der Supermarken
Aushilfskräfte: Der Leiharbeiter
Ja, aber … Wird Bill Gates uns nicht retten?
»Eine Nation von Selbständigen«
Kapitel 11 Die Zerstörung der Loyalität
Es passiert, was passieren muss
Vom Arbeitgeber zum Geldvermehrer
Distanz beruht auf Gegenseitigkeit
Von No Jobs zu No Logo …
No Logo
Kapitel 12 Culture-Jamming
Die Werbung unter Beschuss
»Meuterei auf dem Sponsoring-Schiff der Konzerne« – Paper Tiger, Slogan von 1997
Die Identitätspolitik wird interaktiv
Der innere Werbefachmann
Die Vermarktung des Antimarketings
Logo-Überlastung
Die Coolness-Jäger am Nullpunkt
Adbusting in den dreißiger Jahren: »Werden Sie ein Toucher Upper!«
Kapitel 13 Reclaim the Streets
Politik als Spiel
»Der Widerstand wird genauso transnational wie das Kapital«
RTS AGITPROP
Kapitel 14 Wachsende Wut
Der neue konzernfeindliche Aktivismus
»Das Jahr des Sweatshops«
Das Jahr der Angriffe auf die Marken
Wo die Macht ist
Kapitel 15 Der Markenbumerang
Die Taktik der markenorientierten Kampagnen
Designer-Aktivismus: Das Logo ist der Star
Eine andere Art Logo-Verkehr
Auf dem Logo-Trail
Ungerechtigkeit – synergetisch
Kapitel 16 Drei Logos
Der Swoosh, die Muschel und das M
Der Swoosh: Der Kampf um gute Arbeitsplätze
Shell: Vom Meer als Müllgrube zum Land des Ölschlicks
Das M: Der Kampf gegen Zensur
Lehren aus den drei großen Kampagnen: Nutze die Gerichte als Werkzeug
Lehren aus den drei großen Kampagnen: Nutze das Internet, um den Scheinwerfer auf die Konzerne zu richten
Kapitel 17 Lokale Außenpolitik
Studenten und Gemeinden stürzen sich in die Schlacht
Die Studenten erteilen den Marken eine Lehre
Die eigentliche Universitätsmarke
Aktionen auf Gemeindeebene: Selektive Auftragsvergabe
Kapitel 18 Jenseits der Marke
Wenn Marken Gutes widerfährt
Wenn Unmarkierbaren Böses widerfährt
Sekundärboykotts
Das Menetekel
Schluss Konsumwut versus mündiges Staatsbürgertum
Der weltweite Kampf für das gemeine Volk
Lektüreliste
Nachwort Zwei Jahre auf den Straßen: Bewegung durch Symbole
Anhang
Tafeln und Tabellen
— Für Avi —
An der Oberfläche sieht man noch nichts,
aber darunter brennt es bereits.
Der indonesische Schriftsteller
Y. B. Mangunwijaya, 16. Juli 1998
Danksagung
Die vier Jahre, in denen No Logo von einer Idee zum Buch heranreifte, waren erfrischend. Doch sie waren nicht schmerzlos, und ich habe sehr von der Unterstützung, dem Verständnis und dem Fachwissen meiner Umgebung profitiert.
Es war mir eine große Ehre, Louise Dennys als Lektorin zu haben. Dank ihrer intellektuellen Strenge und ihrem persönlichen Engagement für die Freiheit der Rede und die Menschenrechte gelang es ihr, die Argumente in dem Buch zuzuspitzen und zugleich meine groben Kanten als Schriftstellerin abzuschleifen. Sie verwandelte das Buch auf magische Weise.
Meine Rechercheurin Paula Thiessen hat zahlreiche schwer zu findende Fakten und Quellen aufgespürt. Über zwei Jahre arbeitete sie unermüdlich und trug das statistische Material zusammen, auf dem die vielen Originaltabellen dieses Buches beruhen. Sie zog den verschlossenen Sprechern von Einzelhandelsketten Informationen aus der Nase und überredete Regierungsbehörden auf der ganzen Welt, uns unveröffentlichte Gutachten zu schicken. Sie machte außerdem die Fotorecherche für das Buch und war mir in meiner oft einsamen Arbeit eine ermutigende und hilfreiche Kollegin.
Meine Agenten bei Westwood Creative Artists, Bruce Westwood und Jennifer Barclay, nahmen mit grenzenloser Begeisterung und Entschlossenheit ein Projekt in Angriff, das viele als riskant bezeichnet hätten. Sie suchten in der internationalen Verlagswelt nach verwandten Geistern, die No Logo nicht nur herausbringen, sondern sich auch für das Buch einsetzen würden: Reagan Arthur und Philip Gwyn Jones.
Das außergewöhnliche Team bei Knopf Canada blieb bei jeder Krise warm im Herzen und kühl im Kopf. Ich danke Michael Mouland, Nikki Barrett, Noelle Zitzer und Susan Burns und dem begabten und engagierten Team von Redakteuren, die diesen Text verbessert, geglättet, gekürzt und überprüft haben: Doris Cowan, Alison Reid und Deborah Viets.
Viel verdanke ich auch John Honderich, dem Herausgeber des Toronto Star. Er ließ mich eine regelmäßige Kolumne in seiner Zeitung schreiben, als ich noch viel zu jung dafür war. In diesem Freiraum konnte ich fast fünf Jahre lang die Ideen entwickeln und die Kontakte knüpfen, die die Grundlage dieses Buches bilden. Meine Redakteure beim Star – Carol Goar, Haroon Siddiqui und Mark Richardson – haben mich sehr unterstützt, wenn ich Urlaub nehmen musste, und wünschten mir sogar alles Gute, als ich meine Kolumne aufgab, um mich ganz der Arbeit an meinem Buch zu widmen. Die Arbeit an No Logo begann ernsthaft mit einem Artikel in der Village Voice über Culture-Jamming, und ich danke Miles Seligman für seine redaktionellen Verbesserungen. Mein Redakteur bei Saturday Night, Paul Tough, half mir mit Fristverlängerungen, Forschungshinweisen und Aufträgen zu Themen, die auch in No Logo vorkommen, darunter auch einer Reise zur Roots Lodge, die mein Verständnis für den utopischen Ehrgeiz des Brandings vertiefte.
Wertvolle Hilfe bei meinen Recherchen erhielt ich von Idella Sturino, Stefan Philipa und Maya Roy. Mark Johnston knüpfte in London die erforderlichen Kontakte für mich, Bern Jugunos tat dasselbe in Manila und Jeff Ballinger in Jakarta. Hunderte von Einzelpersonen und Organisationen halfen mir ebenfalls bei meinen Recherchen, aber einige Leute gaben sich besonders große Mühe, um mich mit Statistiken und Fakten zu versorgen: Andrew Jackson, Janice Newson, Carly Stasko, Leah Rumack, Mark Hosler, Dan Mills, Bob Jeffcott, Lynda Yantz, Trim Bissell, Laird Brown und vor allem Gerard Greenfield. Saftige Leckerbissen erhielt ich ungefragt per Post und E-Mail von Doug Saunders, Jesse Hirsh, Joey Slinger, Paul Webster und zahllosen anderen elektronischen Engeln. Die Toronto Reference Library, die Internationale Arbeitsorganisation, die Corporate Watch Website, das Maquila Solidarity Network, The Baffler, SchNEWS, Adbusters und das Listserv-Programm des Tao Collective leisteten mir bei meinen Recherchen allesamt unschätzbare Dienste.
Dankbar bin ich auch Leo Panich und Mel Watkins. Sie luden mich ein, auf Konferenzen zu sprechen, so dass ich meine Thesen schon früh mit einem kritischen Publikum diskutieren konnte. Und ich danke meinen Kollegen von der Redaktion von This Magazine für ihre Großzügigkeit und Ermutigung.
Mehrere Freunde und Familienmitglieder lasen das Manuskript und standen mir mit Ratschlägen und zusätzlichen Informationen zur Seite: Michele Landsberg, Stephen Lewis, Kyo Maclear, Cathie James sowie Bonnie, Michael, Anne und Seth Klein. Mark Kingwell war mir ein lieber Freund und geistiger Mentor. Sara Borins war meine erste und eifrigste Leserin – sowohl des Konzepts als auch der ersten Buchfassung –, und es war die immer fabelhafte Sara, die darauf bestand, dass die Aufmachung von No Logo dem Geist seines Inhalts entsprechen müsse. Nancy Friedland, John Monsanto, Anne Baines und Rachel Giese hielten zu mir, wenn ich nirgends aufzufinden war. Mein verstorbener Großvater Philip Klein, der als Trickfilmzeichner für Walt Disney arbeitete, brachte mir schon früh im Leben etwas Wichtiges bei: Schau immer nach dem Dreck hinter dem schönen Schein.
Am meisten verdanke ich meinem Mann, Avi Lewis. Er weckte mich jahrelang jeden Morgen mit einer Tasse Kaffee und einem Stapel von Zeitungsausschnitten aus dem Wirtschaftsteil. Avi war mir bei dem Projekt auf jede erdenkliche Weise ein Partner. Er blieb bis spät in der Nacht auf und half mir, die Ideen für dieses Buch zu entwickeln; er begleitete mich auf zahlreichen Erkundungsmissionen, im vorstädtischen Rieseneinkaufszentrum wie in den Exportproduktionszonen Indonesiens. Und er redigierte das Manuskript in den verschiedensten Stadien mit Argusaugen. Damit No Logo Wirklichkeit wurde, ließ er es zu, dass unser beider Leben total durch das Buch bestimmt wurde, und gestattete mir die große Freiheit und den Luxus, völlig in der Arbeit aufzugehen.
EinführungEin Netz von Marken
Wenn ich den Kopf schief lege und mein linkes Auge zukneife, sehe ich von meinem Fenster aus nur das Jahr 1932 bis hinunter zum See. Braune Lagerhäuser, Schornsteine mit der Farbe von Hafermehl, verblasste, auf Backsteinwände gemalte Schriftzeichen, die Marken wie »Lovely« und »Gaywear« anpreisen, die es längst nicht mehr gibt. Dies ist das alte industrielle Toronto der Textilfabriken, Kürschnereien und für den Großhandel produzierten Brautkleider. Bis jetzt hat noch niemand einen Weg gefunden, Geld zu machen, indem er diesen Backsteinkästen mit der Abrissbirne zu Leibe rückt, und im kleinen Umkreis von acht oder neun Blocks ist die neue Stadt planlos über die alte geschichtet worden.
Ich schrieb dieses Buch, als ich in einem zehnstöckigen Lagerhaus in den gespenstischen Überresten des alten Textilviertels von Toronto wohnte. Viele ähnliche Gebäude sind schon lange mit Brettern vernagelt, ihre Fensterscheiben sind zerbrochen, und ihre Schornsteine halten die Luft an; ihre einzige noch verbliebene kapitalistische Funktion besteht darin, auf ihren teerbeschichteten Dächern große glänzende Reklametafeln zu tragen, die die Autofahrer an die Existenz von Molsons Bier, Hyundai-Autos und EZ Rock FM erinnern, wenn sie auf der Schnellstraße am Seeufer im Stau stehen.
Die Schichtung der Jahrzehnte in dem Viertel an der Spadina Avenue, das sich wie so viele ähnliche Stadtviertel in einem postindustriellen Übergangsstadium befindet, hat einen wundervollen zufälligen Charme. Die Lofts und Ateliers sind voller Leute, die genau wissen, dass sie eine Rolle in einem Stück urbaner Performance-Kunst spielen, aber meistens geben sie sich alle Mühe, keine Aufmerksamkeit auf diese Tatsache zu lenken. Wenn jemand zu viel Besitzanspruch auf das »wirkliche Spadina« erhebt, dann fühlen sich plötzlich alle nur noch als unbedeutende Requisiten, und das ganze kunstvolle Gebäude bricht zusammen.
Gleich an der Ecke meines Blocks wurde als Denkmal für die Textilarbeiterinnen in den Sweatshops ein riesiger Fingerhut errichtet. Dieses kitschige Monument für die Arbeitskräfte in den Ausbeutungsbetrieben der Textilbranche ist nur die deutlichste Manifestation einer schmerzhaften neuen Selbstwahrnehmung des Viertels. Überall in meiner Umgebung werden die alten Fabrikgebäude umgewidmet und in sogenannte »Loftwohnungskomplexe« mit Namen wie »Candy Factory« verwandelt. Natürlich gibt es auch einen Markt für Eigentumswohnungen in luxusrenovierten alten Sweatshops mit Badewannen und schiefergetäfelten Duschen, unterirdischem Parkhaus, Räumen mit Oberlicht und Conciergen, die rund um die Uhr im Dienst sind.
Mein Vermieter, der sein Vermögen der Herstellung und dem Vertrieb von Regenmänteln der Marke London Fog verdankt, hat sich bisher hartnäckig geweigert, unser Gebäude zur Einrichtung von Eigentumswohnungen mit besonders hohen Decken zu verkaufen. Irgendwann wird er dem Druck nachgeben, aber bis jetzt sind immer noch ein paar Textilfirmen bei ihm eingemietet. Sie sind zu klein, um nach Asien oder Mittelamerika umzuziehen, und aus irgendwelchen Gründen wollen sie dem Trend in der Branche auch nicht folgen und Heimwerker gegen Stücklohn beschäftigen. Der Rest des Gebäudes ist als Wohn- und Arbeitsraum an Yogalehrer, Dokumentarfilmer, Graphiker, Schriftsteller und andere Künstler vermietet. Die Kleiderleute aus dem Büro gegenüber, die immer noch Mäntel verkaufen, sehen schrecklich unbehaglich drein, wenn die Marilyn-Manson-Klone aus der Künstlerszene kettenklirrend und in schenkelhohen Lederstiefeln mit der Zahnpastatube in der Hand zum gemeinsamen Waschraum stampfen. Aber was können sie tun? Wir sind im Augenblick alle hier zusammengepfercht, eingeklemmt zwischen der harten Realität der wirtschaftlichen Globalisierung und der unausrottbaren Rockvideo-Ästhetik.
JAKARTA – »Frag sie, was sie herstellt, was auf dem Label steht. Verstehst du – Label«, sagte ich, griff nach hinten und schlug den Kragen meines T-Shirts hoch. Die indonesischen Arbeitskräfte waren inzwischen an Leute wie mich gewöhnt. Fremde, die mit ihnen über die furchtbaren Arbeitsbedingungen in den Fabriken sprachen, wo sie für multinationale Konzerne wie Nike, Gap und Liz Claiborne schneiden, nähen und leimen. Aber diese Näherinnen sehen ganz anders aus als die ältlichen Textilarbeiterinnen, denen ich daheim im Aufzug begegne. Hier sind alle jung, manche gerade erst fünfzehn und kaum eine älter als dreiundzwanzig.
An jenem Tag im August 1997 hatten die unerträglichen Arbeitsbedingungen zu einem Streik in der Textilfabrik Kaho Indah Citra in dem Industriegebiet Kawasan Berikat Nusantar am Stadtrand von Jakarta geführt. Der Grund für den Arbeitskampf der Kaho-Arbeiterinnen, deren Tagesverdienst umgerechnet zwei Dollar betrug, waren die zahlreichen Überstunden, die sie ohne die gesetzlich vorgeschriebene Bezahlung leisten mussten. Nach einem dreitägigen Streik bot das Management einen Kompromiss an, der für eine Region mit einem entschieden zu entspannten Verhältnis zur Arbeitsgesetzgebung typisch war: Die Überstunden waren nicht mehr Pflicht, aber die Bezahlung blieb weiterhin niedriger als gesetzlich vorgeschrieben. Die 2000 Arbeitskräfte kehrten an ihre Nähmaschinen zurück – alle außer 101 jungen Frauen, die das Management als die Unruhestifter betrachtete, die den Streik ausgelöst hatten. »Unser Fall ist noch immer nicht geklärt«, sagte mir eine dieser Arbeiterinnen, völlig niedergeschlagen und ohne Hoffnung auf eine positive Lösung.
Ich sympathisierte natürlich mit den Opfern, aber als Fremde aus dem Westen wollte ich die Markennamen der Textilien wissen, die in der Kaho-Fabrik hergestellt wurden. Wenn ich daheim von der Sache berichtete, würden sie mir als journalistischer Aufhänger dienen. Also drängten wir uns nun zu zehnt in einem Betonbunker, der kaum größer war als eine Telefonzelle, und spielten mit Begeisterung Firmen-Charade.
»Diese Firma stellt lange Ärmel für die kalte Jahreszeit her«, sagte eine der Arbeiterinnen.
»Sweaters?«, riet ich.
»Nein, keine Sweaters, glaube ich. Wenn man ausgehen will, und es ist kalt draußen, dann zieht man einen …«
»Mantel an«, rief ich.
»Ja, aber keinen schweren, einen leichten.«
»Eine Jacke!«
»Ja, wie eine Jacke, aber keine Jacke – sondern lang.«
Die Verwirrung ist leicht zu erklären: Am Äquator herrscht nicht gerade großer Bedarf an Mänteln, weder im Kleiderschrank noch im Wortschatz. Und doch kommen immer weniger Kanadier mit der Kleidung der letzten beharrlichen Näherinnen aus der Spadina Avenue durch ihre kalten Winter. Immer mehr tragen die Produkte junger asiatischer Frauen, die in heißen Klimaregionen wie der von Jakarta arbeiten. Im Jahr 1997 importierte Kanada für 11,7 Millionen Dollar Anoraks und Skijacken aus Indonesien, im Vergleich zu 4,7 Millionen im Jahr 1993.[1] So viel wusste ich bereits. Aber ich kannte immer noch nicht den Markennamen der langen Mäntel, die die Kaho-Arbeiterinnen zusammengenäht hatten, bevor sie ihre Arbeit verloren.
»Lang, ja. Und was steht auf dem Label?«, fragte ich wieder.
Es gab eine kurze Diskussion und dann, endlich, eine Antwort: »London Fog.«
Ein globaler Zufall, vermute ich. Ich begann, den Arbeiterinnen zu erzählen, dass meine Wohnung in Toronto früher eine Textilfabrik von London Fog gewesen war. Doch ich hörte abrupt damit auf, als die Arbeiterinnen ganz entsetzte Gesichter machten. Der Gedanke, dass ich in einem Gebäude wohnte, in dem sich ein Textilbetrieb befand, hatte sie in Angst und Schrecken versetzt. In diesem Teil der Welt verbrennen jedes Jahr Hunderte von Arbeitskräften, weil ihre Schlafquartiere über feuergefährlichen Sweatshops liegen.
Als ich so im Schneidersitz auf dem Betonboden des kleinen Schlafraums saß, kamen mir meine Nachbarn von daheim in den Sinn: der Ashtanga-Yoga-Lehrer im zweiten Stock, der Trickfilmzeichner aus der Werbebranche im vierten und der Aromakerzenvertrieb im achten. Es scheint, dass die jungen Frauen in den Ex-portproduktionszonen eine Art Mitbewohner von uns sind, mit uns verbunden durch ein weltumspannendes Netz von Stoffen, Schuhbändern, Franchisebetrieben, Teddybären und Markennamen. Ein weiteres Logo, das wir gemeinsam hatten, war Esprit, eine der Marken, die ebenfalls in der Zone hergestellt wurden. Als Teenagerin hatte ich in einem Geschäft gearbeitet, das Esprit-Kleidung verkaufte. Und natürlich war auch McDonald’s präsent: Eine Niederlassung hatte gerade in der Nähe von Kaho eröffnet, sehr zum Verdruss der Arbeiterinnen, für die das angeblich so preisgünstige Essen völlig unerschwinglich war.
Berichte über das weltweite Netz von Logos und Produkten sind normalerweise in der euphorischen Marketingsprache des Global Village abgefasst, jener phantastischen Welt, in der Stammesmitglieder im fernsten Regenwald eifrig auf ihre Laptops hacken, sizilianische Großmütter Internetfirmen betreiben und »Global Teens« einen »weltweiten Kulturstil« gemeinsam haben, um eine Website von Levi’s zu zitieren.[2] Alle Konzerne, von Coca-Cola über McDonald’s bis zu Motorola, bauen ihre Marketingstrategie auf dieser postnationalen Vision auf, doch es ist die schon lange laufende IBM-Kampagne »Lösungen für einen kleinen Planeten«, die das egalitäre Versprechen eines durch Logos vernetzten Erdballs am eindrucksvollsten zum Ausdruck bringt.
Es hat nicht lange gedauert, bis die Begeisterung über diese manische Interpretation der Globalisierung nachließ und die Brüche und Risse hinter der Hochglanzfassade sichtbar wurden. Immer häufiger bekamen wir im Westen Einblicke in ein ganz anderes globales Dorf, wo die wirtschaftliche Ungleichheit wächst und der kulturelle Spielraum abnimmt.
In diesem Dorf sind einige Multis nicht etwa damit beschäftigt, Ungleichheiten zu beseitigen, indem sie Arbeit und Technik für alle anbieten. Vielmehr beuten sie die ärmsten und rückständigsten Regionen des Planeten schamlos aus und machen unvorstellbare Gewinne dabei. In diesem globalen Dorf lebt Bill Gates, der ein Vermögen von mehr als 55 Milliarden US-Dollar angesammelt hat, während ein Drittel seiner Arbeitskräfte als Aushilfen eingestuft sind und Konkurrenten entweder von dem Monolithen Microsoft einverleibt oder durch raffiniertes Software-Bundling ausgeschaltet werden. In diesem Dorf sind wir tatsächlich durch ein Netz von Marken miteinander verbunden, doch die Kehrseite dieses Netzes sind solche Slums der Modeindustrie wie der, den ich bei Jakarta besuchte. IBM behauptet, seine Technik sei weltumspannend, und das ist sie auch, doch seine internationale Präsenz besteht häufig darin, dass billige Arbeitskräfte in der Dritten Welt die Computerchips und Energiequellen produzieren, mit denen unsere Maschinen laufen. In einem Außenbezirk von Manila lernte ich zum Beispiel ein siebzehnjähriges Mädchen kennen, das CD-ROM-Laufwerke für IBM herstellt. Ich sagte, ich sei beeindruckt, dass eine so junge Frau so moderne technische Geräte herstelle. »Wir machen Computer«, sagte sie, »aber wir wissen nicht, wie man sie bedient.« Wie es scheint, ist unser Planet vielleicht doch nicht so klein.
Der Titel No Logo ist nicht wörtlich gemeint im Sinne von »Keine Logos mehr!«, und er ist auch kein Post-Logo-Logo (wie ich gehört habe, gibt es bereits ein Bekleidungssortiment mit dem Logo »No Logo«). Vielmehr ist der Titel ein Versuch, die konzernkritische Haltung auszudrücken, die ich bei vielen jungen Aktivisten entstehen sehe. Dieses Buch basiert auf einer einfachen Hypothese: Wenn immer mehr Leute die dunklen Geheimnisse des globalen Markennetzes entdecken, wird ihre Empörung der Antrieb für die nächste große politische Bewegung, eine gewaltige Welle des Widerstands, die sich frontal gegen die multinationalen Konzerne richtet, und zwar besonders gegen solche, die stark mit einer Marke identifiziert werden.
Ich muss jedoch betonen, dass dieses Buch keine wilden Voraussagen macht, sondern auf Beobachtungen aus erster Hand beruht. Es ist eine Untersuchung über ein weitgehend im Untergrund arbeitendes System, das Informationen vermittelt und Protest organisiert, ein System, das heute schon von Aktivitäten und Ideen pulsiert, die viele Grenzen überschreiten und mehrere Generationen erfassen.
Vor vier Jahren, als ich dieses Buch zu schreiben begann, basierte meine Hypothese vor allem auf einem Gefühl. Ich hatte ein wenig an verschiedenen Universitäten recherchiert und festgestellt, dass viele Studenten, mit denen ich sprach, sich stark mit dem Vordringen von Privatunternehmen an ihre staatlichen Hochschulen beschäftigten. Sie ärgerten sich darüber, dass in ihre Cafeterias, Gemeinschaftsräume und sogar in die Waschräume immer mehr Werbung einsickerte; dass ihre Universitäten Exklusivverträge mit Getränkefirmen und Computerherstellern schlossen; und dass wissenschaftliche Untersuchungen immer mehr nach Marktforschung aussahen.
Natürlich stellen diese konzernkritischen Studenten nicht die Mehrheit in ihrer demographischen Gruppe – auch diese Bewegung wird, wie alle Bewegungen, von einer Minderheit getragen, aber von einer zunehmend machtvollen. Die Gegnerschaft zu den Konzernen ist der politische Inhalt, der die kommende Generation von Unruhestiftern und Aufrührern inspirieren wird. An den radikalen Studenten der sechziger Jahre und den Identitätsaktivisten der achtziger und neunziger Jahre kann man sehen, welche verändernde Kraft ein solcher Bewusstseinswandel entfalten kann.
Auch bei meiner journalistischen Arbeit für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften fiel mir auf, dass konzernkritische Ideen im Zentrum der neueren gesellschafts- und umweltpolitischen Kampagnen standen. Wie die studentischen Aktivisten, die ich kennenlernte, konzentrierten sich auch die führenden Personen in diesen Kampagnen auf die globalen und lokalen Auswirkungen aggressiven Sponsorings und aggressiver Verkaufsstrategien von Großkonzernen auf den öffentlichen Raum und das kulturelle Leben. Kleinstädte in ganz Nordamerika kämpften verzweifelt gegen die Ansiedlung von großen Einzelhändlern wie Wal-Mart. In London fand der McLibel-Prozess statt: Der Fastfoodkonzern McDonald’s hatte zwei Umweltaktivisten wegen Verleumdung angezeigt. Doch die Angeklagten drehten den Spieß um und nutzten das Verfahren, um dem allgegenwärtigen Franchiseunternehmen vor der Weltöffentlichkeit des Cyberspace den Prozess zu machen. Und es erhob sich eine Welle der Empörung und des Protests gegen den Ölkonzern Shell, als der Schriftsteller und Anti-Shell-Aktivist Ken Saro-Wiwa gehenkt wurde.
Ein Element hatten all diese weit verstreuten Proteste und Kampagnen gemeinsam: In allen Fällen stand ein Großunternehmen mit einem bekannten Markennamen im Zentrum des Angriffs – Shell, Wal-Mart, McDonald’s (und andere: Nike, Microsoft, Disney, Starbucks, Monsanto und so weiter). Bevor ich dieses Buch begann, wusste ich nicht, ob die verschiedenen Brennpunkte des konzernkritischen Widerstands noch andere Dinge gemeinsam hatten, als dass sie sich auf bekannte Markennamen konzentrierten. Dies wollte ich herausfinden. Die Suche nach der Antwort führte mich in einen Londoner Gerichtssaal, als das Urteil im McLibel-Prozess verkündet wurde; sie führte mich zu Ken Saro-Wiwas Freunden und Verwandten; zu Demonstrationen gegen Sweatshops vor Nike-Town-Superstores in New York und San Francisco, und zu gewerkschaftlichen Versammlungen in den Lebensmittelabteilungen pompöser Einkaufszentren. Sie brachte mich auf die Straße mit einem »alternativen« Verkäufer von Reklametafeln und auf die Pirsch mit »Adbustern«, die den Sinn dieser Reklametafeln durch ihre eigene Botschaft verändern wollten. Und sie führte mich auch auf mehrere spontane Straßenfeste, deren Organisatoren den öffentlichen Raum wenigstens für kurze Zeit aus der Gefangenschaft durch Werbung, Autos und Polizei befreien wollten. Meine Suche führte mich auch zu heimlichen Treffen mit Hackern, die damit drohten, die Computersysteme amerikanischer Konzerne, die ihrer Ansicht nach die Menschenrechtsverletzungen in China unterstützten, lahmzulegen.
Am denkwürdigsten aber waren meine Besuche in Fabriken und Gewerkschaftsquartieren in Südostasien und in den Außenbezirken von Manila. Dort schrieben philippinische Arbeiter Sozialgeschichte, als sie sich in einer der Exportproduktionszonen, wo die bekanntesten Markenartikel der Welt hergestellt werden, erstmals gewerkschaftlich organisierten.
Im Lauf meiner Suche stieß ich auch auf eine amerikanische Studentengruppe, die auf die multinationalen Konzerne in Burma Druck ausübt, damit sie sich wegen der Menschenrechtsverletzungen der Militärdiktatur aus dem Land zurückziehen. In ihren Kommuniqués bezeichnen sich diese Aktivisten als »Spinnen«, eine Metapher, die mir für ihre weltumspannenden Aktivitäten im Webzeitalter sehr passend erscheint. Logos kommen dank ihrer Allgegenwärtigkeit einer Weltsprache am nächsten; sie werden an mehr Orten verstanden als Englisch. Politische Aktivisten können sich heute wie spionierende Spinnen in diesem Netz von Logos bewegen und deshalb Informationen über Arbeitsbedingungen, freigesetzte Chemikalien, Tierquälerei und unethisches Marketing auf der ganzen Welt publik machen.
Ich bin inzwischen überzeugt, dass dieses auf Logos beruhende Netz es den mündigen Bürgern der globalisierten Welt letztlich ermöglichen wird, nachhaltige Lösungen für diesen verkauften Planeten zu finden. Ich erhebe nicht den Anspruch, in diesem Buch das ganze Programm einer globalen Bewegung zu formulieren, die noch in den Kinderschuhen steckt. Ich will lediglich die ersten Stadien des Widerstands verfolgen und einige grundlegende Fragen stellen: Welche Bedingungen haben die Bühne für die heutige Gegenreaktion bereitet? Erfolgreiche multinationale Konzerne sehen sich zunehmend Angriffen ausgesetzt, ob es sich nun um eine Torte im Gesicht von Bill Gates handelt oder darum, dass der Swoosh von Nike unablässig parodiert wird – welche Faktoren sind es, die immer mehr Leute dazu treiben, auf die multinationalen Konzernen misstrauisch oder gar ausgesprochen empört zu reagieren, obwohl diese doch die Motoren des globalen Wachstums sind? Und vielleicht noch wichtiger, was gibt so vielen Menschen – und besonders jungen Leuten – die Freiheit, ihrem Misstrauen und ihrer Wut durch Taten Ausdruck zu verleihen?
Diese Fragen scheinen vielleicht unnötig, weil einige einfache Antworten schon im Umlauf sind. Etwa, dass die Konzerne so groß wurden, dass sie die Staaten überflügelt haben. Oder dass Konzerne im Gegensatz zu Regierungen nur ihren Aktionären verantwortlich sind und wir nicht über die Mittel verfügen, sie zur Rechenschaft gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit zu zwingen. Es gibt zahlreiche Bücher, die das Thema »Konzernherrschaft« erschöpfend behandeln, und viele waren für mein eigenes Verständnis der Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung (siehe die Lektüreliste ab Seite 451).
Dieses Buch ist jedoch kein weiterer Bericht über die Macht jener ausgewählten Gruppe riesiger Konzerne, die sich zusammengetan haben, um unsere De-facto-Weltregierung zu bilden. Vielmehr ist das Buch ein Versuch, die Kräfte des Widerstands zu analysieren und zu dokumentieren, die sich gegen die Konzernherrschaft formieren. Und es versucht darzulegen, welche spezifischen kulturellen und wirtschaftlichen Bedingungen die Entstehung dieser Opposition unvermeidlich gemacht haben. Teil I, »No Space«, untersucht die Kapitulation von Kultur und Bildungswesen gegenüber dem Marketing. Teil II, »No Choice«, berichtet darüber, wie die Verheißung einer gewaltigen Zunahme der kulturellen Vielfalt durch Fusionen, aggressives Franchising, Kooperation und Zensurmaßnahmen der Konzerne gebrochen wurde. Und Teil III, »No Jobs«, berichtet über Trends auf dem Arbeitsmarkt, die für viele Arbeiter zunehmend unsichere Beschäftigungsverhältnisse bedeuten. Diese Entwicklung ist durch selbständige Erwerbstätigkeit, schlecht bezahlte »McJobs«, Outsourcing, Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverhältnisse gekennzeichnet. Der Zusammenprall und das Zusammenspiel dieser Kräfte – der Angriff auf die drei gesellschaftlichen Grundpfeiler Beschäftigung, Bürgerrechte und öffentlicher Raum – hat zur Entstehung des aktiven Widerstands gegen die Großkonzerne geführt, über den in Teil IV, »No Logo«, berichtet wird. Dieser Aktivismus legt die Saat für eine echte Alternative zur Konzernherrschaft.
No Space
Kapitel 1Neue Markenwelt
Als Privatperson liebe ich Landschaften, und ich habe es noch nie erlebt, dass eine Landschaft durch eine Reklametafel verschönert worden wäre. Der Mensch zeigt sich von seiner hässlichsten Seite, wenn er eine Reklametafel aufstellt, wo die Aussicht am schönsten ist. Wenn ich die Madison Avenue verlasse und in den Ruhestand gehe, gründe ich eine maskierte Selbstschutzgruppe, die auf schallgedämpften Motorrädern rund um die Welt fährt und in mondlosen Nächten Plakatwände fällt. Wie viele Geschworenengerichte würden uns wohl verurteilen, wenn wir bei diesem wohltätigen Akt bürgerlichen Ungehorsams erwischt würden?
David Ogilvy, Gründer der Werbeagentur Ogilvy & Mather in: Geständnisse eines Werbemannes, 1963, dt. 1964.
Die im Laufe der letzten 15 Jahre ins Astronomische gestiegene Wirtschaftskraft und der ungeheure kulturelle Einfluss der multinationalen Konzerne können mit einem gewissen Recht auf eine einzige, scheinbar harmlose Idee zurückgeführt werden. Sie wurde Mitte der achtziger Jahre von Managementtheoretikern entwickelt und lautet, dass erfolgreiche Unternehmen in erster Linie Marken herstellen sollten, keine Produkte.
Bis zu diesem Zeitpunkt galt es bei den Unternehmen zwar als wichtig, einen Markennamen zu stärken, doch das wichtigste Anliegen jedes seriösen Herstellers war die Güterproduktion. Dieses Anliegen war das Evangelium des Industriezeitalters. Lange Zeit blieb die Herstellung von Dingen zumindest im Prinzip das Herz aller industrialisierten Volkswirtschaften. In der Rezession der achtziger Jahre gerieten jedoch einige große Hersteller ins Trudeln, und es wurde allgemeiner Konsens, dass sie aufgebläht und zu groß waren. Sie besaßen zu viel, hatten zu viele Beschäftigte und waren mit zu vielen Dingen belastet. Der Produktionsprozess als solcher – der Betrieb eigener Fabriken, die Verantwortung für Zehntausende von fest angestellten Arbeitskräften –, all das wirkte nun nicht mehr wie der Schlüssel zum Erfolg, sondern wie eine schwere Last.
Etwa um diese Zeit begannen Unternehmen neuen Stils, wie Nike und Microsoft und später Tommy Hilfiger und Intel, mit den traditionellen amerikanischen Herstellern um Marktanteile zu konkurrieren. Diese Pioniere stellten die verwegene Behauptung auf, dass die Herstellung von Gütern nur ein zufälliger Bestandteil ihrer Operationen sei und sie dank der vor kurzem erfolgten Liberalisierung des Handels und der Reform des Arbeitsrechts ihre Produkte von anderen Unternehmen herstellen lassen könnten. Diese Lieferanten befanden sich oft in Übersee. Die Unternehmen neuen Stils stellten nicht mehr in erster Linie Dinge her, sondern Markenimages. Ihre eigentliche Arbeit bestand nicht mehr in der Herstellung, sondern in der Vermarktung. Diese Formel hat sich – wie wir heute wissen – als unglaublich gewinnbringend erwiesen, und ihr Erfolg hat dazu geführt, dass die Großunternehmen einen Wettstreit im Ballastabwerfen begonnen haben. Diesen Wettlauf gewinnt, wer am wenigsten besitzt, die wenigsten Arbeitskräfte beschäftigt und nicht die besten Produkte, sondern die mächtigsten Images produziert.
Die Fusionswelle der letzten paar Jahre ist angesichts dieser Entwicklung ein trügerisches Phänomen. Es sieht nur so aus, als ob die Giganten, indem sie sich zusammentun, immer größer werden. In Wirklichkeit schrumpfen sie in vieler Hinsicht, wenn auch nicht, was ihre Gewinne betrifft. Ihre scheinbare Größe ist ganz einfach der beste Weg zu ihrem eigentlichen Ziel: der Loslösung von der Welt der Dinge. Da viele der bekanntesten Hersteller heute keine Produkte mehr herstellen und Werbung für sie machen, sondern Produkte kaufen und sie mit ihren Markennamen versehen, sind sie ständig auf der Suche nach kreativen neuen Wegen, das Image ihrer Marken aufzubauen und zu verbessern. Zur Herstellung von Produkten mag man Bohrer, Schmelzöfen, Hämmer und Ähnliches benötigen, aber für die Herstellung einer Marke benötigt man ganz andere Werkzeuge. Sie erfordert eine endlose Reihe von Markenerweiterungen, eine stete Erneuerung der Bildersprache für das Marketing und vor allem neue Räume, New Spaces, um das Selbstverständnis der Marke zu verbreiten. In diesem ersten Teil des Buches wird untersucht, wie die Besessenheit von der Markenidentität zu einem teils verdeckten, teils offenen Krieg gegen den öffentlichen und individuellen Raum führt, gegen öffentliche Einrichtungen wie etwa Schulen, gegen die Identität von Jugendlichen, gegen das Konzept der Nationalität und gegen das Potential an nicht vermarkteten Räumen.
Der Ursprung der Marke
Es ist nützlich, kurz Rückschau zu halten, wie es überhaupt zur Einführung von Marken kam. Obwohl die Begriffe oft synonym verwendet werden, sind Markenpolitik bzw. Branding und Produktwerbung keineswegs dasselbe. Die Werbung für irgendein Produkt ist genau wie das Sponsoring oder die Lizenzerteilung für die Verwendung eines Logos nur ein Teil des großen markenpolitischen Programms. Man muss sich die Marke als die Kernbedeutung des modernen Konzerns vorstellen und die Werbung nur als eines von vielen Instrumenten, um der Welt diese Kernbedeutung mitzuteilen.
Die ersten massiven Marketingkampagnen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten mehr mit Werbung zu tun als mit Markenpolitik, wie wir sie heute verstehen. Angesichts einer Vielzahl neu erfundener Produkte – Radio, Phonograph, Auto, Glühbirne und so weiter – hatten die Werbefachleute Wichtigeres zu tun, als für irgendein Unternehmen eine Markenidentität zu schaffen. Zunächst einmal mussten sie die Lebensweise der Menschen verändern. Sie mussten die Verbraucher durch Anzeigen über die Existenz eines neuen Produkts informieren und dann ihre potentiellen Käufer davon überzeugen, dass es ihre Lebensqualität erhöhte, wenn sie beispielsweise Auto statt Pferdewagen fuhren, telefonierten statt Briefe schrieben oder elektrisches Licht statt Öllampen verwendeten. Viele dieser neuen Produkte hatten Markennamen – und einige existieren bis heute –, aber diese Namen spielten noch keine große Rolle. Die Produkte selbst waren die Neuheit; und das war fast Werbung genug.
Die ersten Markenartikel tauchten etwa um dieselbe Zeit auf wie die ersten Anzeigen zur Vermarktung neuer Erfindungen, und zwar vor allem im Zusammenhang mit einer anderen relativ neuen Errungenschaft – der Fabrik. Durch die Fabrikproduktion kamen nicht nur ganz neue Güter auf den Markt, sondern auch alte Produkte in erschreckend neuer Gestalt, darunter auch ganz alltägliche Massenerzeugnisse. Die frühen Bemühungen zur Etablierung von Marken unterschieden sich von den direkteren Verkaufsmethoden früherer Zeiten dadurch, dass der Markt jetzt mit einheitlichen Massenprodukten überschwemmt wurde, die praktisch nicht mehr voneinander zu unterscheiden waren. Der Wettbewerb durch Markenartikel wurde eine Notwendigkeit des Maschinenzeitalters – aufgrund der fabrikmäßig erzeugten Gleichheit musste parallel zur Herstellung des Produkts eine auf dem Image beruhende Verschiedenheit produziert werden.
Die Werbung hatte von nun an nicht mehr die Funktion, Informationen über ein Produkt mitzuteilen, sondern für eine mit einem Markennamen versehene Version eines Produkts ein Image aufzubauen. Als Erstes bekamen unspezifische Güter wie Zucker, Mehl, Seife oder Getreideflocken, die früher vom Ladenbesitzer aus einem Fass geschöpft worden waren, Eigennamen verpasst. In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurden Massenprodukte wie Campbell’s Soup, Konserven von H.J. Heinz und Quaker-Oats-Haferflocken mit dem Logo des Herstellers versehen. Wie die Designhistoriker und Designtheoretiker Ellen Luton und J. Abbott Miller schreiben, waren diese Logos darauf zugeschnitten, volkstümlich und vertrauenerweckend zu wirken, denn sie sollten die neue, beunruhigende Anonymität der verpackten Güter neutralisieren. »Vertraute Persönlichkeiten wie Dr. Brown, Aunt Jemima und Old Grand-Dad ersetzten allmählich den Ladenbesitzer, der den Kunden bis dahin die Massenware abgewogen und angepriesen hatte …, als Schnittstelle zwischen Verbraucher und Produkt.«[1] Nach Einführung der Produktnamen und Produktcharaktere gab ihnen die Werbung das Forum, potentielle Verbraucher direkt anzusprechen. Die spezifisch benannte, verpackte und beworbene »Produktpersönlichkeit« war auf der Bildfläche erschienen.
Die Anzeigenkampagnen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts beruhten in der Regel auf einer Garnitur strenger, pseudowissenschaftlicher Formeln: Konkurrenten wurden nie erwähnt, die Anzeigen bestanden nur aus Aussagesätzen, und die Überschriften mussten groß sein, mit viel weißem Raum. Laut einem Werbefachmann um die Jahrhundertwende sollte »eine Anzeige groß genug sein, um Eindruck zu machen, aber nie größer als die Sache, für die geworben wird«.
Einige der Werbeleute hatten jedoch begriffen, dass Werbung nicht nur wissenschaftlich war; sie war auch spirituell. Marken konnten ein Gefühl wecken – etwa Geborgenheit wie Aunt Jemima –, aber nicht nur das, ganze Unternehmen konnten eine bestimmte Bedeutung verkörpern. In den frühen zwanziger Jahren machte der legendäre Werbeagent Bruce Barton den Autokonzern General Motors (GM) zu einer Metapher für die amerikanische Familie, zu »etwas Persönlichem, Warmem und Menschlichem«. Auch GE waren nun nicht mehr in erster Linie das Akronym der gesichtslosen General Electric Company, sondern, mit Bartons Worten, »die Initialen eines Freundes«. Wie Barton 1923 sagte, hatte Werbung die Aufgabe, den Unternehmen beim Finden ihrer Seele zu helfen. Der Pfarrerssohn profitierte von seiner religiösen Erziehung, wenn er seine erhebenden Botschaften verfasste. »Werbung ist für mich etwas Großes, etwas Herrliches, etwas, das tief in eine Institution eindringt und ihre Seele ergreift …«, sagte er zu Pierre du Pont, dem Präsidenten von GM. »Auch Institutionen haben eine Seele, genau wie Menschen und Völker eine Seele haben.«[2] Anzeigen von GM begannen Geschichten über die Leute zu erzählen, die die Autos des Unternehmens fuhren – über den Priester, den Apotheker oder den Landarzt, der dank seines zuverlässigen GM gerade noch rechtzeitig »am Bett eines sterbenden Kindes eintrifft, um es wieder zum Leben zu erwecken«.
Ende der vierziger Jahre setzte sich allmählich die Erkenntnis durch, dass eine Marke nicht nur ein Maskottchen, ein Schlagwort oder ein Bild auf der Verpackung eines Produkts war. Ein Konzern als Ganzes konnte eine Markenidentität besitzen oder ein »Unternehmensbewusstsein«, wie diese kurzlebige Eigenschaft damals genannt wurde. Als sich diese Idee durchsetzte, sah sich der Werbeagent nicht mehr als Verkäufer, sondern als »Philosoph der Kommerzkultur«,[3] so der Reklamekritiker Randall Rothberg. Die Suche nach der wahren Bedeutung der Marke – oder der »Markenessenz«, wie sie oft bezeichnet wird – führte die Agenturen allmählich weg von den einzelnen Produkten und ihren Eigenschaften und hin zu einer psychologisch-anthropologischen Untersuchung der Bedeutung von Marken für Alltag und Kultur. Diese Veränderung galt als entscheidend, denn Unternehmen mögen Produkte herstellen, aber die Verbraucher kaufen Marken.
Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis sich die Hersteller wirklich auf diesen Wandel einstellten. Sie klammerten sich an die Vorstellung, dass die Herstellung von Gütern noch immer ihre zentrale Aufgabe war und die Etablierung von Marken nur ein wichtiger Zusatzbereich. In den achtziger Jahren kam dann der manische Glaube an das »Markenkapital«. Schlüsselereignis war der Kauf von Kraft durch Philip Morris im Jahr 1988 – für 12,6 Milliarden Dollar, dem sechsfachen Buchwert des Konzerns. Die Preisdifferenz ergab sich offensichtlich aus dem Wert des Wortes »Kraft«. Natürlich war man sich an der Wall Street bewusst, dass jahrzehntelanges Marketing und jahrzehntelange Markenpflege einem Unternehmen über sein Vermögen und seinen jährlichen Gesamtumsatz hinaus Wert verschaffen konnte. Doch mit dem Erwerb von Kraft hatte etwas, das zuvor abstrakt und nicht quantifizierbar gewesen war, einen konkreten Wert in Dollar erhalten – ein Markenname. Dies war eine sensationelle Nachricht für die Werbewelt, denn sie konnte nun »beweisen«, dass die Ausgaben für Werbung keine bloße Verkaufsstrategie, sondern eine knallharte Investition in den Marktwert des Unternehmens waren. Wie zu erwarten, führte dies zu einer beträchtlichen Erhöhung der Werbeetats. Wichtiger noch, es löste ein neues Interesse am Aufblähen von Markenidentitäten aus, einem Projekt, für das mehr erforderlich war als nur ein paar Reklametafeln und Fernsehspots. Viel Geld musste in Sponsoring investiert werden, neue Bereiche für die »Erweiterung« der Marke mussten aufgetan werden, und natürlich musste man auch ständig dem Zeitgeist auf der Spur sein, damit die für die Marke gewählte »Essenz« mit dem Karma des Zielmarktes übereinstimmte. Aus Gründen, die im weiteren Verlauf dieses Kapitels untersucht werden, hat dieser radikale Wandel in der Unternehmensphilosophie bei den Herstellern eine kulturelle »Fressgier« ausgelöst, mit der sie, um ihre Marken aufzublähen, jede Nische noch unvermarkteter kultureller Landschaft verschlingen. Im Lauf dieser Entwicklung ist fast nichts unmarkiert geblieben – eine recht eindrucksvolle Leistung angesichts der Tatsache, dass die Marken noch 1993 von der Wall Street praktisch totgesagt worden waren.
Der Tod der Marke (ein stark übertriebenes Gerücht)
Am 2. April 1993 wurde der Sinn der Werbung just durch jene Marken in Frage gestellt, die die Werbeindustrie – in manchen Fällen über zwei Jahrhunderte lang – aufgebaut hatte. Dieser Tag ist bei Marketingleuten als »Marlboro Friday« in die Geschichte eingegangen, weil Philip Morris damals urplötzlich ankündigte, den Preis von Marlboro-Zigaretten um 20 Prozent zu senken. Der Konzern wollte sich damit gegen die Billigmarken wehren, an die er Marktanteile verlor. Die Preissenkung trieb die Marketingexperten zum Wahnsinn, und sie verkündeten unisono nicht nur den Tod von Marlboro, sondern den Tod aller Markennamen. Wenn eine Marke wie Marlboro, die mit über einer Milliarde Werbedollars aufs Sorgfältigste gepflegt, aufpoliert und herausgestellt worden war, in die verzweifelte Lage geriet, preislich mit Weißen Marken konkurrieren zu müssen, dann, so folgerten die Experten, hatte das ganze Konzept der Markenpolitik offensichtlich seinen Wert verloren. Die Öffentlichkeit hatte die Werbung gesehen, und die Werbung hatte die Öffentlichkeit kaltgelassen. Der Marlboro-Mann war schließlich nicht irgendwer; die Werbekampagne lief seit 1954 und war damit die am längsten laufende Werbekampagne der Geschichte. Sie war Legende. Wenn der Marlboro-Mann nichts mehr wert war, dann war auch die Marke als Kapital nichts mehr wert. Die Vermutung, dass die Amerikaner plötzlich massenhaft selbständig dachten, ließ die gesamte Wall Street erbeben. Als Philip Morris seine Preissenkung verkündete, gingen noch am selben Tag die Aktienkurse sämtlicher Haushaltsmarken auf Sturzflug: Heinz, Quaker Oats, Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble und RJR Nabisco. Philip Morris selbst erwischte es am schlimmsten.
»Wenn ein oder zwei mächtige Konsumgüterunternehmen wirklich anfangen, ernsthaft die Preise zu senken, gibt es eine Lawine«, begründete Bob Stanojev, USA-weiter Direktor für Konsumgütermarketing des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Ernst and Young, die Wall-Street-Panik. »Wertbewusste Generation, wir grüßen dich!«[4]
Die Panik des Marlboro Friday war allerdings nicht die Reaktion auf ein einzelnes Ereignis, sondern der Kulminationspunkt einer jahrelang gewachsenen Furcht, ausgelöst durch einen dramatischen Wandel der Verbrauchergewohnheiten, der Haushaltsmarken von Tide bis Kraft Marktanteile kostete. Schnäppchenhungrige Käufer, die hart von der Rezession getroffen waren, begannen mehr auf den Preis zu achten als auf das Markenprestige, das die Werbekampagnen der Yuppies den Produkten in den achtziger Jahren mit auf den Weg gegeben hatten. Die Öffentlichkeit litt unter einem schweren Fall von in der Marketingbranche sogenannter »Markenblindheit«.[5]
Die wilde Schnäppchenjagd der frühen neunziger Jahre erschütterte die etablierten Marken bis ins Mark. Plötzlich schien es klüger, Ressourcen in Preissenkungen und andere Kaufanreize zu stecken als in sagenhaft teure Werbekampagnen. Die Zweifel manifestierten sich in den Summen, die die Unternehmen noch willens waren, für sogenannte markenverbessernde Werbekampagnen auszugeben. So kam es, dass die hundert führenden US-amerikanischen Marken 1991 tatsächlich 5,5 Prozent weniger für Werbung ausgaben. Es war der erste Einbruch im steten Wachstum der amerikanischen Werbeetats seit einem kleinen Minus von 0,7 Prozent im Jahr 1970 und der größte Einbruch seit vier Jahrzehnten.[6]
Nicht dass die führenden Unternehmen ihre Produkte nicht mehr gepusht hätten, nur steckten viele ihr Geld nun lieber in Werbegeschenke, Wettbewerbe, Schaufensterdekorationen und (wie Marlboro) in Preissenkungen. Im Jahr 1983 hatten die amerikanischen Markenartikelhersteller 70 Prozent ihrer gesamten Marketingbudgets für Werbung und 30 Prozent für die anderen genannten Arten der Verkaufsförderung ausgegeben. 1993 hatte sich das Verhältnis umgekehrt: Nur noch 25 Prozent flossen in die Werbung und 75 Prozent in andere verkaufsfördernde Maßnahmen.
Wie vorauszusehen brach bei den Werbeagenturen eine Panik aus, als ihre Spitzenkunden sie verließen und lieber auf die verkaufsfördernde Wirkung von Preissenkungen setzten. Sie taten was sie konnten, um große Kunden wie Procter & Gamble und Philip Morris davon zu überzeugen, dass der richtige Weg aus der Markenkrise nicht weniger, sondern mehr Markenwerbung war. Auf dem Jahrestreffen der U.S. Association of National Advertisers im Jahr 1988 las Graham H. Phillips, der amerikanische Chairman von Ogilvy & Mather, den versammelten Wirtschaftsführern die Leviten, weil sie sich dazu herabließen, an einem »Gütermarkt« statt an einem imageorientierten Markt teilzunehmen. »Ich bezweifle, dass einer von Ihnen einen Gütermarkt begrüßen würde, auf dem der Wettbewerb nur durch den Preis, durch Verkaufsförderung und Sonderangebote bestimmt ist, alles Dinge, die von der Konkurrenz leicht nachgeahmt werden können und deshalb zu ständig sinkenden Gewinnen und letztlich zu Verfall und Bankrott führen.« Andere betonten, wie wichtig es sei, den »konzeptionellen Mehrwert« der Produkte zu bewahren, der de facto nur aus Marketing besteht. Wenn man nur noch auf der Grundlage des realen Wertes konkurrieren wolle, warnten die Werbeagenturen, werde dies nicht nur den Tod der Marken, sondern auch der Unternehmen bedeuten.
Etwa um die Zeit des Marlboro Friday fühlte sich die Werbeindustrie so unter Druck, dass der Marktforscher Jack Myers das Buch Adbashing: Surviving the Attacks on Advertising publizierte. Das Buch machte gegen alle Feinde der Werbeindustrie mobil, vom Kassierer, der Gutscheine für Erbsen aus der Dose verteilt, bis zum Abgeordneten, der eine neue Reklamesteuer ins Auge fasst. »Unsere Branche muss begreifen, dass die Feindseligkeit gegenüber der Werbung eine Bedrohung für den Kapitalismus, die Pressefreiheit, für die grundlegenden Formen der Unterhaltung und für die Zukunft unserer Kinder darstellt«, schrieb Myers.[7]
Trotz solchen Kampfgeschreis hielt sich bei den meisten Marktbeobachtern die Überzeugung, dass die beste Zeit der Wertschöpfung durch Markenpflege vorüber war. In den achtziger Jahren sei man auf Marken und exklusive Designerlabels abgefahren, argumentierte etwa David Scotland, Europachef von Hiram Walker. In den neunziger Jahren dagegen werde sich alles um den Preis drehen. »Vor einigen Jahren«, sagte Scotland, »galt es vielleicht noch als schick, ein Hemd mit dem Logo des Designers auf der Brusttasche zu tragen; heute wirkt es offen gesagt recht geschmacklos.«[8]
Auf der anderen Seite des Atlantiks, in Cincinnati, kam die Journalistin Shelly Reese ebenfalls zu dem Schluss, dass eine markennamenlose Zukunft bevorstand. »Es ist vorbei, dass Amerikaner mit dem Calvin-Klein-Logo auf der Gesäßtasche Einkaufswagen voller Perrier die Gänge im Supermarkt hinunterschieben«, schrieb sie. »Heute tragen sie Klamotten mit Labels wie Jaclyn Smith von Kmart und haben Big-K-Soda von Kroger Co. im Einkaufswagen. Herzlich willkommen im Jahrzehnt der Hausmarken.«[9]
Wenn sich Scotland und Reese heute an ihre mutigen Voraussagen erinnern, dürften sie sich ein wenig blöd vorkommen. Ihr Logo auf der Gesäßtasche klingt angenehm dezent angesichts der heutigen Logomanie, und der Umsatz von Markentafelwasser ist seit Reeses Voraussage jährlich um neun Prozent gestiegen, bis 1997 entstand daraus eine Industrie mit 3,4 Milliarden Dollar Umsatz. Angesichts der Logoflut von heute erscheint es fast unvorstellbar, dass vor nur sechs Jahren der Tod der Marken nicht nur plausibel, sondern offensichtlich erschien.
Welche Entwicklung führte nach der feierlichen Beerdigung der Marke dazu, dass heute Bataillone von Menschen als freiwillige Werbetafeln für Tommy Hilfiger, Nike und Calvin Klein herumlaufen?
Das Comeback der Marken
Einige Marken waren überhaupt nicht betroffen, als die Wall Street ihren Tod verkündete. Sie waren quicklebendig.
Wie es die Werbeagenten zu Beginn der Rezession vorausgesagt hatten, erholten sich jene Unternehmen am schnellsten von der negativen Entwicklung, die stets das Marketing über die Preispolitik gestellt hatten: Nike, Apple, Body Shop, Calvin Klein, Disney, Levi’s und Starbucks. Diesen Unternehmen ging es hervorragend, und die Markenpolitik nahm bei ihnen eine immer wichtigere Stellung ein. Das reale Produkt war für sie nur noch Füllstoff für das eigentliche Produkt – die Marke. Sie integrierten die Markenphilosophie fest in ihre Unternehmensstruktur. Ihre Unternehmenskultur war so rigide und klösterlich, dass sie von außen wie eine Mischung aus Studentenverbindung, religiösem Kult und Sanatorium wirkte. Alles war Werbung für die Marke: bizarre Begriffe für die Angestellten (Partner, barristas, Teamgefährten, Mannschaftsmitglieder), eigene Lieder, CEOs als Superstars, fanatische Beachtung der Designkonsistenz, die Neigung zu Monumentalbauten und die missionarischen Erklärungen im Jargon des New Age. Im Gegensatz zu klassischen Haushaltsmarken wie Tide und Marlboro verloren diese Logos nicht an Wert, sondern waren auf dem besten Wege, alle Grenzen der Marketingwelt zu sprengen, indem sie zu kulturellen Accessoires und Bestandteilen einer Lifestyle-Philosophie wurden. Die genannten Unternehmen trugen ihr Image nicht wie ein billiges Hemd, sondern integrierten es so sehr in das Geschäft, dass andere Leute ihr Image als ihr Hemd trugen. Als andere Marken Schiffbruch erlitten, merkten es diese Unternehmen nicht einmal – sie waren markenorientiert bis auf die Knochen.
Das wirkliche Vermächtnis des Marlboro Friday besteht also darin, dass er ein grelles Licht auf die beiden wichtigsten Entwicklungen im Marketing und im Verbraucherverhalten der neunziger Jahre warf, nämlich einerseits auf die großen Kästen der Discounter, die (wie Wal-Mart und andere) keineswegs hip sind, aber das Lebensnotwendige liefern und einen übergroßen Teil des Marktes beherrschen, und andererseits die extrafeinen, mit einer »Attitude« verknüpften Marken (wie Nike und andere), die für die Lifestyle-Kultur die Essentials liefern und immer mehr kulturellen Raum erobern. Wie sich diese beiden Aspekte des Verbraucherverhaltens entwickelten, sollte in den folgenden Jahren großen Einfluss auf die Wirtschaft haben. Während die Gesamtausgaben für Werbung 1991 radikal einbrachen, lieferten sich Nike und Reebok eine erbitterte Schlacht auf dem Reklamesektor und erhöhten jeweils ihren Werbeetat (siehe Tafel 1.1 auf Seite 492). Reebok steigerte seine Werbeausgaben allein im Jahr 1991 um 71,9 Prozent, während Nike seinen ohnehin schon gewaltigen Werbeetat um weitere 24,6 Prozent aufblähte. Nikes Gesamtausgaben für Marketing waren damit auf die überwältigende Summe von 225 Millionen Dollar (1991) gestiegen. Ohne sich im Geringsten um preislichen Wettbewerb zu scheren, erfanden die Turnschuhverkäufer immer raffiniertere pseudowissenschaftlich legitimierte Luftpolster und trieben ihre Preise hinauf, indem sie gewaltige Sponsoringverträge mit Star-Athleten schlossen. Diese Strategie, die Marke zum Fetisch zu machen, schien gut zu funktionieren: In den sechs Jahren vor 1993 hatte das von Phil Knight geführte Unternehmen Nike aus Beaverton in Ohio seinen Jahresumsatz von 750 Millionen auf 4 Milliarden Dollar gesteigert, und seine Gewinne waren am Ende der Rezession um 900 Prozent höher als zu ihrem Beginn.
Benetton und Calvin Klein erhöhten inzwischen ebenfalls ihre Ausgaben für Lifestyle-Marketing. In ihrer Werbung brachten sie ihre Produkte mit gewagter Kunst und progressiver Politik in Verbindung. Kleidungsstücke traten in dieser modernen Konzeptwerbung kaum mehr in Erscheinung, von Preisen ganz zu schweigen. Noch abstrakter war die Werbung von Absolut Vodka, einer Firma, die schon seit einigen Jahren eine Marketingstrategie entwickelt hatte, bei der das Produkt verschwand und die Marke nur noch ein weißer flaschenförmiger Raum war. Diese Leere konnte mit jedem Inhalt gefüllt werden, den die jeweilige Zielgruppe sich bei ihrer Marke am meisten wünschte: intellektuell in der Zeitschrift Harper’s, futuristisch in Wired, alternativ in Spin, laut und stolz in Out und mit dem »Absolut Playmate« im Playboy. Die Marke erfand sich immer wieder neu, ein kultureller Schwamm, der seine jeweilige Umgebung in sich aufsaugt und sich ihr durch Gestaltwandel anpasst.
Im Jahr 1993, als der Galopp des Marlboro-Mannes zeitweise von »markenblinden« Verbrauchern gebremst wurde, machte Microsoft sein sensationelles Debüt auf der von Advertising Age veröffentlichten Liste der 100 Unternehmen mit dem größten Werbeetat. Im selben Jahr erhöhte Apple seine Werbeausgaben um 30 Prozent. Das Unternehmen hatte bereits 1984 markenpolitisch Furore gemacht, als es mit der Platzierung von orwellhaften Fernsehspots während der Spiele um die Super Bowl seinen Aufstieg eingeleitet hatte. Beide Unternehmen verkauften eine modische neue Beziehung zur Maschine, die »Big Blue«, den IBM-Konzern, so plump und bedrohlich aussehen ließ wie den inzwischen beendeten Kalten Krieg.
Und dann gab es noch die Unternehmen, die schon immer gewusst hatten, dass sie in erster Linie Marken und nicht Produkte verkauften. Coke, Pepsi, McDonald’s, Burger King und Disney ließen sich von der Markenkrise nicht verwirren und beschlossen, den Markenkrieg auszuweiten, insbesondere da sie das Ziel einer weltweiten Expansion fest vor Augen hatten (siehe Tafel 1.2 auf Seite 493). Diesen Ehrgeiz teilten sie mit einer ganzen Welle hochmoderner Hersteller/Einzelhändler, die Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre gewaltig aufblühten. Gap, Ikea und Body Shop breiteten sich in jener Zeit aus wie ein Steppenbrand. Sie verstanden es hauptsächlich durch sorgfältige Packungsgestaltung und die Förderung eines »experimentellen« Einkaufsumfeldes meisterhaft, No-Name-Produkte in Markenprodukte zu verwandeln. Body Shop war in Großbritannien schon seit den siebziger Jahren präsent, aber erst 1988 begannen die Kosmetikgeschäfte in den USA an jeder Straßenecke wie grünes Unkraut zu sprießen. Selbst in der schlimmsten Phase der Rezession eröffnete das Unternehmen in den USA noch jährlich 40 bis 50 Geschäfte. Am verblüffendsten für die Wall Street war dabei, dass Body Shop diese Expansion durchzog, ohne einen Cent für Werbung auszugeben. Wozu Plakatwände und Zeitungsanzeigen, wenn die Ladengeschäfte dreidimensionale Werbung für einen ethischen und ökologischen Umgang mit Kosmetik darstellen? Body Shop war ganz Marke.
Die Kaffeebarkette Starbucks expandierte in dem genannten Zeitraum ebenfalls, ohne viel für Werbung auszugeben. Stattdessen setzte sie ihren Namen in einer Vielzahl von Marken ein: Starbucks Flugzeugkaffee, Starbucks Bürokaffee, Starbucks Kaffee-Eis, Starbucks Kaffeebier. Starbucks schien den Markennamen in einem noch tieferen Sinne zu verstehen als die Madison Avenue; Marketing steckte in jeder Faser des Unternehmenskonzepts – von der Strategie, es mit Büchern, Blues und Jazz in Verbindung zu bringen, bis zu dem italienisch angehauchten Jargon des Unternehmens. Der Erfolg von Body Shop und Starbucks zeigte, wie weit die Markenpolitik über das bloße Plakatieren des Firmenlogos hinausgewachsen war. Beide Unternehmen hatten mächtige Identitäten aufgebaut, indem sie ihr Markenkonzept in einen Virus verwandelten und ihn durch eine Vielfalt von Kanälen in der Kultur freisetzten: durch Kultursponsoring, politische Auseinandersetzungen, durch die Erfahrung der Verbraucher und durch Markenerweiterung. Direkte Werbung wurde in diesem Kontext als eine ziemlich plumpe Störung einer viel organischeren Art der Imagepflege betrachtet.
Wie Scott Bedbury, der für Marketing zuständige Vorstand von Starbucks, öffentlich einräumte, »glauben die Verbraucher nicht daran, dass es riesige Unterschiede zwischen den Produkten gibt«. Deshalb mussten, laut Bedbury, die Marken durch die »Starbucks-Erfahrung« emotionale Verbindungen mit ihren Kunden knüpfen«.[10] Wer bei Starbucks ansteht, schreibt Starbucks CEO Howard Shultz, will nicht nur einen Kaffee. »Es kommt ihm auf die romantische Kaffee-Erfahrung an, auf das Gefühl von Wärme und Gemeinschaft, das man in den Starbucks-Geschäften bekommt.«[11]
Interessanterweise war Bedbury Marketingchef bei Nike, bevor er zu Starbucks wechselte. Unter seiner Regie wurden der Slogan »Just Do It« und andere bahnbrechende Neuerungen in der Markenpolitik eingeführt. Im folgenden Abschnitt erklärt er, wie den beiden verschiedenen Marken mit denselben Techniken Bedeutung verliehen wurde:
Nike zum Beispiel nutzt die tiefe emotionale Verbindung, die die Leute zu Sport und Fitness haben. Bei Starbucks erfährt man, wie der Kaffee sich mit den Lebensmustern der Menschen verwoben hat, und da liegen die Emotionen, die wir nutzen können … Eine große Marke erhöht die Herausforderung – sie gibt einer Erfahrung größere Bedeutung, gleichgültig ob es darum geht, in Sport und Fitness sein Bestes zu geben, oder darum, dass die Tasse Kaffee, die man trinkt, wirklich wichtig ist.[12]
Hier schien das Geheimnis hinter all den Erfolgsstorys der späten achtziger und frühen neunziger Jahre zu liegen. Die Lehre aus dem Marlboro Friday bestand darin, dass es nie eine echte Markenkrise gegeben hatte – es gab nur Marken mit Vertrauenskrisen. In der Wall Street schloss man aus der Krise, dass diejenigen Marken auch weiterhin florieren würden, die leidenschaftlich an die Grundsätze der Markenpolitik glaubten und sich in diesem Glauben durch nichts beirren ließen. Über Nacht wurde der Slogan: »Marken, nicht Produkte!« zum Kampfruf einer Renaissance des Marketing, angeführt von den Unternehmen neuen Stils, die sich als »Sinnvermittler« und nicht mehr als Produkthersteller betrachteten. Was sich änderte, war das Verständnis dessen, was – sowohl in der Werbung als auch in der Markenpolitik – verkauft wurde. Nach dem alten Paradigma wurde durch Marketing stets ein Produkt verkauft. Doch nach dem neuen Modell ist das Produkt immer sekundär. Es muss gegenüber der Marke als dem eigentlichen Produkt zurückstehen, und der Verkauf der Marke erfordert eine neue Komponente, die man nur als spirituell bezeichnen kann. Werbung bedeutet, mit einem Produkt hausieren zu gehen. Bei der Markenpolitik in ihren wahrsten und fortgeschrittenen Inkarnationen geht es um unternehmerische Transzendenz.
Es klingt verrückt, aber das ist der entscheidende Punkt. Am Marlboro Friday wurde zwischen den gemeinen Preisbrechern und den hochherzigen Markenpolitikern eine Trennlinie gezogen. Die Markenpolitiker gewannen, und ein neuer Konsens wurde geboren. Die Produkte, die in Zukunft florieren, werden nicht mehr als »Waren« präsentiert, sondern als Ideen: die Marke als Erfahrung, als Lifestyle.
Seit diesem Zeitpunkt versucht sich eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen aus der materiellen Welt der Waren, der Herstellung und der Produkte zu befreien, um auf einer anderen Ebene zu existieren. Jeder kann ein Produkt herstellen, so ihre Überlegung (und wie der Erfolg der Weißen Marken während der Rezession bewies, tat es auch jeder). Solch schnöde Arbeiten können und sollen deshalb an andere Unternehmer und Subunternehmer vergeben werden, deren einziges Anliegen darin besteht, den Auftrag pünktlich und mit Budgetunterschreitung zu erfüllen (idealerweise in der Dritten Welt, wo die Arbeit spottbillig ist, die Gesetze lax sind und die Steuervergünstigungen enorm). Die Zentrale des Konzerns kann sich dann auf das wirklich wichtige Geschäft konzentrieren – die Schaffung einer Unternehmensmythologie, die machtvoll genug ist, um einfachen Gegenständen durch den schlichten Namen des Unternehmens Bedeutung zu verleihen.
»Jahrelang hielten wir uns für ein produktorientiertes Unternehmen«, erläutert Nikes CEO Phil Knight diesen Wandel, »das heißt, wir konzentrierten uns voll und ganz auf Design und Herstellung des Produkts. Heute aber wissen wir, dass die Vermarktung des Produkts das Wichtigste ist. Wir haben uns zu der Einsicht durchgerungen, dass Nike ein marketingorientiertes Unternehmen ist und das Produkt unser wichtigstes Marketinginstrument.«[13] Diese Entwicklung hat sich mit der Entstehung von Internet-Giganten wie Amazon.com noch beschleunigt. Die reinsten Marken werden im Internet aufgebaut: Befreit von solchen Lasten der realen Welt wie dem Ladengeschäft und der Produktherstellung können sie ungebremst gedeihen, aber weniger als Lieferanten von Gütern oder Dienstleistungen denn als kollektive Phantasien.
Tom Peters, der schon lange den heimlichen Spinner in vielen hartgesottenen CEOs hätschelt, propagiert die Markenmanie als Geheimnis des finanziellen Erfolgs und ordnet transzendentale Logos und irdische Produkte zwei unterschiedlichen Kategorien von Unternehmen zu. »Die obere Hälfte – Coca-Cola, Microsoft, Disney und so weiter – handelt nur noch mit ›Brainware‹. Die untere Hälfte [Ford und General Motors] ist immer noch Lieferant primitiver Gegenstände, obwohl auch Autos heute viel intelligenter sind als ehedem«, schreibt Peters in Der Innovationskreis (1997, dt. 1998), einer Ode an die Übermacht des Marketings gegenüber der Produktion.[14]
In diesem neuen brisanten Kontext verkauften die führenden Werbeagenturen ein Unternehmen nicht mehr durch einzelne Werbefeldzüge, sondern agierten als »Markenpfleger«, die die Seele des Unternehmens identifizierten, zum Ausdruck brachten und schützten. Kein Wunder, dass dies gute Nachrichten für die US-Werbeindustrie waren. Sie erlebte 1994 einen Ausgabenzuwachs von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Innerhalb eines Jahres schritt die Branche von einer Beinahekrise zu einem weiteren »bisher besten Jahr«.[15] Und dies war nur der Anfang; weitere Triumphe folgten. 1997 stiegen die Ausgaben für unternehmensorientierte Werbung – definiert als »Werbung, die ein Unternehmen, seine Werte, seine Persönlichkeit und seinen Charakter auf dem Markt positioniert« – gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent.[16]
Die Markenmanie hat einen neuen Typ des Geschäftsmanns hervorgebracht. Er verkündet mit stolzgeschwellter Brust, die Marke X sei kein Produkt, sondern ein Lebensstil, sei eine Haltung, ein Wertesystem, ein Aussehen, eine Idee. Und das klingt wirklich toll – viel besser, als die Marke X ist ein Schraubenzieher, eine Hamburgerkette, eine Jeanshose oder ein – zugegeben sehr erfolgreiches – Sortiment von Laufschuhen. »Nike«, verkündete Phil Knight in den achtziger Jahren, sei ein »Sportunternehmen«; seine Mission bestehe nicht darin, Schuhe zu verkaufen, sondern »das Leben der Menschen durch Sport und Fitness zu verbessern« und »den Zauber des Sports am Leben« zu erhalten.[17] Der Präsident und Turnschuh-Schamane des Unternehmens Tom Clark erklärt, dass »wir uns dank der Inspiration des Sports ständig neu gebären können«.[18]
Berichte über solche Erleuchtungen hinsichtlich der »Markenvision« wurden an allen Ecken und Enden laut. »Das Problem von Polaroid«, diagnostizierte John Hegarty, Chairman der Werbeagentur des Unternehmens, »bestand darin, dass man sich immer als Kamera präsentierte, doch der Prozess der [Marken] Vision hat uns etwas gelehrt: Polaroid ist keine Kamera, sondern ein soziales Schmiermittel.«[19]IBM verkauft keine Computer, sondern »Problemlösungen« für Unternehmen. Bei Swatch geht es nicht um Uhren, sondern um die Idee der Zeit. »Wir verkaufen kein Produkt«, sagte Renzo Rosso, der Eigentümer von Diesel Jeans, der Zeitschrift Paper





























