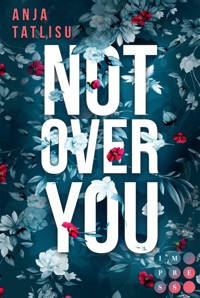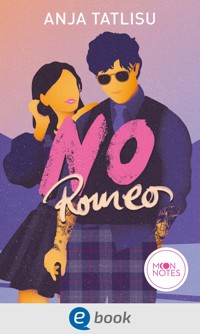
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was, wenn die Vergangenheit dich einholt und zu beenden droht, was gerade erst beginnt? Für ihr Studium an der Yale University zieht Mila nach New Haven und trifft dort gleich am ersten Tag auf den charmanten, aber mysteriösen Easton. Sofort spüren die beiden eine Verbindung zueinander. Gleichzeitig trennen sie Welten, denn während Mila wohlbehütet als Polizistentochter aufgewachsen ist, scheint Eastons Familie in der ganzen Stadt gefürchtet zu sein. Trotz aller Warnsignale schafft Mila es nicht, sich von Easton fernzuhalten. Der versucht unterdessen mit aller Kraft, seine dunkle Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen. Bis sie ihn eines Tages einholt – und auch Mila mitreißt. No Romeo: Gegensätze, die sich anziehen und eine Liebe gegen jede Vernunft. - Erlebe die prickelnde College-Romance zwischen Mila und Easton, die einen dunklen Twist birgt, der den Atem stocken lässt. - Wenn du zu den New Adults gehörst und dir die Tropes "Forbidden Love" und "Morally Grey Characters" am liebsten sind, dann – Vorsicht! – könntest du dich unsterblich in "No Romeo" verlieben. - Bester Schmökerstoff von Anja Tatlisu um eine verbotene Liebe mit einer Prise Shakespeare – ab 16 Jahren. - Für alle jungen Erwachsenen, die den gefühlvollen Liebesromanen von Lena Kiefer, dem federleichten Stil von Mona Kasten und den Dark-Romance-Stories von Nikola Hotel verfallen sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
SIE IST POLIZISTENTOCHTER, ER DER SOHN EINER FAMILIE, DIE KEINE GESETZE KENNT.
THUS WITH A KISS I DIE?
Für ihr Studium an der Yale University zieht Mila nach New Haven und trifft dort gleich am ersten Tag auf den charmanten, aber mysteriösen Easton.
Sofort spüren die beiden eine Verbindung zueinander. Gleichzeitig trennen sie Welten, denn während Mila wohlbehütet als Polizistentochter aufgewachsen ist, scheint Eastons Familie in der ganzen Stadt gefürchtet zu sein. Trotz aller Warnsignale schafft Mila es nicht, sich von Easton fernzuhalten. Der versucht unterdessen mit aller Kraft, seine dunkle Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen. Bis sie ihn plötzlich einholt – und auch Mila mitreißt.
Für die Liebe, den Glauben und die Hoffnung.
Und für Maren, weil es ohne dich
dieses Buch noch gar nicht geben würde.
So wilde Freude
nimmt ein wildes Ende,
und stirbt im höchsten Sieg,
wie Feuer und Pulver
im Kusse sich verzehrt.
(William Shakespeares Romeo und Julia)
Prolog
»Sir? Verstehen Sie mich, Sir?«
Das Chaos um mich herum und die auf mich einredende Stimme nahm ich kaum wahr. Blinkende blaue und rote Lichter. Stöhnen. Wimmern. Dazwischen Sanitäter und Polizisten.
»Können Sie mich hören, Sir?«
Ich wiegte ihren erschlafften Körper in meinen Armen, presste meine Hand noch fester auf die Wunde an ihrer Brust, küsste sie, flüsterte ihren Namen, bat sie unablässig, bei mir zu bleiben, doch ihr Blut rann unaufhaltsam durch meine Finger.
»Sir? Sie müssen sie loslassen, damit wir ihr helfen können.«
Unfähig, etwas zu erwidern, tat ich, worum der Mann mich gebeten hatte, erhob mich mit ihr vom Boden und bettete sie vorsichtig auf eine gepolsterte Trage. Widerstrebend ließ ich sie los, starrte in den offenen Rettungswagen, hörte das Reißen von Stoff und hektisches Gerede. Sah, wie versucht wurde, die Blutung zu stillen, wie Nadeln ihre samtweiche Haut durchstachen und ihr schönes, viel zu blasses Gesicht unter einer Sauerstoffmaske verschwand.
»Sind Sie verletzt, Sir?«
»Durchschuss«, murmelte ich.
An meinen Händen klebte Blut. Ihr Blut.
»Wir werden Sie mitnehmen müssen, Sir, um Ihre Wunde zu versorgen.«
Abwesend folgte ich dem Mann zu einem anderen Krankenwagen, drehte mich immer wieder um. Ich spürte keinen Schmerz in meinem blutenden Oberarm, nur in meinem unverletzten Brustkorb, wo sich immenser Druck aufgebaut hatte, der mich zu zerreißen drohte.
Es war meine Schuld.
Alles war meine Schuld.
Wäre ich um den Bruchteil einer Sekunde schneller gewesen, hätte ich sie mit meinem ganzen Körper schützen können. Die Kugel hätte nicht bloß meinen Bizeps durchschossen, wäre nicht in ihrer Brust gelandet, sondern in meiner, und ich würde an ihrer Stelle blutüberströmt in dem Krankenwagen liegen, dessen Türen sich verschlossen, bevor er mit Vollgas davonfuhr.
Hätte ich sie nicht so nah an mich herangelassen, wäre nichts von alledem geschehen …
Kapitel 1Abschiedsstimmung
»Habt ihr alles?«, fragte mein Dad und schaute durch die weit offen stehende Fahrertür prüfend in meinen petrolgrünen Käfer.
»Jawoll, Lieutenant Lewis, Sir!«, erwiderte Sarah lachend. Meine Freundin saß schon eine ganze Weile startklar auf dem Beifahrersitz und ließ den x-ten Sicherheitscheck geduldig über sich ergehen. »Daran hat sich in den letzten fünf Minuten nichts geändert.«
Ihr augenzwinkernder Seitenhieb prallte an meinem Dad ab. »Pfefferspray? Taser?«, fragte er zum wiederholten Mal.
»Im Handschuhfach. Die gleiche Kombi befindet sich in unserem Gepäck. In Milas und in meinem«, antwortete Sarah und klappte das kleine Fach vor ihren Knien auf, damit er sich selbst davon überzeugen konnte. »Uuund wir haben garantiert keinen dieser abgefahrenen Selbstverteidigungsmoves vergessen, die Sie uns beigebracht haben«, ergänzte sie zu seiner Beruhigung, obwohl es im Grunde nichts brachte. Aus Sorge um uns – vordergründig um mich – wurde er entgegen seinem sonst so souverän fokussierten Naturell seit Tagen von Zweifeln und Unsicherheiten geplagt.
Zum einen lag das an meinem bevorstehenden Roadtrip mit Sarah von Los Angeles aus quer durch mehrere Bundesstaaten nach New Haven. Zum anderen an der Abschiedssituation im Allgemeinen, weil sein einziges Kind auszog, um in Yale zu studieren. Vor den ersten Semesterferien würden wir uns wegen der großen Entfernung nicht wiedersehen. Natürlich gab es Videocalls, und wir waren generell auch auf alle anderen möglichen Arten vernetzt, aber das war eben nicht dasselbe, wie gemeinsam unter einem Dach zu leben.
»Fahr vorsichtig, und pass auf dich auf!« Mom schloss mich fest in ihre Arme und drückte einen innigen Kuss auf meinen brünetten Schopf, den ich nicht besonders schön, dafür äußerst praktisch zu einem dicken Knoten im Nacken zusammengebunden hatte.
»Ich melde mich, sobald wir im Motel in Utah eingecheckt haben.«
Mom ließ mich los, blinzelte auffällig oft und schenkte mir ein tapferes Lächeln. Wenngleich sie sichtlich bemüht war, ihre Fassung zu wahren, schlich sich eine kleine Träne aus ihrem rechten Augenwinkel. Das machte mir den Abschied noch schwerer.
Tief durchatmend wandte ich mich von ihr ab und blickte direkt in das übermüdete Gesicht meines Dads. Vermutlich hatte er die ganze Nacht über wach gelegen und sich Gedanken gemacht. »Ich weiß nicht«, murmelte er zerknirscht. »Vielleicht solltest du doch lieber fliegen. Ich traue dem alten Ding nicht. Der Wagen ist schon ein paar Jahrzehnte vor deiner Geburt vom Band gerollt und –«
»Du bist auch schon ein paar Jahrzehnte vor mir vom Band gerollt, Dad, und ich vertraue dir blind«, unterbrach ich ihn. »Außerdem hast du Otto zweimal von Spencer durchchecken lassen und mir ein Fahrsicherheitstraining aufgebrummt.«
»Aber er hat keinen einzigen Airbag, Mila, und –«
Er verstummte, als meine Mom beruhigend ihre Hand auf seine Schulter legte.
»Wir haben das alles doch schon mehrfach besprochen, Michael. Die beiden kommen nie an, wenn du sie nicht endlich losfahren lässt.«
Dad nickte mit zusammengepressten Lippen und gab sich widerwillig geschlagen. Bei seinen Bedenken ging es weniger um Otto – Grannys alten Käfer, den sie 1984 als Neuwagen gekauft und an dem Grappy in den letzten Monaten wegen meiner bevorstehenden Reise liebevoll rumgeschraubt hatte, bis der VW wieder weitestgehend den aktuellen Standards entsprach. Es ging auch nicht um meine Fahrkünste, sondern um die Tatsache, dass mein Vater wegen der großen Entfernung nicht sofort zur Stelle sein konnte, falls ich ihn brauchen sollte.
So fest wie möglich umarmte ich ihn und drückte ihm einen dicken Kuss auf die Wange. »Hab dich lieb!«, flüsterte ich mit belegter Stimme.
Zögernd ließ er mich los und nickte, was so viel bedeutete wie Ich dich auch.
Ein kurzes Lächeln, dann kehrte ich ihm den Rücken zu, weil ich es sonst nicht länger geschafft hätte, meine Tränen zurückzuhalten. Dabei freute ich mich auf New Haven, Yale und alles, was mich in diesem neuen Lebensabschnitt erwartete.
»Bye«, rief meine Freundin fröhlich, während ich zu ihr in den Wagen stieg, mich unter Dads wachsamem Blick ordnungsgemäß anschnallte und den Motor startete. Für Sarahs lockere Art in fast allen Lebenslagen hätte ich ein Vermögen gegeben, wenn ich denn eines besessen hätte. »Keine Sorge, Mrs und Mr L, ich werde auf Mila aufpassen.«
Mom lachte. »Ob mich das wirklich beruhigt, weiß ich gerade nicht.«
Sarah kicherte. »Sie wird garantiert nichts tun, was ich nicht auch tun würde.«
»Genau das befürchte ich«, erwiderte Mom.
Ich schloss die Wagentür und winkte meinen Eltern beim Losfahren durch die heruntergekurbelte Seitenscheibe zu. »Bis heute Abend!«
»Nicht traurig sein, Millili«, sagte Sarah und sah mich aufmunternd mit ihren strahlend blauen Augen an, »das wird super werden!«
Bestimmt würde es das. Dennoch brauchte ich einen Moment, um den dicken Kloß in meinem Hals loszuwerden.
»Wir beide an einer Uni. Weit, weit weg von zu Hause. In Yale. Wer hätte das gedacht? Und dann auch noch in einem eigenen kleinen Apartment.«
Ich hörte ihr zwar mit einem Ohr zu, hing aber irgendwo zwischen Abschiedsschmerz und Vorfreude fest, was Sarah nicht davon abhielt, vergnügt weiter vor sich hinzuplappern und das Radio lauter zu drehen.
»Double-u ay em cee ay«, ertönte die Stimme des Moderators aus den Boxen. »Oldies but Goldies …«
»Uh, yeah! Gib mir die wilden 70er, 80er und 90er!«, trällerte Sarah breit grinsend dazwischen, während sie mit den Fingern durch ihre schulterlange sonnenblonde Lockenmähne wuschelte. Binnen weniger Takte erkannte sie den Titel. »Sweet Dreams – der beste Song ever und ever und ever!«
Noch bevor sie sich mit Annie Lennox von den Eurythmics ein Gesangsbattle lieferte, musste ich schon lachen. Es gab absolut kein einziges Lied aus dieser Zeitspanne, das sie nicht hätte vorwärts, rückwärts und seitwärts mitsingen können. Ging es allerdings um die aktuellen Charts oder einen bekannten Song ab den 2000ern, war sie komplett raus.
Ich für meinen Teil hörte alles, was mir gerade gefiel, hatte jedoch ein ausgeprägtes Faible für Ed Sheeran, Harry Styles und Eminem. Ein Fangirl im typischen Sinne war ich nicht unbedingt, aber die Musik der drei Solokünstler holte mich mit ihren Songtexten am stärksten ab. Wobei Sarah mich mittlerweile minimal mit dem unvergleichlichen Sound vor unserer Zeit infiziert hatte. Es gab eindeutig Schlimmeres, und ich machte mir keinerlei Illusionen, während der knapp 3000 Meilen weiten Fahrt nach New Haven etwas anderes als ihre heiß geliebten Oldies zu hören.
Wir hatten uns für die kürzeste der drei möglichen Strecken entschieden, deshalb fuhr ich stadtauswärts, um vom San Fernando Valley aus auf die I-15 N zu kommen. Quer durch Las Vegas tuckerten wir gemütlich zum Bundesstaat Utah, machten unterwegs mehrere kleine Pausen und legten am Abend in Beaver unseren ersten Übernachtungszwischenstopp in einem Motel ein.
Das Zimmer war klein und sauber, verfügte über ein Duschbad mit Toilette, frisch bezogene Betten, beleuchtete Nachttischchen, Fernseher sowie einen Tisch mit zwei Stühlen. Alles schlicht und einfach gestaltet, wie in jedem Motel der Six-Kette. Das Wichtigste jedoch, insbesondere für meinen Vater, der unsere Reiseunterkünfte vorab gebucht hatte: Die Rezeption war 24/7 von zwei Mitarbeitern besetzt und wurde zusätzlich von einer Sicherheitsfirma unterstützt.
Nachdem ich total erledigt von der langen Fahrt kurz geduscht und ein Schlafshirt angezogen hatte, meldete ich mich wie versprochen per Videocall bei meinen Eltern. Ich versicherte ihnen gleich zu Beginn mehrfach, dass alles glattgelaufen war, während Sarah im Hintergrund unter der Dusche aus vollem Hals Like a Virgin von Madonna trällerte. Ein Umstand, der es mir neben meiner Müdigkeit zusätzlich erschwerte, mich auf das Kurzverhör zu konzentrieren.
»Was hast du gerade gesagt?«, fragte mein Vater. »Kannst du die Musik vielleicht ein bisschen leiser drehen? Wir verstehen dich kaum.«
»Würde ich wirklich gerne, Dad, aber seit der Grundschule suche ich vergeblich einen versteckten Lautstärkeregler bei Sarah.«
»Das ist Sarah?«, hakte er irritiert nach.
»Jep! Im Madonna-Modus unter der Dusche. Und glaub mir, wenn sie auf Billy Idol umschaltet, bricht garantiert die Leitung zusammen.«
Das kehlige, ansteckende Lachen meines Vaters erklang, und ich stimmte mit ein.
»Wie hältst du das nur aus?«, wollte er wissen.
»Keine Ahnung«, gluckste ich amüsiert. »Aber wenn es sie nicht gäbe, würde ich sie schrecklich vermissen.«
»Wir auch«, rief Mom aus dem Off.
»Melde dich, wenn ihr morgen früh losfahrt«, erinnerte er mich unnötigerweise an unsere Absprache.
Meine Eltern konnten sich genauso bedingungslos auf mich verlassen wie ich mich auf sie.
Doch vor allem Dad schaffte es nicht aus seiner Haut heraus, was ich ihm in keiner Weise übel nahm. Von Berufs wegen erlebte er tagtäglich schreckliche Dinge und war dadurch zwangsläufig von den tiefsten Abgründen menschlichen Fehlverhaltens geprägt worden.
»Mach dir keine Sorgen, alles läuft wie besprochen.«
Er mühte sich ein Lächeln ab.
»Und sollte jemand versuchen, uns schräg von der Seite anzumachen, werde ich den Übeltäter knallhart wegtasern, während Sarah ihn mit 80er-Jahre-Hits in den Wahnsinn singt.«
»Das beruhigt mich«, erwiderte er schmunzelnd, runzelte jedoch im nächsten Moment die Stirn, als der innbrünstige Singsang noch lauter wurde, mittendrin abbrach und ein »Hi, Lieutenant Lewis« hinter mir ertönte.
»Schlaf gut«, sagte mein Vater und kappte überraschend schnell die Verbindung.
Als ich mich meiner Freundin zuwandte, wurde mir klar, warum er den Videocall so abrupt beendet hatte, denn Sarah trug nichts weiter als ein Handtuch um ihren Körper.
»Das war mein Dad, Sasu!«
»Und das«, sie drückte mir einen dicken Schmatzer auf die Stirn, »ist ein Badetuch, das sämtliche Erregungen öffentlicher Ärgernisse vollständig bedeckt, Millili.«
»Du hast ihn trotzdem in Verlegenheit gebracht«, gab ich zu bedenken.
»Kommt nicht wieder vor«, versprach sie, kehrte mir den Rücken zu und zog ein extrem verwaschenes XXL-Rebell-Yell-Shirt von einer Jahrzehnte zurückliegenden Billy-Idol-Tour über, ehe sie das Handtuch löste und zum Trocknen über den freien Stuhl neben mir hängte. »Beim nächsten Mal nehme ich gleich alles mit ins Bad. Ich habe echt nicht daran gedacht, dass du noch im Videocall mit deinen Eltern stecken könntest. Sorry! Mein Fehler.«
»Gute Sasu.« Ich zwinkerte ihr versöhnlich zu und stand von dem viel zu harten Sitz auf. Gähnend schlurfte ich zum linken der beiden Betten, das im Gegensatz zu dem anderen nicht mit Sarahs Klamotten übersät war, plumpste auf die Matratze und kroch abermals gähnend unter die Decke.
Indes schaltete meine Freundin den Fernseher ein, zappte blindlings durch die Kanäle und schlüpfte, ohne vorher das Kleiderchaos zu beseitigen, ebenfalls ins Bett. »Nur Nachrichten und Late Night Shows«, stöhnte sie augenrollend. »Ich brauche unbedingt ganz dringend was Prettywomiges oder Dirtydanciges zum Einschlafen. Was meinst du?«
»Mir egal«, nuschelte ich schläfrig ins bunt geblümte Kopfkissen, das ein wenig nach Hygienespüler roch. »Ich kriege sowieso nix mehr mit.«
»Na dann«, flüsterte Sarah und schaltete den Ton etwas leiser. »Sweet Dreams, meine Süße.«
Kapitel 2Welcome to New Haven
Etwas mehr als 700 Meilen später erreichten wir in York den nächsten Zwischenstopp, und sämtliche Prozedere des Vorabends wiederholten sich. Sarah stand laut singend unter der Dusche, unterdessen vernetzte ich mich mit meinen Eltern und fiel danach hundemüde ins Bett, bevor es relativ früh am nächsten Morgen wieder losging. Sachen packen. Otto bis zur Belastungsgrenze beladen. Auschecken. Fahren, fahren und noch mehr fahren. Auf diese Weise ließen wir Bundesstaat um Bundesstaat und Ortschaft um Ortschaft hinter uns. Nach Moline in Illinois folgten Toledo in Ohio und Clarion in Pennsilvania, bis wir nach sechstägiger Fahrt am Freitagabend völlig erledigt, aber auch quietschglücklich unser Reiseziel erreichten.
»Welcome to New Haven!«, stießen wir zeitgleich aus, als wir das Ortsschild passierten, und klatschten uns ab.
»Wir sind dahaaa«, trällerte Sarah mit einer schrägen Sitztanzeinlage, während ich mich darauf konzentrierte, die Hausverwaltung ausfindig zu machen.
Da wir ziemlich spät dran waren, parkte ich meinen Käfer gesetzeswidrig in der zweiten Reihe und schaltete den Warnblinker ein. Samt meiner Ausweispapiere sprang ich aus dem Wagen, hastete in das kleine Backsteingebäude, brachte so schnell wie möglich die Formalitäten hinter mich und schnappte mir die Unterlagen inklusive der Apartmentschlüssel. Dann spurtete ich zurück zu Otto.
»Ich haaabe sie.« Vergnügt drückte ich Sarah einen dicken Kuss auf den Schopf und startete den Motor. »Jetzt müssen wir nur noch die Caroline Road finden. Dann sind wir wirklich da, und mein armer Otto kann sich mindestens 48 Stunden lang ausruhen.«
»Guter alter Junge«, gluckste Sarah und tätschelte Ottos Lüftungsschlitze. »Er hat sich wirklich eine Auszeit verdient, aber was ist mit Einkaufen?«
»Zu Fuß.«
»Sightseeing?«
»Zu Fuß.«
»Campuserkundung?«
»Zu Fuß.«
»Du hast eindeutig einen Sitzkoller.«
»Und was für einen!«, stöhnte ich.
Ich fuhr weiter gen Osten Richtung Hafen. Eine Brücke verband die West Side mit der East Side und führte uns über das große Hafenbecken der malerischen Universitätsstadt, die zweifellos ihren ganz eigenen Charme besaß. Historische Bauten vermischten sich mit modernen. Dazwischen befanden sich unzählige Grünanlagen. Kleine und große Geschäfte reihten sich aneinander. Herrliche Seeluft strömte durch Ottos heruntergekurbelte Fenster zu uns in den Wagen. Keines der Bilder aus dem Internet spiegelte auch nur annähernd die wunderschöne Realität wider, in der wir nach so langer Fahrt endlich angekommen waren.
Sarah verhielt sich ungewöhnlich still, kommentierte nicht einen der vielen neuen Eindrücke. Zwischendurch entwich ihr ein tiefer Seufzer, was ein untrügliches Zeichen dafür war, dass ihr schlichtweg die Worte fehlten. Zumindest für den Augenblick.
Als wir schließlich die Caroline Road parallel zum Silver Sands Beach passierten, war es mit Sarahs Stille schlagartig vorbei. Ein Ohren quälendes, lang gezogenes, schrilles und temporären Tinnitus auslösendes Quieken erfüllte Ottos Innenraum. Vertraut. Gefürchtet. Und mindestens genauso sehr verhasst, wie ich meine Freundin liebte.
Sarah streckte den Kopf samt ihrem halben Oberkörper aus dem Seitenfenster. »Welches es wohl sein mag?«, fragte sie allen Ernstes, obwohl wir bereits vor Wochen die genaue Adresse und zig Fotos von dem Haus zugeschickt bekommen hatten.
»Das Grauweiße«, zog ich sie auf.
»Die sind alle grauweiß, du Lustige.«
»Ach.«
»Sag schon!«
Es war immer wieder ein Phänomen. Ihr Gedächtnis erlitt grundsätzlich einen vorübergehenden Totalschaden, wenn sie aufgeregt war. Dann vergaß sie absolut alles. Außer die Songtexte ihrer Lieblingshits.
»101. Das Erste in der Reihe«, erinnerte ich sie und bog im selben Moment von der Caroline Road auf die hellgrau gepflasterte Zufahrt des zweistöckigen Holzhauses ab. Ich parkte Otto mit ausreichendem Abstand neben zwei Fahrrädern, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Ein schwarzes Rennrad und ein violettes Hollandrad, dessen Lenkgestänge bis zum Rahmen mit pastellfarbenen Kunstblumenranken umwickelt war, ließen mich darauf schließen, dass die studentische Mini-WG im Erdgeschoss wahrscheinlich aus zwei ebenso verschiedenen Charakteren bestand. Viel wussten wir noch nicht über sie. Nur, dass die beiden genau wie Sarah und ich weibliche Erstsemester waren, die sich das untere Apartment teilten.
Erleichtert aufatmend schaltete ich den Motor ab und zog den Schlüssel aus Ottos Zündschloss. Eins stand jetzt schon fest: Wenn wir den Wagen leer geräumt und alles nach oben geschafft hatten, brauchte ich dringend Bewegung, etwas Vernünftiges zu essen und Schlaf. Viel Schlaf. In einem hoffentlich bequemen Bett.
»Wow, ist das schön hier!«, schwärmte Sarah und stieg aus, während ich sämtliche herumfliegende Papierchen einsammelte und zu dem restlichen Müll in eine McDonalds-Tüte stopfte. »Kommst du mit zum Strand?«
»Lass uns vorher noch alles nach oben bringen. Der Strand läuft garantiert nicht weg.«
Sarah sah mich mit ihrem Kälbchenblick an – eine Masche, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent funktionierte, und das wusste sie genau. »Fünf Minuten, Millili?«, fragte sie unschuldig. Erst das Vergnügen, danach die Arbeit – typisch Sarah –, einer der wenigen gravierenden Punkte, in denen wir uns absolut uneins waren und wahrscheinlich immer bleiben würden.
»Willst du denn gar nicht wissen, wie unser Apartment aussieht?«, versuchte ich ihre Ankunftseuphorie in eine andere Richtung zu lenken.
»Das kenne ich doch schon von den Fotos.«
»Den Strand auch«, warf ich ein Totschlagargument in den Diskussionsring und musste mir ein Lachen verkneifen, weil sich ihre Kälbchenmiene in die eines Fisches auf dem Trockenen wandelte. »Wir bringen nur ganz schnell die Sachen hoch, damit Otto auch wirklich verschnaufen kann, und dann geht’s gleich zum Silver Sands Beach. So lange du willst, Sasu.« Jetzt war es an mir, sie übertrieben wimpernklimpernd mit großen Augen anzuschmachten.
»So lange ich will?«, hakte sie nach.
»So lange du willst!«
»Na gut«, lenkte Sarah ein. Zu meiner Überraschung klappte sie ohne weitere Einwände den Beifahrersitz nach vorne, schnappte sich, was sie tragen konnte, und steuerte voll beladen die Holztreppe zu unserem neuen Zuhause an.
Da ich ihren plötzlichen Tatendrang unter keinen Umständen ausbremsen wollte, zerrte ich unser restliches Gepäck von Ottos Rückbank und schleppte es die fünfzehn Stufen hoch. Atemlos kam ich neben ihr zum Stehen, ließ den ganzen Kram fallen und schloss die Tür auf.
»War das alles?«, fragte Sarah, während wir unser Zeug in den Flur brachten.
»Nein«, keuchte ich, »dein Koffer fehlt noch.«
»Der kann ruhig warten. Da ist nur Kosmetikgedöns und so drin«, wiegelte sie ab. »Bereit?«
»Sowas von bereit!«, erwiderte ich und wir begaben uns gemeinsam auf Erkundungstour.
Vom lang gezogenen Eingangsbereich des voll möblierten Apartments aus gingen drei Türen ab. Hinter den beiden linksseitigen lagen ein kleines Duschbad inklusive Waschtrockner und gleich daneben ein separates WC. Am Ende des Flurs befand sich eines der zwei fast identisch eingerichteten Schlafzimmer, für das sich Sarah entschieden hatte. Im Gegensatz zu dem anderen verfügte es nämlich über einen Fernseher, und den brauchte sie unbedingt zum Einschlafen. Da ich das mit dem Strandblick und direktem Terrassenzugang ohnehin viel schöner fand, waren wir uns bei der Zimmerverteilung bereits in L.A. einig gewesen.
»Oh, mein Gott!«, stieß Sarah aus. Durch den Flur tänzelte sie nach rechts in die große Wohnküche und gab einen spitzen Freudenschrei von sich, als sie die moderne Einbauküche samt Esstheke sowie zwei hochbeinige Hocker entdeckte. Auf den Fotos hatten wir zwar schon gesehen, dass die komplette Einrichtung in Grau und Weiß gehalten war, dennoch klappte auch mir beim Anblick des geschmackvoll eingerichteten Raumes und der gläsernen Schiebefensterfront, die hinaus auf eine Hochterrasse führte, die Kinnlade runter.
Sichtlich begeistert wandte Sarah sich der anderen Seite zu und plumpste kichernd auf ein hellgrau gepolstertes, megagemütlich wirkendes Mammutsofa, das sich nebst einem runden Tisch vor einem wandbefestigten Flatscreen befand. »Ich könnte ausflippen, so schön ist die Hütte!«
»Tust du das nicht gerade?«
»Na ja, vielleicht ein bisschen«, erwiderte sie grinsend. »Aber jetzt mal im Ernst.« Sarah streifte ihre violetten Flipflops von den Füßen, wackelte mit den Zehen und setzte sich im Schneidersitz auf die Couch. »Wer bitte vermietet solche Apartments in absoluter Traumlage für eine lächerlich geringe Summe an Studenten, wenn mindestens das Zehnfache an Miete drin wäre? Vierhundert Mäuse im Monat sind praktisch nichts.«
Eine berechtigte Frage, die ich mir auch schon gestellt hatte, nachdem mich die Studienberatung, wegen mangelnder Wohnheimplätze und schier unbezahlbaren Preisen für kaninchenstallgroße Zimmer in Universitätsnähe, an die Lara-Bay-Stiftung verwiesen hatte. Den Unterlagen nach setzten sich die Förderer dafür ein, Studenten aus sozial schwachen Familien, dem Ausland und weit entfernten Bundesstaaten erschwinglichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dazu zählten unter anderem drei Strandhausblocks am Silver Sands Beach.
Ich zuckte mit den Schultern. »Mein Dad hat die Stiftung mehrfach durchleuchtet und für sauber befunden. Irgendein stinkreicher Gönner steckt wohl dahinter. Mehr weiß ich auch nicht.«
»Wenn Lieutenant Lewis höchstselbst die Hintergründe gecheckt hat, wird alles in bester Ordnung sein, und das wiederum bedeutet, wir können uns einfach über unser Scheißglück freuen.« Sarah gab ihre Schneidersitzhaltung auf, fläzte sich in die Couchkissen und schaltete den Fernseher ein.
»Wolltest du nicht ganz unbedingt sofort zum Strand?«, fragte ich verwundert.
»Hab’s mir anders überlegt«, gähnte sie. »Der läuft ja nicht weg.«
Kopfschüttelnd ging ich in den Flur, holte mein Gepäck und brachte es durch den Wohnraum in mein Zimmer, dessen Zugang sich zwischen dem Flatscreen und der Fensterfront befand. Vor einem weißen Kleiderschrank zu meiner Linken stellte ich die Sachen auf dem rauchgrauen Holzboden ab und schaute mich lächelnd in meinem Schlafdomizil um. Ein unerwartet vertrautes Gefühl machte sich in mir breit, während mein Blick zu einem silbergrauen Queensize-Polsterbett, dem farblich passenden kleinen Sessel und einem dazugehörenden runden Flachtischchen schweifte. Langsam durchquerte ich den Raum, strich im Vorbeigehen mit den Fingern über das graue, angeraute Polster eines Bürostuhls und die glatte Oberfläche des Schreibtischs, die zusammen mit einem Bücherregal an der Wand neben einer breiten Glasschiebetür standen. Zufrieden seufzend öffnete ich sie, und sogleich wehte mir eine angenehm frische Meeresbrise entgegen.
Tief durchatmend trat ich hinaus auf die Hochterrasse. Der Außenbereich war deutlich größer als erwartet und bestückt mit zwei Sonnenliegen, einem Tisch sowie vier Stühlen. Alles in den Farben des Hauses gehalten. Und dann war da diese traumhafte Aussicht auf den Strand, das Meer und Kelly Island – eine nicht allzu weit entfernte Insel in Privatbesitz, die rötlich in der milden Abendsonne schimmerte. Ich brauchte eine Weile, um zu realisieren, dass Sarah und ich von nun an mindestens drei Jahre, womöglich sogar länger, genau hier an diesem wundervollen Ort leben würden.
Einige salzluftige Atemzüge später kehrte ich zurück ins Zimmer, fischte ein paar Sachen aus einer Reisetasche und zog mich um. Turnschuhe, Shorts, ärmelloses Shirt, Sportkopfhörer, Laufgürtel. Fertig.
In der Wohnküche fand ich auf dem Sofa eine friedlich schlummernde Sarah. Da ich sie nicht wecken wollte, schlich ich mich auf leisen Sohlen an ihr vorbei in den Flur. Die Haustür stand immer noch offen. Leichtsinnigerweise hatte ich den kleinen Schlüsselbund mit dem beschrifteten Kunststoffanhänger in unserer Ankunftseuphorie im Schloss stecken lassen. Ich zog die Schlüssel ab, steckte sie zu meinem Smartphone und machte lautlos die Tür hinter mir zu, ehe ich die Holzstufen runterjoggte und den kurzen Weg vom Haus zum Strand für leichte Dehnübungen nutzte.
Blutrot stand im Westen die Abendsonne tief am Himmel – ein wunderschöner Anblick, dem ich mich kaum entziehen konnte.
Ich ging bis zum Ufer, setzte meine Kopfhörer auf und drückte auf Play. Als die ersten Takte von Bad Habits ertönten, lief ich in gemäßigtem Tempo los. Nach fast einer Woche bewegungsfreier Zeit wollte ich keinen Muskelkater riskieren, obwohl ich mich gerne richtig ausgepowert hätte. Kühles Salzwasser und nasser Sand spritzten meine Beine hoch. Die Meeresbrise zerzauste meine Haare, blies mir lange Strähnen ins Gesicht. Mit jedem weiteren Laufschritt fühlte ich mich unbeschwerter, und die mehrtägige körperliche Anspannung fiel von mir ab.
Ich rannte, bis es nicht mehr weiterging. Die letzten Strahlen der Abendsonne im Nacken, lief ich zurück, vorbei am Silver Sands Beach & Tennis-Club und an meinem neuen Zuhause, Richtung South End Point, einem steinernen Strömungsdamm, der weit ins Meer hineinreichte.
Die Abenddämmerung tauchte den Strand in Zwielicht. Abgesehen von einigen Surfern im Wasser lag die Strecke nahezu menschenleer vor mir. In einiger Entfernung brannte ein Lagerfeuer, um das vier Gestalten hockten und so was wie eine kleine Party feierten. Als ich dem feuchtfröhlichen Gelage näher kam, erkannte ich, dass es ein paar Typen waren. Den Boards im Sand nach zu urteilen schienen es ebenfalls Surfer zu sein, und gemessen an ihrem Verhalten hatten sie bereits das ein oder andere Dosenbier zu viel. Reflexartig drehte ich um, nahm die Kopfhörer ab und steckte sie in meinen Laufgürtel, um besser einschätzen zu können, was sich in meinem Rücken abspielte. Kaum war der Sound der Musik in meinen Ohren verstummt, hörte ich lautes Gelächter und trotz der rauschenden Wellen das schnelle Stapfen von Füßen im nassen Sand. Vielmehr spürte ich es, da all meine Sinne Gefahr witterten. Adrenalin schoss durch meine Adern, ließ mich erzittern, und mein Herzschlag verdoppelte sich drastisch.
Dads Regel Nr. 1: Keine Angst zeigen.
Obwohl mich mein Instinkt ermahnte, schneller zu werden, hielt ich die Laufgeschwindigkeit. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich einen typisch amerikanischen Sonnyboy. Grinsend holte er mich ein, drehte sich im Lauf und joggte rückwärts neben mir, ehe er seinen mit schäumenden Wellen tätowierten Arm ausstreckte und mich zum Stehenbleiben zwang. »Was geht, Babe? Lust auf einen Sundowner mit mir und meinen Freunden?«
Dads Regel Nr. 2: Deeskalation.
Ich rang mir ein freundliches Lächeln ab und sah ihm fest in die Augen. »Lieb von dir, aber ich bin total erledigt. Vielleicht ein anderes Mal.«
Tief durchatmend schob ich mich an ihm vorbei. Er hielt mich am Handgelenk fest, zog mich zurück und kam mir dabei so nah, dass mir trotz der frischen Meeresluft sein Bieratem entgegenschlug. »Stell dich nicht so an, Sweetheart, es wird dir gefallen. Ein bisschen unverfänglicher Spaß zu fünft wird dich sicher nicht gleich umbringen.«
Dads Regel Nr. 3: Alarmbereitschaft.
»Lass mich gehen«, erwiderte ich mit fester Stimme. Ich behielt ihn genau im Auge und spannte meine Muskeln an. »Du kennst garantiert genug andere Mädchen, die gerne mit euch feiern würden. Ruf sie einfach an.«
Ich bemerkte ein weiteres schnelles Stapfen im nassen Sand, und meine Nackenhärchen richteten sich allesamt auf.
Dads Regel Nr. 4: Höchste Alarmbereitschaft.
Unweigerlich ballte sich meine rechte Hand zur Faust. Dann spürte ich auch schon einen Körper viel zu nah an meinem Rücken und einen Arm, der sich von hinten um meine Schultern legte. »Selten so was Hübsches gesehen«, raunte mir eine Stimme ins Ohr. Am ganzen Körper zitternd vor Adrenalin konzentrierte ich mich auf das, was mein Vater hundertfach mit mir geübt hatte. Ich wusste genau, was in dieser Situation zu tun war. Bei dem Gedanken daran wurde mir schlecht, und ich zögerte kurz. Doch als ich die Hand des Kerls hinter mir an meiner Taille fühlte, brannten mir die Sicherungen durch. Alle gleichzeitig.
Dads Regel Nr. 5: Gegenwehr.
Ruckartig befreite ich mich vom Griff des Fremden, der mir gegenüberstand, schlug mit meinem linken Handballen in einer Aufwärtsbewegung unter seine Nase, spürte das Knirschen des Knorpels an seinem Nasenbein, und mir wurde noch übler. Dennoch rammte ich dem Kerl hinter mir mit voller Wucht meinen Ellbogen in den Solarplexus, trat mit der Ferse auf seinen Fuß und setzte abermals meinen Ellbogen ein. Ungebremst landete er in seinem Gesicht, und einen halben Atemzug später schlug ich ihm mit geballter Faust in die Weichteile. Vor Schmerz stöhnend fiel der Typ auf die Knie und kippte seitlich in den Sand. Das Überraschungsmoment weiter nutzend, wollte ich losrennen, doch hatte ich den Sonnyboy trotz blutender Nase wohl nicht hart genug erwischt, um ihn außer Gefecht zu setzen. Ehe ich begriff, wie mir geschah, packte er abermals meinen Arm und zerrte mich zurück. Ich geriet ins Straucheln, hörte nichts weiter als meinen eigenen panischen Atem, bis ich im Fallen einen groß gewachsenen, muskulösen Körper wahrnahm, der von einer Sekunde auf die andere mit einem Surfboard unterm Arm aus dem Meer auftauchte und direkt auf uns zukam. Blitzartig holte er aus, sein Board durchschnitt surrend die Luft und traf den vermeintlichen Sonnyboy hart am Bauch. Ein dumpfer Aufprall, und er lag stöhnend am Boden, krümmte sich im Sand. Vom Lagerfeuer aus rannten die Freunde meiner beiden Angreifer auf uns zu, und ich befürchtete noch Schlimmeres. Bevor ich es jedoch schaffte, wieder auf die Beine zu kommen, blieb der Schnellere plötzlich wie angewurzelt stehen, bremste seinen etwas langsameren Kumpel gleich mit und hielt ihn davon ab, weiter auf uns zuzustürmen.
»Was soll das?«, brüllte er außer sich vor Wut. »Den Penner mache ich fertig!«
»Das ist Yves’ Cousin«, erwiderte der andere. »Glaub mir, Bro, mit dem willst du dich garantiert nicht anlegen, das würdest du nicht überleben.«
Kapitel 3Salzwassertropfen
Den Rücken zu mir gewandt, seinen Blick auf das Geschehen vor sich gerichtet, schirmte mich mein Retter vor den vier Typen ab. Die beiden, die angerannt gekommen waren, halfen ihren stark angeschlagenen Freunden auf und brachten sie zurück zum Lagerfeuer.
Unterdessen kam ein weiterer Surfer aus dem Wasser. »Geiler Move, Mann!«, stellte er respektvoll fest, während er sich von der Sicherheitsleine befreite und sein Board in den Sand rammte.
»Sorge dafür, dass der Abschaum auch wirklich von hier verschwindet und in die West Side zurückkehrt, Lance«, sagte mein Beschützer mit dunkler Stimme.
»Was ist mit der Kleinen?«, fragte Lance.
»Ich kümmere mich um sie.«
Sein Gegenüber nickte. Ein scharfer Pfiff hallte über den Strand, als er sich von uns entfernte. Am Rande nahm ich wahr, dass sich ihm drei weitere Surfer anschlossen, dann verließ mich durch das Schwinden des Adrenalins ein Stück weit meine Kraft. Rücklings sackte ich in den Sand und vergrub das Gesicht in meinen Händen – was für ein Horrorerlebnis. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn mir niemand geholfen hätte. Unweigerlich löste sich ein Schluchzen aus meiner Kehle, und Tränen bahnten sich ihren Weg unter meinen geschlossenen Lidern hervor.
»Bist du okay?«, vernahm ich abermals die angenehm dunkle Stimme meines Retters.
Ich fühlte mich alles andere als okay. Dennoch nickte ich.
»Sicher?«, fragte er zweifelnd, und im selben Moment spürte ich seine Finger auf meiner Haut. Er schob meine Hände zur Seite, und ich ließ es geschehen. »Sieh mich an«, bat er leise, da meine Lider immer noch gesenkt waren.
Zittrig atmete ich ein und kam zögernd seiner Bitte nach. Als ich in seine dunkelbraunen Augen blickte, die eindringlich und gleichermaßen besorgt auf mich gerichtet waren, verflogen mit einem letzten Tränenschwall all meine Ängste, die der Übergriff ausgelöst hatte.
Auf einem Bein kniete er neben mir. Vom Deckhaar abgesehen, trug er seine glatten schwarzen Haare kurz. Aus einigen der längeren Strähnen perlte Salzwasser und tropfte auf mein Shirt. Seine Gesichtszüge waren markant, wirkten aber durch seine vollen, sanft geschwungenen Lippen nicht zu hart, und unter dem leichten Dreitagebartschatten ließ sich ein Grübchen an seinem Kinn erkennen. Er war höchstens zwei oder drei Jahre älter als ich, verströmte jedoch eine ungewöhnliche und faszinierende Reife.
»Kannst du aufstehen?«
»Ja«, antwortete ich leise.
Behutsam umfasste er meine Hände, erhob sich mit einer geschmeidigen Bewegung aus dem Sand und zog mich zu sich hoch. Dabei kamen wir uns so nah, dass ich die im Zwielicht glänzenden Salzwassertropfen auf seiner unbehaarten Brust erkennen konnte. Als ich zu ihm aufsah, neigte er den Kopf ein wenig zur Seite und wischte mit seinem Daumen die Tränenspuren aus meinem Gesicht – eine zärtliche Berührung, die mich erschauern ließ. Danach ergriff er meinen rechten Arm und bewegte die Gelenke. »Tut das weh?«, wollte er wissen.
Ein schwaches »Nein« schaffte es über meine Lippen, während er die Rötungen an meinem Oberarm und meinem Handgelenk begutachtete.
»Die Abdrücke könnten blau werden«, stellte er leise fest. In seiner Stimme lag etwas Bitteres. »Und du solltest deine Hand kühlen.«
Ich nickte mechanisch.
»Wo wohnst du?«, fragte er so vertrauenswürdig, dass ich trotz aller Warnungen meines Vaters wahrheitsgemäß antwortete.
»In einem der Strandapartments kurz vorm Beach Club.«
»Ich werde dich begleiten.«
»Musst du nicht«, murmelte ich, obwohl ich mich nach dem Vorfall in seiner Nähe sehr viel sicherer fühlte.
»Ich weiß.« Er schenkte mir den Hauch eines Lächelns und ließ meinen Arm los, um sein Board aufzuheben und es neben ein paar Kleidungsstücken in den Sand zu rammen. Vermutlich waren es seine Sachen, denn er griff gezielt nach einem Handtuch. Wortlos legte er es mir um die Schultern, und ich war ihm überaus dankbar dafür. Mein vom Laufen erhitzter Körper war nach dem heftigen Adrenalinkick viel zu schnell ausgekühlt, und mittlerweile fror ich trotz der sommerlichen Abendtemperaturen.
»Danke«, flüsterte ich.
»Nicht dafür«, erwiderte er leise. Dabei streiften seine Finger meine Hand, und es fühlte sich verwirrend gut an.
»Wer hat dir beigebracht, dich so zu verteidigen?«, fragte er nach ein paar Schritten am Ufer entlang.
»Mein Dad.« Bei dem Gedanken an ihn und Mom musste ich lächeln. Gleichzeitig wurde mir bewusst, wie sehr ich sie vermisste. Gerade jetzt. »Er arbeitet beim LAPD und wittert überall Gefahr. In der Elementary School konnte ich schon deutlich größere Jungs aufs Kreuz legen. Aber das eben … das … das war so anders … Ich hätte es einfach weiter mit Reden versuchen und nicht so schnell zuschlagen sollen. Dann wäre die Situation vielleicht nicht eskaliert, und du hättest nicht eingreifen müssen.«
»Dich trifft keine Schuld«, erwiderte er. »Im Gegenteil. Du hast alles richtig gemacht. Nur dein erster Schlag war nicht hart genug.«
Mir war klar, dass er recht hatte, doch zwischen theoretischen Selbstverteidigungsübungen und deren Anwendungen im Ernstfall lagen mehrere Universen. »Es … hat sich so falsch und unwirklich angefühlt.«
»Ja, ich weiß, was du meinst.« Seine Stimme klang rau und brüchig, als er weitersprach. »Egal, wie oft du dazu gezwungen wirst: Jemanden zu verletzen, ist niemals leicht, auch wenn er es nicht anders verdient hat.«
Die bittere Erkenntnis seiner Worte hallte in mir nach, und ich fragte mich, ob die East Side New Havens etwas Hässliches hinter ihrer malerischen Fassade verbarg. »Lebst du schon lange hier?«
»Seit ich denken kann.«
»Und wie oft ist so was schon passiert?«
»Noch nie«, sagte er leise. »Aber seit ein paar Tagen lungern diese Typen hier rum und suchen Ärger. Deshalb solltest du das Ende der Bucht nach Sonnenuntergang lieber meiden.«
Selbst am helllichten Tage hätten mich vorerst keine zehn Pferde mehr dorthin gezogen, aber das konnte er nicht wissen.
»Welche Hausnummer?«, fragte er, nachdem wir für mein Empfinden viel zu schnell die Strandwohnungen erreicht hatten.
»101.«
Vom Ufer aus überquerten wir den breiten Strand und blieben vor der Treppe zum Apartment stehen. Er sah mich an, und sein Blick kroch mir tief unter die Haut. Ich wollte nicht, dass er fortging, doch ich traute mich nicht, ihn zu fragen, ob er bleiben würde. Um irgendetwas zu tun und ihm nicht weiter einfach nur sprachlos gegenüberzustehen, griff ich nach dem Handtuch, das er mir um die Schultern gelegt hatte. Bevor ich es abnehmen konnte, kam er mir näher, und ich erstarrte in meiner Bewegung.
»Behalte es«, flüsterte er ganz nah an meinem Ohr und küsste mich auf die Schläfe. Überraschend schnell wandte er sich zum Gehen von mir ab.
Mein Herz schlug wie verrückt. Reflexartig griff ich nach seiner Hand. Unsere Finger verwoben sich wie von selbst miteinander, und er verharrte auf der Stelle, drehte sich aber nicht um.
»Danke, dass du mir geholfen hast«, wisperte ich.
»Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich es nicht getan hätte?«, erwiderte er leise, löste seine Finger ganz langsam von meinen und verschwand im Dunkel des Strandes.
Hoffnungslos überfordert von allem, was binnen kürzester Zeit geschehen war, musste ich gleichzeitig lachen und weinen, stand schluchzend am Fuße der Treppe, bis meine Beine mich endlich die Stufen hinauftrugen.
Ein Bewegungsmelder schaltete die Außenbeleuchtung der Haustür an. Erschöpft zog ich den kleinen Schlüsselbund aus dem Laufgürtel, dessen Klettverschlüsse glücklicherweise dem Übergriff standgehalten hatten. Alles war sandig, aber noch da, wo es sein sollte. Mein Smartphone schien keinen Schaden genommen zu haben, die Sportkopfhörer waren allerdings ziemlich verbogen.
Ich schloss die Tür auf und zog sie hinter mir zu.
»Wo warst du?«, hörte ich Sarah von der Wohnküche aus rufen.
»Laufen«, antwortete ich, setzte ein Lächeln auf und wollte an ihr vorbei in mein Zimmer gehen, damit sie meinen aufgewühlten Zustand nicht bemerkte. Doch Sarah etwas vorzumachen, war ein Ding der Unmöglichkeit.
»Moooment«, kam es sogleich aus ihrem Mund. Sie sprang von der Couch und stellte sich mir in den Weg. Binnen Sekunden wechselte ihre Miene von amüsiert zu extrem besorgt. »Was ist passiert?« Sie strich mir ein paar zerzauste Haarsträhnen aus dem Gesicht. »Hast du etwa geweint? Warum klebt so viel Sand an dir? Bist du gestürzt?«
Mein Kopfschütteln wurde zu einem Nicken. Dann fing es wieder an. Lachen und Weinen. Einfach so. Ich konnte es weder zurückhalten noch kontrollieren.
»Komm her, Millimaus«, flüsterte Sarah bestürzt, ergriff meine Hand und zog mich mit sich auf das Mammutsofa. Sie umarmte mich und streichelte beruhigend über meinen Rücken. Es dauerte einen Moment, bis ich mich ausgeweint hatte und in der Lage war, ihr alles zu erzählen.
»Diese verdammten Scheißärsche!«, schimpfte sie. »Wenn ich die armseligen Scheißkakerlaken in die Finger kriege, werde ich die verkümmerten Kleinteile zwischen ihren Beinen langsam und qualvoll filetieren! Wir sollten die Pissbacken sofort anzeigen. Die gehören eingesperrt!«
»Ich habe sie ja nicht mal richtig gesehen. Nur diesen blonden Sonnyboy und der sah aus wie mindestens fünfzig Prozent aller Surfer. Wahrscheinlich würde ich ihn jetzt schon nicht mehr wiedererkennen. Bloß das Wellentattoo an seinem Arm habe ich noch vor Augen, und an seine Stimme kann ich mich erinnern. Die werde ich wohl nie vergessen …«
»Vielleicht reicht die Tätowierung, um den Scheißarsch zu finden.«
»Dann steht Aussage gegen Aussage, und ich wette, er würde von irgendwem ein wasserfestes Alibi geliefert bekommen. Es gibt Tausende solcher Fälle, und die meisten bleiben ungeklärt.«
»Ja, ich weiß, die Kriminalstatistiken in dem Bereich sind echt mies. Was für ein Glück, dass Aquaman aufgetaucht ist und dieses oberwiderliche Scheißarschloch mit seinem Board umgenietet hat. Oh Mann! Den Typen feiere ich total! Wie heißt er eigentlich?«
»Keine Ahnung.«
»Wie jetzt? Du kennst seinen Namen nicht?«, fragte Sarah irritiert.
Sie hatte noch nicht ganz ausgesprochen, da klingelte mein Handy. Hastig zog ich es aus der Kletthülle an meinem Laufgürtel und starrte total überfordert auf das Display – ein Videocall meiner Eltern. Ich hatte völlig vergessen, mich nach unserer Ankunft bei ihnen zu melden. »Oh nein! Wenn mein Dad mich so sieht, bin ich schneller exmatrikuliert, als ich Yale aussprechen kann, und sitze spätestens morgen früh in einem Flieger nach L.A.«
»Ich mache das schon.« Sarah streckte die Hand nach meinem Smartphone aus. »Und du … du solltest sowieso duschen gehen, also verzieh dich am besten ins Bad. Ich improvisiere einfach. Vielleicht kann ich sie mit einer Live-Wohnungsbesichtigung bei Laune halten.«
»O-okay«, wisperte ich hektisch, gab Sarah das Telefon und huschte ins Badezimmer.
»Hi, Mrs und Mr L, wie geht’s?«, hörte ich Sarah noch fröhlich trällern, bevor ich die Tür hinter mir schloss.
Tief durchatmend lehnte ich mich mit dem Rücken gegen das weiße Holz. Was für ein heftiger Tag. Im guten wie im schlechten Sinne. Ich zog das Handtuch von meinen Schultern und vergrub die Nase in dem weichen Frottee. Es roch nach Sand, Wind und Meer. Genau wie er. Bewegte Bilder tauchten in meinen Gedanken auf, vertrieben alles Negative. Ich sah ihn vor mir stehen, mit nassem Haar, den im abendlichen Zwielicht glitzernden Salzwassertropfen auf seiner Haut, fühlte, wie er meine Tränen wegwischte, und plötzlich traf mich ein kleiner Blitz mitten ins Herz.
Kapitel 4Die Sache mit dem Koffer
Sarah hatte es tatsächlich geschafft, meine Eltern dermaßen um den Finger zu wickeln, dass ich sie nach dem Duschen nicht zurückrufen musste. Zum dringend notwendigen Einkaufen waren wir wegen der Nachwehen des Zwischenfalls nicht mehr gekommen. Stattdessen hatten wir aus den kläglichen Resten unseres vordergründig süßen Reiseproviants ein eher ungesundes Soulfood-Picknick vor dem Fernseher veranstaltet, bis ich irgendwann, umringt von aufgerissenen Snacktüten, zwischen den dicken Sofakissen eingeschlafen war.
Entsprechend gerädert und magengrummelig erwachte ich am nächsten Vormittag. Mit schalem Schokoladengeschmack im Mund trottete ich aufs Klo, gleich danach ins Bad und sofort wieder zurück, weil sich mit Nichts einfach nicht die Zähne putzen ließ. Das heillose Chaos in der Fernsehecke blendete ich aus, ging in mein Schlafzimmer, um nach meiner Kulturtasche zu suchen, und startete den zweiten Anlauf, Morgenhygiene zu betreiben. Währenddessen kehrten langsam meine Lebensgeister zu mir zurück. Deutlich wacher rief ich nach Sarah, bekam keine Antwort, witterte aber dezenten Kaffeeduft und schnupperte mich in den Wohnbereich. Auf der Esstheke entdeckte ich ein ofenfrisches Croissant und einen Coffee to go. Der lauwarmen Temperatur nach zu urteilen, stand der Becher schon länger dort. In meinem zombieähnlichen Zustand kurz nach dem Aufstehen hatte ich ihn bloß nicht gesehen. Mit halbem Po setzte ich mich auf einen der beiden Hocker an die kleine Küchentheke, nahm den Deckel ab und trank einen großen Schluck. Hmmm. Milchkaffee. Schön süß. Als Nächstes war mein Lieblingsfrühstücksgebäck dran. Ich biss ein Stück des Blätterteigs ab, kaute es genüsslich und las den mit Sarahs Handschrift vollgekritzelten kleinen Zettel, der danebenlag.
Bin einkaufen. Zu Fuß.
Damit Otto genau wie du
noch ein bisschen schlafen kann.
Hab dich lieb!
»Hab dich auch lieb, Sasu«, murmelte ich lächelnd. Sarah konnte anstrengend hoch zwanzig sein, laut, überdreht und sprunghaft, doch ihr Herz bestand aus purem Gold.
Nach der Frühstücksüberraschung tauschte ich mein Schlafshirt gegen frische Unterwäsche, schlüpfte in ein kurzes Blümchenkleid und sortierte danach sämtliche Klamotten aus meinen Reisetaschen in den Schrank. Im obersten Regal fand ich zwei schlichte grauweiße Garnituren Bettwäsche und bezog den Queensize-Traum. Die Hausverwaltung hatte wirklich an alles gedacht. Fünf Sternchen mit Zuckerguss und Streuseln für dieses studentische Rundum-sorglos-Paket.
Was nichts im Kleiderschrank zu suchen hatte, platzierte ich dort, wo es nach meinem Empfinden hingehörte, und verpasste dem schicken Zimmer damit eine persönliche Note. Die Mila-Note. Zum Schluss setzte ich Schweinebacke – mein knallpinkes, superflauschiges Prüfungsglücksschweinchen, das mich bereits zu meinem ersten Buchstabierwettbewerb in der Elementary School begleitet hatte – neben mein technisches Equipment auf den Schreibtisch.
Da Sarah den Einkauf übernommen hatte und ihr Gepäck noch im Flur stand, brachte ich es in ihr Zimmer und bezog ihr Bett gleich mit. Das Einräumen konnte ich ihr nicht abnehmen, weil sie sich in einer ganz speziellen Form von gemütlichem Chaos am wohlsten fühlte, das allein sie beherrschte. Deshalb ließ ich ihre Taschen unberührt und ging runter zu Otto, um Sarahs »Kosmetikgedöns-und-so-Koffer« aus dem Wagen zu holen. Das antiquarische, grottenhässliche dunkelbraune Ding mit der defekten Schließe war sauschwer. Schon bei unserer Abreise hatte ich mich gefragt, welche Beauty- und Hygieneartikel wohl solch ein Gewicht haben könnten.
Sicherheitshalber kontrollierte ich, ob das launische Schnappschloss auch richtig eingerastet war. War es.
Also wuchtete ich Sarahs Gepäckstück aus dem Auto und machte mich daran, es leise fluchend die Treppenstufen zum Apartment hochzuschleppen. Auf halber Höhe vernahm ich ein verräterisches Klicken. Noch ehe ich in irgendeiner Form reagieren konnte, rumpelte es, und das Gewicht des Koffers ließ nach. Als ich mich umdrehte, sah ich die beschissene Bescherung und fühlte mich wie eine dieser dumm aus der Wäsche guckenden Figuren in Sarahs heiß geliebten Slapstick-Filmen. Eine ganze Armada von Walt Disneys lustigen Taschenbüchern hatte sich polternd in Bewegung gesetzt, dicht gefolgt von einem Aromaöldiffuser samt Dutzender Duftölfläschchen, diversen Kosmetikartikeln, einem erstaunlich großen Vorratspack Tampons und einer Blechkeksdose, die mindestens genauso Retro war wie der dämliche Koffer, dessen eigenwillige Schließe trotz vorheriger Kontrolle urplötzlich beschlossen hatte, ihren Dienst aufzugeben. Der gesamte Inhalt hüpfte, rollte und purzelte die Treppe hinunter, während ich dem Spektakel bewegungsunfähig zusah. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht die leiseste Ahnung davon gehabt, wie wild Tampons herumspringen konnten, wenn sich die Pappschachtel durch einen Aufprall öffnete. Parallel dazu klirrte der Diffuser, dann ploppte die Keksdose auf. Zig viereckige rosa- und orangefarbene Tütchen stoben wie XXL-Konfetti durch die Gegend und entpuppten sich zu allem Überfluss bei genauer Betrachtung als Kondome in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Mir war zum Heulen zumute.
Und zum Schreien.
»Du dämliches Kackding!«
Reflexartig verpasste ich dem scheißblöden Koffer einen gewaltigen Tritt. Der hatte nichts Besseres zu tun, als sich von seinem Griff zu verabschieden und im hohen Bogen über das von ihm ausgelöste Chaos zu fliegen. Mit einem lauten Knall landete er einige Meter von mir entfernt auf dem Bürgersteig, rutschte die Bordsteinkante hinunter und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Eine Millisekunde später hörte ich das Quietschen von Reifen.
Entsetzt starrte ich einen mattschwarzen Porsche Speedster mit einem Surfbrett als Beifahrer an, der gerade noch rechtzeitig zum Stehen gekommen war und dessen schwarzhaariger Fahrer mich stirnrunzelnd aus dem offenen Cabrio heraus mit seinen tiefbraunen Augen musterte. »Kann ich dir irgendwie helfen?«, fragte er mit angenehm dunkler Stimme.
Mir rutschte das Herz in die Knie und nach einer Ehrenrunde durch meinen Magen wieder zurück in die Brust. Abgesehen davon, dass mir vor ein paar Jahren im Beisein meines damaligen Schwarms wegen eines blöden Sarahspruchs vor Lachen Cola aus der Nase gesprudelt war, war das gerade der mit Abstand unangenehmste Auftritt meines bisherigen Lebens. Dabei zählte ich in keiner Weise zur tollpatschig ungeschickten Sorte Mensch, die mit zwei linken Händen und Füßen durch die Gegend rannte.