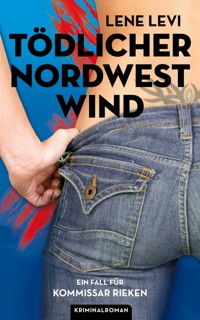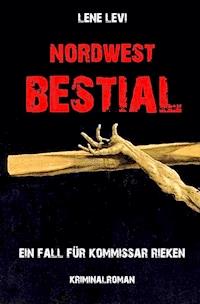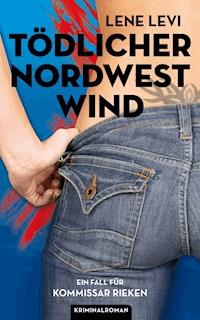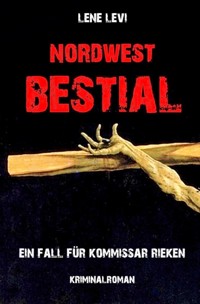
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
An einem regnerischen Dezembertag kommt es zu einem Zwischenfall. Ein niederländisches Agrarunternehmerehepaar wird tot in einem mit Jauche gefüllten Whirlpool aufgefunden. Dies ruft den Oldenburger Kriminalhauptkommissar Robert Rieken auf den Plan. Die Ermittler stoßen am Tatort auf Indizien, die auf einen möglichen Rachemord einer militanten Tierbefreiungsorganisation hindeuten. Dennoch trifft Kommissar Rieken bei seinen weiteren Ermittlungen auf eine Mauer des Schweigens. Selbst der Chef des Vechtaer Polizeikommissariats zeigt dem Kollegen aus der Diaspora zunächst die kalte Schulter, bis kurz darauf auch ein katholischer Offizialatsrat von mutmaßlichen Tierrechtsaktivisten bedroht wird. Nicht nur ein heftiger Wintersturm drängt die Polizisten zur Eile, sondern bald auch der nächste bestialisch ausgeführte Mord.
„Nordwest Bestial“ ist der zweite Fall des Oldenburger Kriminalisten-Teams um Robert Rieken, Jan Onken und der Rechtsmedizinerin Dr. Lin Quan. Der erste Band dieser Reihe „Tödlicher Nordwestwind“ avancierte schnell nach seinem Erscheinen zum Bestseller und wurde von vielen LeserInnen mit positiven Rezensionen bewertet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Nordwest Bestial
Ein Fall für Kommissar Rieken / Band 2
Über die Autorin: Lene Levi lebt und arbeitet als Autorin und Audioproduzentin in Berlin. Im Nordwesten Deutschlands ist sie aufgewachsen, in dieser Region spielen alle ihre Kriminalromane. BookRix GmbH & Co. KG81371 München0
Lene Levi
Nordwest Bestial
Ein Fall für Kommissar Rieken
Kriminalroman
Impressum
© 2015 Lene Levi - created by ebuchedition words & music
Lene Levi: Nordwest Bestial - Ein Fall für Kommissar Rieken
Titelgestaltung: ebuchedition words & music
unter Verwendung eines Altarbildes von Matthias Grünewald (Ausschnitt)
Lektorat & Korrektorat: Gaby Lindner, Petra Lorenz
© 2015 hoerbuchedition words & music, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
www.words-and-music.de
ebuchedition words & music
Inhaber: Peter Eckhart Reichel
Hohenzollernstrasse 31
D-14163 Berlin
Germany
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung, Aufführung, Vertonung,
kommerzielles Filesharing und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und zur Handlung gehörende Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Anfragen, Anregungen oder Kritiken haben wir immer ein offenes Ohr.
Schreiben Sie bitte an:
Kennwort: Lene Levi – Nordwest Bestial
Südoldenburg ist flach, die Wiesen feucht und die Dörfer gepflegt. Aber hinter den unauffälligen Hausfassaden verbergen sich erst die eigentlichen Wahrzeichen der Region: langgezogene Stallbaracken mit winzigen Fensteröffnungen und Belüftungskaminen. Die Menschen hier gelten als bodenständig, katholisch und geschäftstüchtig. Durch Massentierhaltung haben es einige von ihnen zu beachtlichem Reichtum gebracht. Nirgendwo sonst sind die Fleischproduzenten so unumschränkte Herrscher über Wasser, Boden und Luft wie hier. Im Oldenburger Münsterland scheint die Welt noch in Ordnung, bis sich eines Tages herausstellt, das Geld doch stinkt! An einem regnerischen Dezembertag kommt es zu einem Zwischenfall. Ein niederländisches Agrarunternehmerehepaar wird tot in einem mit Jauche gefüllten Whirlpool aufgefunden. Dies ruft den Oldenburger Kriminalhauptkommissar Robert Rieken auf den Plan. Die Ermittler stoßen am Tatort auf Indizien, die auf einen möglichen Rachemord einer militanten Tierbefreiungsorganisation hindeuten. Dennoch trifft Kommissar Rieken bei seinen weiteren Ermittlungen auf eine Mauer des Schweigens. Selbst der Chef des Vechtaer Polizeikommissariats zeigt dem Kollegen aus der Diaspora zunächst die kalte Schulter, bis kurz darauf auch ein katholischer Offizialatsrat von mutmaßlichen Tierrechtsaktivisten bedroht wird. Nicht nur ein heftiger Wintersturm drängt die Polizisten zur Eile, sondern bald auch der nächste bestialisch ausgeführte Mord. „Nordwest Bestial“ ist der zweite Fall des Oldenburger Kriminalisten-Teams um Robert Rieken, Jan Onken und der Rechtsmedizinerin Dr. Lin Quan. Der erste Band dieser Reihe „Tödlicher Nordwestwind“ avancierte schnell nach seinem Erscheinen zum Bestseller und wurde von vielen LeserInnen mit positiven Rezensionen bewertet.
Der Menschensohn wird seine Engel aussenden,
und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen,
die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben,
und werden sie in den Ofen werfen,
in dem das Feuer brennt.
- Matthäus 13,42
Prolog
Der Augenblick an dem sich sein bewegliches Ziel nur einen kurzen Moment lang zeigte, musste ihm wie eine glückliche Fügung erschienen sein. Ein maskierter Schütze hatte Ende Oktober mit einem PSG1-Gewehr vom gegenüberliegenden Bahndamm aus auf ein geöffnetes Bürofenster der Oldenburger Polizeiinspektion gezielt. Mit nur einem einzigen Präzisionsschuss aus etwa 60 Meter Entfernung hatte das Projektil den Kopf Peter Selbys auseinandergefetzt. Das Attentat geschah direkt vor den Augen der Polizeibeamten. Natürlich lag der Verdacht nahe, dass es sich bei dem unbekannten Gewehrschützen um einen Berufskiller handeln könnte, der im Auftrag einer kriminellen Organisation tätig geworden war. Sein Job war es, einen geständigen Mörder rechtzeitig zum Schweigen zu bringen, noch bevor dieser eine belastende Aussage zu Protokoll geben könnte.
Hauptkommissar Robert Rieken bewegte sich mit seiner Hypothese auf unsicherem Terrain, aber er hatte im Augenblick keine andere Wahl. Es gab nur Wahrscheinlichkeiten, Annahmen und Spekulationen, mit denen er sich befassen konnte. Es existierte kein einziger Zeuge, der den Schützen vor, während oder nach der Tat gesehen hatte. Auch die aufgefundenen Beweismittel waren für gesicherte Erkenntnisse viel zu mickrig, nahezu unbrauchbar. Nicht einmal Indizien gab es, auf die er seine hypothetischen Erklärungsversuche hätte aufbauen, geschweige denn stützen könnte. Allein die eigene Intuition sagte ihm, dass sich dahinter das Organisierte Verbrechen verbarg.
Er hatte immer wieder versucht den Tathergang aus der Position des Schützen durchzuspielen, sowohl in seiner Phantasie als auch am Tatort selbst.
Robert stellte jede seiner Bewegungen nach. Er hob den Arm, als hätte er selbst ein Gewehr im Anschlag, legte seinen Finger an den imaginären Abzug, nahm sein Ziel ins Visier, krümmte seinen rechten Zeigefinger und drückte dann ab. Jedes Mal blickte er nach dieser Versuchsanordnung hinüber zum Fenster seines eigenen Büros. Die Jalousien waren herabgelassen; schon seit Wochen. Anschließend sah er sich jedes Mal um, ging ein paar Schritte neben dem Gleisbett entlang, blieb dann vor dem wildgewachsenen Gebüsch stehen und verharrte erneut davor, regungslos.
Die Deckung war nahezu ideal, von anderen möglichen Beobachtungspositionen aus nicht einsehbar. Aus diesem Versteck hatte der Schütze durch die Zieleinrichtung seines Gewehrs das Geschehen im Polizeigebäude im Auge behalten. Bis sich ihm diese einmalige Chance bot. Und die hatte er genutzt.
Am Ende war Robert immer wieder am gleichen Punkt angelangt. Die gesammelten Erkenntnisse konnten ihm nicht die Frage nach der Identität des Scharfschützen beantworten. Er warf erneut einen Blick hinüber zum Polizeigebäude.
Noch bevor damals die Beamten an diesem regnerischen Oktobertag die steile Böschung der Bahnanlage erklimmen konnten, war der Sniper längst von den Gleisen verschwunden und hatte nicht einmal die Patronenhülse zurückgelassen.
1
Er hatte sich nach dem Attentat zunächst für vierzehn Tage beurlauben lassen. Aber aus den vierzehn Tagen wurden drei Wochen, dann vier. Er fühlte sich irgendwie mitschuldig, obwohl er die Umstände der Vernehmung in seinem Büro gar nicht zu verantworten hatte.
All das hatte sich tief in sein Unterbewusstsein eingegraben und ließ ihn seitdem keine einzige Minute mehr los. Sein psychischer Zustand war einige Wochen lang angeschlagen gewesen und er hatte bereits ernsthaft darüber nachgedacht, den Dienst bei der Kripo zu quittieren. Aber einfach so alles hinschmeißen, war eigentlich nie sein Ding gewesen. Er hoffte, die Zeit würde ihm darüber hinweghelfen, über seine berufliche Zukunft mitentscheiden, aber diese Hoffnung stellte sich als Trugschluss heraus. Jetzt neigte sich das Jahr seinem Ende entgegen und er wollte wieder in den Dienst zurück, das war ihm soweit klar.
Robert stand am Küchenfenster und blickte gedankenversunken hinaus in den Garten. Er erinnerte sich an das, was sein alter Schulfreund Jülf ihm erzählt hatte. Dass sein Großvater, als er noch ein junger und völlig unbekannter Künstler gewesen war, einmal bei Ebbe eine Rolle mit bemalten Leinwänden hinaus ins Dangaster Tief geworfen haben soll, weil er sie für misslungene Werke gehalten hatte. Aber mit der nächsten Flut wurde alles wieder an den Strand zurückgespült. Er hatte es noch einmal versucht, aber mit dem gleichen Ergebnis. Die Bilder kamen zurück.
So ähnlich erging es ihm jetzt selbst. Er versuchte die Erinnerungen aus seinem Gedächtnis zu tilgen, mit denen er glaubte, nicht fertig zu werden, aber sie tauchten, wie damals die Gemälde, immer wieder auf. Sogar jetzt in diesem Augenblick als er am Fenster stand und in den Garten sah, tauchten sie vor seinem inneren Auge auf.
Der Herbstwind hatte die Blätter und Früchte des Wallnussbaumes heruntergerissen, der im hinteren Bereich des Gartens direkt am Zaun zum Nachbargrundstück stand. Robert hatte sich schon vor Tagen vorgenommen, die Arbeit im Garten zu erledigen. Die welken Blätter mussten kompostiert werden und die Wallnüsse waren von den aufgeplatzten Fruchthülsen zu trennen, damit sie trocknen konnten.
Er zwängte sich in seine alte Jeans, die ihm viel zu eng geworden war, nahm dann anschließend seinen Neil-Young-Hut vom Küchentisch und stieg die Eisentreppe hinab, die von seinem Arbeitszimmer auf das Grundstück führte.
Als er eine Stunde später mit dem Laub fertig war, sammelte er die Wallnüsse ein, füllte sie in einen Papiersack, schleppte diesen vor das Haus und stellte ihn auf den Bürgersteig vor den Gartenzaun. Dann hängte er ein Pappschild mit der Aufschrift: »zum Mitnehmen« an den Zaunpfahl. Er war durchgeschwitzt. Brust, Achseln und Leisten fühlten sich unangenehm an. Mit zitternden Fingern nestelte er an den Knöpfen seines Hemdes. Unzufrieden über seine mangelnde Leistungsfähigkeit, fluchte er über sich selbst. Lin hatte ihm schon vor ein paar Tagen Blut abgenommen und das Röhrchen an ein Labor geschickt. Irgendetwas stimmte nicht. Sie machte sich Sorgen, aber Robert selbst hielt das für übertrieben. Er ging zurück in seine Wohnung, stellte sich kurz unter die Dusche, zog sich frische Klamotten an und machte es sich anschließend auf einem Sessel bequem. Vivaldi-Klänge schwebten durch den Raum. Die Musik schien wie aus einer anderen Welt herüber zu schallen.
Es hatte keine volle Stunde gedauert, da war der Papiersack schon fast vollständig geleert. Robert hatte von seinem Wohnzimmerfenster aus beobachtet, wie sich die Kinder, die hier jeden Tag nach Schulschluss vorbei kamen, begeistert ihre Taschen vollstopften. Auch die Briefträgerin mit den knallrotgefärbten Haaren, die jeden Tag zur gleichen Zeit mit ihrem Fahrrad die Werbachstraße entlang fuhr, hatte das Angebot entdeckt und sich ihren Teil eingesteckt. Solche kleinen und unbedeutenden Begebenheiten verursachten in ihm ein seltsam anmutendes Glücksgefühl.
Als er der Polizeipsychologin am nächsten Tag davon erzählte, machte sie sich nur flüchtige Notizen, nickte allwissend, als hätte sie tatsächlich etwas von dem verstanden, was er meinte, dabei sah sie ihn mit seitlich geneigter Kopfhaltung an. Natürlich hatte sie nicht die leiseste Ahnung, was sich wirklich in seinem Innersten abspielte, stellte aber unentwegt Fragen und er musste vor ihr sein Berufsleben ausbreiten.
Robert kam ursprünglich aus Ostfriesland. Bei der Oldenburger Polizei hatte er vor Jahrzehnten seine Beamtenlaufbahn begonnen, doch irgendwann hatte er es in der Provinz nicht mehr ausgehalten. Es zog ihn damals vielmehr in die Großstädte, denn er wollte beruflich etwas erreichen. Etwas, dass ihm einst in dieser verschlafenen Stadt, in der scheinbar jeder jeden kannte, nicht möglich erschien und von dem er selbst nicht mal genau wusste, was es eigentlich war. Doch als er nach seiner Versetzung in Berlin den Dienst antrat, zerplatzte auch dort sein Traum von einer gerechteren Welt. Auch in Berlin wurde nur mit Wasser gekocht. Vor allem aber ging es in der Großstadt wesentlich härter zu, und zwar auf beiden Seiten des Gesetzes. Es herrschte ein ungeheurer Druck, dem jeder Polizist tagtäglich ausgesetzt war. Wer nicht standhielt, wurde zerrieben. Die Diplom-Psychologin Ursula Przybylski machte sich weitere Notizen.
Erst vor einigen Monaten war er nach über zwei Jahrzehnten wieder in die ihm vertraute Landschaft seiner Kindheit und Jugendzeit zurückgekehrt. »Back to the Roots«, wie er es nannte. Er hatte nochmals das große Bedürfnis nach Veränderung verspürt. Seinen alten Zopf hatte er im vergangenen Sommer einfach abgeschnitten, hatte sich selbst einen kahlen Schädel verpasst, über die polierte Kopfhaut einen alten Hut gestülpt, eine längst aus der Mode gekommene Sonnenbrille auf die Nase geschoben, und war so eines Morgens in der Polizeiinspektion aufgekreuzt. Die Kollegen hatten ihn verblüfft angestarrt, aber nichts gesagt. Er passte natürlich nicht wirklich zur Oldenburger Polizeiinspektion. Das war ihm bewusst. Aber der Job bereitete ihm Spaß. Jedenfalls am Anfang, bis die Sache mit Selby in seinem Büro passierte. »Burnout Syndrom« kritzelte die Polizeipsychologin auf ihren Notizblock und setzte dahinter ein dickes Fragezeichen.
„Trinken Sie Alkohol?“ Sie lächelte.
„Das kommt vor“, antwortete Robert.
„Häufig?“ Sie lächelte.
Er tat so, als müsste er erst darüber nachdenken. Sie lächelte noch immer. „Ich meine“, lenkte sie ein, „trinken Sie täglich Alkohol?“
„Nee!“, antwortete Robert kurz und knapp.
„Auch nicht einen Cocktail zur Happy Hour, ein Gläschen Bier nach Büroschluss, ein Schoppen Wein zum Essen?“
„Nee!“
Frau Diplom-Psychologin Ursula Przybylski war Expertin auf dem Gebiet der Alkoholismus-Forschung. Sie hatte an der Carl-von-Ossietzky-Universität angewandte Psychologie studiert und war nach ihrem Abschluss bei der hiesigen Polizei kleben geblieben. Das Thema ihrer Diplomarbeit lautete: Alkoholismus am Arbeitsplatz aus der Perspektive subjektiv sinnhafter Lebensbewältigung unter dem Aspekt positiver und negativer Attribute des Geschlechtsrollen - Selbstkonzepts.
Es hatte sich aber erst nach Studienabschluss zum Hauptthema ihres wissenschaftlichen Forscherdrangs entwickelt und war inzwischen zu einer großen Kampfansage herangewachsen. Ihr bislang größter Erfolg gegen Alkoholmissbrauch bestand darin, dass sie es in der Polizeiinspektion tatsächlich durchgesetzt hatte, den Kollegen das bis dato übliche Feierabendbier zu verbieten. Es war allgemeiner Brauch, dass sich Polizisten manchmal nach Dienstschluss unten in der Polizeikantine trafen, sich eine Flasche Bier genehmigten und sich dabei ihren berufsbedingten Alltagsstress von der Seele redeten. Keiner ihrer Vorgesetzten hatte bisher irgendwelche Einwände dagegen gehabt, bis sich die Diplom-Psychologin durchsetzte. Ihre ungeliebte Dienstanweisung hatte ihr schließlich den Spitznamen »Bier-Uschi« eingebracht; wahrscheinlich auch deshalb, weil ihr polnisch klingender Familienname ohnehin den meisten Kollegen nur schwer über die Lippen ging und fast immer in einem heillosen Durcheinander aus unaussprechlich aneinandergereihten Zischlautendungen hinauslief. Auch Robert vermied es, sie mit ihrem Nachnamen anzusprechen. „Frau Kollegin, was bezwecken Sie eigentlich mit ihrem Fragebogen? Ich bin kein Alkoholiker.“
Sie lächelte ihn an und warf dabei ihre Schüttelfrisur mit einer seitlich geneigten Kopfdrehung in die richtige Position. „Sie waren oder sind nicht verheiratet?“
„Das ist korrekt“, antworte Robert.
„Und Kinder?“
„Ich mag Kinder, wenn Sie das meinen.“
Sie lächelte. „Ich meinte, haben Sie eigene Kinder?“
Robert wiegte sanft den Kopf und lächelte nun auch. Sie lächelte ebenfalls.
„Sind Sie Raucher?“
„Als Kettenraucher würde ich mich nicht unbedingt bezeichnen.“
„Wie viele Zigaretten am Tag?“
„Notieren Sie am besten, er raucht gelegentlich. Das kommt der Beantwortung Ihrer Frage am nächsten.“
„Das sollten Sie schon mir überlassen“, meinte sie und gab sich beleidigt.
Er beschloss, die regelmäßigen Sitzungen bei Ursula Przybylski endgültig einzustellen. Sie hatte es tatsächlich geschafft, ihn von seiner Last zu befreien, indem sie ihm eine andere aufbürdete. Es war schließlich diese erbarmungslose, falsche Höflichkeit, die ihn langsam aber sicher aufrieb, ihr ewiges Lächeln. Er stand auf und verabschiedete sich freundlich. Tatsächlich hatte er jetzt das Gefühl, jemanden die Zähne einschlagen zu müssen. Wenn das der unergründliche Zweck ihres saudämlichen Fragespiels gewesen sein sollte, dann war es auf jeden Fall ein voller Erfolg.
Als er an seiner Haustür den Briefkasten öffnete, fand er darin das Schreiben des Labors. Nun hatte er es schwarz auf weiß. Seine Blutzuckerwerte waren nicht in Ordnung, jedenfalls nicht so, wie sie es hätten sein sollen. Es war von Anfangsverdacht auf Diabetes mellitus die Rede. Probates Gegenmittel: mehr körperliche Bewegung, weniger Kohlenhydrate, runter vom Übergewicht.
Er nahm den kleinen Knubbel aus dem Versteck, das sich Lin in seiner Wohnung eingerichtet hatte, hielt sein Feuerzeug kurz drunter, um das Klümpchen Schwarzer Afghane zu erwärmen , dann bröselte er es ab und mischte es mit Tabak. Es lag gut dreißig Jahre zurück, dass er sich das letzte Mal einen Joint gebaut hatte. Ob er das Zeug überhaupt noch abkönnte, würde sich in wenigen Minuten herausstellen. Jetzt war ihm aber danach zumute.
Er entdeckte auf einem kleinen Beistelltisch, der neben der Le Corbusier-Liege stand, die hauptsächlich Lin benutzte, wenn sie Bücher las, einen Studienratgeber, der das Thema Rechtsmedizin behandelte. Robert machte es sich auf der Liege bequem, zündete sich seinen Joint an und begann in der Broschüre zu blättern.
Lins Beruf war durch einige TV-Serien, besonders in letzter Zeit, überaus populär geworden. Neuerdings wurde ihr verantwortungsvoller Job sogar als eine Art Modeberuf angesehen. Das Rechtsmedizinische Institut arbeitete eng mit der Medizinischen Fakultät der Universität Oldenburg zusammen. Vermutlich wurde diese Broschüre deshalb herausgegeben, um dem TV-verzerrten Berufsbild entgegenzuwirken, denn es passierte nicht selten, dass Lin mit Medizinstudenten zu tun hatte, die eine Famulatur oder ein Praktikum im Institut absolvieren wollten. Nicht wenige Studenten verabschiedeten sich bereits nach den ersten Probestunden aus dem Sektionssaal und damit auch von ihrem Traumberuf; oder sie klappten schlichtweg zusammen, weil sie allein schon die penetranten Gerüche abschreckten. Die meisten der zukünftigen Humanmediziner schienen, Lins Meinung nach, jedenfalls nicht in der Lage zu sein, Fiktion und Realität klar und deutlich voneinander unterscheiden zu können.
Die Bezeichnung Forensik umfasst ganz unterschiedliche wissenschaftliche Arbeitsfelder, die sich einerseits mit dem Aufarbeiten, Analysieren oder der Rekonstruktion krimineller Handlungsabläufe beschäftigen. Dazu zählen auch Teilgebiete der Traumatologie, der forensischen Psychologie und der Psychiatrie. Andererseits befasst sich dagegen die klassische Rechtsmedizin hauptsächlich mit körperlichen Verletzungen an Leichen, Leichenteilen oder mit aufgefundenen und sichergestellten Insekten in oder auf Leichen. Sie versucht wissenschaftlich, von diesen Tatsachen ausgehend, auf die entsprechenden Todesumstände Rückschlüsse zu ziehen. Im Bereich der forensischen Psychiatrie dagegen werden Straftäter hinsichtlich des Grades ihrer Gefährlichkeit und der Schuldfähigkeit eingeschätzt. Alles in allem, ein ziemlich weites Feld - und ganz bestimmt kein Betätigungsfeld für medizinstudierende Weicheier, wie Lin immer wieder bemerkte.
Er hatte großen Respekt vor ihrer Arbeit. Aber allein schon der Geruch von Desinfektionsmitteln oder Formalin löste in ihm einen kalten Schauder mit Gänsehauteffekt aus. Er zählte sich selbst, ohne Umschweife oder lächerliche Ausreden, ganz eindeutig zur Fraktion der Weicheier.
Robert ging jetzt mehrmals täglich mit dem Hund der älteren Dame spazieren, die direkt unter ihm wohnte. Sie hatte ihn angesprochen und gefragt, ob er dem Tier etwas zusätzlichen Auslauf verschaffen könne, da sie selbst nicht mehr so »flink op de Fööt« sei. Robert kümmerte sich gern darum. Er nutzte auch die Zeit, um sich intensiver als zuvor um seine Mutter zu kümmern, die ganz in der Nähe wohnte. Rixte war mit ihren über neunzig Jahren noch recht gut beieinander, brauchte aber ab und an vor allem Unterhaltung. Einmal am Tag triumphierte in ihr das Verlangen, zu tratschen. Auf diese Weise erfuhr er meist, was sich so alles im Ziegelhofviertel zugetragen hatte oder vorgefallen war. Manchmal besuchte ihn auch sein Assistent. Jan Onken war der einzige Kollege, den er sehen wollte. Sie verstanden sich auch privat sehr gut.
Manchmal, beim morgendlichen Blick in den Badezimmerspiegel, empfand er sich selbst als einen eher zufällig übrig gebliebenen Retro-Veteran, als Rhythm & Blues-Saurier; und wäre er damals in den 70ern nicht bei den Bullen gelandet, hätte aus ihm vielleicht sogar ein einigermaßen passabler Musiker werden können. Die Betonung lag auf ‚hätte‘, das wusste er selbst am besten. Einer alten »Flying Gibson«, die jahrelang nahezu unberührt in irgendwelchen Zimmerecken herumgestanden hatte, versuchte er nun sogar wieder ab und an schräge Klänge und runde Bluesakkorde abzuringen. Auch wenn seine Fingerspitzen inzwischen viel zu taub geworden waren, so hatte er doch endlich wieder damit angefangen, auf dem Instrument zu spielen. Und es funktionierte wesentlich besser, als er es zunächst für möglich gehalten hatte. Für den Hausgebrauch reichte es. Immerhin.
Der Böschung am Bahndamm hatte er sich zumindest schon seit einigen Wochen nicht mehr genähert. Zu oft hatte er versucht, die genaue Abfolge der Handlungen des Snipers zu rekonstruieren. Aber die Aneinanderreihung von nicht zueinanderpassenden Akkorden führte nun mal zu nichts. Das hatte er endlich begriffen. Oder aber der richtige Moment dafür war noch nicht gekommen.
2
Seit dem Attentat waren bereits Monate vergangen, trotzdem herrschte in der Polizeiinspektion noch immer ein ungutes Gefühl, das zwischen Zweckoptimismus und Resignation pendelte. Auf der 5. Etage war noch immer die Führungsposition der beiden Fachkommissariate 1 & 2 unbesetzt. Beide Abteilungen wurden, nachdem der bisherige Chef in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden war, vom Zentralen Kriminaldienst übergangsweise geleitet. Die Ermittlungen waren mit Roberts Beurlaubung nahezu zum Erliegen gekommen. Die plötzlich aufgetauchte Anwesenheit eines Snipers hatte bei der Bevölkerung Angst und Schrecken erzeugt. Ein kaltblütiger Auftragsmord passte einfach nicht ins scheinbar friedliche Bild der Oldenburger. Eine Art Schockstarre hatte sich auch bei den Beamten ausgebreitet, aus deren Umklammerung sie sich nur mühsam befreien konnten. Von offizieller Seite sprach der PD Oldenburg lediglich von strukturellen Maßnahmen, die innerhalb der beiden Fachkommissariate dringend erforderlich wären. Tatsächlich suchte Polizeipräsident Joachim Radunski nach einem neuen Kripo-Chef, der geeignet wäre, den Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Als Robert von einer Sekretärin in das Büro des Polizeipräsidenten geführt wurde, war er nicht sonderlich überrascht.
Der Raum war riesig. Ein Metallschreibtisch prangte wie ein Ausstellungsstück auf einer Designmesse vor einem Panoramafenster, das mit Lamellenjalousien automatisch auf die einfallenden Lichtverhältnisse reagierte. Der Ausblick aus dem obersten Stockwerk des ehemaligen Regierungsgebäudes verlieh dem Büro zusätzlichen Glanz; man sah direkt auf den Kaiserteich und das umliegende Dobbenviertel. In einer Ecke neben dem Panoramafenster befand sich eine Garnitur mit Drehstühlen, alle mit sehr hochwertigen Lederbezügen. In deren Mitte ein kleiner runder Rauchertisch mit Edelholzintarsien. Alles wirkte sehr nobel. Roberts Blick blieb jedoch an einem gerahmten Foto an der Wand hängen. Es zeigte Joachim Radunski, leger in Freizeitkleidung und Golfutensilien. Das Bild war sicher schon vor ein paar Jahren aufgenommen worden. Neben Radunski war ein ehemaliger niedersächsischer Ministerpräsident zu erkennen, der inzwischen auch als Bundespräsident gescheitert war. Wahrscheinlich eine persönliche Erinnerung an alte glanzvolle Zeiten. Radunski stemmte sich vom Sitz hoch. Der Mann war dick, fast breiter als hoch. Sein Teint war teigig, er hatte erstaunte braune Augen, eine winzige, kindliche Nase und schütteres Haar. Er kam auf Robert zu und strahlte ihn mit seinem besten Fernsehlächeln an. Seine Zähne wirkten wie blankpoliert. „Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Rieken.“
Sein oberster Vorgesetzter bot ihm zuvorkommend einen Platz an. „Sie haben eine tadellose Laufbahn absolviert, Hauptkommissar Rieken. Alles makellos, sowas ist heute ja schon eher eine Seltenheit.“ Dabei gestikulierte er mit Roberts Personalakte.
„Wie soll ich das verstehen?“, hinterfragte Robert.
„Ach, nehmen Sie es einfach als Kompliment.“ Robert konnte am ganzen Gehabe des Polizeipräsidenten leicht ablesen, dass er mächtig unter Druck stand. Die Wogen, die das Attentat verursacht hatte, waren weit über die Ländergrenzen Niedersachsens hinaus geschwappt und hatten selbstredend auch auf Polizeipräsident Radunski einen unschönen Schatten geworfen. Die Presse hatte dem Vorfall in den vergangenen Wochen allergrößte Aufmerksamkeit geschenkt, schließlich war dieser Mord der eindeutige Beweis dafür, dass inzwischen die ausgestreckten Tentakel des organisierten Verbrechens sogar bis in das ruhige und beschauliche Oldenburg vorgedrungen waren. Den Begriff »Russenmafia« wollte offenbar in der Polizeidirektion niemand mehr laut aussprechen. Vorerst stocherten die Journalisten zwar nur in den offenen Wunden herum, aber es war nur noch eine Frage der Zeit, dann würden sie sich auch mit der Frage der Kompetenz des Polizeichefs beschäftigen. Diesem Problem versuchte er zuvorzukommen. Radunski warf den Kopf zurück und lachte. Robert fand das Lachen allerdings genauso angespannt beherrscht wie das gesamte Verhalten des Mannes.
„Sehen Sie, Herr Hauptkommissar, wir müssen endlich wieder auf unseren altbewährten Erfolgskurs bei der Verbrechensbekämpfung zurückkehren. Und ich denke, Sie sind genau der richtige Mann dafür. Wenn schon das Organisierte Verbrechen nicht einmal mehr davor zurückschreckt, vor den Augen der Ermittlungsbehörde und der Justiz einen kaltblütigen Mordanschlag zu begehen, dann müssen wir dem mit aller größter Entschlossenheit und äußerster Konsequenz entgegentreten.“ Die Lippen des Mannes verzogen sich zu einem breiten Grinsen. „Ich habe gestern mit dieser Diplom-Psychologin, mit Frau Ursula Przy-bycz-linski …“
„Sie meinen, sicher die Kollegin Przybylski“, sagte Robert schnell, um ihm die korrekte Aussprache des Namens zu ersparen. Radunski nickte zustimmend.
„Ja, natürlich, also ich habe mit ihr gesprochen. Sie bestätigte, dass einer sofortigen Wiederaufnahme Ihrer erfolgreichen Ermittlungsarbeit keinerlei gesundheitliche Bedenken mehr im Wege stünden. Sie sind also wieder voll einsatzfähig und diensttauglich. Sehen Sie das genau so?“
„Einsatzfähig, diensttauglich.“ Diese zwei Worte platzten aus ihm heraus.
Auf Radunskis rundem Gesicht tauchte der misstrauische Ausdruck auf, den Robert nur allzu gut kannte. „Und wer sonst, wenn nicht Sie und ihr Assistent Kriminalmeister Onken haben durch ihre akribische Ermittlungsarbeit diesen Stein ja schon ins Rollen gebracht. Sie müssen unbedingt den Sniper aufspüren und ihn so schnell wie möglich hinter Schloss und Riegel bringen. Sonst bekommen wir heftigen Gegenwind von ganz oben. Verstehen Sie?“
Auf den Auftragskiller war inzwischen das ganze Spektrum seines Interesses gerichtet. „Wären Sie dazu bereit, als neuer Chefermittler beide Kommissariate zu übernehmen? Das würde selbstverständlich auch mit einer Beförderung zum Ersten Kriminalhauptkommissar einhergehen; versteht sich ja von selbst.“
Robert mochte die ohnehin reichlich anfallenden administrativen Tätigkeiten nicht besonders, die nur mit dem PC zu erledigen waren. Zwei Kommissariate zu leiten, das bedeutete unweigerlich jede Menge Schreibkram, stundenlanges Palavern auf Konferenzen mit kleinen Bullshit-Bingo-Einlagen, kaum noch Kontakt mit der Welt da draußen, langweiliger Büroalltag bis zur Pensionierung. Er rümpfte seine Nase.
„Um ehrlich zu sein, Herr Polizeipräsident, ich würde liebend gern als Chefermittler arbeiten. Als Kripo-Chef, fürchte ich, wäre ich in der Führungsposition gleich zweier Fachkommissariate glatt weg eine Fehlbesetzung.“
Radunski errötete, stammelte eine Floskel, die Roberts Bedenken herunterspielen sollte; dabei blickte er ihn die ganze Zeit über wie ein Cockerspaniel an, der Angst vor Prügel hat.
„Sie würden selbstverständlich von mir jegliche Unterstützung erhalten.“
„Jede?“, erkundigte sich Robert und schien über das Angebot ernsthaft nachzudenken. Aber ihm fehlte die Muße, um aus dem Bauch heraus eine spontane Entscheidung zu treffen. „Und?“, hakte Radunski nach. „Ich würde Ihnen außerdem einige Freiheiten einräumen.“
Nachdem Roberts Interesse geweckt war, schob er einen Stapel Papierkram auf dem kleinen Tisch zur Seite, lehnte sich auf seinem Drehstuhl zurück und hörte zu, was Radunski noch zu sagen hatte.
„Ich meine damit natürlich nur persönliche Freiräume bei der Wahl ihrer Ermittlungspraktiken. Und natürlich auch nur dann, wenn sie meinen Ermessenspielraum nicht übersteigen.“
„Hmm … also gut“, erwiderte Robert, nachdem er sich mit dem Gedanken angefreundet hatte. „Unter einer Bedingung.“
„Und die wäre?“
„Kriminalmeister Jan Onken, der zwar noch als unerfahrener Polizist gilt, aber dennoch einen ganz erheblichen Beitrag zur Aufklärung des letzten Falles beigesteuert hat, sollte bei der Beförderung nicht übergangen werden. Ich bestehe darauf.“
„Einverstanden. Ich hatte ohnehin Gleiches im Sinn.“
Robert gab sich damit zufrieden.
Joachim Radunski atmete erleichtert aus und murmelte: „Wenn das alles ist.“ Ein Ausdruck ungläubigen Erstaunens breitete sich auf seinem Gesicht aus.
„Das ist alles“, meinte Robert. „Datenbanken zu füttern, aufzubauen und zu pflegen, das ist alles nicht so mein Ding, wissen Sie? Das gehört zu Jans Stärken. Er ist quasi mit dem modernen technischen Krimskrams aufgewachsen.“
Radunski lächelte. „Schön, dass Sie einen jungen Kollegen protegieren. Gerade heutzutage, wo jeder nur noch an die nächsthöhere Besoldungsstufe denkt.“
Als er das Büro verließ, entdeckte er zufällig an der Wand ein zweites gerahmtes Foto. Diesmal stand neben dem dicken, teigigen Mann mit der winzigen, kindlichen Nase ein großer blonder Typ in lächerlichen Gala-Klamotten, den er zweifelsfrei als einen bekannten Schlagersänger identifizierte. Robert wusste, dass der TV-Promi in seiner Jugend das hiesige Wirtschaftsgymnasium im Stadtteil Haarentor besucht hatte. Und ihm war klar, dass in Oldenburg nicht gerade ein Überangebot an Prominenz herrschte, da machte selbst ein peinlicher Schlagerstar was her. Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Radunski sah auf dem Foto aus wie ein Ochsenfrosch, der zufällig auf einem roten Sofa neben einem Nymphensittich gelandet war. Offensichtlich war der oberste Polizist Oldenburgs abhängig von der Prominenz anderer Leute.
***
Am nächsten Tag war es schon soweit: neue Schulterstücke, Händeschütteln, ein Fototermin für die Lokalpresse, erneutes Händeschütteln, großer Bahnhof.
Die örtliche Regionalzeitung wusste immerhin am darauffolgenden Tag, die beiden beförderten Kripo-Beamten mit einem Artikel auf der dritten Seite zu würdigen. Als Robert die NWZ aufschlug, bereute er allerdings schon jetzt, den Job angenommen zu haben. Tröstlich war lediglich der Gedanke, dass dieses Bild ganz bestimmt nicht in einem Goldrahmen an der Wand in Radunskis Büro landen würde. Das Pressefoto zeigte ihn und Jan, beide in Uniform. Neben ihnen der amtierende Oberbürgermeister der Stadt. Dahinter der Polizeipräsident und ganz rechts im Bild ein aufgeblasener Landrat. Unter dem Foto war eine dieser typisch nichtsagenden Wortmeldungen abgedruckt:
»Begrüßt wurden Robert Rieken und sein junger Kollege Jan Onken auch von Oldenburgs Oberbürgermeister Detmar Schindler und Landrat Siegmar Schulte. Der Oberbürgermeister lobte die traditionell gute Zusammenarbeit mit der Polizei und bot dem frischgebackenen Ersten Kriminalhauptkommissar an, diese auch in Zukunft fortzusetzen. Ähnlich äußerte sich Landrat Schulte, der außerdem betonte, dass er hoffe, Robert Rieken in seiner Funktion als Chefermittler nur zu offiziellen Anlässen im ruhigen und beschaulichen Landkreis begrüßen zu müssen.
Fast alle zeigten ein fotogenes Lächeln, nur Robert hatte dem Pressefotografen ein künstlich aufgesetztes Grinsen verweigert.
3
Der weihnachtlich dekorierte Lamberti-Markt war um diese Zeit gut besucht. Obwohl es noch am Morgen und den ganzen Vormittag über wie aus Kübeln gegossen hatte, zeigte sich jetzt plötzlich das unberechenbare norddeutsche Wetter wieder von seiner schönsten Seite. Der strahlend blaue Himmel verbreitete zwar keine vorweihnachtliche Stimmung, inspirierte aber dafür viele Oldenburger zu einem Spaziergang über den Markt.
Über hundert Verkaufsbuden boten zwischen Rathausmarkt und Schlossplatz ihre Waren an. Weil kein echter Schnee zur Verfügung stand, wurde dieser auf den Dächern der Holzbuden durch künstliche Imitate ersetzt. Geboten wurde auch in diesem Jahr wieder das übliche: Glühwein und Kinderpunsch, gebrannte Mandeln, kandierte Früchte und andere überzuckerte Leckereien. Die Leute drängten sich über die Achtern- und Lange Straße in Richtung Schlossplatz. Die ganze Innenstadt schien auf den Beinen zu sein. Unbeeindruckt von der an ihm vorüberziehenden Menschenmenge stand an einer Hausecke einer der wenigen noch existierenden Oldenburger Originale. Der hagere Mann hatte sich über seine Schulter einen roten Umhang und eine halbakustische Gitarre gehängt und vor seinem Gesicht baumelte eine Mundharmonika an einem Halterungssteg. Der Straßenmusikant erinnerte mit seiner Sonnenbrille und seinem blassen Gesicht ein wenig an jenen blonden Schlagersänger, der mit unsagbar vielen Schrammel- und Schunkelliedern bereits jahrzehntelang ein Millionenpublikum beglückte. Aber dieses stadtbekannte Original gab an der Häusing keine nachgespielten Rocksongs oder deutsches Liedgut von sich. Es waren vielmehr feingewebte, manchmal in sich unschlüssige Eigenkompositionen, die er mit eigenen Texten ausstaffierte, die aber kaum jemand verstand, weil seine geheimnisvolle Lyrik durch den mickrigen, batteriegespeisten Verstärker ständig übertönt wurde. In der ganzen Stadt war er unter dem Namen Friedemann bekannt. Manchmal spendierten die Geschäftsinhaber in der Fußgängerzone ihm einen kleinen Obolus, unter der Bedingung, dass er weiter zur nächsten Straßenecke ziehen sollte, da sie seine Auftritte nicht länger aushielten. Als Robert ihn vor der Häusing entdeckte, warf er ihm eine Zwei-Euro-Münze auf den Pinketeller.
Jan und Robert waren auch auf dem Weg zum Lamberti-Markt. Dort sollte ein offizielles Treffen mit niederländischen Kollegen stattfinden. Robert freute sich auf Frau Commissaris Kuperus von der Regiopolitie Groningen. Die Polizeidienststellen von Oldenburg und Groningen pflegten eine gemeinsame Tradition. Jedes Jahr zur Adventszeit fand ein Kollegenaustauch statt. In Oldenburg patrouillierten einige niederländische Streifenpolizisten durch die Fußgängerzone und in Groningen versahen im Gegenzug Oldenburger Beamte ihren Dienst. Ähnlich hielten es auch viele Weihnachtsmarktbesucher. Unzählige Oldenburger bevölkerten an den Adventstagen die Innenstadt von Groningen, währenddessen Niederländisch auf dem Lamberti-Markt zur Hauptsprache wurde.
„Sag mal, kennst du dich zufällig in der Hierarchie der niederländischen Polizei aus?“ Jan nickte und begann sofort aus dem Effeff die Dienstgrade aufzusagen: „Agent, Hoofdagent, Brigadier, Adjudant, Inspecteur, Hoofdinspecteur, Commissaris - und ganz weit oben steht der Hoofdcommissaris.”
Ein Ausdruck ungläubigen Erstaunens breitete sich auf Roberts Gesicht aus, was so viel wie Respekt signalisieren sollte. Dann aber fuhr er sich mit der rechten Hand über den Rand seiner Schirmmütze und blieb vor einem Ladengeschäft stehen. Einen Augenblick kämpfte er mit sich, doch dann triumphierte das Verlangen, sich mit kritischen Blicken im Spiegelbild einer Schaufensterscheibe zu betrachten. „Weißt du, ich frage mich nämlich schon die ganze Zeit, wie ich die Kommissarin korrekt ansprechen soll. Bei uns ist ein weiblicher Kommissar ja normalerweise eine Kommissarin. Wie aber spricht man eine niederländische Kommissarin an?“ Robert empfand seine Figur beim Anblick des Spiegelbildes absolut unvorteilhaft.
„Das ist eigentlich ganz einfach“, antwortete Jan, „Wenn es sich um eine Kommissarin handelt, wird sie als 'vrouwelijke Commissaris' angesprochen. Verstehst du: 'De commissaris is een vrouw'.“
Robert zwinkerte hinter seinen Brillengläsern. „Und das alles weißt du, auch ohne zuvor das Internet-Orakel zu befragen? - Alle Achtung!“
Robert redete weiter. Er strich sich mit einer Hand über den Bauch.
„Ich bin einfach viel zu fett geworden in letzter Zeit. Ich sehe aus wie eine uniformierte Presswurst!“ Dann wandte er sich von dem Spiegelbild ab und brummte frustriert: „Wenn dieser bescheuerte Anlass überstanden ist, wandert meine Uniform sofort mit ein paar Mottenkugeln in den Schrank zurück. Sowas steht mir einfach nicht.“ Aus seinem Augenwinkel sah er, wie sich Jan amüsierte.
„Ist das dort drüben nicht unser Informationsstand?“ Jan hielt eine Hand über seine Stirn. Er hatte am nördlichen Ende des Schlossplatzes einen Zelt-Pavillon entdeckt. Nebenan waren auf beiden Seiten Einsatzfahrzeuge aufgestellt, links ein protziger blau-silberner E-Klasse-Mercedes der Oldenburger Polizei und rechts ein in den niederländischen Landesfarben blau-weiß-orange gestreifter Funkstreifenwagen der Regiopolitie Groningen. Vor dem Zelt-Pavillon wimmelte es nur so von Uniformierten. Aus der Mitte des blauen Pulks ragte der Kopf des Oldenburger Polizeipräsidenten Joachim Radunski heraus, der gerade ein Podium bestieg und irgendetwas über Lautsprecher ankündigte. Als sie sich dem Pavillon genähert hatten, entdeckten sie auch eine blonde Frau, die offenbar Amélie Kuperus sein musste. Sie war wie eine Bienenkönigin von ihren niederländischen Kollegen umringt, die deutlich an den grellleuchtenden gelben Streifen auf ihren Uniformen zu erkennen waren. Amélie Kuperus trug ein dunkelblaues Käppi, was sogar recht chic wirkte. Sie war vielleicht Mitte 40, hatte ein markantes aber freundliches Gesicht und trug eine auf Taille maßgeschneiderte Uniform.
„Schon knuffig, unsere Nachbarn“, sagte Robert. „Das Uniformmodell ‚bewaffneter Briefträger‘ hat sich dann wohl durchgesetzt.“ Jan grinste. Er kannte längst Roberts tiefsitzende Abneigung gegenüber jeglicher Uniformierung.
Polizeipräsident Radunski sprach gerade in ein Mikrofon und verkündete voller Begeisterung den Marktbesuchern, dass der Polizei in Niedersachsen gemeinsam mit der Regiopolitie Groningen nun sehr bald mit einem neuentwickelten automatischen Kennzeichen-Lesegerätes ein wirkungsvolles Instrument zur Verfügung stehe, das im Kampf gegen die grenzübergreifende Kriminalität zum Einsatz kommen werde. Dabei deutete er auf ein elektronisches Gerät, das einer herkömmlichen Radarfalle sehr ähnlich sah. Dann hielt Radunski inne, so als erwarte er, dass sich ein Applaus seiner wenigen Zuhörer einstellen würde. Aber niemand rührte auch nur eine Hand.
Er versuchte, seine Würde wiederzufinden, indem er sich das Haar zurückstrich und demonstrativ ein Lächeln zeigte. Dann forderte er seine niederländische Kollegin mit einem Handzeichen auf, zu ihm aufs Podium zu kommen. Als er jedoch bemerkte, dass Amélie Kuperus keinerlei Anstalten machte, setzte er seine Rede unbeirrt fort: „Die Funktionsweise dieses High-Tech-Gerätes ist ebenso kompliziert wie effektiv: Eine Videokamera scannt die Kfz-Kennzeichen der kontrollierten Fahrzeuge ein und gleicht sie in Bruchteilen von Sekunden mit den Fahndungscomputern in beiden Ländern ab. Sollte ein gesuchtes Fahrzeugkennzeichen, das in den Fahndungslisten registriert ist, auf diese Weise entdeckt werden, erhält die Besatzung des Streifenwagens ein Signal auf einem Bildschirm und kann blitzschnell erkennen, aus welchem Grund das Fahrzeug ins Visier genommen worden ist.“
Er hob beide Arme, als wolle er mit dieser Geste versuchen, seine Zuhörer in die verheißungsvollen Segnungen dieser technischen Meisterleistung einzuweihen. „Ich verspreche Ihnen, liebe Oldenburger Bürgerinnen und Bürger: Drogendealer, Autoschieber oder Bankräuber werden es zukünftig noch schwerer haben, sich dem langen Arm des Gesetzes zu entziehen.“
4
Die vergangenen Tage waren noch sehr klar und sonnig gewesen, doch in der vergangenen Nacht hatte ein heftiger Dauerregen eingesetzt.
Oxana hatte vor fünf Monaten einen Job als Haushaltshilfe im Landhaus der de Groots angenommen. Sie hatte zuvor unzählige Bewerbungen geschrieben, aber immer nur Ablehnungen erhalten. Dann entdeckte sie eines Tages diese Anzeige in der Zeitung: Haushaltshilfe dringend gesucht. Und hatte sich sofort gemeldet.
Sophia de Groot war eine attraktive Frau, Mitte vierzig, gepflegt, intelligent und gebildet, aber nicht eingebildet oder voreingenommen. Sie fanden sich beide gleich beim ersten Vorstellungsgespräch sympathisch. Sophia hatte ihr erzählt, dass schon einige Bewerberinnen vor ihr dagewesen wären, aber die meisten von ihnen hätten recht schnell Desinteresse gezeigt, besonders nachdem sie das ganze Anwesen besichtigt hätten. Vor allem die sumpfige Umgebung wäre wohl daran schuld gewesen, hatte ihr Sophia de Groot gesagt. Das Anwesen der Familie bestand hauptsächlich aus einem renovierten Bauerngehöft, das von drei Seiten mit einem parkähnlichen Grundstück umsäumt war. Es lag mitten im Goldenstedter Moor, einem 640 Hektar großen Naturschutzgebiet und zählte zu den größten zusammenhängenden Moorgebieten Deutschlands. Frau de Groot hatte ihr auch erklärt, dass sich etwa zwei Drittel des angrenzenden Umlandes noch immer in unkultiviertem Urzustand befänden. Sie schwärmte von der noch nahezu unberührten Natur. Oxana fand das alles sehr reizvoll. Sie war selbst in der Nähe eines Moores aufgewachsen, das lag allerdings einige tausend Kilometer weit entfernt, mitten in Sibirien.
Ihre Chefin legte vor allem Wert auf Pünktlichkeit. Heute würde sie auf jeden Fall zur vereinbarten Zeit bei den de Groots eintreffen.
Nachdem sie mit ihrem Kleinwagen von der Landesstrasse 881 rechts in Richtung Arkeburg abgebogen und anschließend einige Minuten die wellige und mit Pfützen übersäte Straße entlang gefahren war, tauchten plötzlich hinter ihr im Rückspiegel zwei Autoscheinwerfer auf, die sie zunächst in größerer Entfernung bemerkte. Die Nebenstraße führte durch flaches Weideland und an einzelnen Wäldchen vorbei. Doch dann wurde aus der befestigten Straße ein Sandweg, der direkt zum Goldenstedter Moor hinführte. Bereits nach wenigen Minuten hatte sich der Pkw ihr soweit genähert, dass sie die auf und ab schwenkenden Scheinwerfer des Wagens zu irritieren begannen. Als der Wagen endlich so dicht hinter ihr aufgefahren war, dass die Lichter sie nicht mehr im Rückspiegel blendeten, erkannte sie die schemenhafte Kontur eines Mannes. Er saß am Steuer eines dieser geländegängigen Jeeps, denen eine solche schlechte Wegstrecke weniger Probleme bereitete als ihrem Fiat Punto. Sie klammerte sich am Lenkrad fest und steuerte ihren Kleinwagen soweit wie möglich nach rechts, so dass ihre beiden rechten Wagenräder bereits über die Grasnarben holperten. Als der Jeep kurz darauf an ihr vorbeizog, warf ihr der Fahrer einen freundlichen Blick zu und hob seine rechte Hand, als wollte er sich mit dieser Geste für ihre freundliche Umsichtigkeit bedanken. Sie nickte kurz zurück, konzentrierte sich dann aber wieder auf die Unebenheiten der Wegstrecke. Ein Schwall Wasser spritzte vor ihr aus einer der Pfützen auf und ein schlammiges Gemisch aus Torf, Sand und Lehm wurde gegen die Windschutzscheibe ihres Wagens geschleudert. „Das hat man nun davon“, murmelte Oxana ärgerlich und schaltete sofort den Scheibenwischer auf die nächsthöhere Intervallstufe. Aber die Wischblätter überzogen gleich mit der ersten Drehbewegung die gesamte Windschutzscheibe mit einem Schmutzfilm, der wie ein undurchdringlicher Schleier die Durchsicht einen Moment lang nahezu unmöglich machte. Erst nachdem sie kurz gestoppt hatte und die Reinigungsflüssigkeit aus der Sprühvorrichtung eine erste Wirkung zeigte, hörten die beiden Wischblätter auf über die Glasoberfläche zu kratzen. Jetzt konnte sie auch wieder die roten Rücklichter des Wagens erkennen, der sie gerade überholt hatte. Der Jeep trug ein niederländisches Kennzeichen und Oxana wusste sofort, dass sie beide das gleiche Ziel haben würden. Sie erinnerte sich daran, dass Sophia de Groot erst vor wenigen Tagen davon gesprochen hatte, dass ihr Sohn Erik aus Groningen zu Besuch kommen würde. Dies musste er sein, Erik de Groot, von dem sie schon so viel gehört hatte und dessen Foto erst vor ein paar Wochen in der Zeitung abgebildet war. Sie hatte den Artikel zufällig beim Staubwischen in der Diele des Landhauses entdeckt und ihn flüchtig gelesen. Daher wusste sie, dass Erik zukünftig einen geschäftlichen Bereich der Firma seines Vaters übernehmen und leiten sollte.
Im morgendlichen Dämmerlicht, das über der Moorlandschaft lag, herrschten Brauntöne vor und die Gebiete links und rechts des Weges wurden zusehends feuchter, die Bäume immer kleiner und verkrüppelter. Oft waren nur abgestorbene Stämme zu sehen. Wie würde sie eigentlich diesen Weg bei Frost und Glatteis bewältigen? Normalerweise fuhr sie mit dem Fahrrad zweimal wöchentlich diese Strecke. Bei diesem Mistwetter hätte sie es heute mit dem Rad erst gar nicht bis hierher geschafft. Was aber, wenn erst alles zugefroren und vereist wäre? Würde sie es überhaupt mit dem Wagen bis zum Anwesen der de Groots schaffen? An die bevorstehenden Wintermonate hatte sie tatsächlich noch nie gedacht. Es gab ja nicht einmal eine Busverbindung von Vechta bis in diese abgeschiedene Gegend.
In den vergangenen Tagen war allerdings noch nichts von einem Wintereinbruch zu spüren gewesen. Im Gegenteil, es herrschten Temperaturen um die 10 Grad Celsius. Zwar hatte der Wetterbericht gestern Abend ein heranziehendes Sturmtief mit orkanartigen Böen vorhergesagt, dessen Vorboten sich bereits mit tief hängenden und schnell dahinziehenden Wolken ankündigten; auch gab es schon jetzt vereinzelte Windböen, die über die kahlen Felder jagten und ihrem alten Fiat heftig zusetzten. Aber mit sibirischen Winterverhältnissen, wie sie sie kannte, hatte das alles nichts zu tun.
Sie musste plötzlich lächeln, als sie sich erinnerte, welche frostigen Temperaturen sie als Kind in ihrer Heimat erlebt hatte. Temperaturen von unter minus 25 Grad Celsius und meterhoch aufgetürmte Schneewehen waren dort im Dezember keine Seltenheit. Umso mehr war sie froh darüber, sich an diesem Morgen dafür entschieden zu haben, das Auto zu benutzen. So saß sie wenigstens im Trockenen.
Als sie erneut versuchte, die Rücklichter des vorausfahrenden Jeeps wiederzuentdecken, waren diese bereits in der Dämmerung verschwunden. Endlich näherte sie sich dem Mooreichenwäldchen, welches das Anwesen der de Groots umsäumte. Durch die kahlen Baumkronen war nun auch das reetgedeckte Dach des Hauses deutlich sichtbar. Von hier aus waren es nur noch weniger als hundert Meter, bis sie den rechtwinklig abzweigenden und mit Schotter aufgeschütteten Zufahrtsweg zum Landhaus erreichen würde. Als sie nochmals genauer hinübersah, bemerkte sie einen Lichtschimmer, der direkt hinter dem Dachgiebel von der Gartenseite des Anwesens aufsteigend, die kahlen Äste der Bäume in ein merkwürdig diffuses Licht tauchte. Der Effekt wurde zusätzlich noch von den tiefliegenden Wolkenmassen verstärkt, die das Licht reflektierten. Ihr war bisher dieser Irrlichteffekt noch nie aufgefallen und sie wunderte sich darüber. Vielleicht war es die neue Gartenillumination, die Hendrik de Groot erst in den vergangenen Tagen installiert hatte und die er jetzt ausprobieren wollte. Sie kannte seine Leidenschaft für solche Spielereien. Die Um- und Neugestaltung des noch immer teilweise verwilderten Anwesens war allein seine Angelegenheit und er schien sich hierbei als leidenschaftlicher Landschaftsdesigner immer wieder Neues und Außergewöhnliches einfallen zu lassen. Offensichtlich gehörte es zu seinem ganz persönlichen Spleen, das direkt am Moor angrenzende Areal in eine anderthalb Hektar große Parklandschaft mit künstlich gesetzten Irrlichteffekten zu verwandeln.
5
Das Gebäude der Polizeiinspektion stand vor ihm wie ein großer dunkler Kasten. Es war noch nicht einmal 7 Uhr 15 morgens und es goss in Strömen. Er wollte heute noch vor allen anderen Kollegen im Büro sein. Es war sein erster Arbeitstag seit Monaten.
Robert hatte den Aufzug benutzt. Er ging über den Korridor der 5. Etage und trat die Schuhe auf einer Gummimatte ab. Sein Regenmantel tropfte auf den abgenutzten Fußbodenbelag. In den anderen Büros brannte noch kein Licht. Aber als er die Schwingtür zum Kommissariat mit dem Fuß aufstieß, sah er am Ende des Korridors einen Lichtschimmer unter einer der Bürotüren. Jan war ihm offensichtlich zuvorgekommen.
„Moin, Jan. Hast du kein Zuhause?“
„Moin, Robert. Wenn du meine Bude kennen würdest, käme dir wahrscheinlich dieses Büro auch wie ein Luxusapartment vor.“
„Offizieller Dienstbeginn ist aber erst in einer Dreiviertelstunde.“
„So? Und was machst du dann hier?“
„Ich dachte, neuer Chef, neue Regel. Ich sollte vielleicht als Erster im Büro sein.“
„Was soll daran neu sein? Das hast du doch früher auch schon so gehalten. – Und? Tolles Büro, oder?“
Sie hatten sich ganz bewusst nicht für das wesentlich komfortablere Chefbüro entschieden, sondern waren nur eine Tür weitergezogen, um ein paar Quadratmeter mehr Raumfläche zu haben. Ihr bisheriges drohte ohnehin längst aus allen Nähten zu platzen. Jetzt hatten sie zumindest jeder einen eigenen Schreibtisch und konnten darunter ihre Füße ausstrecken, ohne dabei Gefahr zu laufen, sich gegenseitig ins Gehege zu kommen. Es roch überall noch nach frischer Malerfarbe und eine moderne Organisationstafel hatte die alte durchlöcherte Pinnwand ersetzt. Sogar zwei nagelneue PCs, die jeweils mit großen Flachbildschirmen ausgestattet waren, standen einsatzbereit zur Verfügung, was besonders Jans Herz höher schlagen ließ. Robert entdeckte beim ersten Rundblick zwei Blumentöpfe auf dem Fensterbrett, die jemand dort sehr dekorativ platziert hatte.
„Na toll“, meinte er überrascht, „Weihnachtsterne, meine erklärten Lieblingspflanzen. Mit so viel Fürsorge hatte ich, ehrlich gesagt, gar nicht gerechnet.“
„Das war sicher Frau Bulthaupt“, vermutete Jan. „Sie hatte wochenlang keinen Chef mehr, den sie betüddeln konnte. Jetzt hofft sie auf eine gute Zusammenarbeit mit uns. Ist doch eine sehr nette Geste, finde ich.“
„Ja, finde ich auch. - Übernimmst du das Gießen? Ich habe keinen grünen Finger. Bei mir vertrocknet immer alles.“
Jan und Robert konnten sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
„Schön, dass du wieder da bist“, bemerkte Jan. „Ehrlich, wir haben dich hier echt vermisst.“
„Glaub ich nicht.“ Robert tippte mit einem Bleistift auf die noch unbenutzte Schreibtischunterlage, dann wechselte er das Thema: „Sag mal, was ist eigentlich aus deiner Karriereplanung geworden? Du wolltest dich doch an der Uni Kiel bewerben, um Rechtspsychologie zu studieren.“
„Ach, das habe ich vorerst auf Eis gelegt.“
„Aber weshalb? Du hattest doch noch vor einigen Monaten davon gesprochen, dass du dich für den Polizeipsychologischen Dienst interessierst.“
„Ist irgendwie Schnee von gestern“, meinte Jan etwas kleinlaut.
„Was ist passiert?“
„Na ja, die Sache ist so. Ich hab´s mir inzwischen anders überlegt. Die Aufgaben des Polizeipsychologischen Dienstes beschränken sich ja nun mal nicht allein auf die Unterstützung der Dienststellen bei komplizierten Einsätzen, sondern hauptsächlich auf die psychologische Begutachtung von Kollegen. Diese Leute entscheiden über eine Polizeidienstfähigkeit. Jedoch Gutachten über Kollegen zu erstellen, und damit über Lebensläufe zu entscheiden, das ist vielleicht doch nicht so mein Ding.“
„Verstehe“, sagte Robert, „wahrscheinlich hast du an unsere »Bier-Uschi« gedacht. Stimmt’s?“
„Ja, hab ich auch, aber nicht nur. Außerdem kam mir jetzt noch diese vorzeitige Beförderung zum Kriminalobermeister in die Quere. Damit war ja nicht zu rechnen.“ Er hielt inne, so, als erwarte er, Robert würde etwas dazu sagen. Aber Robert sah ihn nur fragend an. „Deshalb wollte ich sowieso mit dir reden.“
„Schieß los.“
„Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Beförderung allein dir zu verdanken habe. - Ist das so?“ Seine Worte klangen mehr wie eine Feststellung als eine Frage. Robert lächelte.
„Nee. Den dritten Stern hast du dir ganz redlich selbst verdient. Schließlich warst du es, der uns beiden aus der Patsche geholfen hat. Die Sache wäre ohne dein überlegtes Eingreifen völlig aus dem Ruder gelaufen. Selby hätte mich und sicher auch Lin erledigt. Soviel steht fest.“
„Du hast also nicht bei Radunski nachgeholfen?“
„Ach, woher denn!“, platzte es aus ihm heraus. „Unser Polizeipräsident war gar nicht zu bremsen. Er ist ganz zufrieden mit unserer Arbeit. Du siehst ja selbst. Jetzt haben wir sogar ein nagelneues Büro.“
„Was hat er eigentlich gesagt? Ich meine, er hat dich doch bestimmt in die Mangel genommen, oder?“
„Radunski ist natürlich sehr daran interessiert, dass wir Selbys Mörder finden. Er hat einfach nur Angst um sein Renommee. Die schlechte Presse bereitet ihm schlaflose Nächte. Versprochen habe ich ihm aber nichts. - Und mich als kommissarischen Kommissar einzusetzen, war auch seine Idee.“ Robert blätterte in der dünnen Akte herum, die ihm jemand auf den Schreibtisch gelegt hatte und die mit der Aufschrift »Sniper« versehen war. – „Konntet ihr inzwischen neue Erkenntnisse sammeln, die uns in diesem Fall weiter voranbringen?“
Jan zuckte mit den Schultern.
„Als sicher gilt nur eins, er hat ein PSG1 benutzt. Es gibt nach wie vor keinen einzigen Zeugen, der den Schützen vor, während oder nach seiner Tat gesehen hat. Die ausgewerteten Videoaufzeichnungen haben auch nichts ergeben. Ich hatte gehofft, durch die Überwachungskameras, die überall am Polizeigebäude installiert sind, eventuell Aufnahmen von ihm zu bekommen. Leider Fehlanzeige. Auch die damals eingeleitete Ringfahndung kam viel zu spät zum Einsatz, da wir hier alle zunächst völlig kopflos reagiert haben.“
Robert ließ seine geballte Faust gegen die Schublade eines Aktenschrankes krachen. „Das kann alles nicht wahr sein! Kein Mensch taucht irgendwo auf und verschwindet dann wieder, ohne eine Spur zu hinterlassen. So ein PSG1-Scharfschützengewehr hat einen Anschaffungspreis von mindestens 11.000 Euro. Sowas besitzt nicht jeder dahergelaufene Kleinkriminelle. Das hat mich die ganzen letzten Wochen ohne Unterbrechung beschäftigt. Verstehst du?“ Das kam nicht ungläubig heraus, sondern vielmehr erschöpft und frustriert.
„Er hat eine Spur hinterlassen“, erläuterte Jan trocken. „Das Dum-Dum-Geschoss. Es steckte unter der Kunststoffverkleidung der Bürodecke. Die Reste des Projektils sind allerdings nach Meinung unserer Ballistiker als Beweisstück völlig unbrauchbar, da es nur noch aus zerfetzten Metallsplittern besteht.“
„Unsere Ballistiker reden lauter Scheiß!“ Robert hielt inne und korrigierte sich. „Jedenfalls teile ich ihre Meinung nicht.“ Dann fuhr er in ruhigem und neutralem Ton fort. „Wir sollten die Splitter des Projektils ans Kriminaltechnische Institut beim BKA nach Wiesbaden einsenden. Die Experten dort liefern oft entscheidende Hinweise auf den Täter. Kannst du das noch heute veranlassen? Du weißt ja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.“
Jan grinste verlegen. „Ich wollte nur sagen, dass ich diese Option schon eingeleitet habe.“
„Ich hab´s irgendwie geahnt, Jan. Ich bin, ehrlich gesagt, heilfroh darüber, dass du dir die Sache mit dem Studium noch mal überlegt hast. - Und was ich auch noch sagen wollte: Ich weiß jetzt wieder, weshalb ich diesen Job hier so mag.“
„Und was ist der Grund?“
„Wir müssen hier nicht ständig lächeln, wie die Parfümverkäuferinnen bei Leffers. Wir können uns auch mal anschreien, ohne dass gleich der Polizeipsychologische Dienst vor der Tür steht.“
Es klopfte energisch an der Tür.
„Wenn man vom Teufel spricht“, witzelte Jan grinsend.
6
Als Oxana die Auffahrt erreicht hatte und langsam den Kiesweg zum Anwesen entlangrollte, entdeckte sie auch den Jeep wieder, der direkt vor der Eingangstür des Hauses abgestellt war. Sie hatte sich also doch nicht getäuscht. Es war Erik de Groot, der bereits vor der Haustür stand und auf sie zu warten schien. Als er die Scheinwerfer des Fiat Punto sah, eilte er ein paar Schritte dem sich nähernden Kleinwagen entgegen und wartete dann, bis Oxana direkt neben ihm anhielt und den Motor ausstellte. Kaum war sie ausgestiegen, sprach er sie an: „Sie müssen die Haushälterin sein, nicht wahr?“
Oxana nickte etwas verlegen. „Ja, die bin ich. Mein Name ist Oxana Timtschenko. Und Sie sind sicher der Sohn der Familie.“
Erik sah sie erstaunt an.
„Ihre Mutter hat mich schon darüber informiert, dass Sie heute früh hier eintreffen würden.“
Er streckte seine Hand zum Gruß aus und stellte sich vor. Oxana wunderte sich über seine Geste. „Sehr angenehm“, sagte sie, zog dann aber eilig ihre Hand aus der seinen zurück.
„Ich bin vorhin etwas forsch an Ihnen vorbeigezogen.“ Er warf einen Blick auf die mit Lehmspritzern überzogene Motorhaube ihres Wagens. „Vermutlich hat Ihr Wagen ziemlich was abgekriegt. Entschuldigen Sie.“
„Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen.“
Oxana sah hinüber zum Haus. „Haben Sie schon an der Tür geläutet?“
„Ja, hab ich, sogar mehrmals. Aber es scheint niemand im Haus zu sein.“ Er dachte kurz nach. „Besitzen Sie denn als Haushälterin keinen Zweitschlüssel für die Haustür?“ Oxana zuckte mit den Achseln. „Nein, leider nicht.“
„Das ist wieder mal typisch“, stöhnte Erik. „Bei den de Groots herrscht wahrscheinlich wieder mal Sicherheitswarnstufe 3.“ Er wischte sich mit einer Hand über die Stirn, um lästige Regentropfen abzustreifen.
„Das glaube ich nicht“, sagte Oxana. Sie sah hinauf zu den beiden kleinen Fenstergauben im Obergeschoss des Hauses. Die Vorhänge waren noch zugezogen und es drang auch kein Licht aus der als Schlafzimmer genutzten Dachkammer.
„Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand im Haus ist. Es stehen doch beide Wagen auf dem Hof.“
Erik sah sich um. Sie hatte recht. Ohne Fahrzeug kam man hier nicht weit. Daran hatte er noch gar nicht gedacht. Der Wagen seines Vaters, ein dunkelgrüner Landrover, stand unter dem Dach des Carports direkt neben dem Haus, und der silbergraue Wagen seiner Mutter, ebenfalls ein Landrover, allerdings ein kleineres Model, war neben dem Hundezwinger abgestellt. Genau an der Stelle, an der sie für gewöhnlich immer ihren Wagen abstellte. Von da aus konnte sie Wim, ihren belgischen Schäferhund, schneller aus seinem Zwinger befreien. Sie liebte es mit dem Hund herumzutollen.
Beide hatten sich der Haustür genähert. Oxana drückte sicherheitshalber auf den Klingelknopf, so, als wollte sie sich selbst davon überzeugen, dass die Anlage ordnungsgemäß funktioniere. Sie vernahmen den Klingelton, aber von dem sonst üblichen Hundegebell aus dem Hausflur war nichts zu hören. Oxana entfernte sich ein paar Schritte von der Haustür, blieb dann auf dem Hof stehen und sah sich um. Ihr Blick richtete sich zufällig auf Sophia de Groots Wagen und ihr fiel auf, dass das Seitenfenster der Fahrertür nicht ganz geschlossen war. Sie spürte instinktiv, dass irgendetwas nicht stimmen konnte. Als sie einen Blick in den Fond des Landrovers warf, sah sie, dass das Regenwasser bereits den lederbezogenen Fahrersitz völlig durchnässt hatte. Auch der Wagenschlüssel steckte noch im Zündschloss.
Erik, der nun direkt neben ihr stand, öffnete die Fahrertür, betätigte einen der elektrischen Fensterheber und ließ das Seitenfenster hinaufgleiten. Anschließend drückte er einmal kurz auf die Hupe und zog dann den Zündschlüsselbund heraus. Aber selbst nach dem lautstarken Hupsignal schien sich nichts im Haus zu rühren. Er warf einen Blick auf das Schlüsselbund. „Vielleicht ist hier auch einer für die Haustür dran.” Doch Oxana musste nicht erst die Wagenschlüssel in die Hand nehmen. Sie schüttelte den Kopf. „Die sind nur für ihren Wagen. Der für die Haustür ist ein Sicherheitsschlüssel.”
„Meine Eltern sind vielleicht zu Fuß mit dem Hund im Moor unterwegs”, meinte Erik und sah resigniert auf seine Armbanduhr. „Bestimmt werden sie jeden Augenblick hier wieder eintreffen.” Er strich sich erneut mit der Hand über die Stirn und sah hinauf. „Aber bis dahin sollten wir uns in meinen Wagen setzen, sonst holt man sich ja bei diesem Sauwetter noch den Tod. Außerdem stinkt es hier wie im Frühjahr, wenn die Bauern ihre Felder mit Jauche düngen.”
Oxana hielt diesen Vorschlag für eine gute Idee. Nachdem sich die Autotüren geschlossen hatten, entstand ein mehrere Sekunden langes Schweigen. Dann fragte Erik: „Wie lange leben Sie eigentlich schon in Deutschland? Ich meine, Sie sprechen nahezu ein akzentfreies Deutsch.”
Sie schenkte ihm ein rasches, flüchtiges Lächeln, bevor sie antwortete. „Deutsch ist nur eine meiner Muttersprachen. Ich bin quasi zweisprachig aufgewachsen.”
„Und woher stammen Sie ursprünglich? Ich meine, ihr Name ist doch ein typisch russischer, oder?”
Oxana war auf diese Frage bereits vorbereitet. Sie hatte sie in den letzten Jahren schon tausend Mal beantwortet. „Wir sind sogenannte Spätaussiedler. Ich wurde in einem kleinen Dorf in der Nähe von Omsk geboren. Das liegt in Sibirien. Meine Mutter ist deutschstämmig, aber mein Vater war oder vielmehr ist Russe. Meine Mutter und ich, wir sind vor 15 Jahren ausgesiedelt und leben seither in Vechta. Mein Vater blieb in Russland. Er lebt heute noch in Omsk.”
Erik musterte ihr Profil und nickte: „Ah ja, verstehe. Entschuldigen Sie, ich wollte nicht zu neugierig sein.”
„Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Aber ich möchte gern Ihr Kompliment erwidern. Sie sprechen für einen gebürtigen Niederländer auch ein erstaunlich akzentfreies Deutsch.”
Erik musste lächeln. „Danke.” Er ließ sich in den Fahrersitz zurücksinken und atmete aus. „Dann haben wir ja eine Gemeinsamkeit. Ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Meine Mutter stammt, wie Sie sicher wissen, hier aus der Gegend, aber mein Vater ist Niederländer. Die Grundschule habe ich noch in Utrecht besucht. Aber dann sind wir nach Deutschland gezogen und meine Eltern haben ihr Unternehmen hier im Oldenburger Münsterland aufgebaut. Jetzt studiere ich wieder in Groningen. Ein ständiges Hin und Her, nicht wahr?”
„Ich weiß”, behauptete Oxana, „es stand ja alles in der Zeitung.”
Die hohe Luftfeuchtigkeit hatte inzwischen die Scheiben beschlagen lassen. „Ist Ihnen kalt?”, fragte Erik. Er stellte das Gebläse an und öffnete das Seitenfenster einen winzigen Spalt. Ein lauwarmer Luftzug durchströmte sofort das Innere des Jeeps. „Es ist trotzdem sehr merkwürdig”, stellte Oxana fest und warf einen Blick hinüber zum Haus. „Wenn ihre Eltern mit dem Hund draußen im Moor unterwegs wären, hätten sie doch sicher ihre Gummistiefel angezogen. Sie stehen aber dort unter dem Vordach neben der Haustür.“
Er beugte sich vor und redete mit leiser Stimme: „Stimmt. Ich verstehe das auch nicht.“
„Außerdem hat mich ihre Mutter heute für 8 Uhr bestellt. Jetzt ist es schon fast 30 Minuten nach 8. Das ist ungewöhnlich. Ich meine, sie legt immer großen Wert auf Pünktlichkeit. Irgendwas passt da nicht zusammen.”
Er wiegte den Kopf. „Jetzt, da Sie es so sagen, fange ich auch an, mir Sorgen zu machen. Ich bin extra heute ganz früh in Groningen losgefahren, da wir heute morgen einen wichtigen Notartermin vereinbart haben, der allerdings schon in einer halben Stunde stattfinden soll.” Er rieb sich bedächtig das Kinn. „Was meinen Sie? Was sollten wir unternehmen?”
Oxana sah auf das Mobiltelefon, das an der Armatur des Jeeps in einer Halterung steckte. „Haben Sie es schon einmal damit versucht?” Er atmete ein, und sein Puls schlug schneller. Eilig betätigte er die Schnellwahltaste. Aus der Freisprechanlage ertönte die akustische Signalabfolge der gespeicherten Rufnummer. Dann hörten sie ein Freizeichen und im nächsten Augenblick vernahmen sie einen Klingelton, der trotz der Regentropfen, die unablässig auf das Autodach trommelten, bis zu ihnen vordrang. Er kam direkt aus dem Haus. Erik ließ es so lange klingeln, bis endlich der Anrufbeantworter ansprang und sich die Stimme seines Vaters vom Band meldete. Dann sprach Erik nach dem Piepton: „He! Wo seid ihr?“, aber niemand nahm den Hörer ab.
„Versuchen Sie es mal mit dem Mobilanschluss. Falls beide tatsächlich unterwegs sein sollten, haben sie vielleicht ein Handy dabei.”
Er zögerte kurz. „Obwohl ich weiß, dass mein Vater Mobiltelefone hasst, ist es vielleicht doch einen Versuch wert.” Er suchte die Nummer im Speicher und drückte dann erneut auf die Verbindungstaste.
Für einen kurzen Augenblick sah es so aus, als würde durch die geschlossene Wolkendecke ein erster zaghafter Lichtstrahl der aufgehenden Sonne dringen, doch dann fiel alles wieder in die Dämmerung zurück.
Beide warteten noch einige Sekunden lang, aber auch diesmal nahm niemand ab.
„Mir ist da gerade was eingefallen.” Sie betrachtete ihn nachdenklich. „Ist Ihnen bei der Herfahrt nicht auch dieser merkwürdige Lichteffekt hinter dem Haus aufgefallen? Vielleicht sind Ihre Eltern beide draußen auf dem Grundstück und können deshalb keins der Klingelzeichen hören.”
Er betrachte sie und überlegte. „Ja, da war was hinter dem Haus, irgend so ein diffuses Leuchten.”
Sie öffnete die Wagentür. „Kommen Sie, wir schauen nach.”