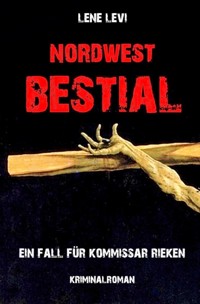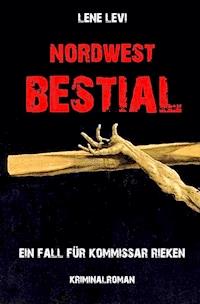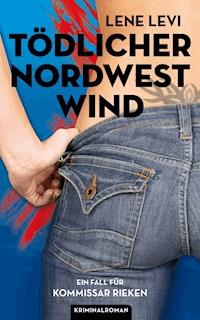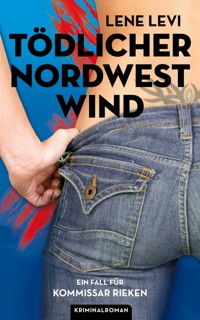
4,99 €
Mehr erfahren.
Eigentlich erhoffte sich Robert Rieken durch seine Rückversetzung in die Oldenburger Polizeiinspektion nur eins: lieber Fahrraddieben das Handwerk legen, als brutale und kaltblütige Verbrechen aufzuklären. Mit Raub, Erpressung, Mord und Totschlag wollte er nichts mehr zu tun haben, denn die meisten seiner Dienstjahre hatte er als Ermittler in den härtesten Großstadtrevieren des Landes zugebracht - und nun war einfach das Maß voll.
Jedoch sein Wunschtraum zerplatzt genau an jenem Tag, an dem zwei Dangaster Krabbenfischer eine männliche Leiche mit ihrem Schleppnetz aus der Nordsee ziehen und Robert als Kriminalkommissar plötzlich vor der Aufgabe steht, die Identität des unbekannten Toten zu ermitteln. Während der Autopsie durch die taffe Gerichtsmedizinerin Dr. Lin Quan wird schnell klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt.
Eine schwierige Ermittlungsarbeit beginnt und führt Robert zu weiteren ungeklärten Mordfällen im Rotlicht-Milieu.
Er muss schließlich erkennen, dass sein Versuch, vor dem organisierten Verbrechen in eine norddeutsche Provinzstadt zu fliehen, ein großer Trugschluss war.
„Tödlicher Nordwestwind“ ist ein Kriminalroman von Lene Levi (ein Pseudonym) und zugleich der erste Fall des Oldenburger Kriminalisten Robert Rieken. Der zweite Band dieser Reihe „Nordwest Bestial“ kann auch hier bei BookRix als eBook bestellt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Tödlicher Nordwestwind
Ein Fall für Kommissar Rieken / Band 1
Über die Autorin: Lene Levi lebt und arbeitet als Autorin und Audioproduzentin in Berlin. Im Nordwesten Deutschlands ist sie aufgewachsen, in dieser Region spielen alle ihre Kriminalromane. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel
Lene Levi
Tödlicher Nordwestwind
Ein Fall für Kommissar Rieken
Kriminalroman
Impressum
© 2015 Lene Levi - created by ebuchedition words & music
Lene Levi: Tödlicher Nordwestwind - Ein Fall für Kommissar Rieken
Lektorat & Korrektorat: Gaby Lindner, Petra Lorenz
Titelgestaltung: ebuchedition words&music
unter Verwendung einer Fotovorlage von istockphoto.com
© 2015 hoerbuchedition words & music
Alle Rechte vorbehalten.
www.words-and-music.de
ebuchedition words & music
Inhaber: Peter Eckhart Reichel
Hohenzollernstrasse 31
D-14163 Berlin
Germany
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung, Aufführung, Vertonung,
kommerzielles Filesharing und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und zur Handlung gehörende Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Anfragen, Anregungen oder Kritiken haben wir immer ein offenes Ohr.
Schreiben Sie bitte an:
Kennwort: Lene Levi – Tödlicher Nordwestwind
Eigentlich erhoffte sich Robert Rieken durch seine Rückversetzung in die Oldenburger Polizeiinspektion nur eins: lieber Fahrraddieben das Handwerk legen, als brutale und kaltblütige Verbrechen aufzuklären. Mit Raub, Erpressung, Mord und Totschlag wollte er nichts mehr zu tun haben, denn die meisten seiner Dienstjahre hatte er als Ermittler in den härtesten Großstadtrevieren des Landes zugebracht - und nun war einfach das Maß voll.
Jedoch sein Wunschtraum zerplatzt genau an jenem Tag, an dem zwei Dangaster Krabbenfischer eine männliche Leiche mit ihrem Schleppnetz aus der Nordsee ziehen und Robert als Kriminalkommissar plötzlich vor der Aufgabe steht, die Identität des unbekannten Toten zu ermitteln. Während der Autopsie durch die taffe Gerichtsmedizinerin Dr. Lin Quan wird schnell klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt.
Eine schwierige Ermittlungsarbeit beginnt und führt Robert zu weiteren ungeklärten Mordfällen im Rotlichtmilieu.
Er muss schließlich erkennen, dass sein Versuch, vor dem organisierten Verbrechen in eine norddeutsche Provinzstadt zu fliehen, ein großer Trugschluss war.
„Tödlicher Nordwestwind“ ist ein Kriminalroman von Lene Levi (ein Pseudonym) und zugleich der erste Fall des Oldenburger Kriminalisten Robert Rieken. Weitere Fälle des Kommissars aus dieser Region werden folgen.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
„Farbe ist Blut und Blut ist Leben.“
Karl Schmidt-Rottluff
Kapitel 1
Noch vor Sonnenaufgang des 29. Juli, der ein feuchter- und schwül-heißer Sonntag werden sollte, verließen der friesische Fischer Enno Fedder und sein Maat Hauke Schortens mit dem Krabbenkutter »DAN 2« ihren Heimathafen Dangast am Südrand des Jadebusens. Nachdem sie ihr kleines Schiff durch den gewundenen und schmalen Prickenweg bis hin zur Innenjade hinaus manövriert hatten, durchquerten sie anschließend das Außentief und erreichten endlich das offene Meer. Sogleich ließen sie den Kurrbaum ausfahren, an dem das Netz aufgespannt war, und senkten das Fanggerät mit der Seilwinde herab. Sie beobachteten, wie die schwere Konstruktion langsam auf den Grund der Nordsee hinab sank.
Der erste Fang fiel an diesem Tag mager aus, nur wenige Kilo Nordseegarnelen, ein paar junge Plattfische, sowie Seesterne und anderer Beifang hatten sich in den Netzen verfangen. Das reichte nicht einmal aus, um den Bedarf der Urlauber zu decken, die später am Hafen und gleich vom Kutter weg, fangfrische Delikatessen kaufen wollten. Der Beifang flog ins Meer zurück. Auch ein zweiter Versuch lohnte das Einholen nicht. Missgelaunt und bereits auf Heimatkurs setzten die beiden Männer das Schleppnetz wenige Meilen vor der Küste ein drittes Mal aus. Es war gegen drei Uhr nachmittags und am Horizont zeigten sich schon die ersten Ausläufer einer heranziehenden Gewitterfront aus nordöstlicher Richtung.
„Hol jetzt ein, Hauke!“, grummelte Enno Fedder missmutig vor sich hin und drosselte die Maschine. Die Verständigung auf See funktionierte zwischen den beiden Männern meist ohne viele Worte. Doch diesmal hatte sich Schortens aus reinem Übermut, und weil er genau wusste, dass er damit seinen Chef leicht aus der Reserve locken konnte, absichtlich zu weit über die Reling gelehnt. „Ay, ay, Captain!“, rief er mit ironischem Unterton zurück. Enno Fedders Gesichtsausdruck verfinsterte sich noch mehr, denn genau dieses »Ay, ay, Captain!« konnte er partout nicht ausstehen. Aber er verkniff sich eine abfällige Bemerkung. Als der Maat bemerkte, dass seine kleine Stichelei im Nordseewind verwehte, setzte er die Seilwinde in Gang. Das Tau straffte sich diesmal gleich so rückartig, dass zunächst der kleine Motor der Winde zu ächzen begann. Auch Enno spürte den unerwarteten Gegendruck am Ruder und ließ den tuckernden Dieselmotor erneut anspringen, so dass der Kutter manövrierfähig blieb.
„Na, Junge! Diesmal scheint sich ja der Fang endlich gelohnt zu haben.“
Hauke zwängte seinen breiten Kopf aus der Fensterluke des winzigen Führerhäuschens, um so das Einholen des Netzes besser kontrollieren zu können.
„Sieht ganz danach aus, Enno.“
Schon stemmte sich der Maat mit ganzer Kraft gegen das leicht verzogene Reepspill, um ein drohendes Herausspringen des Seils aus der Trommelwinde zu verhindern.
„Hoffentlich hängt nicht wieder eine dieser verdammten Plastiktonnen mit Drecksabfällen drin, wie vor zwei Wochen“, gab der Maat zu bedenken.
Enno verließ den Ruderverschlag, um Hauke bei der Arbeit zu helfen.
„Nach dem Gewicht zu urteilen, müssten schon drei von diesen Dingern ins Netz gegangen sein.“
Hauke legte sich schwitzend noch mehr ins Zeug.
„Leg doch lieber noch ´nen Zahn zu. Das verdammte Ding ist ziemlich schwer.“
Einige Minuten später hatte sich das gefüllte Netz der Meeresoberfläche so weit genähert, dass schon einige grau-silbrige Reflektionen des Sonnenlichts unter Wasser aufblitzten.
„Granat ist das jedenfalls nicht, was da so schimmert. Da muss noch was anderes drin sein.“
Enno beugte seinen Oberkörper über die Reling, um besser beobachten zu können, aber er konnte nichts Genaues erkennen.
Endlich erhob sich das geschlossene Fangnetz über der Meeresoberfläche und schwang am Kurrbaum, durch den Seegang bewegt wie ein prall gefüllter Beutel auf und ab. Der Krabbenkutter neigte sich in diesem Moment spürbar zur Steuerbordseite. Ein breiter Wasserstrom ergoss sich aus dem Netz und rauschte ins Meer zurück.
„Zieh den Ausleger dichter ran!“, kommandierte Enno. „Ja. Gut so! – Und jetzt lass ihn nieder auf Deck!“
Beide Männer zogen nun gemeinsam an dem Tau, bis das Fangnetz direkt über dem Auffangbehälter auf der Decksmitte schwebte und sich der Motor der Seilwinde automatisch abstellte. Als Hauke die Schlinge des Fangnetzes löste, ergoss sich ein großer Teil des Inhalts in das darunter stehende Auffangbecken, das sofort überschwappte. Erst jetzt, nachdem sich das Netz zur Hälfte geleert hatte, wurde ein weiterer Teil des Fanges sichtbar. Enno war schon wieder am Steuer, als er von dort bemerkte, dass irgendetwas nicht stimmen konnte, denn Haukes Gesichtsausdruck sah sehr ernst aus.
„Is was?“, rief er zu ihm hinüber. Der Maat antwortete jedoch nicht, sondern schaute nur gebannt und wie erstarrt auf die Planken.
„Heiliger Strohsack!“, fluchte Enno. Erst jetzt reagierte Hauke auf seine Frage: „Komm her und sieh dir diesen Schiet an!“
Enno verließ genervt das Steuerhaus und näherte sich mit ein paar Schritten der Decksmitte, auf deren Planken sich inzwischen eine Menge zappelnder Fische mit einer rotfleckigen Hand vermengten. Der Rumpf eines menschlichen Körpers lag unter dem Haufen des herabgesenkten Fangnetzes.
„Ach du liebe Scheiße, eine Leiche. Verdammt, das bringt Unglück!“
Enno hatte eigentlich damit gerechnet, illegal entsorgten Schiffsabfall von einem dieser Riesenpötte eingefangen zu haben. Zu seinem Leidwesen war es längst keine Seltenheit mehr, dass Behälter mit Chemikalien oder anderen giftigen Gegenständen von Bord der großen Frachtschiffe und Öltanker rücksichtslos ins offene Meer verklappt wurden. Anschließend kontaminierten diese dann die Fanggründe der Deutschen Bucht. Solch einen Dreck fand er häufiger im Netz vor. Die Klassifizierung des Wattenmeers als Nationalpark und Biosphärenreservat war deshalb aus seiner Sicht schon eine ziemlich verlogene Angelegenheit, da sich offenbar viele Seeleute nicht daran hielten oder zu wenige Kontrollen stattfanden. Enno zündete sich hastig eine Zigarette an. Nein, damit hat er nicht gerechnet. Eine Wasserleiche an Deck, das war ihm schon viele Jahre nicht mehr passiert.
Er stand ziemlich fassungslos auf den glitschigen Planken seines Krabbenkutters und zog verzweifelt an dem inzwischen feucht gewordenen Zigarettenstummel.
„Verdammt, das bringt Unglück!“, murmelte er noch einmal vor sich hin. Hauke dagegen hatte sich schon wieder gefangen. Mit seinem Gummistiefel versetzt er der Hand der Leiche einen kleinen Schlag.
„Nicht für den hier, Enno. Der hat`s ja hinter sich.“
Enno wandte sich ab und spuckte seinen Zigarettenstummel aus.
Nachdem er einen Teil des Fanges mit einer Schaufel beiseitegeschoben hatte, beugte sich der Maat vorsichtig über die aufgedunsene und merkwürdig verkrümmte Leiche und versuchte ihren Kopf aus der dichten Masse des Granats herauszupuhlen: „Lange kann der da jedenfalls noch nicht im Meer herumgetrieben sein. An dem Kerl ist ja noch alles dran.“
Schortens suchte nun auf dem Deck nach einem Gegenstand, mit dessen Hilfe er den toten Mann herumdrehen konnte, ohne ihn dabei mit den Händen berühren zu müssen: „Willst du mal sehen was er macht, wenn ich hier draufdrücke?“
Hauke hielt plötzlich einen Netzreiter in der Hand, der an einem dicken Tampenende befestigt war. Mit dem verjagte er für gewöhnlich die Möwen von Bord. Jetzt drückte er damit der Leiche auf den aufgedunsenen Bauch: „Unser Netzinspektor streckt bestimmt gleich seine Zunge raus, nur um uns zu verarschen!“
Doch Enno wollte jede Berührung der Leiche vermeiden. Er hasste diese Art von morbidem Sarkasmus, der vielen Seeleuten eigen war, und hielt das nicht für einen besonders liebenswerten Wesenszug.
„Lass den Quatsch! Vor paar Jahren habe ich schon mal so einen Kerl herausgezogen. Der sah aber schon ganz anders aus; da krochen bereits die Aale …“
Enno konnte seine letzten Worte nicht mehr vollständig artikulieren, da sich schlagartig ein heftiger Würgereiz in seiner Magengegend bemerkbar machte.
„Was meinst du? Sollten wir ihn wieder dahin befördern, von wo wir ihn hergeholt haben?“, fragte Hauke. Doch Enno wankte bereits kreidebleich zur Reling und kotzte einen breiten Schwall seines Mageninhaltes ins Meer hinaus. Als er damit fertig war, wischte er sich mit dem Ärmel seines verschmierten Kapuzenpullis die Schweißtropfen aus dem Gesicht.
„Nein, das geht nicht.“
Der Maat ließ nicht locker: „Der Netzinspektor wird uns nur `ne Menge Ärger machen, glaub mir. Sollen ihn doch die Fische fressen.“
Hauke ließ den Tampen fallen und spuckte angeekelt aus.
„Halt die Klappe, Hauke! Auch dieser Kerl hat ein Recht darauf, ordnungsgemäß vom Pastor verscharrt zu werden. Vermutlich ist’s einer dieser neureichen Hamburger Yuppies, die sich hier in letzter Zeit mit Papis geleaster Yacht breitmachen und keinen blassen Schimmer von der Gefährlichkeit der Frachterautobahn haben, geschweige denn von der Nordsee.“
Schortens richtete sich wieder auf und sah hinaus auf die offene See.
„Wo er recht hat, da hat er nun mal recht, der alte Enno Fedder. Wie ein Penner aus Bremerhaven sieht der jedenfalls nicht aus.“
Hauke zog einen Flachmann aus seiner Brusttasche und genehmigte sich einen Schluck. Dann reichte er den Schnaps an Enno weiter. Dieser winkte dankend ab.
„Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass einer von denen mit einem Kaventsmann über Bord gegangen ist. Aber vielleicht ist der da ja auch nur ein ganz gewöhnlicher Selbstmörder? Was meinst du, Enno?“
„Schon möglich“, erwidert Enno. Dann warf er doch einen genaueren Blick auf den toten Mann. Hielt aber genügend Abstand zu der Leiche.
„Ist dir schon die Trosse aus Polyester aufgefallen, die um sein Fußgelenk geschnürt ist? Ein richtiger Seemannsknoten ist das jedenfalls nicht.“ Er hielt inne und fuhr dann in ruhigem Ton fort: „Irgendwo da unter dem Netz wird wahrscheinlich ein Ballast liegen. Da gehe ich fast jede Wette ein.“
Maat Schortens machte sich sogleich an dem Netzhaufen zu schaffen, in dessen Wirren das andere Ende des Seils verschwand. Enno stand noch immer wie angewurzelt auf dem Deck und machte keinerlei Anstalten Schortens zu helfen. Plötzlich glitt Schortens auf einem der herumzappelnden Fische aus und landete, beim Versuch sich abzustützen, direkt mit seiner linken Hand auf dem aufgedunsenen Gesicht des Toten.
„So ein Schiet aber auch!“, fluchte er.
„Ich würde ihn an deiner Stelle jedenfalls nicht gleich umarmen.“ Enno sagte dies nicht ganz ohne ironischen Unterton. „Schon mal was von Leichengift gehört?“
Ihm missfiel diese ganze Angelegenheit. Hauke jedoch scherte sich einen Dreck darum. Im nächsten Augenblick zog er bereits einen Rocna-Anker aus glänzendem Edelstahl aus dem Netzhaufen hervor, der tatsächlich mit dem anderen Ende des Polyesterseils verbunden war. Es war keiner der üblichen und billigen Schlickrutscher, sondern eher einer von der Bauart, die jetzt in Mode kamen. Das Ding wog an die 25 Kilo und musste mehr als 3.000 Euro gekostet haben. Hauke kannte sich in diesen Dingen sehr gut aus. Nun hielt er stolz seine Entdeckung wie eine Trophäe in die Luft.
„Das erklärt ja wohl alles! – Oder?“
„Was für ein Scheißtag heute“, knurrte Enno wütend. Hauke war jetzt aber nicht zu bremsen: „He! Du kannst recht haben, Enno. Ich meine, dass was du eben über die neureichen Yuppies gesagt hast. Sieh mal, an seinem Handgelenk die Uhr. Das ist bestimmt nicht so ein billiges Ding von Woolworth. Schade nur, dass das Glas kaputt ist.“
Enno wendete sich angeekelt ab und eilte schnurstracks in Richtung Führerhaus. Er atmete durch, um sich wieder zu fangen und sich einen Moment zum Nachdenken zu geben. Dann stand sein Entschluss fest: „Ich muss die Küstenwache verständigen, Hauke! Sofort!“
Maat Schortens ließ enttäuscht den blanken Anker auf Deck sinken. Kurz darauf breitete sich über dem Krabbenkutter eine kleine, schwarze Abgaswolke aus. Der Dieselmotor begann lautstark zu tuckern und der Kutter nahm langsam Fahrt auf. Die einsetzende Ebbe und das heranziehende Gewitter ermahnten die beiden Fischer zur Eile, wenn sie noch rechtzeitig ihren kleinen Heimathafen erreichen wollten.
Ein immer dichter werdender Schwarm fressgieriger Möwen umkreiste das Schiff. Die gefangenen Fische und Krabben konnte Maat Schortens nur noch ins Meer zurückkippen. Sollten wenigstens die Vögel was davon haben.
Kapitel 2
Etwa zur gleichen Stunde dieses hochsommerlichen Julitages stand Robert Rieken in Gummistiefeln und einer nagelneuen Anglerkluft am Leib auf dem schmalen Holzsteg am Ufer eines kleinen Binnensees, der idyllisch zwischen Wiesen und Wäldern eingebettet lag. Ein geschäftstüchtiger Grundstückspächter war auf die Idee gekommen, aus diesem etwa 70.000 qm großen Wasserareal ein gewerblich attraktives, kleines, aber feines Anglerparadies zu schaffen. Robert war schon oft an dem Werbeschild des Betreibers vorübergefahren. Jedes Mal nahm er sich vor, sein nächstes freies Wochenende dafür zu nutzen, um diesem Anglerparadies einen Besuch abzustatten. Aber immer wieder war irgendwas dazwischen gekommen. Allerdings waren seine freien Tage in letzter Zeit ziemlich rar geworden. Genaugenommen war dieses Wochenende das erste Dienstfreie, seit seinem persönlichen Rückversetzungsantrag, der vor etwa sechs Monaten stattgegeben wurde. Jetzt war er als Beamter bei der Oldenburger Kripo einem neuen Dienstherrn unterstellt und dieser sorgte dafür, dass Robert alle Hände voll zu tun bekam, denn auch in seiner ehemaligen und zugleich neuen Dienststelle herrschte akuter Personalnotstand. Er genoss diese Arbeit, auch wenn er sich in letzter Zeit mehr auf die administrativen Dinge konzentrieren musste, als auf sein eigentliches Element - die Ermittlungsarbeit.
Vor etlichen Jahren begann seine Beamtenlaufbahn hier bei der Oldenburger Polizei, doch irgendwann hielt er den eintönigen Alltag nicht mehr aus. Es zog ihn vielmehr in die Großstädte, denn er wollte beruflich etwas erreichen. Etwas, das ihm damals in dieser verschlafenen Stadt, in der scheinbar jeder jeden kannte, nicht möglich erschien, und von dem er selbst nicht mal genau wusste, was es eigentlich war. Doch als er wenig später in der Großstadt Berlin, die erst kurz zuvor wieder vereint worden war, als ganz gewöhnlicher Streifenpolizist seinen Dienst antrat, zerplatzte sehr schnell seine Vorstellung von einer gerechteren Welt. Auch in den Großstädten wurde nur mit Wasser gekocht und es gab, wie überall, gute und auch schlechte Bullen. Vor allem aber ging es dort wesentlich härter zur Sache, und zwar auf beiden Seiten des Gesetzes. Es herrschte ein ungeheurer Druck, dem jeder Polizist tagtäglich ausgesetzt war.
Robert stammte ursprünglich hier aus dieser Gegend. Jetzt war er nach über zwei Jahrzehnten wieder in die ihm vertraute Landschaft seiner Kindheit und Jugendzeit zurückgekehrt. »Back to the roots«, wie er es nannte. Eigentlich wollte er durch seine Rückversetzung nach Oldenburg nur eines erreichen: lieber Fahrraddieben das Handwerk legen, als weiter brutale und kaltblütige Gewaltverbrechen aufklären zu müssen. Irgendwann war das Maß einfach voll gewesen. Mit Raub, Erpressung, Mord und Totschlag wollte er nichts mehr zu tun haben, denn die meisten seiner Dienstjahre hatte er als Ermittler und Profiler in den härtesten Revieren des Landes zugebracht.
Er war jetzt Mitte fünfzig und das jahrzehntelange Stadtleben hatte aus ihm mehr und mehr einen Einzelgänger gemacht.
Sein einst durchtrainierter Körper war in den vergangenen Jahren etwas aus dem Leim gegangen, aber er hielt ihn dennoch einigermaßen fit. Das funktionierte auch ohne großen Muckibudenzauber oder Polizeisportgruppenstumpfsinn. Er fuhr, so oft es ging, mit dem Fahrrad und fand sich selbst nach wie vor annehmbar. Im Laufe der letzten Jahre war die Bundweite seiner Jeans zwar ein paar Nummern größer geworden, aber auf seine seelische Verfassung hatte dieser Umstand keinerlei Auswirkungen.
Eine andere Begleiterscheinung des unvermeidlichen Alterns löste er auch auf seine eigene Art. Um dem langsam, aber unaufhaltsam fortschreitenden Haarausfall zuvorzukommen, entschloss er sich kurzerhand, der immer dünner werdenden, zuletzt ganz spärlichen, langen Haartracht ein Ende zu bereiten. Robert rasierte sich den Schädel glatt und damit war für ihn dieses Kapitel abgeschlossen. Anfangs erschien ihm der radikale Kahlschlag zwar noch gewöhnungsbedürftig, aber schon nach einigen Wochen hatte sich das gelegt. Jetzt war er sogar froh darüber, weil er sich so das morgendliche Betrachten seines Antlitzes im Badezimmerspiegel ersparen konnte. „Was vorbei ist, ist nun mal vorbei. Also was soll´s?“, sagte er zu sich selbst, als er seine abgeschnittenen langen Haare auf den Fliesen des Badezimmers zusammenkehrte und in einen Abfalleimer warf. Um sich vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen, trug er stattdessen neuerdings einen ziemlich zerbeulten, aus naturfarbigem Bast geflochtenen Sommerhut. Nicht so ein albernes Model, das stets den Eindruck erweckt, als würde jemand versuchen, seine stark ausgewölbte Neandertalerstirn zu verbergen, sondern einen ähnlichen Hut, wie ihn manchmal auch Neil Young trägt. Diese momentan aus der Mode gekommene Kopfbedeckung gehörte schnell zu seinem neuen Markenzeichen, genau wie die graumelierten 8-Tage-Bart-Stoppeln, die wie eine Feile kratzen konnten.
Robert empfand sich selbst als eine Art Rhythm & Blues-Veteran; und wäre er damals nicht bei den Bullen gelandet, hätte aus ihm vielleicht sogar ein anständiger Gitarrist werden können. Er besaß noch immer seine alte Flying V. Ein wahres Prachtexemplar des legendären Gitarrenbauers Gibson, das einst auch schon Jimi Hendrix gern mal malträtierte oder gar auf seinen Bühnenshows in Kleinholz verwandelt hatte. Leider stand die Gibson schon lange nur noch in einer Zimmerecke herum. Und es war auch schon lange her, dass sie mit dem Hughes & Kettner-Verstärker eine elektrisch-knisternde erotische Verbindung eingegangen ist. Roberts Finger waren nicht mehr so flink wie früher, vor allem aber fehlte es ihm an der notwendigen Zeit und Ruhe fürs Spielen. Darum standen beide Gegenstände mehr zu Dekorationszwecken in seiner Wohnung, was er sehr bedauerte. Aber allein schon die Anwesenheit des Instruments und des Gitarrenverstärkers erzeugte in ihm ein angenehmes Gefühl von Geborgenheit.
Warum er jetzt hier auf dem hölzernen Anglersteg stand, konnte er sich eigentlich selbst nicht ganz erklären. Schuld daran waren die Zeitschriften des Lesezirkels im Wartezimmer seines Zahnarztes. Dort stand nämlich in einem dieser dämlichen Ratgeber zum Thema Work-Life-Balance, dass das Forellenfangen ein ganz probates Mittel wäre, um ein aus den Fugen geratenes inneres Gleichgewicht wieder in den richtigen Einklang zu bringen. Er hatte sich tatsächlich von diesem esoterischen Blödsinn zu einem Selbstversuch verleiten lassen. Und wer weiß, vielleicht stimmt es ja. An irgendetwas muss man doch glauben. Die zweite Empfehlung des Käseblatts, der Besuch eines riesengroßen und vollbesetzten Fußballstadions, wäre sowieso nichts für ihn gewesen. Massentauglichkeit war nicht gerade seine Stärke. Also blieb nur das Angeln.
An solch regnerischen und schwülen Tagen, wie an diesem, würden die Forellen besonders gut beißen. So behauptete es zumindest der Teichwart, als sich Robert heute die Tageskarte kaufte. Erst vor wenigen Tagen hätte ein Petrijünger ein sieben Kilo schweres Prachtexemplar aus diesem See gezogen. Robert konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Bei regnerischem Wetter? Das war ja nun in dieser Gegend ganz bestimmt keine Seltenheit und wäre sicher für den Seepächter ein grandioses Minusgeschäft. Der Mann schien sich nicht so gut mit den hiesigen Wetterverhältnissen auszukennen, dafür umso mehr mit Anglerlatein.
Um den besten Angelplatz am See ausfindig zu machen, verließ sich Robert lieber auf seine eigene analytische Fähigkeit und gab deshalb auf die Ratschläge des Teichwarts nicht sehr viel. Robert wusste ganz genau: 95 Prozent der Fische stehen auf nur 5 Prozent der Fläche eines Sees. So ähnlich verhielt es sich auch in der Kriminologie. Man musste nur ein sicheres Gespür dafür entwickeln, wo sich genau diese 5 Prozent der Fische aufhielten, dann könnte man auch mit etwas Glück und Verstand den Größten von ihnen ködern und an Land ziehen.
Kaum hatte er seine Angelschnur das erste Mal ausgeworfen, spürte er auch schon, wie die Schnur von der Rolle raste. Dann ein kurzer Anschlag, Drill, und schon hing sein erster Fang fest am Haken. Die Forelle blickte ihn mit erschrockenen Augen an, als er sie vom Spinner befreite. So leicht hatte er es sich nicht vorgestellt. Es war fast schon eine Enttäuschung. Ab sofort müsste also seine Work-Life-Balance wieder im richtigen Lot sein. So ein Scheiß aber auch. Robert grinste in sich hinein. Etwas, an das es sich wirklich noch zu glauben lohnte, würde er wahrscheinlich in seinem Leben nicht mehr finden können. Und wenn doch, dann vielleicht nur in der Natur. Er liebte das Licht und die Leute hier oben im Norden, das Rauschen des Schilfs am Seeufer und den modrigen Geruch, der gerade mit einem ganz seichten Luftzug vom Moor herüber wehte. Der feinstaubige Regen machte ihm nichts aus. Im Gegenteil, er vermisste ihn schon lange Zeit sogar körperlich. Die feuchte und schwüle Hitze des heutigen Tages empfand er dagegen als ziemlich unangenehm. Es war genau diese Klimakonstellation, die am Ende eines solchen Sommertages zu einem Unwetter führen würde. Vermutlich spürten das sogar die Fische im See.
Gerade hatte er die Rute zum zweiten Mal ausgeworfen, als er plötzlich die Vibrationen seines Mobiltelefons spürte, das in einer der vielen Seitentaschen seiner Anglerweste verstaut war. Er tastete nach dem Handy, konnte es aber nicht so einfach herausziehen, weil es sich unter einer Naht verklemmt hatte. Nervös versuchte er es noch einmal, da er wusste, dass es spätestens nach dem dritten Vibrationsintervall lautstark und schrill zu dröhnen anfing. Ein beseelter Petrijünger warf ihm bereits vom Nachbarsteg aus einen wütenden Blick zu. Aber es war bereits zu spät. Das Ding begann zu dröhnen und der unangenehme Ton verbreitete sich über die glatte Wasseroberfläche wie ein nervtötender Schall. Endlich hielt Robert das Mobiltelefon zwischen seinen Fingern. Er warf einen prüfenden Blick auf das Display. Der Name seines Chefs wurde angezeigt. Robert drückte eilig auf die Verbindungstaste.
„Moin Chef. Woher wissen Sie eigentlich, dass ich hier bin?“, witzelte er los.
„Wo sind Sie denn? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo Sie sich aufhalten.“
Das war mal wieder typisch für seinen Chef. Er hatte Roberts kleinen Scherz nicht verstanden.
„Sie werden es nicht glauben, aber ich sitze im Augenblick auf einem Anglersteg mitten im Ammerland und habe vor wenigen Minuten meine Abendmahlzeit aus dem Wasser gezogen.“
Die Stimme seines Chefs klang etwas gehetzt, er benutzte wieder mal diesen dienstlichen Beamtenton: „Herr Rieken. Ich weiß, dass heute Sonntag ist und ich weiß auch, dass Sie an diesem Wochenende keinen Bereitschaftsdienst haben. Aber hören Sie trotzdem gut zu. Sie werden umgehend etwas ganz anderes aus dem Wasser ziehen. Vergessen Sie also Ihr Abendessen und fahren Sie so schnell wie möglich zum Dangaster Hafen. Ich habe vor etwa zehn Minuten einen Anruf von der Küstenwache erhalten. Einer der einheimischen Fischer hat da einen ganz merkwürdigen Fang gemacht. Da wartet ein toter Mann auf Sie. Wo, sagten Sie, stecken Sie im Augenblick?“
Robert war nicht gerade begeistert von der Aussicht, seinen dienstfreien Sonntag mit einer Wasserleiche zu teilen: „An einem Anglersee in der Nähe von Westerstede.“
„Gut. Wenn Sie also die A 29 nehmen, könnten Sie es sogar in einer halben Stunde schaffen. Es tut mir leid, Sie in Ihrer Freizeit belästigt zu haben, aber ich kann selbst nicht weg. Sie wissen ja, einer muss hier im Büro die Stellung halten. Also verlieren Sie keine Zeit und fahren Sie los!“ Er räusperte sich kurz. – „Ach, übrigens, der Mann, der die Leiche herausgefischt hat, heißt Enno Fedder. Er wird im Hafen auf Sie warten.“
Robert antwortete nicht gleich, sondern wartete einige Sekunden darauf, ob sein Chef noch etwas von ihm verlangen würde. Dann hörte er wieder dessen gehetzte Stimme: „Rieken, sind Sie noch dran?“
“Ja, Chef. - Sagen Sie, warum schicken Sie nicht Kriminalmeister Onken zum Hafen? Ich kann mir gut vorstellen, dass er in seiner bisher noch nicht sehr erfahrungsreichen Polizistenlaufbahn kaum Erlebnisse mit einer Wasserleiche hatte. Ich finde, diese Bildungslücke könnte er gleich heute schließen. Das wäre doch jetzt eine passende Gelegenheit …“
Doch Kriminaldirektor Heribert de Boer fuhr Robert ins Wort: „Geht nicht. Weil ich ihn telefonisch nicht erreichen kann.“
Robert bereute in diesem Moment, den Anruf seines Chefs überhaupt entgegengenommen zu haben. „Ist sonst noch was?“, fragte er ziemlich genervt.
„Nein, nein, nichts weiter. Ich wollte Ihnen nur noch sagen, dass Sie die Angelegenheit schon schaukeln werden, Rieken. Machen Sie mir Meldung, wenn Sie herausgefunden haben, was an der Sache dran ist.“ Dann legte er auf.
Kapitel 3
Als Robert mit seinem alten, roten Volvo Kombi 740 direkt am Dangaster Sielhafen eintraf, entdeckte er sofort die beiden Fischer, die gerade damit beschäftigt waren, eine Menge neugieriger Touristen und schaulustiger Wochenendbesucher von ihrem Krabbenkutter fernzuhalten. Denn es hatte sich bereits auf dem angrenzenden Campingplatz und damit auch in Windeseile bis zum nahegelegenen Alten Kurhaus herumgesprochen, dass die beiden einheimischen Fischer diesmal keinen fangfrischen Granat in den Hafen mitbrachten, sondern einen mysteriösen Fund, der nicht für die Augen der Öffentlichkeit, geschweige denn für die Bratpfannen der Camper, bestimmt war. Genaueres aber wusste keiner, deshalb zog es viele sensationsgierige Menschen hin zum Anlegerkai. Der Kommissar stieg aus seinem Wagen und ging auf einen der beiden Männer zu:
„Sind Sie es, der die Leiche gefunden hat?“
Robert hielt ihnen seinen Dienstausweis unter die Nase.
„Nicht direkt, Herr Wachtmeister“, antwortete Hauke Schortens.
„Ich bin Kriminalhauptkommissar Rieken. Und wie heißen Sie?“
Hauke Schortens war körperlich ein eher schmächtiger Typ mit blauer Bommelmütze und runzliger Gesichtshaut. Wie ein Seebär sah er nicht gerade aus, eher wie eine Figur aus einem dieser Walter-Moers-Comics. Hauke blickte etwas hilflos in Richtung des Campingplatzes und gab Enno Fedder ein Handzeichen.
„Ich heiße Schortens. Hauke Schortens. Ich bin hier sozusagen der Maat auf diesem Krabbenkutter. Maat deshalb, weil ich früher als solcher bei der Marine gedient habe.“
Enno Fedder nahm man dagegen auf dem ersten Blick den sturmerprobten Seemann ab. Er war wie aus reinstem friesischen Schrot und Korn gemacht. Ein hemdsärmeliger Kerl, der aber mit weicher Stimme sprach. Enno versuchte sich gerade eine Zigarette anzustecken, aber der Wind blies ihm immer wieder die Flamme seines Feuerzeugs aus. Er kam herüber und warf einen flüchtigen Blick auf den Ausweis.
„Und das hier ist mein Chef. Ihm gehört der Kutter“, stellte Hauke Enno vor.
Der Kommissar hielt Enno sein brennendes Feuerzeug vor die Zigarette: „Rieken, Kripo Oldenburg.“
„Kripo Oldenburg? Gibt´s denn keinen Polizisten hier aus Varel, den sie herschicken konnten?“ Enno nahm seine Mütze ab und wischte sich damit den Schweiß von der Stirn. Er zwinkerte hinter seinen Brillengläsern und sagte dann: „Frage, Herr Kommissar: Warum gibt es in Ostfriesland keine Hämorrhoiden? - Antwort: Weil die ganzen Arschlöcher in Oldenburg sitzen.“
Robert sah ihn einen Augenblick lang verständnislos an, sammelte sich dann wieder und sagte: „Ich weiß schon, ihr haltet ja Oldenburg immer noch für feindliches Ausland. Aber es ist nun mal nicht ganz einfach, einen Polizisten hier bei euch aufzutreiben, der telefonieren und gleichzeitig auch schreiben und lesen kann. Deshalb müsst ihr schon mit mir vorlieb nehmen.“ Dann sah sich Robert etwas genervt um. „Ziemlicher Menschenauflauf hier.“
Enno wusste nun, dass er mit seinem Humor bei Robert keinen großen Eindruck machen konnte:
„Wir haben schon versucht die Leute auf Abstand zu halten, Herr Kommissar. Aber Sie wissen ja, wie die heutzutage so drauf sind.“
„Ja, gut. Ich übernehme das fürs Erste“, sagte Robert.
Er stellte sich vor die Menschenansammlung und gab den Leuten eindeutig zu verstehen, dass sie sich gefälligst vom Hafengelände fernzuhalten hätten. Die Gaffer traten daraufhin wenige Meter zurück, lösten sich aber nicht auf, wie es Robert eigentlich erhofft hatte. Dann ging er zurück und stellte sich zwischen die beiden Fischer mit dem Rücken zur Kaimauer, so dass er die Menschenansammlung weiterhin im Blick behalten konnte. Enno begann zu berichten: „Naja, die Sache war so, Herr Kommissar. Wir sind heute gegen 4 Uhr rausgefahren, wie wir es fast jeden Tag tun, wenn die Tide es erlaubt. Aber heute schien nicht unser Tag zu sein. Wir haben's zuerst westlich von Alte Mellum versucht, aber da war nichts. Dann sind wir etwas weiter hinaus auf See in Richtung Minsener Oog. Aber auch da war nichts zu holen.“ Er warf jetzt seine Zigarettenkippe auf den Betonboden und trat sie aus. „Sie müssen wissen, die Fanggründe sind in dieser Jahreszeit äußerst unergiebig. Hinzu kommt noch der Umstand, dass die ständigen Verlandungen in diesem Gebiet durch wandernde Sandbänke die Krabbenfischerei nicht gerade leichter macht.“
Robert warf nun einen Blick hinüber zum Kutter.
„Sie sind der Eigentümer des Schiffs?“
„Ja. Ich habe mir den Kutter aber erst vor zwei Jahren gekauft. Hätte ich damals geahnt, welche Schwierigkeiten auf mich zukommen, glauben Sie mir, hätte ich´s gelassen.“
Hauke Schortens nickte Enno zu. Er rieb sich gereizt die Stirn: „Genau. Wenn das so weitergeht, können wir unseren Job bald hinschmeißen, Herr Kommissar.“
Enno wirkte nachdenklich: „Hauke hat nicht ganz unrecht. Unsere alten und angestammten Fangplätze werden außerdem von anderen Kollegen, wenn man diese Leute überhaupt so nennen mag, regelrecht ausgeplündert. Sie fangen sogar die Fischbrut weg, wenn Sie wissen, was ich damit sagen will. Und gesetzlich geregelte Fangquoten existieren ja für uns Krabbenfischer nicht.“
Robert sah verzweifelt auf seine Uhr. „Sie haben sicher recht, Herr Fedder. Nur leider hat das wenig mit Ihrem - wie soll ich sagen - heutigen Beifang zu tun. Erzählen Sie mir doch bitte, wo und wie Sie den Toten genau herausgefischt haben.“
Enno machte eine Handbewegung, die andeuten sollte, ihm zu folgen. Robert warf nochmals einen Blick auf die Gaffer, die aber keinen Schritt nähergekommen waren. Dann gingen die drei Männer in Richtung Kaimauer und betraten den schmalen hölzernen Laufsteg, der von der Mauer direkt hinüber zum Kutter führte. Auf Deck gab Enno dem Kommissar das Feuerzeug zurück. Der Fischer spürte instinktiv, dass der Kripomann in Gummistiefeln nicht einer der üblichen Beamten war, die eigentlich keine blasse Ahnung vom Fischfang haben, aber dennoch überall mitreden wollten. Enno schritt zur Mitte des Decks und blieb dann vor einem abgedeckten Haufen stehen.
„Wie gesagt, wir wollten schon aufgeben, haben es dann aber doch nochmal, etwa zwei bis drei Meilen vor Wangerooge versucht – und plötzlich hing der da in unserem Netz.“
Enno deutete mit einer knappen Handbewegung auf den abgedeckten Haufen. Kaum hatte er den Satz ausgesprochen, hob Hauke auf der Backbordseite des Kutters einen Zipfel des zerschlissenen Segeltuchs auf, mit dem die Wasserleiche bereits auf See notdürftig abgedeckt wurde. Ein ekelhafter Gestank von angegammeltem Fisch, Schlamm und Maschinenöl breitete sich schlagartig auf Deck aus. Die beiden Fischer schienen daran gewöhnt zu sein. Robert warf nur einen flüchtigen Blick auf die Leiche, dann presste er ein Taschentuch vor seinen Mund.
„Genauso war's! Und dann hat Enno über Funk sofort die Küstenwache alarmiert!“, sagte Hauke und ließ das Segeltuch wieder fallen.
„Was übrigens sehr umsichtig und richtig von Ihnen beiden war.“
Robert schoss ein paar Fotos von der vorläufigen Lagerstätte der Leiche und fotografierte auch das Deck des Kutters: „Haben Sie zufällig auch die genauen Koordinaten der Fundstelle festgehalten?“
Enno hatte sich unterdessen an der verbogenen Seilwinde zu schaffen gemacht, bevor er antwortete: „Natürlich, ist ja nicht meine erste Wasserleiche. Als erfahrener Seemann weiß man ja wohl, was in solch einer Situation zu tun ist. Ich habe die Koordinaten hier elektronisch im Logbuch gespeichert.“
„Herr Kommissar“, warf Hauke ein, „wir sind übrigens der Meinung, dass es sich bei dem da vielleicht um einen dieser Hamburger Schnösel handeln könnte, die gern mal eine Party auf Papas Yacht veranstalten und dann besoffen ein unfreiwilliges Bad in der Nordsee nehmen.“
„Wieso kommen Sie ausgerechnet auf Hamburg? Der Mann könnte doch genauso gut aus Groningen oder sonst woher stammen. Ist Ihnen sonst irgendwas Verdächtiges aufgefallen? Herumtreibende Wrackteile vielleicht oder ein gekentertes Beiboot?“
Hauke zog ein dümmliches Gesicht und zuckte mit den Schultern: „Nein. Nicht, dass ich wüsste.“
Aber Robert bohrte weiter und wendete sich nun gezielt an Enno, da ihm dieser Mann als der wesentlich Intelligentere erschien. Aber auch Enno zuckte nur mit den Schultern; ein leichtes Unbehagen war ihm dennoch anzumerken.
„Mir fällt da auch nichts ein. Außer, dass es heute ein beschissener Tag auf See war.“
Dabei lenkte er seinen Blick hinüber zur Kaimauer, wo sich neben dem Liegeplatz des kleinen Ausflugdampfers Etta von Dangast erneut eine Menschenmenge angesammelt hatte, um von dieser günstigen Position aus die Vorgänge an Bord des Kutters genau beobachteten zu können. Einige der Leute hielten sogar Handys und Kameras hoch über ihre Köpfe und begannen zu fotografieren. Enno reagierte wütend: „Herr Kommissar. Wir sollten zunächst dafür sorgen, dass diese saublöden Typen da endgültig vom Hafengelände verschwinden. Was meinen Sie? Ich jedenfalls habe nicht das geringste Interesse, mein Bild morgen in einem dieser Wurstblätter wiederzufinden.“
Robert schritt eilig über das Deck, kletterte den Laufsteg hinüber und stellte sich erneut direkt vor die Gaffer auf die Kaimauer. Noch bevor jemand eine Frage an ihn richten konnte, blaffte er die Leute an. Diesmal zeigten seine verbalen Ausfälle offenbar eine spürbare Wirkung, da er auch seinen Dienstausweis hochhielt. Nachdem sich die Neugierigen wieder verstreuten, telefonierte Robert mit seiner Dienststelle und blickte dabei von oben herab auf das durch die Ebbe immer tiefer absinkende Schiffsdeck, auf dem die beiden Fischer noch immer standen und warteten. Dann informierte er die beiden Männer von der Kaimauer aus:
„Ich habe die zuständige Polizeidienststelle informiert. Die Leute von der Spurensicherung und die Rechtsmedizin müssten bald hier eintreffen.“ Er verspürte ein leichtes Unbehagen, doch er wandte sich nochmals an Hauke: „Würden Sie bitte die Freundlichkeit besitzen mir die Leiche noch einmal zu zeigen? Ich möchte nur von hier oben aus kurz ein paar Aufnahmen machen.“
„Wie bitte?!“, stotterte Hauke Schortens. „Hat der Kommissar eben was von Spurensicherung gesagt?“
Er warf einen verstohlenen und zugleich vorwurfsvollen Blick auf Enno. „Hab ich´s dir nicht gleich gesagt? Der Kerl wird uns nur `ne Menge Ärger machen!“
Enno reagierte nicht auf Haukes Geschwafel, sondern schob ihn unsanft beiseite, um das Segeltuch über der Leiche vollständig zu entfernen. Nachdem Robert seine Fotos geschossen hatte, kletterte er wieder hinüber auf das Deck.
„Die Leiche wird noch heute zur Obduktion in die Gerichtsmedizin nach Oldenburg überführt. Dorthin kommen sie übrigens alle, egal ob Selbstmord oder Badeunfall.“ Dann streifte er sich Latexhandschuhe über die Hände und betrachte die Leiche aus geringer Distanz. Der Tote war fast vollständig bekleidet. An seinem rechten Fuß trug er einen Sneakers aus feinem Leder. Der linke Schuh fehlte. Und er wies am Hinterkopf eine große Platzwunde auf. Am rechten Handgelenk trug er eine Armbanduhr. Robert kannte zufällig diese Marke, da er schon einmal bei einem Mordfall in seiner Berliner Zeit mit solch einer Uhr zu tun gehabt hatte. Weitere Besonderheiten konnte er jedoch nicht auf den ersten Blick feststellen. Aber das war auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht so wichtig, denn am nächsten Tag würde sich ohnehin die Gerichtsmedizin ausführlicher mit dem Toten aus dem Meer beschäftigen.
Als er wenig später in sein Auto stieg, brach fast im gleichen Augenblick der erwartete Wolkenbruch los und ein heftiges Hitzegewitter verwandelte den kleinen Nordseehafen in eine gespenstische Theaterszenerie aus zuckenden Blitzen und Donnergrollen. Die bis zuletzt ausharrenden Gaffer waren eilig in ihre Wohnwagen auf dem Campingplatz geflüchtet und Robert beobachtete durch die Windschutzscheibe seines Wagens das einzigartige Naturschauspiel zwischen Himmel und Erde. Dicke Regentropfen prasselten wie ein ausgeschütteter Sack Erbsen auf das Dach seines Wagens. Der Kommissar fühlte sich seltsamerweise in diesem Moment wie nach einer langen Reise endlich zu Hause angekommen. Dieser Enno, so kam es ihm plötzlich in den Sinn, könnte vermutlich der Sohn seines alten Schulfreundes Jülf Fedder aus Varel sein, mit dem er zusammen die achte Klasse wiederholen durfte. Er erinnerte sich plötzlich ganz genau daran. Diese Ehrenrunde aus ihrer gemeinsamen Schulzeit hatte sie einst zu Freunde werden lassen. Zusammen verbrachten sie damals so manches Wochenende hier an dem kleinen Sandstrand zwischen Hafen und dem Alten Kurhaus. Es waren kurzzeitig auftauchende Gedankensplitter, die ihm jetzt plötzlich wieder einfielen; Erinnerungen an ausgiebige Schlickschlachten, an kleine improvisierte Partys mit Dosenbier, Musik von Led Zeppelin und Lagerfeuer am nächtlichen Strand. Und natürlich an die hübschesten Mädchen aus der Gegend, die immer mit dabei waren. Irgendwann verloren sie sich aus den Augen. Jülf half damals im Geschäft seiner Eltern aus, als Robert beschloss, die Polizeischule zu besuchen. Sein Freund und er trugen zu dieser Zeit so lange Haare, dass sie ihnen fast bis zum Hintern reichten. Er erinnerte sich an den typischen Wattgeruch, der selbst durch ausgiebiges Schrubben nicht aus den Hautporen auszuwaschen war, und an die verrückt gekleideten Freaks, die hier auf dem Deich ihre selbstgebauten Riesendrachen steigen ließen. Bei jedem kräftigen Windstoß hoben sie damit ab und landeten irgendwo da draußen im Matsch. Er musste auch an seine Großmutter Lina denken, die früher hier in der Nähe noch eine kleine Gastwirtschaft betrieben und die ein streng gehütetes Familiengeheimnis für ihre Nachwelt hinterlassen hatte.
Dieser alte und inzwischen fast wieder vergessene Badeort und seine Umgebung, das bedeutete Robert damals sehr viel. Was es genau war, ließ sich nur sehr schwer in Worte fassen. Es war vielleicht sowas, wie sein ganz privates Woodstock des Nordens. Hier veranstalteten sie in den 70ern sogar kleine Open-Air-Konzerte. Es war ein magischer Ort der Erinnerungen und einer der letzten Privatstrände an der Nordsee, der bis zum heutigen Tag gebührenfrei allen Besuchern offenstand. Robert fiel nur ein Wort ein: Freiheit. Ein seltsamer Begriff, der sich im Laufe seines Lebens unzählige Male umdefinierte. Hier aber hatte er für Robert seine Allgemeingültigkeit erhalten.
Er lächelte. Das alles lag nun schon Jahrzehnte zurück. Er konnte sich bei diesem Gedanken ein leicht verschmitztes Grinsen nicht verkneifen. Was ist bloß aus diesen alten Träumen geworden? Ob Jülf überhaupt noch lebte?
Der Wolkenbruch hörte so plötzlich auf, wie er begonnen hatte, aber das Gewitter tobte noch immer ziemlich heftig. Robert stellte den Scheibenwischer seines Wagens aus und sah hinüber bis zur Horizontlinie, die sich als farbig abgehobener Strich zwischen Himmel und Wasser in der schmalen Öffnung des Jadebusens hin zum offenen Meer deutlich erkennbar abzeichnete. Und was ist heute aus diesem einst so verwunschenen Ort geworden? Einzig und allein stand da noch das Alte Kurhaus, fast wie ein einsamer und stoischer Fels in der Brandung, der sich aus überlebter Tradition gegen die neue Zeit stemmte. Ansonsten war der Ort kaum noch wiederzuerkennen. Die vielen neugebauten Ferienwohnungen entstellten das ursprüngliche Gesicht des ganzen Ortes fast vollständig.
Er musste diesen Enno Fedder unbedingt fragen, ob er zufällig mit Jülf verwandt sei. Robert saß sicher in seinem Auto wie in einem Faradayschen Käfig und wartete darauf, dass endlich die Kollegen von der Spurensicherung eintreffen würden. Diese Leute hätten natürlich nicht die geringste Chance, irgendwelche Details auf dem Kutter aufzuspüren oder gar sicherzustellen, die auf eine mögliche Todesursache des Mannes verwertbare Hinweise liefern könnten. Sie würden vermutlich die Wasserleiche einfach nur einsacken und abtransportieren.
Und genau so, wie es sich Robert bereits ausgemalt hatte, traf es eine Stunde später ein. Nach ihrer routinierten, jedoch ergebnislosen Untersuchung verpackten die Kollegen den Toten in einen Plastikbehälter und verschwanden anschließend im Zwielicht der untergehenden Sonne.
Kapitel 4
Als Robert vom Pferdemarkt in die schmale Gasse einbog, in der ein Kino und ein Café ums Überleben kämpften, gelangte er nach ein paar Metern auf eine mit groben Pflastersteinen angelegte Straße. Hier begann das Ziegelhofviertel, eine der inzwischen bevorzugten Wohngegenden der Stadt. Robert überkam bei seinen Streifzügen durch dieses Viertel immer wieder das Gefühl, er betrete an dieser Stelle eine Puppenstubenstadt, so klein und gediegen waren einige der Häuser. Die mit Rosen und Buchsbaumhecken bepflanzten Vorgärten waren ebenso winzig wie die Häuser selbst und von den davorliegenden schmalen Bürgersteigen konnte jeder Passant direkt in die Wohnzimmer der Menschen blicken. Jedes Mal, wenn er in der hiesigen Regionalzeitung las, Oldenburg wäre eine Großstadt, musste er schmunzeln. Dabei stimmte diese Einordnung durchaus, denn in der Stadt lebten über 100.000 Einwohner, genau genommen waren es sogar über 162.000. Und Jahr für Jahr nahm diese Zahl noch zu, denn Oldenburg hatte sich eine Gediegenheit bewahrt, die die Menschen, die hier lebten, sehr schätzten.
Aber es blieb nicht nur bei diesem Puppenstubenstadtgefühl. Schon nach wenigen Metern änderte sich der Gesamteindruck. In einem der nächsten und schäbig wirkenden Mehrfamilienhäuser, an dessen Außenfassade seit den letzten Weltkriegstagen offenbar keinerlei Renovierungen mehr durchgeführt worden waren, lebte Roberts Mutter nun schon seit vielen Jahrzehnten. Über einem der Kellerfenster dieses aschgrauen Gebäudes waren noch immer deutlich drei mit weißer Farbe aufgemalte Großbuchstaben LSR mit einem Richtungspfeil hin zur Fensteröffnung gut lesbar. Die alte Dame wunderte sich selbst am meisten darüber, dass sie es für einen Großteil ihres Lebens hier ausgehalten hatte, denn die Wohnung war alles andere als komfortabel.
Rixte Rieken war geistig noch sehr fit, fuhr sogar noch Auto, auch wenn inzwischen der klapprige R 4 immer mehr Beulen bekam, über deren Entstehung sie nicht sprach und auch nichts wissen wollte. Sie nahm am Leben noch regen Anteil, soweit dies ihre gesundheitlichen Einschränkungen erlaubten. Rixte litt schon jahrelang an unregelmäßig auftauchenden, nicht therapierbaren Migräneanfällen, an denen ganze Generationen von Fachärzten wie Spezialisten verzweifelt waren. Keiner der Mediziner konnte ihr jemals ein probates oder wirksames Mittel gegen ihr Leiden verordnen, sodass sie es irgendwann aufgegeben hatte, die gutgemeinten ärztlichen Ratschläge und Therapien zu befolgen. Mit zunehmendem Alter lernte sie ganz pragmatisch damit umzugehen und irgendwann akzeptierte sie es, mit ihrer Krankheit so gut es eben ging fertig zu werden.
Robert blieb für einen Moment vor dem Haus stehen und sah hinauf zu ihrem Wohnzimmerfenster. Er war beruhigt, da er die eingeschaltete Zimmerbeleuchtung erkennen konnte und die Bewegungen ihres Schattenbildes, das durch das Licht auf die Zimmerdecke projiziert wurde. Rixte einem trostlosen Altersheim auszuliefern, das hätte er nicht übers Herz gebracht, deshalb kümmerte er sich regelmäßig um sie. Er selbst bewohnte nur wenige Gehminuten entfernt eine Etagenwohnung in einem renovierten Gründerzeithaus. Diese Nähe erwies sich als sehr praktisch, denn wenn Markttage waren, besorgte er alle notwendigen Einkäufe und versorgte seine Mutter gleichzeitig mit dem allerneuesten Stadttratsch.
Robert mochte dieses Viertel sehr. Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Grundsteinlegung des Hauses, in dem er nun selbst wohnte, lies die etwas eigenwillige Hauseigentümerin ein Sandsteinrelief an die Hausfassade anbringen. Das steinerne Kunstwerk stellte eine barbusige junge Frau dar, die ganz verklärt in der einen Hand einen Joint hielt und in der anderen einen Backstein. Manchmal blieben Passanten davor stehen und betrachteten verwundert oder neugierig das Relief. Darunter hatte der Bildhauer eine Hinweistafel angebracht. Darauf stand der eindeutige Titel: Die Kifferin.
Robert kannte die Hauseigentümerin schon seit vielen Jahren, denn er wohnte früher schon einmal hier in diesem Haus, damals jedoch noch als Polizeischüler und Mitglied einer WG, die zum Teil aus schwer erziehbaren Jugendlichen und zum anderen Teil aus Studenten und schließlich der Vermieterin selbst bestand. Das kiffende Hippiemädchen an der Hauswand war vermutlich deshalb auch eine Art Reminiszenz an längst vergangene Zeiten. Als Robert sich um seine Versetzung nach Oldenburg bemühte und sich bereits abzeichnete, dass seinem Antrag stattgeben würde, war ihm der Gedanke gekommen, seine damalige Vermieterin im Internet ausfindig zu machen. Sie erinnerte sich tatsächlich noch an ihn. Und so war er, nicht ganz zufällig, zu dieser schönen Wohnung gekommen. Mit seinem Einzug schloss sich ein Kreislauf in seinem Leben und dieses Ereignis vermittelte Robert das Gefühl, genau an einem Ort angekommen zu sein, an dem einmal alles begonnen hatte - und wo er jetzt wieder hingehörte. Inzwischen lebten hier längst andere Mieter. Die WG existierte schon lange nicht mehr. Die alten Geschichten waren mit den einstigen Hausbewohnern ausgezogen. Eine Frau, die direkt unter ihm wohnte, besaß einen silbergrauen Jagdhund, der jeden Morgen in den Garten schiss. Robert mochte Hunde. Und über ihm schien ein junges Pärchen zu wohnen, das er zwar schon des Öfteren nachts gehört, aber bisher noch nie persönlich zu Gesicht bekommen hatte.
Mit den alteingesessenen Oldenburgern war er es dagegen nicht so einfach. Im Grunde hatte anscheinend nur er sich in den vergangenen Jahren verändert, so kam es ihm zumindest vor. Seine ganz persönliche Art, auf die Dinge des Lebens zu sehen und sie zu bewerten, war eine völlig andere geworden, seitdem er die Stadt irgendwann in den 80er Jahren verlassen hatte. Manchmal begegneten ihm in der Fußgängerzone vertraute Gesichter, die er jedoch nicht mehr namentlich zuordnen konnte. Seltsamerweise erkannten ihn selbst aber wesentlich mehr Leute aus früheren Tagen als umgekehrt. Wenn sie ihn fragten, wo er die ganze Zeit gesteckt habe und er dann erzählte, dass er in Berlin und anderswo gelebt und gearbeitet hätte, bekamen sie mitunter seltsam leuchtende Augen, als wäre Berlin das Gelobte Land oder gar die sächsische Elbmetropole Dresden ein exotischer Ort, der auf einer abgelegenen Südseeinsel liegt. So mancher seiner einstigen Weggefährten schien zwar unter der Beschaulichkeit und Trägheit der Stadt zu leiden, aber diesen Ort jemals für längere Zeit zu verlassen, dazu wäre kaum einer von ihnen bereit gewesen.
Dem Stadtfluidum war irgendein undefinierbarer Klebstoff beigemischt. Und eben diesen Leim spürte Robert nun selbst wieder unter den eigenen Schuhsohlen. Oldenburg war eine Klebestadt. Hier lebten scheinbar friedfertig mit- und nebeneinander Studenten und Bankangestellte, Esoteriker und Verwaltungsbeamte, Arbeitslose und Akademiker, Lehrer und Besserwisser, Fahrradfahrer und Altrocker. Und genauso stellten es die hiesigen Stadtväter auch sehr gern dar, wenn sie über die von ihnen selbst inszenierte »Zukunftsstadt« ins Schwärmen gerieten.
Die Fußgängerzone in der Innenstadt funktionierte im Grunde wie ein Kettenkarussell, sie war öffentliche Ringelpiezanstalt und zugleich auch die Buschfunkzentrale Oldenburgs. Für einen Kriminalkommissar ein ziemlich ergiebiges Terrain. Robert brauchte sich eigentlich nur eine Weile in eines der Straßencafés zwischen Staulinie und Theaterwall zu setzen, um von diesem Fixpunkt aus die vorüberziehenden Passanten zu beobachten. Nach kurzer Zeit hätte er alle Neuigkeiten erfahren, die diese Stadt derzeit bieten konnte, ohne dabei auch nur einen Fuß vor den anderen setzen zu müssen. Auch das gehörte mit zur Gediegenheit des Oldenburger Stadtlebens.
***
Der Wolkenbruch des gestrigen Abends brachte am Montagmorgen nicht die erhoffte Abkühlung. Es war noch immer heiß und schwül. Die Luft in dem Plattenbau, in dem die Polizeiinspektion untergebracht war, wirkte abgestanden und stickig. Robert wollte nur kurzzeitig sein Büro aufsuchen, um etwas Schreibkram und ein paar Anrufe zu erledigen. Er war noch immer ziemlich sauer auf seinen Chef. Da aber Heribert de Boer noch nicht zum Dienst erschienen war, entschied er sich dafür, die neue Woche möglichst ruhig anzugehen. Nach einer Stunde hielt er es in der Dienststelle nicht mehr aus. Er schwang sich auf sein Fahrrad und radelte in Richtung Innenstadt.
Kurze Zeit später schlürfte er an einem Glas Latte macchiato in einem der Straßencafés und beobachtete gelangweilt die Leute, als plötzlich sein junger Mitarbeiter auftauchte. Kriminalmeister Jan Onken, mit dem er sich seit einem halben Jahr das kleine Dienstzimmer und sogar den einzigen Schreibtisch darin teilte, legte Robert von hinten seine Hand auf die Schulter.
„Hab ich´s mir doch gleich gedacht, dass Sie sich hier vor der Arbeit drücken.“
„Im Gegenteil, Onken, im Gegenteil. Ich behalte die Szene der Kleinkriminalität im Auge. Immerhin werden pro Tag etwa acht Drahtesel hier in der Stadt geklaut. Da muss das Auge des Gesetzes stets wachsam sein. Sogar während der Mittagspause.“
Robert streute genüsslich braunen Rohrzucker in sein Getränk und beobachtete dabei das verblüffte Gesicht seines jungen Kollegen.
„Ah, verstehe. Mittagspause um 10 Uhr 30.“
Er ging auf diese ironische Bemerkung nicht ein. Jan legte das aufklappbare Kästchen mit dem Backgammonspiel auf den Bistrotisch und setzte sich zu Robert.
„Hat sich inzwischen das Betrugsdezernat gemeldet?“, erkundigte sich Robert.
„Nein, aber die Gerichtsmedizin hat vor etwa einer halben Stunde angerufen. Sie sollen zurückrufen, sobald Sie wieder im Büro sind.“
Jan war Ende Zwanzig und erst vor einigen Monaten von der Polizeiakademie Niedersachen direkt ins Oldenburger Kommissariat versetzt worden. Seine Gesichtszüge und sein ganzes Äußeres ähnelten auf merkwürdige Weise dem des englischen Prinzen William. Er kleidete sich überaus korrekt und bevorzugte dabei dunkle Strellson-Anzüge. Sein Haupthaar war für sein Alter bereits sehr dünn, auch darin ähnelte er dem englischen Thronfolger. Dadurch wirkte er viel reifer und gesetzter. Jan hätte sicher auch als smarter Banker eine gute Figur abgegeben. Ansonsten war er ein schlanker, sportlicher Typ, im Gegensatz zu Robert. Der Kommissar und sein junger Kriminalmeister waren schon deshalb rein optisch ein vollkommen ungleiches Paar. Robert wäre es am Beginn seiner eigenen Polizeilaufbahn wahrscheinlich niemals in den Sinn gekommen, mit Schlips und gebügeltem Hemd, geschweige mit einem teuren Anzug, zum Dienst zu erscheinen. Das war damals noch nicht üblich, aber so ändern sich die Zeiten. Ansonsten kam er mit Jan sehr gut zurecht und das war die Hauptsache. Beide hatten es von Anbeginn ihrer Zusammenarbeit geschickt verstanden, die gravierenden Generationsunterschiede und abweichenden Lebenserfahrungen mit allen damit einhergehenden hierarchischen Kompetenzproblemen, die leicht zu Konflikten führen können, in den Hintergrund zu stellen. Für Robert war vor allem eins wichtig: alle beruflichen Probleme effizient und gemeinsam zu lösen. Dienstränge oder Hackordnungen jeglicher Art spielten für ihn nur eine untergeordnete Rolle. Er fühlte sich während seiner Arbeit an keinerlei Konventionen gebunden und Dienstvorschriften interessierten ihn schon gar nicht. Es reichte ihm aus, dass sie auf dem Papier standen. Der Alte konnte von dem Jungen ebenso viel lernen, wie umgekehrt. Robert hasste vor allem die anfallenden administrativen Tätigkeiten, die nur mit dem PC zu erledigen waren. Diese Arbeit wiederum empfand Jan als sehr notwendig. Datenbanken zu füttern, aufzubauen und zu pflegen, das gehörte zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Er war ja quasi mit dem modernen technischen Krimskrams aufgewachsen. Jan profitierte dagegen reichlich von Roberts kriminalistischem Spürsinn und seinen manchmal unorthodoxen Ermittlungsmethoden. Einen besseren Vorgesetzten hätte er sich eigentlich nicht wünschen können. Allerdings gehörten Fahrraddiebstähle nicht unbedingt zu den übermäßig verantwortungsvollen Aufgaben, die sie gern gemeinsam aufklären wollten, aber sie arbeiteten dennoch sehr erfolgreich in diesem Bereich. Das Team Rieken/Onken hatte es immerhin binnen weniger Monate geschafft, die Aufklärungsquote dieser Delikte schlagartig nach oben schnellen zu lassen. Sechs von acht Fahrraddiebstählen schafften sie, innerhalb weniger Wochen nach begangener Tat aufzuklären. Dazu gesellten sich neuerdings ganz gewöhnliche Wohnungseinbrüche und Autodiebstähle. Dagegen kamen Mord oder Totschlag in Oldenburg relativ selten vor. Und genau das war einer der Gründe, weshalb Robert seine Versetzung in diese Stadt angestrebt hatte.
Nachdem sie gemeinsam noch einige Partien Backgammon speilten, die allesamt Robert verlor, verließen sie das Café und kehrten ins Polizeirevier zurück.
Im Büro bekam Robert plötzlich Kopfschmerzen. Er trat an den Wasserkocher, um sich eine frische Tasse Tee aufzubrühen. Dann öffnete er beide Fenster, um einen Luftdurchzug zu ermöglichen. Aber es schien aussichtslos zu sein. Draußen bewegte sich kein einziges Blatt an den Bäumen. Jan saß an seinem PC und hackte auf der Tastatur herum. Von einem der beiden Bürofenster aus blickte Robert ins Grüne eines gegenüberliegenden alten Friedhofs, als plötzlich das Telefon auf dem Schreibtisch klingelte. Frau Dr. Lin Quan, die Gerichtsmedizinerin, meldete sich. Robert nahm ab:
„Moin Lin. Du hast wahrscheinlich so einiges über die Wasserleiche herausgefunden. Stimmt’s?“