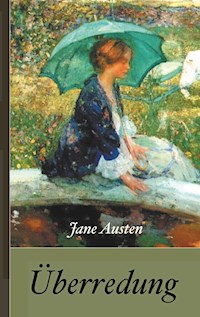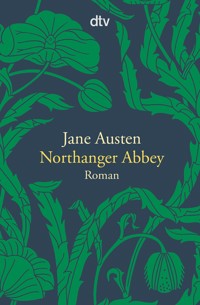
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein finsteres Familiengeheimnis oder doch nur blühende Phantasie? Catherine Morland liest gerne Schauerromane. Als ihr gebildeter Verehrer sie seiner Familie vorstellt, ist diese not amused. Die Aura des alten Landsitzes ›Northanger Abbey‹ beflügelt Catherines Phantasie so sehr, dass sie bald glaubt, einem Familiengeheimnis auf der Spur zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Jane Austen
Northanger Abbey
Roman
Aus dem Englischen neu übersetztvon Sabine Roth
ANKÜNDIGUNG DER AUTORIN
zu
NORTHANGER ABBEY
Dieses kleine Buch wurde im Jahr 1803 vollendet und sollte eigentlich gleich veröffentlicht werden. Es wurde an einen Verleger verkauft, es war sogar schon angekündigt, und warum es danach nicht weiterging, hat die Verfasserin nie in Erfahrung gebracht. Daß ein Verleger erst ein Buch kauft, das er dann nicht veröffentlichenswert findet, scheint sehr seltsam. Aber das muß die Verfasserin wie auch ihre Leser nur insofern kümmern, als ein gewisses Augenmerk auf diejenigen Teile des Werks zu richten ist, die nach dreizehn Jahren etwas veraltet sind. Der Leser möge also im Gedächtnis behalten, daß dreizehn Jahre seit Fertigstellung dieses Buches vergangen sind und noch viele Jahre mehr, seitdem es begonnen wurde, und daß sich während dieser Zeit die Örtlichkeiten, Gebräuche, Bücher und Ansichten zum Teil erheblich gewandelt haben.
ERSTES BUCH
I. KAPITEL
Kein Mensch, der Catherine Morland in ihrer Kindheit gekannt hatte, wäre auf die Idee gekommen, sie könnte zur Romanheldin geboren sein. Ihr Platz in der Welt, der Charakter ihres Vaters und ihrer Mutter, ihre eigene Erscheinung und Veranlagung, alles sprach gleichermaßen gegen sie. Ihr Vater, ein Geistlicher, aber dabei weder mißachtet noch arm, war ein hochanständiger Mann, obwohl er Richard1 hieß, und gut ausgesehen hatte er auch nie. Er hatte ein respektables Vermögen, dazu zwei sehr einträgliche Pfarren – und er neigte kein bißchen dazu, seine Töchter einzusperren. Ihre Mutter war eine nüchterne, zupackende Frau von freundlichem Wesen und, was noch bemerkenswerter ist, robuster Konstitution. Sie hatte drei Söhne geboren, bevor sie Catherine bekam; und anstatt bei der Geburt letzterer zu sterben, wie wohl jeder erwarten konnte, lebte sie einfach weiter – lebte und brachte noch sechs Kinder mehr zur Welt, die sie um sich herum aufwachsen sah, und all das bei bester Gesundheit. Eine Familie mit zehn Kindern muß grundsätzlich als prächtig gelten, solange nur Köpfe und Gliedmaßen in ausreichender Zahl vorhanden sind, aber darüber hinaus verlieh den Morlands kaum etwas Anspruch auf solch ein Prädikat, denn sie waren im großen und ganzen recht unscheinbar, und Catherine bildete da lange Zeit keine Ausnahme. Sie hatte eine magere, ungelenke Figur, einen bleichen, käsigen Teint, strähniges dunkles Haar und ein knochiges Gesicht, so viel zu ihrem Äußeren; und ebensowenig brachte sie innerlich das Zeug zur Heldin mit. Sie spielte am liebsten Bubenspiele und gab Kricket nicht nur bei weitem den Vorzug vor ihren Puppen, sondern auch vor den heroischeren Zeitvertreiben der Kindheit wie dem Füttern von Haselmäusen oder Kanarienvögeln oder dem Begießen von Rosenstöcken. Überhaupt war keine Gärtnerin an ihr verlorengegangen, und wenn sie einmal Blumen pflückte, dann eher aus Übermut – zumindest lag dieser Verdacht nahe, denn sie riß mit Vorliebe die ab, die sie nicht anrühren sollte. – So sah es mit ihren Neigungen aus, und ihre Fähigkeiten waren ähnlich herausragend. Sie konnte oder verstand nie etwas, bevor man es ihr beibrachte, und manchmal nicht einmal dann, denn sie war oft unaufmerksam und zuweilen begriffsstutzig. Drei Monate brauchte ihre Mutter, bis sie sie auch nur so weit hatte, daß sie »Des Bettlers Bittgesuch«2 aufsagen konnte; und selbst dann deklamierte ihre nächstjüngere Schwester Sally es immer noch besser als sie. Nicht daß sich Catherine bei allem dumm angestellt hätte, im Gegenteil, sie lernte das Gedicht von der Häsin und ihren vielen Freunden3 so geschwind wie nur irgendein Mädchen in England. Ihre Mutter wollte, daß sie musizieren lernte, und Catherine versprach sich großen Spaß davon, denn sie klimperte für ihr Leben gern auf den Tasten eines ausgemusterten alten Spinetts herum; also fing sie im Alter von acht damit an. Ein Jahr lang bekam sie Stunden und quälte sich sehr, und Mrs.Morland, die ihren Töchtern keine Fertigkeiten aufzwingen mochte, wo Unlust und Unfähigkeit so lautstark Protest einlegten, erlaubte ihr aufzuhören. Der Tag, an dem der Musiklehrer seinen Hut nahm, war einer der schönsten in Catherines Leben. Um ihre Zeichenkünste war es kaum besser bestellt, auch wenn sie sich, sooft sie von ihrer Mutter das Außenblatt eines Briefs oder sonst einen Papierfetzen ergattern konnte, mächtig ins Zeug legte und Häuser, Bäume, Hennen und Küken darauf malte, die alle ziemlich gleich aussahen. – Schreiben und Rechnen bekam sie von ihrem Vater beigebracht, Französisch von ihrer Mutter. Sie tat sich in keinem Fach sonderlich hervor und drückte sich um jedes, wo immer es ging. Was für ein sonderbares, widersprüchliches Wesen! – denn trotz so vieler Anzeichen der Liederlichkeit im Alter von zehn war sie weder bösartig noch launenhaft, selten trotzig, fast nie auf Streit aus und, von gelegentlichen tyrannischen Anwandlungen abgesehen, sehr lieb zu ihren kleinen Geschwistern; sie war außerdem laut und wild, haßte Stubenhockerei und Reinlichkeit und kannte nichts Schöneres auf der Welt, als den Grashang hinter ihrem Haus hinunterzurollen.
Das war Catherine Morland mit zehn. Ab fünfzehn ging es mit ihrer Erscheinung langsam bergauf; sie drehte sich die ersten Locken und sehnte sich nach ihrem ersten Ball; ihr Teint wurde klarer, ihre Gesichtszüge runder und rosiger, ihr Blick gewann an Glanz und ihre Figur an Fülle. Ihre Liebe zum Schmutz wich der Freude am Putz, und im selben Maße, in dem sie reinlich wurde, wurde sie schmuck; es konnte jetzt geschehen, daß sie eine Bemerkung ihrer Eltern über ihr verbessertes Aussehen auffing. »Catherine macht sich immer mehr heraus, heute sieht sie fast hübsch aus«, waren Worte, die mitunter an ihr Ohr drangen; und wie willkommen war ihr dieser Klang! Fast hübsch auszusehen, das ist für ein Mädchen, das die ersten fünfzehn Jahre seines Lebens unscheinbar war, ein beglückenderes Kompliment, als es eine Schönheit von Kindesbeinen an jemals empfangen könnte.
Mrs.Morland war eine sehr tüchtige Frau, die ihren Kindern gern alles mitgeben wollte, was sich für sie schickte, aber sie war so beschäftigt damit, zu gebären und ihre Kleinen zu unterrichten, daß die größeren Töchter wohl oder übel sich selbst überlassen blieben, und so verwunderte es nicht weiter, wenn Catherine, von der Natur nicht eben zur Heldin veranlagt, mit vierzehn lieber Kricket oder Schlagball spielte, ausritt oder über die Wiesen lief, als Bücher zu lesen – oder zumindest lehrreiche Bücher; denn solange nichts Nützliches darin stand, solange sie bloß Geschichten enthielten und keine Betrachtungen, hatte sie gegen Bücher durchaus nichts. Aber zwischen fünfzehn und siebzehn legte sie sich das Rüstzeug zur Heldin zu; sie las sämtliche Werke, mit denen Romanheldinnen vertraut sein müssen, um all jene Zitate im Gedächtnis zu haben, die ihnen in den Wechselfällen ihres bewegten Lebens eine so große Hilfe und ein so großer Trost sind.
Von Pope lernte sie, diejenigen zu verurteilen, die
»zur Schau nur tragen fälschlich’ Leid.«4
Von Gray, daß
»Gar manche Blüte ungesehen erglüht
Und ihren Duft in Wüstenlüfte strömt.«5
Von Thompson, daß
»kein Amt so freudig ist,
wie jungem Geistestrieb die Richtung weisen.«6
Und von Shakespeare erfuhr sie einen ganzen Schatz an Wissenswertem, unter anderem, daß
»Dinge, leicht wie Luft,
Der Eifersucht Beweise sind, so stark
Wie Bibelsprüche«,
daß
»Der arme Käfer, den dein Fuß zertritt,
Doch körperlich ein Leid fühlt, ganz so groß,
Als wenn ein Riese stirbt«
und daß eine verliebte junge Frau zwangsläufig dreinblickt
»wie die Geduld auf einer Gruft,
Dem Grame lächelnd.«7
Soweit waren ihre Fortschritte ganz zufriedenstellend – und auch in manch anderer Hinsicht gebührte ihr hohes Lob; denn wenngleich sie selbst keine Sonette schreiben konnte, überwand sie sich nun, sie zu lesen; und obwohl sie nicht hoffen durfte, eine ganze Abendgesellschaft durch ein selbstkomponiertes Prélude auf dem Pianoforte in Entzücken zu versetzen, konnte sie den Darbietungen anderer ohne allzu große Ermüdungserscheinungen lauschen. Ihr größter Schwachpunkt war das Malen – sie besaß keinerlei zeichnerische Begabung, nicht einmal genügend, um sich an einem Profil ihres Geliebten zu versuchen, auf daß darin ihre Hand zu erkennen sei. Auf diesem Gebiet verfehlte sie den Heldinnenstatus aufs kläglichste. Noch ahnte sie allerdings nichts von diesem Manko, denn es gab keinen Geliebten, den sie hätte porträtieren können. Sie hatte das Alter von siebzehn Jahren erreicht, ohne auch nur einen einzigen holden Jüngling erblickt zu haben, der ihren Busen in Wallung gebracht hätte, ohne eine einzige wahre Leidenschaft entfacht und mehr als die mäßigste und vorübergehendste Bewunderung erregt zu haben. Wirklich höchst rätselhaft! Aber Rätsel lassen sich im allgemeinen lösen, wenn nur die Umstände gründlich genug beleuchtet werden. Es gab nicht einen Lord in der Gegend, ja nicht einmal einen Baronet. Es gab nicht eine Familie in ihrem Bekanntenkreis, die auf ihrer Türschwelle ein Findelkind entdeckt und es aufgenommen und großgezogen hatte – nicht einen einzigen jungen Mann, dessen Herkunft im Dunkeln lag. Ihr Vater hatte kein Mündel, und der Squire der Gemeinde war kinderlos.
Aber wenn eine junge Frau zur Romanheldin bestimmt ist, kann auch die Widernatürlichkeit von vierzig Nachbarsfamilien sie nicht aufhalten. Etwas muß und wird geschehen, um einen Helden ihren Weg kreuzen zu lassen.
Mr.Allen, der Grundherr von fast ganz Fullerton, dem Dorf in Wiltshire, wo die Morlands wohnten, bekam gegen seine Gichtanfälle eine Kur in Bath verordnet; und seine Gattin, eine gutartige Frau, die Miss Morland sehr mochte – und vielleicht ja erkannte, daß eine junge Dame, der in ihrem Heimatdorf partout keine Abenteuer zustoßen wollen, sich eben in der Fremde welche suchen muß –, lud Catherine ein, sie zu begleiten. Mr. und Mrs.Morland waren sehr dafür und Catherine überglücklich.
II. KAPITEL
Zusätzlich zu dem, was bereits über Catherine Morlands äußerliche und innere Qualitäten gesagt wurde, ehe nun all die Schwierigkeiten und Gefahren von sechs Wochen Bath auf sie einstürmen, sei – falls die folgenden Seiten dem Leser nicht den nötigen Aufschluß über ihren Charakter verschaffen – sicherheitshalber noch dies vermerkt: daß sie ein liebevolles Herz hatte, ein fröhliches, offenes Naturell ohne alle Dünkel oder Affektiertheit, ein Auftreten, dem noch die Unbeholfenheit und Schüchternheit des Schulmädchens anhaftete, ein gefälliges und, wenn sie guter Dinge war, auch hübsches Äußeres – und einen so unbedarften, naiven Geist, wie ihn weibliche Wesen im Alter von siebzehn gemeinhin haben.
Als die Stunde des Aufbruchs heranrückte, mußten erwartungsgemäß auch Mrs.Morlands Mutterängste sich zuspitzen. Tausend bange Visionen von den Übeln, die ihrer geliebten Catherine aus dieser Trennung erwachsen würden, mußten ihr das Herz abdrücken und den Born ihrer Tränen für die letzten ein, zwei Tage nimmermehr versiegen lassen; und Ratschläge der bedeutsamsten und probatesten Art mußten bei der Abschiedsunterredung in ihrem Gemach von ihren weisen Lippen fließen. Warnungen vor der Zügellosigkeit jener Edelmänner und Baronets, die nichts lieber tun, als junge Damen in abgelegene Gehöfte zu verschleppen, mußten in einem solchen Moment ihrem übervollen Herzen entströmen. Wer könnte etwas anderes glauben? Aber Mrs.Morland wußte so wenig von Lords und Baronets, daß sie sich gar keinen Begriff von ihrer grundsätzlichen Niedertracht machte und nichts ahnte von den Fährnissen, die ihrer Tochter von den Umtrieben dieser Herren drohten. Ihre Ermahnungen beschränkten sich auf folgende Punkte: »Ich bitte dich, Catherine, pack dich schön warm am Hals ein, wenn du abends vom Tanzen kommst; und versuch doch unbedingt, dir zu notieren, was du ausgibst – hier hast du ein kleines Büchlein dafür.«
Sally oder vielmehr Sarah (denn welche junge Dame, die auf sich hält, wird sechzehn, ohne ihren Namen soweit wie möglich zu verfremden?) war schon aufgrund ihres Alters zur Busenfreundin und Vertrauten ihrer Schwester prädestiniert. Um so bemerkenswerter darum, daß sie weder darauf drang, Catherine möge ihr mit jeder Post schreiben, noch ihr das Versprechen abnahm, genaueste Charakterstudien sämtlicher neuer Bekannten abzufassen und jede interessante Unterhaltung, zu der es in Bath kommen mochte, in allen Einzelheiten zu schildern. Überhaupt wurde alles rund um diese bedeutungsschwere Reise von den Morlands so maßvoll und gelassen betrieben, als ginge es um banale Alltagsgefühle und nicht um die zarten Regungen und überfeinerten Empfindungen, die der erste Abschied einer Romanheldin von ihrer Familie von Rechts wegen auslösen sollte. Ihr Vater, weit davon entfernt, ihr eine unbeschränkte Vollmacht für seinen Bankier zu erteilen oder ihr wenigstens einen Hundertpfundschein in die Hand zu drücken, gab ihr nur zehn Guineen und versprach ihr mehr, falls sie mehr brauchte.
Unter solch widrigen Vorzeichen also trennte man sich, und die Fahrt begann. Sie verlief so geruhsam, wie es sich ziemte, in ereignisloser Sicherheit. Weder Räuber noch Unwetter hatten ein Einsehen mit ihnen, kein glückhafter Achsbruch rief den Helden auf den Plan. Das Beunruhigendste war, daß Mrs.Allen fürchtete, ihre Galoschen in einem Gasthof vergessen zu haben, und auch diese Sorge erwies sich gottlob als grundlos.
Sie langten in Bath an. Catherine wußte sich kaum zu lassen vor Eifer und Freude, ihre Augen waren hier, dort, überall, während sie durch das schöne und prächtige Umland der Stadt fuhren und dann durch die Straßen, die zum Hotel führten. Sie war ausgezogen, glücklich zu sein, und sie war es jetzt schon.
Nicht lange, und sie waren in einem komfortablen Quartier in der Pulteney Street untergebracht.
Es wird nun Zeit für eine nähere Beschreibung Mrs.Allens, damit sich der Leser ein Bild davon machen kann, in welcher Weise ihr Vorgehen im weiteren Verlauf dazu angetan ist, das allgemeine Unglück in diesem Buch zu befördern, und wodurch sie am ehesten mithelfen wird, die arme Catherine in all den Jammer und all die Verzweiflung zu stürzen, die ein letzter Band hergibt – ob durch ihre Kopflosigkeit, Vulgarität oder Eifersucht – ob dadurch, daß sie ihre Briefe abfängt, ihren Ruf ruiniert oder sie vor die Tür setzt.
Mrs.Allen gehörte zu jener zahlreich vertretenen Kategorie weiblicher Wesen, deren Gesellschaft nur zu einem Gefühl Anlaß gibt: Verwunderung darüber, wie irgendein Mann auf der Welt sie lieb genug gewinnen konnte, um sie zu heiraten. Sie besaß weder Schönheit noch Geist, Lebensart oder Schliff. Ein damenhaftes Benehmen, viel freundliches Phlegma und ein kindisches Gemüt mußten ausreichen als Erklärung dafür, daß die Wahl eines vernünftigen, intelligenten Mannes wie Mr.Allen auf sie gefallen war. In einer Hinsicht jedenfalls eignete sie sich ganz eminent dazu, eine junge Dame in die Gesellschaft einzuführen, insofern nämlich, als sie vom selben Verlangen beseelt war, überall hinzugehen und alles zu sehen, wie nur irgendeine Debütantin. Kleider waren ihre Passion. Sie hatte eine unschuldige Freude daran, sich feinzumachen; und der Eintritt unserer Heldin ins Leben mußte warten, bis drei oder vier Tage damit verbracht worden waren, sich umzutun, was man derzeit so trug, und Catherines Beschützerin ein Kleid ihr eigen nannte, das dem neuesten Schick entsprach. Auch Catherine tätigte einige Einkäufe, und als alles fertig und bereit war, kam der große Abend, da sie erstmals die Upper Rooms betreten sollte. Ihre Haare wurden kunstgerecht geschnitten und frisiert, ihre Kleider von kundiger Hand angelegt, und sowohl Mrs.Allen als auch ihre Zofe versicherten ihr, daß alles an ihr so war, wie es sein sollte. Solcherart ermutigt hoffte Catherine, in der Menge zumindest nicht negativ aufzufallen. Bewunderung – nun, die würde ihr selbstredend willkommen sein, aber sie setzte nicht darauf.
Mrs.Allen verwandte so viel Zeit auf ihre Toilette, daß sie erst spät in den Ballsaal kamen. Die Saison war in vollem Gange, der Saal gut gefüllt, und die beiden Damen zwängten sich hinein, so gut sie konnten. Mr.Allen für seinen Teil begab sich unverzüglich ins Kartenzimmer, und so waren sie in dem Gedränge ganz auf sich gestellt. Mit mehr Rücksicht auf die Unversehrtheit ihres neuen Gewands als auf das Wohlergehen ihres Schützlings bahnte sich Mrs.Allen ihren Weg durch den Pulk von Männern am Eingang, so rasch, wie die gebotene Vorsicht es zuließ; Catherine aber hielt sich dicht an ihrer Seite und hakte die Freundin so entschlossen unter, daß selbst die vereinten Kräfte einer schiebenden und stoßenden Menge sie nicht auseinanderzureißen vermochten. Sehr zu ihrer Verblüffung mußte sie jedoch feststellen, daß tiefer in den Saal vorzudringen keineswegs hieß, sich aus dem Gewühl zu befreien; es schien weiter drin eher noch zuzunehmen, während sie doch geglaubt hatte, wenn sie erst ein Stück von der Tür entfernt wären, müßten sie leicht Plätze finden und bequem den Tänzen zuschauen können. Aber dem war keineswegs so, und obgleich sie sich mit nicht erlahmendem Einsatz bis ans andere Ende des Saals durchkämpften, blieb ihre Lage auch dort die gleiche; sie sahen von den Tanzenden nichts außer dem hohen Federputz einzelner Damen. Dennoch gaben sie nicht auf – eine Hoffnung blieb ihnen noch; und dank eines unverminderten Aufgebots von Kraft und Findigkeit gelangten sie endlich in den Durchgang hinter der obersten Bankreihe. Hier war deutlich mehr Platz als unten, und so hatte Miss Morland freie Sicht auf die Gesellschaft, durch die sie sich unter solchen Gefahren einen Weg gesucht hatten. Es war ein prachtvoller Anblick, und zum ersten Mal an diesem Abend bekam sie das Gefühl, auf einem Ball zu sein; sie sehnte sich danach, zu tanzen, aber sie kannte keinen Menschen im ganzen Saal. Mrs.Allen tat alles, was sie in so einem Fall tun konnte, indem sie von Zeit zu Zeit behaglich sagte: »Ich wollte, du könntest mittanzen, meine Liebe – ich wollte, du fändest einen Partner.« Eine Weile fühlte ihre junge Freundin sich verpflichtet, ihr für diese Wünsche zu danken; aber sie wurden so oft wiederholt und blieben so völlig ohne Wirkung, daß Catherine es schließlich müde wurde und mit dem Danken aufhörte.
Lange durften sie sich jedoch nicht an dieser so hart erkämpften Ruhe in luftiger Höhe freuen. – Schon bald brach alles zum Teetrinken auf, und sie mußten sich mit den anderen wieder hinauszwängen. In Catherine regte sich langsam doch leise Enttäuschung – sie war es leid, immerzu von Leuten angerempelt zu werden, deren Gesichter so gar nichts hatten, was sie interessierte, und die ihr alle so völlig fremd waren, daß sie die Verdrießlichkeit des Gefangenseins durch keine Silbe zu einem ihrer Mitgefangenen abmildern konnte; und als sie schließlich im Teesalon ankamen, störte es sie noch empfindlicher, keine Gruppe zu haben, zu der sie stoßen, keine Bekanntschaft, die sie geltend machen durften, keinen Herrn, der ihnen beisprang. – Von Mr.Allen war nichts zu sehen, und nachdem sie vergebens nach einer brauchbareren Lösung ausgeschaut hatten, blieb ihnen nichts übrig, als am Ende eines Tisches Platz zu nehmen, der bereits von einer großen Gesellschaft besetzt war, ohne daß sie irgend etwas dort zu tun gehabt hätten oder mit irgendwem hätten sprechen können als miteinander.
Kaum saßen sie, beglückwünschte Mrs.Allen sich dazu, daß ihr Kleid vor Schaden bewahrt worden war. »Es wäre fatal gewesen, wenn es eingerissen wäre«, sagte sie, »meinst du nicht auch? – Ein solch zarter Musselin … Also ich habe im ganzen Saal nichts gesehen, was mir nur annähernd so gefiele, das muß ich sagen.«
»Wie unangenehm es ist«, flüsterte Catherine, »hier keine Menschenseele zu kennen.«
»Ja, meine Liebe«, erwiderte Mrs.Allen stillvergnügt, »äußerst unangenehm.«
»Was sollen wir tun? Die Herren und Damen am Tisch fragen sich sicher schon, was wir hier wollen – wir drängen uns ihnen ja regelrecht auf.«
»O ja, das tun wir. – Wirklich sehr unerfreulich. Ich wünschte, wir hätten viele Bekannte hier.«
»Ich wünschte, wir hätten überhaupt welche – dann könnten wir uns an jemanden halten.«
»Sehr wahr, meine Liebe; wenn wir Bekannte hier hätten, dann würden wir uns sofort zu ihnen setzen. Letztes Jahr waren die Skinners hier – ich wünschte, sie wären jetzt auch da.«
»Sollten wir dann nicht besser hier weggehen? Es ist ja nicht einmal ein Gedeck für uns da.«
»Stimmt, da steht keins. – Wie überaus ärgerlich! Aber ich glaube, wir sollten trotzdem lieber sitzenbleiben, in dem Gedränge wird man so schrecklich herumgestoßen! Was macht meine Frisur, meine Liebe? – Jemand hat mir einen Puff versetzt, der sie ruiniert hat, fürchte ich.«
»Nein, gar nicht, es sieht sehr gut aus. Aber, liebe Mrs.Allen, sind Sie sicher, daß Sie in dieser ganzen riesigen Menschenmenge niemanden kennen? Irgendwen müssen Sie doch kennen.«
»Niemanden, wirklich nicht – ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte von Herzen, ich hätte einen großen Bekanntenkreis hier, und dann würde ich dir einen Partner verschaffen. – Ich wäre so froh, wenn du zum Tanzen kämst. Gott, sieht die Frau dort drüben merkwürdig aus! Was für ein komisches Kleid sie anhat! – Wie altmodisch es ist! Schau dir den Rücken an.«
Nach einer Weile bekamen sie von einem ihrer Nachbarn Tee angeboten; sie nahmen dankbar an, und daraus ergab sich ein kurzer Wortwechsel mit dem Herrn, der ihnen einschenkte – das einzige Mal, daß jemand an diesem Abend mit ihnen sprach, ehe nach Beendigung des Tanzes Mr.Allen sie entdeckte und zu ihnen trat.
»Nun, Miss Morland«, sagte er gleich, »ich hoffe, es war ein schöner Ball für Sie.«
»Ja, sehr schön«, antwortete sie und versuchte vergeblich, ein herzhaftes Gähnen zu unterdrücken.
»Ich wünschte, sie hätte tanzen können«, sagte seine Frau, »ich wünschte, wir hätten einen Partner für sie gefunden. – Ich habe schon gesagt, ich wäre so froh, wenn die Skinners diesen Winter hier wären statt letzten, oder wenn die Parrys gekommen wären, wie sie es eigentlich wollten, denn dann hätte sie mit George Parry tanzen können. Es ist so schade, daß sie keinen Partner hatte!«
»Nächstes Mal haben wir sicher mehr Glück«, tröstete Mr.Allen.
Nun, da nicht mehr getanzt wurde, begann die Gesellschaft sich zu zerstreuen – ausreichend, daß die Zurückbleibenden recht bequem herumspazieren konnten; und dies war die Zeit, da eine Heldin, die bei den Begebnissen des Abends bislang keine herausragende Rolle gespielt hatte, bemerkt und bewundert werden konnte. Mit jeder Minute, die verstrich, dünnte die Menge sich mehr aus, und Catherines Reizen bot sich folglich eine immer größere Bühne. Sie war jetzt für viele junge Männer zu sehen, die vorher keine Möglichkeit dazu gehabt hatten. Keinem stockte jedoch bei ihrem Anblick der Atem vor Überwältigung, kein fragendes Raunen verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Saal, und nicht einem Menschen fiel es ein, sie als Göttin zu bezeichnen. Dabei sah Catherine für ihre Verhältnisse sehr gut aus, und hätten die Versammelten sie nur vor drei Jahren gekannt, so hätten sie sie jetzt als eine Schönheit empfunden.
Blicke erntete sie dennoch, und durchaus anerkennende; denn sie hörte selbst, wie zwei Herren sie ein hübsches Ding nannten. Solche Worte verfehlten nicht ihre Wirkung; der Abend erschien ihr gleich viel vergnüglicher als zuvor – ihrer bescheidenen Eitelkeit war Genüge getan – sie fühlte sich den beiden jungen Männern für dieses schlichte Lob zu größerem Dank verpflichtet als eine Heldin von Format für fünfzehn Sonette, die ihren Liebreiz in den Himmel hoben, und war, als sie in die Sänfte stieg, im reinen mit sich und der Welt und hochzufrieden mit ihrem Maß an allgemeiner Beachtung.
III. KAPITEL
Jeder Vormittag brachte nun seine regelmäßigen Pflichten mit sich; – Läden wollten aufgesucht sein, ein neuer Teil der Stadt besichtigt, und danach ging es in die Trinkhalle, wo sie eine Stunde lang auf und ab promenierten, alle sahen und mit keinem sprachen. Der Wunsch nach recht vielen Bekannten in Bath lebte auch weiterhin sehr stark in Mrs.Allen, und sie wiederholte ihn nach jedem erneuten Beweis (den ihr kein Vormittag schuldig blieb), daß sie gar niemanden kannte.
Sie besuchten die Lower Rooms; und hier meinte es das Schicksal besser mit unserer Heldin. Der Zeremonienmeister führte ihr einen sehr kultivierten jungen Mann als Tanzpartner zu, Tilney mit Namen. Er war um die vier- oder fünfundzwanzig, recht hochgewachsen, mit angenehmen Gesichtszügen, einem sehr intelligenten, wachen Blick, und wenn er auch nicht regelrecht gut aussah, so war er doch nahe genug daran. Sein Auftreten war gewandt, und Catherine fühlte sich vom Glück sehr begünstigt. Während des Tanzens blieb zum Reden wenig Gelegenheit, aber als sie sich zum Tee setzten, fand sie ihn gerade so liebenswürdig, wie sie es ihm vorab schon unterstellt hatte. Er plauderte flüssig und lebhaft – und es war etwas Schalkhaftes, Scherzendes an seiner Art, das sie fesselte, auch wenn sie nur Teile davon verstand. Nachdem sie sich eine Weile über all das unterhalten hatten, was sich so en passant ergab, sagte er unvermittelt: »Ich habe es bisher sträflich an den Aufmerksamkeiten fehlen lassen, gnädiges Fräulein, die Sie billigerweise von Ihrem Tanzpartner erwarten können; ich habe Sie noch nicht gefragt, wie lange Sie bereits in Bath sind, ob dies Ihr erster Besuch hier ist, ob Sie schon in den Upper Rooms waren, im Theater und im Konzert, und wie es Ihnen überhaupt hier gefällt. Ich war sehr ungalant; aber hätten Sie nun Muße, meine Neugier in dieser Hinsicht zu befriedigen? Wenn ja, will ich unverzüglich beginnen.«
»O bitte, machen Sie sich keine Mühe, Sir.«
»Glauben Sie mir, es ist mir keine Mühe, gnädiges Fräulein.« Und indem er ein maskenhaftes Lächeln aufsetzte und seine Stimme künstlich sanft und weich klingen ließ, fragte er in geziertem Ton: »Sind Sie schon länger hier in Bath, gnädiges Fräulein?«
»Ungefähr eine Woche, Sir«, antwortete Catherine, die sich das Lachen verbeißen mußte.
»Tatsächlich!« – mit aufgesetzter Verblüffung.
»Warum überrascht Sie das, Sir?«
»Gute Frage«, sagte er in seinem normalen Ton. »Aber irgendeine Gefühlswallung muß Ihre Antwort nun einmal in mir auslösen, und Überraschung ist leichter vorzutäuschen und auch nicht weniger plausibel als alle anderen. – Also, fahren wir fort. Waren Sie noch nie vorher hier, gnädiges Fräulein?«
»Noch nie, Sir.«
»So etwas! Haben Sie denn schon die Upper Rooms beehrt?«
»Ja, Sir, ich war letzten Montag dort.«
»Waren Sie im Theater?«
»Ja, Sir, ich habe am Dienstag ein Stück gesehen.«
»Im Konzert?«
»Ja, Sir, am Mittwoch.«
»Und gefällt es Ihnen soweit in Bath?«
»Ja, es gefällt mir sehr gut.«
»Jetzt muß ich noch kurz süßlich lächeln, und dann können wir wieder Vernunft einkehren lassen.«
Catherine wandte das Gesicht ab, unsicher, ob sie es wagen durfte zu lachen oder nicht.
»Ich merke schon, was Sie von mir halten«, sagte er gramvoll, »ich werde schlecht wegkommen, wenn Sie morgen Ihr Tagebuch schreiben.«
»Mein Tagebuch!«
»Ja, ich sehe es schwarz auf weiß vor mir: Freitag, war in den Lower Rooms, hatte mein geblümtes Musselinkleid mit der blauen Borte an – dazu schlichte schwarze Schuhe – sehr vorteilhaft; wurde jedoch aufs unerklärlichste von einem seltsamen, schwachköpfigen Mann belästigt, der mich zum Tanzen genötigt und mich dann mit seinem Unsinn gepeinigt hat.«
»So etwas schreibe ich ganz bestimmt nicht.«
»Darf ich Ihnen sagen, was Sie dann schreiben sollten?«
»Wenn Sie so nett sein wollen.«
»Habe mit einem äußerst liebenswürdigen jungen Mann getanzt, der mir von Mr.King vorgestellt wurde; habe mich bestens mit ihm unterhalten – ein außerordentlich kluger Kopf, wie mir scheint – hoffe sehr, ihn näher kennenlernen zu dürfen. Das, gnädiges Fräulein, hätte ich gern dort stehen.«
»Aber vielleicht führe ich ja gar kein Tagebuch.«
»Und vielleicht sitzen Sie auch nicht hier in diesem Raum, und ich sitze nicht neben Ihnen. Daran ließe sich dann ebenso zweifeln. Kein Tagebuch führen! Wie sollen Ihre fernen Kusinen denn ohne ein Tagebuch jemals ermessen, wie Ihr Leben in Bath abläuft? Wie wollen Sie die Artigkeiten und Komplimente eines jeden Tages ordnungsgemäß wiedergeben, wenn Sie sie nicht Abend für Abend in einem Tagebuch festhalten? Wie wollen Sie sich Ihre diversen Kleider merken, wie soll dem speziellen Leuchten Ihres Teints und den Ringeln in Ihrem Haar in ihrer ganzen Vielfalt Gerechtigkeit widerfahren, wenn Sie nicht jederzeit auf ein Tagebuch rekurrieren können? – Mein liebes gnädiges Fräulein, ich bin nicht so unbewandert in den Gepflogenheiten junger Damen, wie Sie mich gerne hätten; es ist die treffliche Gewohnheit des Tagebuchführens, die maßgebend zur Herausbildung jenes leichthändigen Schreibstils beiträgt, für den die Damen gemeinhin gerühmt werden. Alle Welt ist sich einig, daß die Gabe, schöne Briefe zu schreiben, eine typisch weibliche sei. Die Natur wird ihre Hand im Spiel gehabt haben, das wohl, aber ich bin überzeugt, daß ihr die Praxis des Tagebuchschreibens ein wichtiger Helfer war.«
»Ich weiß gar nicht«, sagte Catherine zögernd, »ob Frauen wirklich so viel schönere Briefe schreiben als Männer. Ich meine, immer sind die unsrigen vielleicht auch nicht die besseren.«
»Nach den Einblicken, die mir bisher vergönnt waren, scheint mir der Briefstil der Damen gemeinhin untadelig, bis auf drei kleine Punkte.«
»Und welche Punkte sind das?«
»Allgemeine Inhaltsleere, ein komplettes Desinteresse an Zeichensetzung und eine sehr häufige Unkenntnis der Grammatik.«
»Oh! Da hätte ich das Kompliment also ruhig annehmen können. Zu gut denken Sie in dieser Sache bestimmt nicht von uns.«
»Ich würde es genausowenig zur Regel erheben wollen, daß Frauen bessere Briefe schreiben als Männer, wie daß sie bessere Duette singen oder bessere Landschaften malen. In jeder Fertigkeit, bei der es auf den Geschmack ankommt, sind die Talente relativ gleich zwischen den Geschlechtern verteilt.«
Sie wurden von Mrs.Allen unterbrochen: »Meine liebe Catherine«, sagte sie, »zieh doch bitte diese Nadel da aus meinem Ärmel; ich fürchte, sie hat schon ein Loch hineingerissen; das wäre mir sehr arg, denn es ist fast mein Lieblingskleid, obwohl der Meter nur neun Shilling gekostet hat.«
»Genau das hätte ich auch geschätzt, Madam«, sagte Mr.Tilney, der den Musselin betrachtete.
»Ach, kennen Sie sich mit Musselin aus, Sir?«
»Bestens, ich kaufe mir meine Halstücher immer selber und gelte als ein großer Experte; sogar meine Schwester überläßt die Auswahl ihrer Kleider bisweilen mir. Erst neulich habe ich ihr eins ausgesucht, und sämtliche Damen, die es gesehen haben, fanden es einen ausgemachten Glückskauf. Ich habe nur fünf Shilling für den Meter bezahlt, und es war echter indischer Musselin.«
Mrs.Allen war tief beeindruckt von seinem Genie. »Männer haben für gewöhnlich so wenig Sinn für solche Dinge«, klagte sie. »Mr.Allen bringe ich nicht mal dazu, eins meiner Kleider vom anderen zu unterscheiden. Sie müssen Ihrer Schwester eine große Stütze sein.«
»Das hoffe ich, Madam.«
»Aber sagen Sie doch, Sir, wie finden Sie Miss Morlands Kleid?«
»Sehr hübsch«, sagte er und begutachtete es mit ernster Miene, »aber ich weiß nicht, ob es sich so gut waschen läßt; ich fürchte, es zerschleißt.«
»Wie können Sie so …«, fragte Catherine lachend, »so …« – fast hätte sie gesagt: seltsam sein.
»Ich bin ganz Ihrer Meinung«, erwiderte Mrs.Allen, »und das habe ich Miss Morland auch gesagt, als sie es gekauft hat.«
»Aber wissen Sie, Madam, irgendeine Verwendung findet sich für Musselin immer; Miss Morland wird genug davon übrigbehalten, daß es für ein Taschentuch reicht oder für eine Haube oder einen Umhang. Musselin ist nie verschwendet, das habe ich meine Schwester wohl vierzigmal sagen hören, wenn sie entweder unmäßig war und sich daran überkauft hat, oder ungestüm und ihr die Schere ausgerutscht ist.«
»Bath ist ein wundervoller Ort, Sir, es gibt so viele gute Läden hier. – Wir auf dem Land sind da übel dran; nicht, daß es in Salisbury nicht auch sehr gute Läden gäbe, aber es ist so weit weg – acht Meilen sind ein weiter Weg; Mr.Allen sagt, es sind neun, gemessene neun, aber ich bin sicher, es können nicht mehr als acht sein, und es ist so unglaublich anstrengend – ich komme immer halbtot vor Erschöpfung zurück. Aber hier, hier tritt man einfach nur aus der Tür und hat in fünf Minuten alles gekauft.«
Der höfliche Mr.Tilney bekundete weiterhin Interesse, und sie hielt ihn mit dem Thema Musselin in Beschlag, bis der Tanz wieder begann. Catherine, die dem Gespräch der beiden lauschte, bekam das Gefühl, daß er etwas zu gern auf die Schwächen seiner Mitmenschen einging. – »Worüber grübeln Sie so ernsthaft?« fragte er sie auf dem Weg zurück in den Saal; – »nicht über Ihren Tanzpartner, hoffe ich, denn so, wie Sie den Kopf schütteln, sind Ihre Betrachtungen nicht eben erfreulich.«
Catherine errötete und sagte: »Ich habe gar nichts gedacht.«
»Das ist zugegebenermaßen geschickt und schlau geantwortet; aber mir wäre es lieber, Sie sagten mir gleich, daß Sie es mir nicht sagen werden.«
»Also gut, ich sag’s Ihnen nicht.«
»Danke; denn nun werden wir rasch näher bekannt werden, weil ich Sie jetzt damit aufziehen darf, wann immer wir uns begegnen, und nichts auf der Welt fördert die Vertrautheit so sehr.«
Sie tanzten wieder, und als die Geselligkeit endete, trennten sie sich zumindest seitens der Dame mit einer entschiedenen Neigung, die Bekanntschaft fortzusetzen. Ob sie wohl hinreichend an ihn dachte, während sie ihren warmen, mit Wasser verdünnten Wein trank und sich fürs Bett fertigmachte, um, wenn sie einmal darin lag, von ihm zu träumen? Allenfalls in einem leichten Halbschlaf oder Morgenschlummer, hoffe ich; denn wenn es sich so verhält, wie ein gefeierter Schriftsteller behauptet8, und keine junge Dame das Recht hat, sich zu verlieben, ehe nicht der Gentleman sich ihr erklärt, dann schickt es sich erst recht nicht für sie, von ihm zu träumen, ehe nicht feststeht, daß auch der Gentleman schon von ihr träumt. Ob Mr.Tilney so träumte oder sich verliebte, wie es sich schickt, darüber hatte sich Mr.Allen vermutlich noch keine Gedanken gemacht; daß aber als Bekannten seiner jungen Schutzbefohlenen grundsätzlich nichts gegen ihn sprach, wußte er bereits, denn er hatte zu Beginn des Abends Erkundigungen über ihren Tanzpartner eingeholt und in Erfahrung gebracht, daß Mr.Tilney Geistlicher war und aus einer sehr angesehenen Familie in Gloucestershire stammte.
IV. KAPITEL
Mit mehr Eifer als sonst eilte Catherine tags darauf in die Trinkhalle, und so sicher war sie sich, dort vor Ablauf des Vormittags auf Mr.Tilney zu treffen, daß sie das Begrüßungslächeln gleichsam schon auf den Lippen trug: – doch kein Lächeln war vonnöten – Mr.Tilney tauchte nicht auf. Jeder in Bath, jeder außer ihm, ließ sich während der gängigen Zeit früher oder später in der Halle blicken, Scharen von Menschen betraten oder verließen sie unablässig, stiegen die Treppen hinauf und hinunter, Menschen, nach denen keiner fragte und die keiner sehen mochte; und nur er fehlte. »Was für ein wunderbarer Ort ist doch Bath«, sagte Mrs.Allen, als sie bis zur Erschöpfung auf und ab promeniert waren und sich bei der großen Uhr niederließen, »und wie schön wäre es, hier irgendwelche Bekannten zu haben.«
Diese Sehnsucht war schon so oft vergeblich geäußert worden, daß Mrs.Allen kaum hoffen durfte, sie diesmal erfüllt zu sehen; doch »ohne Fleiß kein Preis«, wie der alte Spruch besagt, und der beispiellose Fleiß, mit dem sie jeden Tag das gleiche herbeigewünscht hatte, warf nun zu guter Letzt seinen gerechten Lohn ab. Sie hatte noch nicht zehn Minuten gesessen, als eine Dame etwa in ihrem Alter, die gleich neben ihr saß und sie mehrere Minuten lang gespannt betrachtet hatte, sie sehr höflich mit folgenden Worten ansprach: – »Ich glaube nicht, daß ich mich täusche, Madam; es ist lange her, daß ich zuletzt das Vergnügen hatte, aber ist Ihr Name nicht Allen?« Die Frage wurde bereitwilligst bejaht, worauf die Fremde sich mit Thorpe vorstellte, und schon erkannte Mrs.Allen die Züge einer einstigen Schulkameradin und Busenfreundin, die sie seit ihrer beider Verehelichung nur einmal getroffen hatte, und das vor vielen Jahren. Der Wiedersehensjubel war erwartungsgemäß groß, nachdem sie fünfzehn Jahre bestens ohne einander ausgekommen waren. Wechselseitige Komplimente über ihr gutes Aussehen folgten; und als sie einander überdies bestätigt hatten, wie die Zeit seit damals dahingeflogen war, wie wenig sie damit gerechnet hatten, sich in Bath zu begegnen, und welche Freude es war, eine so alte Freundin wiederzutreffen, begannen sie von ihren Familien, Schwestern und Kusinen zu sprechen, beide gleichzeitig und beide weit mehr dazu geneigt, Auskunft zu erteilen als zu erhalten, so daß keine groß auf die andere hörte. Mrs.Thorpe war jedoch gegenüber Mrs.Allen erzählerisch insofern im Vorteil, als sie Kinder hatte; und als sie nun von der Begabung ihrer Söhne und der Schönheit ihrer Töchter anfing – als sie von ihren jeweiligen Tätigkeiten und Zukunftsaussichten berichtete – daß John in Oxford sei, Edward an der Merchant-Taylors-School und William auf See und ein jeder an seinem Platz beliebter und geachteter als irgendwelche anderen drei Wesen sonstwo auf Gottes Erdboden –, konnte Mrs.Allen mit nichts kontern, konnte keine ähnlichen Triumphe in das ungeneigte und ungläubige Ohr ihrer Freundin träufeln, sondern mußte notgedrungen dasitzen und diese mütterlichen Schwelgereien über sich ergehen lassen, wobei freilich ihr scharfes Auge schon bald die trostreiche Entdeckung machte, daß die Spitze an Mrs.Thorpes Umhang nicht halb so hübsch war wie die an dem ihrigen.
»Hier kommen meine lieben Mädchen«, rief Mrs.Thorpe und zeigte auf drei schick aussehende Frauenspersonen, die Arm in Arm auf sie zusteuerten. »Meine liebe Mrs.Allen, ich muß sie Ihnen unbedingt vorstellen; sie werden so entzückt sein, Sie kennenzulernen. Die Große ist Isabella, meine Älteste – ist sie nicht ein Bild von einer jungen Frau? Die anderen kommen auch sehr gut an, aber ich meine doch, daß Isabella die hübscheste ist.«
Die Miss Thorpes wurden vorgestellt, und ebenso Miss Morland, die für ein Weilchen in Vergessenheit geraten war. Beim Klang ihres Namens schienen sie alle aufzuhorchen; und nach einer sehr verbindlichen Begrüßung bemerkte die älteste der jungen Damen laut zu den anderen: »Wie unglaublich ähnlich Miss Morland ihrem Bruder sieht!«
»Wie aus dem Gesicht geschnitten!« rief die Mutter – und »Ich hätte sie überall als seine Schwester erkannt!« wurde von ihnen allen zwei- oder dreimal wiederholt. Einen Moment lang stutzte Catherine; aber Mrs.Thorpe und ihre Töchter hatten kaum Atem geholt, um zu berichten, woher sie Mr.James Morland kannten, als ihr schon einfiel, daß ihr ältester Bruder seit kurzem mit einem jungen Mann aus seinem College befreundet war, der Thorpe hieß, und daß er die letzte Woche der Weihnachtsferien bei dessen Familie nahe London verbracht hatte.
Nachdem all dies geklärt war, bekam sie von den Miss Thorpes viele nette Dinge gesagt, des Inhalts, daß man sich unbedingt näher kennenlernen müsse, da ja die Freundschaft der Brüder sie schon quasi zu Freundinnen mache, und einiges andere mehr, das Catherine freudig vernahm und mit so wohlgesetzten Worten erwiderte, wie sie es nur vermochte; und als ersten Beweis guten Einvernehmens wurde sie umgehend aufgefordert, sich doch bei der ältesten Miss Thorpe einzuhängen und mit ihr durch die Halle zu wandeln. Catherine war entzückt über diese Ausweitung ihrer Bather Bekanntschaft und vergaß über den Plaudereien mit Miss Thorpe beinahe Mr.Tilney. Freundschaft ist wahrlich der beste Balsam für die Wunden, die die Liebe schlägt.
Ihre Unterhaltung kreiste um all die Themen, deren freimütige Erörterung zuverlässig für eine schnelle Vertrautheit zwischen zwei jungen Damen sorgt, nämlich Kleider, Bälle, Liebeleien und Laffen. Hier befand sich Miss Thorpe, die vier Jahre älter als Miss Morland und um mindestens vier Jahre erfahrener war, allerdings ganz entschieden im Vorteil: sie konnte die Bälle in Bath mit denen in Tunbridge vergleichen und den Bather Stil mit dem Londoner Stil, sie konnte ihre neue Freundin von vielen irrigen Annahmen in Detailfragen modischen Geschmacks befreien, konnte hinter einem einzigen Lächeln, das eine Dame und ein Herr tauschten, eine Liebelei erkennen und eine lächerliche Erscheinung auch im ärgsten Gedränge ausmachen. Solche Fähigkeiten stießen auf gebührende Bewunderung bei Catherine, der sie vollkommen neu waren; und der Respekt, den sie ihr naturgemäß abnötigten, hätte einem unbefangenen Umgang im Weg stehen können, hätten nicht Miss Thorpes ungezwungene Fröhlichkeit und ihre zahlreichen Freudenbekundungen angesichts der Bekanntschaft die Ehrfurcht erheblich abgeschwächt und nichts übriggelassen als wärmste Zuneigung. Ihrer wachsenden Verbundenheit war mit einem halben Dutzend Runden durch die Trinkhalle nicht Genüge getan, nein, als sie alle miteinander aufbrachen, mußte Miss Thorpe Miss Morland auch noch bis vor Mr.Allens Haustür begleiten; und mit einem langen, liebevollen Händedruck nahmen sie Abschied voneinander, nicht ohne vorher zu ihrer beiderseitigen Erleichterung festgestellt zu haben, daß sie sich gleich am Abend quer durchs Theater wiedersehen würden und am Morgen darauf in der Kirche. Danach lief Catherine eilig in den Salon hinauf, um der entschwindenden Miss Thorpe vom Fenster aus nachzublicken – ihren graziösen Schritt und die Eleganz ihrer Figur und ihres Gewandes zu bewundern und sich zu Recht glücklich zu preisen für diese Fügung, die ihr eine solche Freundin beschert hatte.
Mrs.Thorpe war eine Witwe, und keine sehr reiche; sie war eine gutmütige, wohlmeinende Frau und die nachsichtigste Mutter. Ihre älteste Tochter besaß ein bildschönes Äußeres, und die Jüngeren taten, als wären sie ebenso hübsch wie die Schwester, ahmten ihr Auftreten nach, kleideten sich wie sie und fuhren damit sehr gut.
Dieser kurze Überblick über die Familie soll uns die umfang- und blumenreiche Schilderung vergangener Abenteuer und Schicksalsschläge aus Mrs.Thorpes eigenem Mund ersparen, die andernfalls leicht die nächsten drei bis vier Kapitel füllen würde, wobei es ausführlichst um die Nichtswürdigkeit von Lords und Advokaten ginge und wir Gespräche, die schon zwanzig Jahre zurückliegen, Wort für Wort wiederholt bekämen.
V. KAPITEL
Abends im Theater war Catherine nicht so ausschließlich damit beschäftigt, Miss Thorpes Nicken und Lächeln zu erwidern (auch wenn ein beträchtlicher Teil ihrer Zeit darüber hinging), daß sie deswegen vergessen hätte, in jeder Loge, die ihr Blick erreichte, mit Adleraugen nach Mr.Tilney zu spähen; aber sie spähte vergebens. Mr.Tilney hatte fürs Schauspiel nicht mehr übrig als für die Trinkhalle. Sie sagte sich, daß der nächste Tag mehr Glück bringen würde; und als ihre Hoffnung auf gutes Wetter sich erfüllte und sie in einen strahlenden Morgen hinaussah, glaubte sie sich schon am Ziel ihrer Wünsche, denn ein schöner Sonntag in Bath lockt die Bewohner sämtlicher Häuser ins Freie, und alle Welt scheint sich aufzumachen, um Freunden und Bekannten zu versichern, welch ein prachtvoller Tag es doch sei.
Kaum war der Gottesdienst aus, taten die Thorpes und die Allens sich zusammen; und nachdem sie lange genug durch die Trinkhalle flaniert waren, um festzustellen, daß das Gedränge unerträglich und nur der Pöbel unterwegs war – eine Feststellung, wie sie jeder an jedem Sonntag unter der Saison wieder macht –, begaben sie sich eilends zum Crescent, um die frische Luft besserer Gesellschaft zu atmen. Hier schwelgten Catherine und Isabella, Arm in Arm und ungehemmt plaudernd, erneut in den Wonnen der Freundschaft – redeten viel und höchst angeregt; doch Catherines Hoffnung, ihren Tanzpartner wiederzusehen, wurde auch diesmal enttäuscht. Er war nirgendwo zu entdecken; alles Suchen nach ihm blieb gleichermaßen erfolglos; weder bei Matineen noch bei Soireen, weder in den Upper noch in den Lower Rooms, in keinem Salon, keinem Ballsaal fand sich eine Spur von ihm; er machte keinen Vormittagsspaziergang, er ritt nicht, er lenkte kein Kabriolett. Sein Name stand nicht im Meldebuch der Trinkhalle, und mehr konnte die Neugier nicht tun. Er mußte aus Bath abgereist sein. Aber er hatte doch mit keiner Silbe erwähnt, daß er nur so kurz bleiben wollte! Diese Rätselhaftigkeit, die wohl jedem Helden gut zu Gesicht steht, verlieh seiner Person und seinem Auftreten in Catherines Phantasie zusätzlichen Reiz und verstärkte ihren Drang, mehr über ihn zu erfahren. Von den Thorpes waren keine Aufschlüsse zu erwarten, denn sie waren erst zwei Tage vor ihrer Begegnung mit Mrs.Allen in Bath eingetroffen. Dennoch war er ein großes Thema zwischen ihr und ihrer schönen Freundin, die sie in jeder nur vorstellbaren Weise dazu ermutigte, auch weiterhin an ihn zu denken; und so erhielt der Eindruck, den er in ihrem Gemüt hinterlassen hatte, keine Gelegenheit, sich abzuschwächen. Isabella war sich ganz sicher, daß er ein bezaubernder junger Mann sein mußte, und ebenso sicher, daß er entzückt von ihrer lieben Catherine war und daher schon bald zurückkehren würde. Daß er Geistlicher war, nahm sie nur noch mehr für ihn ein, denn sie habe »nun einmal eine Schwäche für diesen Beruf, leider Gottes«; und eine Art Seufzen entfuhr ihr, als sie es sagte. Vielleicht tat Catherine unrecht daran, dieser zarten Gefühlsregung nicht nachzugehen – aber sie war zu ungeübt in den Feinheiten der Liebe oder den Pflichten der Freundschaft, um zu wissen, wann sanftes Hänseln geboten war oder wann einem Bekenntnis nachgeholfen sein wollte.
Mrs.Allen war jetzt durch und durch glücklich – durch und durch zufrieden mit Bath. Sie hatte Bekannte gefunden, in Gestalt einer trefflichen alten Freundin und auch noch deren Familie; und um ihr Glück vollkommen zu machen, waren diese Bekannten längst nicht so kostspielig gekleidet wie sie. Ihr täglicher Ausruf lautete nun nicht mehr: »Ich wünschte, wir hätten einen großen Bekanntenkreis hier in Bath!« Jetzt hieß es statt dessen: »Wie froh bin ich, daß wir Mrs.Thorpe getroffen haben!«, und sie förderte den Umgang zwischen den Familien fast noch eifriger als ihre junge Schutzbefohlene und Isabella selbst. Kein Tag durfte vergehen, ohne daß sie und Mrs.Thorpe den Großteil desselben Seite an Seite verbrachten, im Gespräch, wie sie sagten – wobei dieses Gespräch weitgehend ohne Meinungsaustausch auskam und meist auch ohne einen rechten Gegenstand, denn Mrs.Thorpe redete fast nur von ihren Kindern und Mrs.Allen fast nur von ihren Kleidern.
Die Freundschaft zwischen Catherine und Isabella entwickelte sich so zügig, wie es ihrem herzlichen Anfang entsprach, und so blitzschnell durchliefen sie sämtliche Stufen wachsender Zuneigung, daß es bald keine neuen Liebesbeweise mehr gab, die sie ihren Mitmenschen oder sich selbst hätten liefern können. Sie nannten einander beim Vornamen, gingen überall Arm in Arm, steckten einander beim Ball die Schleppe hoch und tanzten immer in derselben Reihe; und wenn ein verregneter Morgen ihnen sonstige Lustbarkeiten verwehrte, ließen sie es sich nicht nehmen, trotz Nässe und Schmutz zusammenzukommen, und schlossen sich miteinander ein, um Romane zu lesen. Ja, Romane, denn ich verweigere mich jener unrühmlichen und unklugen, unter Romanschreibern so verbreiteten Sitte, durch ihr verächtliches Urteil eben die Werke zu schmähen, deren Zahl sie doch selbst vermehren helfen – sie mit so harschen Beiwörtern zu belegen, wie sonst nur ihre ärgsten Feinde dies tun, und es kaum je zuzulassen, daß ihre eigene Heldin sie liest – die, fällt ihr zufällig ein Roman in die Hände, unfehlbar voll Abscheu über das fade Geschreibsel hinwegblättert. Ach! Wenn nicht eine Romanheldin in der anderen eine Fürsprecherin findet, auf wessen Schutz und Wertschätzung soll sie dann hoffen? Nein, ich kann das nicht billigen. Überlassen wir es den Kritikern, über die Gebilde unserer Vorstellungskraft herzufallen und sich anläßlich jedes neuen Romans in abgedroschenen Phrasen über das hohle Geschwätz zu erregen, an dem unsere heutige Presse krankt. Halten wir zusammen; alle miteinander stehen wir unter Beschuß! Obgleich unser Schaffen umfassendere und aufrichtigere Freuden bereitet als das jeder anderen literarischen Zunft auf der Welt, ist doch kein Genre so in Verruf gebracht worden. Sei es Dünkel, Unwissenheit oder einfach die Mode, unsere Gegner sind beinahe so zahlreich wie unsere Leser. Und während tausend Federn das Verdienst des Mannes besingen, der als Neunhundertster eine »Geschichte Englands« kompiliert oder in einem Bändchen ein paar Dutzend Zeilen von Milton, Pope und Prior versammelt und sie mit einem Artikel aus dem Spectator und einem Kapitel von Sterne herausgibt, scheinen sich nahezu alle einig in dem Wunsch, die Fähigkeiten des Romanschreibers in Abrede zu stellen, seine Leistung unterzubewerten und generell jene Werke geringzuschätzen, die sich durch nichts hervortun als durch Talent, Geist und Geschmack. »Romane sind nichts für mich – Ich schlage nur ganz selten einen auf – Denken Sie bloß nicht von mir, daß ich oft Romane lese – Für einen Roman mag so etwas noch angehen.« – Diese Leier tönt aus aller Munde. – »Was lesen Sie denn da, Miss – –?« »Ach, nur einen Roman«, erwidert die junge Dame und legt mit gespielter Gleichgültigkeit oder jäh aufwallender Scham ihr Buch beiseite. – »Das ist nur Cecilia, oder Camilla, oder Belinda«9 – kurzum, nur irgendeins dieser Werke, in denen sich die höchsten Kräfte des Geistes offenbaren und der Welt in geschliffenster Sprache tiefgreifendste Kenntnis der menschlichen Natur, gelungenste Schilderungen ihrer vielfältigen Spielarten und lebhafteste Ergüsse von Witz und Humor darbieten. Wäre nun selbige junge Dame in der Lektüre des Spectator begriffen, wie stolz würde sie dann ihr Buch herzeigen und seinen Titel nennen; auch wenn ihr kaum vergönnt sein dürfte, einen Teil dieser umfänglichen Publikation vor sich zu haben, der eine junge Frau




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)