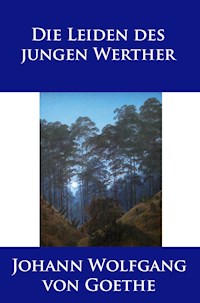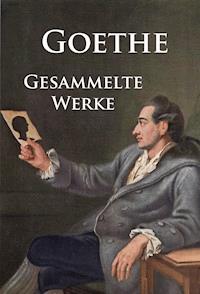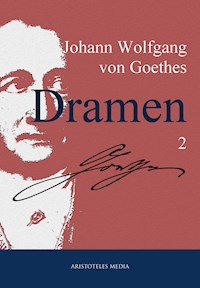0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Mit einem furchtbaren Schock endet ein Ausflug ins Gebirge: Plötzlich taucht ein entlaufenes Raubtier auf, ein zweites ist nicht weit. Angst und Panik lassen nur einen einzigen Gedanken zu: Die Tiere müssen auf der Stelle getötet werden. Gibt es wirklich kein anderes Mittel? Ist Gewalt die einzige Lösung? Orpheus kannte doch noch eine andere Methode… Eine zarte, poetische Erzählung über die Macht der Kunst, die Gegensätze versöhnen und die elementaren Kräfte der Natur zähmen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 74
Ähnliche
Johann Wolfgang Goethe
Novelle
Fischer e-books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Zur Poetik der Novelle
Es kam sodann zur Sprache, welchen Titel man der Novelle geben solle; wir taten manche Vorschläge, einige waren gut für den Anfang, andere gut für das Ende, doch fand sich keiner, der für das Ganze passend und also der rechte gewesen wäre. »Wissen Sie was«, sagte Goethe, »wir wollen es die Novelle nennen; denn was ist eine Novelle anders als eine sich ereignete unerhörte Begebenheit. Dies ist der eigentliche Begriff, und so vieles, was in Deutschland unter dem Titel Novelle geht, ist gar keine Novelle, sondern bloß Erzählung oder was Sie sonst wollen. […]«
J. W. Goethe: Gespräche mit Eckermann, 25. Januar 1827
Eine starke Silhoutte – um nochmals einen Ausdruck der Malersprache zu Hülfe zu nehmen – dürfte dem, was wir im eigentlichen Sinne Novelle nennen, nicht fehlen, ja wir glauben, die Probe auf die Trefflichkeit eines novellistischen Motivs werde in den meisten Fällen darin bestehen, ob der Versuch gelingt, den Inhalt in wenige Zeilen zusammenzufassen, in der Weise, wie die alten Italiener ihren Novellen kurze Überschriften gaben, die dem Kundigen schon im Keim den spezifischen Wert des Themas verraten. Wer, der im Boccaz die Inhaltsangabe der 9ten Novelle des 5ten Tages liest:
»Federigo degli Alberighi liebt, ohne Gegenliebe zu finden; in ritterlicher Werbung verschwendet er all seine Habe und behält nur noch einen einzigen Falken; diesen, da die von ihm geliebte Dame zufällig sein Haus besucht und er sonst nichts hat, ihr ein Mahl zu bereiten, setzt er ihr bei Tische vor. Sie erfährt, was er getan, ändert plötzlich ihren Sinn und belohnt seine Liebe, indem sie ihn zum Herrn ihrer Hand und ihres Vermögens macht« – wer erkennt nicht in diesen wenigen Zeilen alle Elemente einer rührenden und erfreulichen Novelle, in der das Schicksal zweier Menschen durch eine äußere Zufallswendung, die aber die Charaktere tiefer entwickelt, aufs Liebenswürdigste sich vollendet? Wer, der diese einfachen Grundzüge einmal überblickt hat, wird die kleine Fabel je wieder vergessen, zumal wenn er sie nun mit der ganzen Anmut jenes im Ernst wie in der Schalkheit unvergleichlichen Meisters vorgetragen findet.
Wir wiederholen es: eine so einfache Form wird sich nicht für jedes Thema unseres vielbrüchigen modernen Kulturlebens finden lassen. Gleichwohl aber könnte es nicht schaden, wenn der Erzähler auch bei dem innerlichsten oder reichsten Stoff sich zuerst fragen wollte, wo »der Falke« sei, das Spezifische, das diese Geschichte von tausend anderen unterscheidet.
Paul Heyse: Einleitung zu »Deutscher Novellenschatz« (1871)
Die Novelle, wie sie sich in neuerer Zeit, besonders in den letzten Jahrhunderten, ausgebildet hat und jetzt in einzelnen Dichtungen in mehr oder minder vollendeter Durchführung vorliegt, eignet sich zur Aufnahme auch des bedeutendsten Inhalts, und es wird nur auf den Dichter ankommen, auch in dieser Form das Höchste der Poesie zu leisten. Sie ist nicht mehr, wie einst, »die kurzgehaltene Darstellung einer durch ihre Ungewöhnlichkeit fesselnden und einen überraschenden Wendepunkt darbietenden Begebenheit«; die heutige Novelle ist die Schwester des Dramas und die strengste Form der Prosadichtung. Gleich dem Drama behandelt sie die tiefsten Probleme des Menschenlebens; gleich diesem verlangt sie zu ihrer Vollendung einen im Mittelpunkt stehenden Konflikt, von welchem aus das Ganze sich organisiert, und demzufolge die geschlossenste Form und die Ausscheidung alles Unwesentlichen; sie duldet nicht nur, sie stellt auch die höchsten Forderungen der Kunst.
Dass die epische Prosadichtung sich in dieser Weise gegipfelt und gleichsam die Aufgabe des Dramas übernommen hat, ist nicht eben schwer erklärlich, […] aber was solcherweise der dramatischen Schwester entzogen wurde, ist der epischen zugute gekommen.
Theodor Storm: Eine zurückgezogene Vorrede (1881)
Ich glaube auch, dass es besser ist, wenn Sie Ihre Vorrede an der geplanten Stelle weglassen, da die Küchenrezepte nicht zu den Gastgerichten auf die Tafel gehören. Für meine Person habe ich halbwegs vor, dergleichen Aufsätze und Expektorationen extra zu verfassen und eines Tages für sich herauszugeben, sozusagen als Altersarbeit. Vielleicht könnten Sie auch Ihre Arbeit nebenbei in einer Zeitschrift erscheinen lassen, mit einer Einleitung oder Anmerkung. Vorenthalten sollte sie keineswegs bleiben.
Was die fragliche Materie selbst betrifft, so halte ich dafür, dass es für Roman und Novelle so wenig aprioristische Theorien und Regeln gibt als für die andern Gattungen, sondern dass sie aus den für mustergültig anzusehenden Werken werden abgezogen, respektive dass die Werte und Gebietsgrenzen erst noch abgesteckt werden müssen. Das Werden der Novelle, oder was man so nennt, ist ja noch immer im Fluss; inzwischen wird sich auch die Kritik auf Schätzung des Geistes beschränken müssen, der dabei sichtbar wird. Das Geschwätz der Scholiarchen aber bleibt Schund, sobald sie in die lebendige Produktion eingreifen wollen.
Gottfried Keller: Brief an Theodor Storm, 14./16. August 1881
Novelle
Ein dichter Herbstnebel verhüllte noch in der Frühe die weiten Räume des fürstlichen Schlosshofes, als man schon mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pferde und zu Fuß durcheinander bewegt sah. Die eiligen Beschäftigungen der Nächsten ließen sich erkennen: man verlängerte, man verkürzte die Steigbügel, man reichte sich Büchse und Patrontäschchen, man schob die Dachsranzen zurecht, indes die Hunde ungeduldig am Riemen den Zurückhaltenden mit fortzuschleppen drohten. Auch hie und da gebärdete ein Pferd sich mutiger, von feuriger Natur getrieben oder von dem Sporn des Reiters angeregt, der selbst hier in der Halbhelle eine gewisse Eitelkeit, sich zu zeigen, nicht verleugnen konnte. Alle jedoch warteten auf den Fürsten, der, von seiner jungen Gemahlin Abschied nehmend, allzu lange zauderte.
Erst vor kurzer Zeit zusammen getraut, empfanden sie schon das Glück übereinstimmender Gemüter; beide waren von tätig lebhaftem Charakter, eines nahm gern an des andern Neigungen und Bestrebungen Anteil. Des Fürsten Vater hatte noch den Zeitpunkt erlebt und genutzt, wo es deutlich wurde, dass alle Staatsglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schaffen jeder nach seiner Art erst gewinnen und dann genießen sollte.
Wie sehr dieses gelungen war, ließ sich in diesen Tagen gewahr werden, als ebender Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern durch das Gewimmel der aufgehäuften Waren zu Pferde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das Gebirgsland mit dem flachen Lande einen glücklichen Umtausch treffe; er wusste sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länderkreises aufmerksam zu machen.
Wenn sich nun der Fürst fast ausschließlich in diesen Tagen mit den Seinigen über diese zudringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch auch der Landjägermeister sein Recht, auf dessen Vorstellung es unmöglich war, der Versuchung zu widerstehen, an diesen günstigen Herbsttagen eine schon verschobene Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen angekommenen Fremden ein eignes und seltnes Fest zu eröffnen.
Die Fürstin blieb ungern zurück; man hatte sich vorgenommen, weit in das Gebirg hineinzudringen, um die friedlichen Bewohner der dortigen Wälder durch einen unerwarteten Kriegszug zu beunruhigen.
Scheidend versäumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleit Friedrichs, des fürstlichen Oheims, unternehmen sollte. »Auch lasse ich«, sagte er, »dir unsern Honorio als Stall- und Hofjunker, der für alles sorgen wird.« Und im Gefolg dieser Worte gab er im Hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nötigen Aufträge, verschwand sodann bald mit Gästen und Gefolge.
Die Fürstin, die ihrem Gemahl noch in den Schlosshof hinab mit dem Schnupftuch nachgewinkt hatte, begab sich in die hintern Zimmer, welche nach dem Gebirg eine freie Aussicht ließen, die um desto schöner war, als das Schloss selbst von dem Flusse herauf in einiger Höhe stand und so vor- als hinterwärts mannigfaltige bedeutende Ansichten gewährte. Sie fand das treffliche Teleskop noch in der Stellung, wo man es gestern Abend gelassen hatte, als man, über Busch, Berg und Waldgipfel die hohen Ruinen der uralten Stammburg betrachtend, sich unterhielt, die in der Abendbeleuchtung merkwürdig hervortraten, indem alsdann die größten Licht- und Schattenmassen den deutlichsten Begriff von einem so ansehnlichen Denkmal alter Zeit verleihen konnten. Auch zeigte sich heute früh durch die annähernden Gläser recht auffallend die herbstliche Färbung jener mannigfaltigen Baumarten, die zwischen dem Gemäuer ungehindert und ungestört durch lange Jahre emporstrebten. Die schöne Dame richtete jedoch das Fernrohr etwas tiefer nach einer öden, steinigen Fläche, über welche der Jagdzug weggehen musste; sie erharrte den Augenblick mit Geduld und betrog sich nicht: denn bei der Klarheit und Vergrößerungsfähigkeit des Instruments erkannten ihre glänzenden Augen deutlich den Fürsten und den Oberstallmeister; ja sie enthielt sich nicht, abermals mit dem Schnupftuche zu winken, als sie ein augenblickliches Stillhalten und Rückblicken mehr vermutete als gewahr ward.