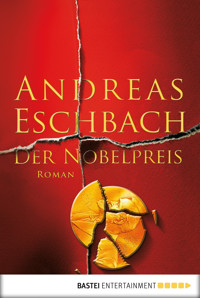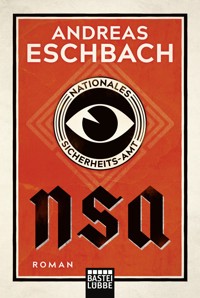
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Weimar 1942: Die Programmiererin Helene arbeitet im NSA, dem Nationalen-Sicherheitsamt, und entwickelt dort Komputer-Programme, mit deren Hilfe alle Bürger überwacht werden. Erst als die Liebe ihres Lebens Fahnenflucht begeht und untertauchen muss, widersetzt Helene sich. Dabei muss sie nicht nur gegen das Regime kämpfen, sondern auch gegen ihren Vorgesetzten Lettke, der die perfekte Überwachungstechnik des Staates für ganz eigene Zwecke benutzt und dabei zunehmend jede Grenze überschreitet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumVorspannKapitel 1InterviewÜber dieses Buch
Sie wissenALLES, was du tust!
XXL-Leseprobe zu Andreas Eschbachs »NSA - Nationales Sicherheits-Amt«:
Weimar 1942: Die Programmiererin Helene arbeitet im NSA, dem Nationalen-Sicherheitsamt, und entwickelt dort Komputer-Programme, mit deren Hilfe alle Bürger überwacht werden. Erst als die Liebe ihres Lebens Fahnenflucht begeht und untertauchen muss, widersetzt Helene sich. Dabei muss sie nicht nur gegen das Regime kämpfen, sondern auch gegen ihren Vorgesetzten Lettke, der die perfekte Überwachungstechnik des Staates für ganz eigene Zwecke benutzt und dabei zunehmend jede Grenze überschreitet ...
Diese Leseprobe enthält außerdem noch ein Interview mit Andreas Eschbach über seinen neuen Roman »NSA - Nationales Sicherheits-Amt«.
Über den Autor
Andreas Eschbach, geboren am 15.09.1959 in Ulm, ist verheiratet, hat einen Sohn und schreibt seit seinem 12. Lebensjahr. Er studierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Von 1993 bis 1996 war er geschäftsführender Gesellschafter einer EDV-Beratungsfirma.
Als Stipendiat der Arno-Schmidt-Stiftung »für schriftstellerisch hoch begabten Nachwuchs« schrieb er seinen ersten Roman »Die Haarteppichknüpfer«, der 1995 erschien und für den er 1996 den »Literaturpreis des Science-Fiction-Clubs Deutschland« erhielt. Bekannt wurde er vor allem durch den Thriller »Das Jesus-Video« (1998), der im Jahr 1999 drei literarische Preise gewann und zum Taschenbuchbestseller wurde. ProSieben verfilmte den Roman, der erstmals im Dezember 2002 ausgestrahlt wurde und Rekordeinschaltquoten bescherte. Mit »Eine Billion Dollar«, »Der Nobelpreis« und zuletzt »Ausgebrannt« stieg er endgültig in die Riege der deutschen Top-Thriller-Autoren auf. Nach über 25 Jahren in Stuttgart lebt Andreas Eschbach mit seiner Familie jetzt seit 2003 als freier Schriftsteller in der Bretagne.
ANDREASESCHBACH
Roman
XXL-Leseprobe
BASTEI ENTERTAINMENT
XXL-Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erscheinenden Werkes »NSA – Nationales Sicherheits-Amt« von Andreas Eschbach
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Dieses Werk wurde vermittelt durch dieLiterarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Copyright © 2018 by Andreas Eschbach
Hardcover-Ausgabe 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stefan Bauer
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © Ozen Guney/shutterstock.com; caesart/shutterstock.com; MaxyM/shutterstock.com; Antonina Tsyganko/shutterstock.com
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-6924-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Seit es Lord Charles Babbage im Jahre 1851 gelungen ist, seine – damals noch mit Dampf und Lochkarten betriebene – »Analytische Maschine« fertigzustellen, hat die maschinelle Verarbeitung von Informationen rasche Fortschritte gemacht, was wiederum die gesamte übrige technische Entwicklung wesentlich beschleunigt hat. Noch im Kaiserreich Wilhelms II. wird das Deutsche Netz eingerichtet, der Vorläufer des Weltnetzes, das auch im Weltkrieg 1914/17 eine bedeutende Rolle spielt, ohne jedoch dessen für Deutschland nachteiligen Ausgang verhindern zu können.
In der Weimarer Republik verbreitet sich das noch zu Kriegszeiten entwickelte tragbare Telephon rasch, ebenso die Nutzung der sogenannten Gemeinschaftsmedien, die auch eine wesentliche Rolle beim Aufstieg der NSDAP spielen. Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kommt, übernimmt seine Regierung unter anderem auch das Nationale Sicherheits-Amt in Weimar, das seit der Kaiserzeit die Aktivitäten des Weltnetzes überwacht und Zugriff auf alle Daten hat, die Bürger des Deutschen Reichs je erzeugt haben, seien es Kontobewegungen, Termine, Elektrobriefe, Tagebucheinträge oder Meinungsäußerungen im Deutschen Forum …
1
Das schwarze Telephon klingelte zum achten Mal an diesem Morgen.
Die Männer, die rings um den Schreibtisch saßen und warteten, wechselten angespannte Blicke. Schließlich nickten sie dem zu, der direkt vor dem Apparat saß, dem Jüngsten in der Runde, der hellbraune Locken hatte und Sommersprossen.
Der nahm ab. »Nationales Sicherheit-Amt, Engelbrecht am Apparat. Sie wünschen?«
Gleich darauf lächelte er, schaute in die Runde, während er der Stimme am anderen Ende der Leitung lauschte, und schüttelte beruhigend den Kopf. Entwarnung hieß das. Die anderen atmeten wieder auf.
»Ja, kein Problem«, sagte er dann und griff nach einem Bleistift. »Wie buchstabiert man das? L … i … p … Mmh. Mmh.« Er machte sich konzentriert Notizen, bis ihm einer der anderen, ein älterer Mann, der in einem Rollstuhl saß, ein Zeichen gab, indem er vernehmlich auf seine Armbanduhr klopfte. »Gut. Kriegen Sie im Lauf des Tages. Spätestens morgen. Nein, schneller geht es nicht, tut mir leid. Ja. Heil Hitler.« Er legte auf.
»Und?«, fragte der Mann im Rollstuhl.
»Anruf aus der Ostmark.« Er riss das oberste Blatt des Notizblocks ab. »Die Polizeidirektion Graz braucht das Bewegungsprofil eines gewissen Ferenc Lipovics.«
»Ostmark?« Der Mann im Rollstuhl hob die Augenbrauen.
Der junge Mann lief rot an. »Ich meinte natürlich das Reichsgau Steiermark.«
»Der Rudi hat uns so über, dass er lieber ins Lager geht«, spottete ein anderer, ein stiernackiger Mann mit Glatze.
»Nein, ich –«
Der Mann im Rollstuhl unterbrach das Geplänkel. »Die Zinkeisen soll sich darum kümmern«, bestimmte er. »Gustav, übernimmst du das?«
Der Angesprochene, der Einzige in der Runde, der eine Brille trug, nickte und streckte die Hand nach dem Blatt aus. »Ich geb’s ihr.«
Er verließ das Bureau. Die anderen sanken zurück in ihre Stühle und starrten wieder auf das Telephon, als wollten sie es hypnotisieren.
Zehn Minuten vergingen, ohne dass jemand ein Wort sagte. Der mit der Brille kam zurück, setzte sich wieder auf den Stuhl, auf dem er auch schon vorhin gesessen hatte, ein altes, dunkles Teil mit einem über die Jahre hart gewordenen Lederpolster, das beim Daraufsetzen seufzende Geräusche machte.
Dann klingelte das Telephon wieder.
»Neun«, sagte der mit der Glatze.
Der junge Mann legte die Hand auf den Hörer, atmete einmal durch, hob ab. »Nationales Sicherheits-Amt, Engelbrecht am –« Er hielt inne, lauschte. »Ja. Ja, verstehe. Danke. Ja. Heil Hitler.«
Er legte auf, sah in die Gesichter der anderen, schluckte. »Das war seine Sekretärin. Er ist unterwegs.«
Der Mann im Rollstuhl nickte ernst, setzte ein Stück zurück und wendete in Richtung der Tür. »Also«, sagte er. »Dann geht es los.«
***
Das Nationale Sicherheits-Amt war in einem trotz seiner beträchtlichen Größe unscheinbaren Gebäude im Zentrum Weimars untergebracht, nicht weit entfernt von jenem Hoftheater, in dem seinerzeit die verfassunggebende Deutsche Nationalversammlung getagt und eben den deutschen Staat aus der Taufe gehoben hatte, den man heute die Weimarer Republik nannte. Gegründet worden war das Amt jedoch lange davor, noch unter Wilhelm II., der, als die ersten Komputer zu einem Netzwerk zusammengeschaltet wurden, erkannt hatte, dass hieraus Gefahren für das Staatswesen erwachsen mochten und es demzufolge einer Einrichtung bedurfte, die hierüber die Aufsicht führte. So war das Kaiserliche Komputer-Kontrollamt entstanden, und dass dies in Weimar geschah, war in erster Linie dem Umstand geschuldet, dass Weimar so etwas wie den annähernd geographischen Mittelpunkt des Deutschen Reiches darstellte und folglich alle Leitungen hier am ökonomischsten zusammenlaufen konnten.
Als der Weltkrieg im Herbst 1917 mit der Niederlage Deutschlands zu Ende ging, war eine der vielen Sanktionen, welche die Siegermächte dem Reich auferlegten, die Aberkennung aller deutschen Patente, natürlich auch jener, die die Konstruktion von Komputern betrafen oder die während des Krieges entwickelte bewegliche Telephonie. Bis dahin hatte man im Rest der Welt Komputer als absonderliche Spielerei betrachtet, abgesehen von England natürlich, deren hochgezüchtete mechanische Analytical Engines bekanntlich die Vorreiter dieser Technologie waren: Die deutschen Rechenmaschinen entsprachen den englischen vom Prinzip her, nur wurden sie elektrisch betrieben. Doch nun hielt auch außerhalb Deutschlands die Komputertechnik Einzug, ohne dass Deutschland etwas dagegen hätte tun können oder einen Nutzen davon gehabt hätte, und dank der Tatsache, dass das Telephonnetz weltweit einheitlich funktionierte, wuchsen innerhalb kürzester Zeit die Komputernetze der verschiedenen Länder zu einem Gebilde zusammen, das man das Weltnetz nannte.
Es war kein Geringerer als Philipp Scheidemann, der erste Regierungschef der Weimarer Republik, der die Befugnisse und Aufgaben des Amtes neu ordnete. Er verfügte, dass es hinfort Nationales Sicherheits-Amt heißen sollte und dass seine Aufgabe darin bestand, genau wie zu Kaisers Zeiten die Datenströme im Netz der Komputer dahingehend zu beobachten, ob sich darin irgendeine Gefahr für Deutschland abzeichnete, nur dass dieses Netz sich inzwischen über den gesamten zivilisierten Teil des Globus erstreckte und das Netz der beweglichen Telephonie zusätzlich hinzugekommen war.
Die Regierung Adolf Hitlers hatte das NSA, dessen Existenz den meisten Deutschen völlig unbekannt war, aus der Weimarer Republik übernommen und sich seiner auch von Anfang an bedient, es als Einrichtung aber weitgehend unangetastet gelassen. Der Leiter des NSA, August Adamek, führte diesen im Hinblick auf den sonstigen Umgestaltungswillen der Reichsregierung erstaunlichen Umstand auf, wie er es nannte, »die Magie der Buchstaben« zurück: Offenbar gingen jene, die von der Existenz des NSA wussten, ohne weiteres davon aus, die Buchstaben NS stünden für »national-sozialistisch«, sahen mithin hier keinen Handlungsbedarf.
So waren die Mitarbeiter des NSA unbehelligt geblieben von all den Stürmen der Erneuerung, die über Deutschland hinwegbrausten, und auch weitgehend von den Belastungen, die der Krieg mit sich brachte, abgesehen davon, dass sich ihre Reihen nach und nach durch Einberufungen gelichtet hatten. In aller Stille und Bescheidenheit hatten sie ihre Pflicht erfüllt und all jene Einrichtungen des Staates mit Daten, Listen und Auswertungen versorgt, die solcher Dienste bedurften. Sie wussten alles, was vor sich ging, doch keiner von ihnen hatte jemals außerhalb des Amtes darüber geredet.
Heute war der Tag, an dem sich all das ändern mochte.
Denn der Krieg im Osten war in eine kritische Phase getreten. Die Öffentlichkeit wusste davon noch nichts, abgesehen von Gerüchten, die es immer gab, aber wer imNSAarbeitete, hatte naturgemäß den Überblick über alles, was im Reich geschah, womöglich einen besseren als der Reichskanzler und Führer selbst. Die führenden Mitglieder der Reichsregierung waren in einer Zeit aufgewachsen, in der Komputer noch keinen selbstverständlichen Teil des Alltags dargestellt hatten. Es war nicht ihre Schuld, dass sie kein wirkliches Gefühl für die Möglichkeiten besaßen, welche die Komputer eröffneten.
Doch das hinderte sie nicht daran, Entscheidungen zu treffen. Es war Aufgabe des Amtes, dafür zu sorgen, dass es die richtigen sein würden.
Was sie hatten vorbereiten können, war vorbereitet. Nun kam es nur noch darauf an, dass alles so gelang, wie sie es sich ausgedacht hatten.
***
Man schrieb den 5. Oktober 1942. Der Himmel war an diesem Montagmorgen so grau, als habe jemand eine gewaltige Glocke aus Blei über das Land gestülpt, und die hohen, schmalen Fenster des NSA-Gebäudes wirkten in dem diffusen Licht wie die Schießscharten einer abwehrbereiten Festung. Kein Lüftchen rührte sich. Die Straßen der Stadt lagen weitgehend verwaist, abgesehen von ein paar Fahrradfahrern, die mit eingezogenen Köpfen eilig ihres Weges strampelten. Entlang der Häuserwände sah man aufgestapelte Sandsäcke vor Kellerfenstern: eine reine Vorsichtsmaßnahme. Bis jetzt hatte es erst ein einziger Bomber des Feindes bis nach Weimar geschafft, und der hatte es nicht vermocht, großen Schaden anzurichten.
Endlich bogen drei schimmernd schwarze Mercedes-Benz-Limousinen des Typs 320 in die Straße ein und rollten in geradezu maschinenhaft präziser Formation die Auffahrt empor, um vor dem Portal zu halten, über dem die Hakenkreuzfahne schlaff und feucht herabhing. SS-Männer in schwarzen Uniformen stiegen aus, sahen sich mit ausdruckslosen, herrischen Gesichtern und raubtierhaften Blicken nach allen Seiten um. Dann öffnete einer von ihnen zackig den Wagenschlag auf der Beifahrerseite des mittleren Wagens, und ein Mann stieg aus, den jedermann sofort erkannt hätte, und sei es nur anhand seiner unverkennbaren runden Brille: Reichsführer SS Heinrich Himmler, der nach Adolf Hitler mächtigste Mann des Reiches.
Himmler trug einen schwarzen Ledermantel und schwarze Handschuhe, die er nun mit ungeduldigen Bewegungen auszog, während er das Gebäude vor sich betrachtete und insbesondere den über dem Portal eingemeißelten alten lateinischen Wahlspruch SCIENTIAPOTENTIAEST, dessen Anblick ihm ein missmutiges Stirnrunzeln entlockte. Die sonstige Umgebung war ihm keinen einzigen Blick wert.
In diesem Augenblick öffneten sich beide Flügel des Portals, mehr als vier Meter hohe Kassettentüren aus dunkler Eiche, und der stellvertretende Leiter des Amtes, Horst Dobrischowsky, trat ins Freie, um den hohen Gast zu begrüßen. Hinter ihm warteten alle Mitarbeiter, die nicht durch dringende Pflichten verhindert waren oder durch anderes, wie im Falle August Adameks, dessen Rollstuhl ins Foyer zu befördern mehr Umstände bereitet hätte, als sachdienlich gewesen wäre.
»Heil Hitler, Reichsführer«, rief Dobrischowsky, die Hand in vorbildlichster Weise zum deutschen Gruß erhoben. »Im Namen des gesamten Amtes darf ich Sie herzlich willkommen heißen.«
Himmlers Rechte zuckte nur kurz und nachlässig nach oben. »Schon gut«, meinte er unleidig, während er die drei Stufen der Treppe erklomm. »Ich habe wenig Zeit. Verschwenden wir sie nicht.«
***
Helene wischte zum bestimmt hundertsten Mal eine Staubfluse von einer der Bakelit-Kappen auf der Tastatur, die vor ihr auf dem Tisch stand. Sie liebte diese Tastatur, liebte das satte Geräusch, das beim Niederdrücken der Tasten entstand, liebte deren Leichtgängigkeit – und das solide Gefühl, das sie vermittelten. Wie sorgfältig jeder Buchstabe eingefräst war! Die weiße Farbe war trotz täglichen Gebrauchs noch kein bisschen abgenutzt, und dabei war die Tastatur bestimmt über zehn Jahre alt.
Solche Tastaturen wurden heutzutage gar nicht mehr hergestellt. Nicht nur wegen des Krieges, auch schon vorher nicht mehr.
Sie richtete sich auf, atmete durch, sah sich um. Ungewohnt, hier zu arbeiten, in dem Saal, in dem sonst Weihnachtsfeiern stattfanden oder Filmvorführungen oder wichtige Besprechungen, an denen nur die Männer teilnahmen. Es roch immer noch nach Jahrzehnte altem Zigarettenrauch, obwohl sie vergangene Woche jeden Tag gelüftet hatten, und nach Schweiß und Bier und verbranntem Staub. Der Tisch, auf dem ihr Komputer stand, war höher, als sie es gewohnt war, und auch der Stuhl war unpraktisch mit seinen Armlehnen.
Sie rutschte unbehaglich umher, zog ihr Kleid zurecht. Sie hatte ihr bestes Kleid angezogen, wie man es ihr gesagt hatte, und fühlte sich nun fehl am Platz, denn das trug sie sonst nur sonntags oder zu festlichen Anlässen. Aber sogar Herr Adamek, der Amtsleiter, der für gewöhnlich lediglich eine Strickweste über dem Hemd trug, hatte sich heute in einen Anzug gezwängt, also war es wirklich ernst.
Jemand öffnete die Tür. Helene fuhr herum, aber es war nur Engelbrecht, der hereingehumpelt kam.
Er nickte ihr zu. »Hallo, Fräulein Helene. Alles klar?«
Sie nickte beklommen. »Ich glaube schon.«
»Wird schon gut gehen«, meinte er unbekümmert, während er sich vergewisserte, dass der schwere Messingstecker fest in der Bildausgangsdose ihres Komputers saß.
Das dicke, stoffumwickelte Kabel lief einige Meter über den abgewetzten Linoleumboden und dann in den Projektor, der einsatzbereit auf einem anderen Tisch stand, direkt auf die Leinwand gerichtet. Der Lüfter surrte schon die ganze Zeit. Engelbrecht öffnete die seitliche Klappe, hinter der die Kohlen der Lichtbogenlampe in ihren Fassungen saßen.
»Ist er schon da?«, fragte Helene.
Engelbrecht nickte, überprüfte den festen Sitz der Kohlen und die Leichtgängigkeit der automatischen Nachführung. »Horst zeigt ihm gerade die Datenspeicher. Die übliche Tour, nur ein bisschen abgekürzt. Der Reichsführer hat nicht viel Zeit.«
»Gut«, sagte Helene. Dann würde es wenigstens bald ausgestanden sein. Sie hatte die vergangene Nacht kaum ein Auge zugetan vor Nervosität.
Wenn sie wenigstens Bescheid gewusst hätte, worum es überhaupt ging! Aber die Männer machten immer aus allem ein Geheimnis. Frauen sollten nicht mitdenken, sie sollten einfach nur programmieren, was man ihnen vorgab.
Engelbrecht schloss die Klappe zufrieden und ging wieder hinaus. Helene sank seufzend in sich zusammen. Wenn der Tag nur schon vorüber gewesen wäre!
Wieder ging die Tür. Im ersten Moment dachte sie, es sei Engelbrecht, der etwas vergessen hatte, aber er war es nicht, sondern Frau Völkers, ihre Chefin.
Auch das noch.
Rosemarie Völkers war eine magere, kleine Frau von fast sechzig Jahren, die älteste Mitarbeiterin im ganzen Amt, und sie hatte die Angewohnheit, sich mit Tippelschritten zu bewegen, bei denen Helene immer an eine Spinne denken musste, die sich einem in ihrem Netz zappelnden Opfer nähert. Es hieß, sie sei schon seit den Anfängen der Bewegung Mitglied der NSDAP, mit einer nur fünfstelligen Mitgliedsnummer, und seit der Machtergreifung hatte sie noch nie jemand ohne das »Bonbon«, das NSDAP-Parteiabzeichen, am Revers gesehen.
»Fräulein Bodenkamp«, sagte sie, als sie heran war, und spitzlippig wie immer, »ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich sehr hoffe, Ihre Programme rechtfertigen heute das Vertrauen, das Herr Adamek in Sie setzt.«
Helene starrte auf die Schreibmarke, das Einzige, was bis jetzt auf dem Bildschirm zu sehen war. Was konnte man auf eine solche Bemerkung schon erwidern?
»Ich habe alle Routinen getestet«, beteuerte sie. »Ich bin sicher, sie funktionieren alle korrekt.«
»Gut. Dass es ernste Konsequenzen für Sie hätte, wenn Ihre Routinen nichts finden, brauche ich Ihnen hoffentlich nicht zu erklären.«
Nein, dachte Helene. Das weiß ich auch so, du alte Hexe.
»Die Routinen«, sagte sie dann mit aller Ruhe, die sie aufbringen konnte, »können nur etwas finden, wenn auch etwas da ist.«
Die Völkers gab ein abfälliges Schnauben von sich. »Machen Sie sich nicht die Mühe, jetzt schon nach Ausreden zu suchen«, riet sie. »Ich werde keine akzeptieren.«
Damit drehte sie sich um, tippelte davon und verließ den Saal wieder. Helene atmete tief durch, beugte sich nach vorn und strich einmal mehr nervös über die alten, schwarzen Bakelit-Tasten.
***
Horst Dobrischowsky übernahm es, dem Reichsführer die hinteren Hallen zu zeigen, das eigentliche »Herz« des NSA. Ob das sein müsse, hatte Himmler zu ihrer aller Bestürzung gefragt, worauf ihm der stellvertretende Amtsleiter geistesgegenwärtig versicherte, dass es natürlich nicht unbedingt sein müsse, zum Verständnis dessen, was sie ihm zu präsentieren gedachten, aber doch unbedingt von Vorteil sei. »Na gut«, hatte Himmler gesagt, und so hatten sie den Weg nach hinten eingeschlagen, Dobrischowsky, Himmler und einer seiner Adjutanten, ein Mann mit messerscharfen Gesichtszügen und wässrig-grauen Augen, die wie tot wirkten.
Wozu die erste, ursprüngliche Halle einmal gedient haben mochte, ehe das NSA das Gebäude bezogen hatte, wusste niemand mehr so genau; die Vermutungen gingen dahin, dass sie zu Kaisers Zeiten ein Tanzsaal gewesen war. Dafür sprachen auch die gezierten Torbögen und die Stuckdecke, die vor Jahrzehnten sicher weiß gewesen waren.
Im Lauf der Zeit hatte man mehrmals erweitert, wobei man den Anbauten natürlich keine Stuckdecken mehr spendiert, sondern nüchterne Zweckbauten errichtet hatte, in denen genau wie vorne zahllose schlanke, aufrecht positionierte Zylinder in Reih und Glied standen wie eine Armee kupferfarbener Soldaten. Normalerweise schimmerten sie nicht so wie heute – für das einwandfreie Funktionieren war es unerheblich, ob das Kupfer der Hülle angelaufen war oder nicht –, aber im Hinblick auf den seit langem angekündigten Besuch des Reichsführers hatten die Putzfrauen in den letzten Wochen viel Muskelkraft und viel Zigarrenasche darauf verwendet, die Geräte auf Hochglanz zu polieren.
»Die besten Datensilos der Welt«, erklärte Dobrischowsky über das unablässige, verhaltene Surren und Klackern hinweg, das die Hallen erfüllte und klang, als nähere sich ein Schwarm hungriger Heuschrecken. Er legte die Hand neben das Signet der Firma Siemens, das auf jedem der Zylinder prangte. »Siemens DS-100. Um den Faktor zehntausend schneller als die Geräte vor dem Weltkrieg und um den Faktor eintausend kompakter.«
Bei einer normalen Führung hätte Dobrischowsky an dieser Stelle einige launige Vergleiche gebracht, wie viele Milliarden Informationseinheiten in einem solchen Silo gespeichert werden konnten, wie viele Leitz-Ordner voll es ergäbe, würde man sämtliche in diesen Hallen gelagerten Daten ausdrucken, wie viele Regale man dafür bräuchte und wie viel Stellfläche wiederum für die Regale: Man hätte damit nämlich jedes einzelne Haus in Weimar füllen können und dann immer noch eine Menge Ordner übrig gehabt.
Aber so desinteressiert, wie der Reichsführer dreinschaute, hatte Dobrischowsky das deutliche Gefühl, dass er besser daran tat, diesen Part ausfallen zu lassen.
Also sagte er nur: »Sie sehen hier praktisch ganz Deutschland in Form von Daten erfasst und abgebildet. Zum Zwecke der Auswertung haben wir darüber hinaus unmittelbaren Zugriff auf die zentralen Dienst-Komputer des Weltnetzes, die bekanntlich nach wie vor am …« Er hüstelte. Um ein Haar hätte er am ehemaligen Kaiserlichen Institut für Informationsverarbeitung gesagt. Macht der Gewohnheit. »Die in Berlin an der Universität stehen«, korrigierte er sich.
Himmler machte, die Hände hinter dem Rücken zusammengelegt, ein paar Schritte. »Nur Deutschland?«, fragte er.
Dobrischowsky räusperte sich. »Gemeint ist natürlich das ganze Reich. In seinen gegenwärtigen Grenzen.« Er hob die Hand, wies nach links. »Kommen Sie, ich kann Ihnen zeigen, wie das konkret aussieht.«
Er dirigierte den hohen Gast und seinen Begleiter in einen Nebenraum, ihren jüngsten Anbau: Sie hatten eine Garage dafür geopfert, die sie infolge der Reduzierung des Personalbestands seit Kriegsbeginn ohnehin nicht mehr benötigten. Hier war nichts mehr zu ahnen von der kupferfarbenen, Reichsparteitag-haften Symmetrie der anderen Hallen; stattdessen standen mehrere graue Kolosse nebeneinander, die aussahen wie gußeiserne Öltanks und dröhnten wie unrund laufende Düsentriebwerke. Jede der Maschinen war auf eine Weise, die nicht nur kompliziert aussah, sondern es auch war, mit dem hausinternen Netz verbunden: ein Knäuel aus grauen, stoffumwickelten Kabeln, selbst gefertigten Anschlussstücken und provisorisch mit Lochblechen ummantelten Schaltkreisen, die sie ebenfalls selbst entwickelt hatten. Für einige davon hatten sie sich mit alten Röhren behelfen müssen, deren rötlicher Widerschein die Kästen geheimnisvoll erhellte.
»Das sind beispielsweise die Datensilos, die nach der Besetzung Polens hergeschafft wurden«, erklärte Dobrischowsky. »Sie enthalten sämtliche Daten des polnischen Telephonnetzes sowie alle Einträge des Polnischen Forums bis zu dessen Stilllegung.«
Tatsächlich stammten die Silos aus englischer Fertigung, und zwar noch aus der Zeit, als die Engländer gerade erst damit begonnen hatten, elektronische Komputer zu bauen anstatt noch mehr ihrer dampfbetriebenen Analytical Engines. Die elektronische Industrie Polens war bei Kriegsbeginn noch vollauf damit beschäftigt gewesen, das Land mit Radiogeräten und Fernsehapparaten zu versorgen; man hätte sich überdies schwergetan, mit den englischen Schleuderpreisen für Komputer zu konkurrieren.
»Sämtliche Daten …«, wiederholte Himmler, und auf einmal ging so etwas wie ein Leuchten über sein Gesicht. »Das heißt, Sie waren das? Sie haben uns diese Berichte geschickt, wo wir die Widerständler finden?«
»Ja«, sagte Dobrischowsky. »Den meisten Menschen ist nicht klar, dass man über ihre Telephone jederzeit ihren Aufenthaltsort ermitteln kann.«
Himmler grinste, sah seinen Adjutanten an. Der meinte mit einem abfälligen Lächeln: »Die Zecken vom polnischen Widerstand haben das irgendwann schon kapiert. Aber da war es halt zu spät.«
Sie lachten beide. Dobrischowsky beließ es bei einem Lächeln, ein Lächeln der Erleichterung. Dass sich die Laune des Reichsführers zu bessern schien, war hoffentlich ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall schien er allmählich zu verstehen, was sie für das Vaterland zu tun imstande waren.
Zum ersten Mal an diesem Tag verspürte Dobrischowsky so etwas wie Zuversicht, dass ihr Plan Erfolg haben würde.
***
Eugen Lettke hatte die Toilette ganz für sich alleine, diesen viel zu großen, viel zu hohen, ungemütlich kalten, weiß gekachelten Raum, in dem es nach Desinfektionsmittel und Urin stank und in dem jedes Geräusch schrecklich laut widerhallte: Nicht nur die Wasserspülung, die klang, wie er sich die Niagarafälle vorstellte, nicht nur das Verriegeln der Klotür, das an zufallende Kerkergitter denken ließ, nein, auch jeder Schritt, den man tat, war überlaut zu hören, genau wie das Rascheln der Hose, die man herunterließ, selbst das bloße Aufknöpfen des Hosenschlitzes. Von den Geräuschen, die mit den eigentlichen »Geschäften« verbunden waren, ganz zu schweigen.
Es war schon gut, wenn man die Toilette für sich alleine hatte.
Im Moment quietschte nur der Wasserhahn, der noch aus einem anderen Jahrhundert stammte. Drei Waschbecken gab es, viel zu viele für die Anzahl der Männer, die noch im NSA arbeiteten. Der Wasserhahn am Becken ganz links tropfte unentwegt, und zwar schon, seit er hier arbeitete. Niemand fühlte sich dafür zuständig; er auch nicht.
Eugen Lettke hatte es nicht eilig. Er betrachtete sich im Spiegel, während er sorgsam einigen widerspenstigen Strähnen an seinem Kopf mit etwas kaltem Wasser Gehorsam beibrachte. Auch die Spitzen seines dünnen Oberlippenbärtchens konnten ruhig noch etwas spitzer werden.
Er studierte die Züge seines Gesichts – es war eine Gewohnheit, fast so etwas wie eine Obsession das zu tun, wann immer er sich in einem Spiegel gegenüberstand –, erinnerte sich daran, wie er ausgesehen hatte, als Kind und als Heranwachsender, und versuchte zu verstehen, was er an sich gehabt haben mochte, dass keines der Mädchen, in das er sich verliebt hatte, etwas mit ihm zu tun haben wollte. Das hatte er nie begriffen. Er war nicht hässlich, ganz gewiss nicht, und das war auch früher nicht anders gewesen. Andere hatten hässlicher ausgesehen und trotzdem Freundinnen gehabt, sogar dieser Kerl aus dem Nachbarhaus mit der Hasenscharte!
Früher hatte er darunter gelitten. Bis er dann eine größere, verzehrendere, seine eigentliche Leidenschaft entdeckt hatte. Seitdem war es nur noch Gewohnheit, darüber nachzudenken.
Außerdem war sein momentanes Problem nicht, wie sein Gesicht einmal ausgesehen hatte, sondern wie es heute aussah. Wenn er in den Spiegel blickte, sah er einen blonden, blauäugigen Mann vor sich, einen Arier, wie er im Schulbuch stand. Männer wie er hielten sich in diesen Tagen nicht im sicheren Heimatland auf, sondern kommandierten Panzerverbände an der Ostfront, dort, wo die Serie deutscher Siege ein Ende gefunden hatte. Männer wie er schossen oder wurden erschossen, und auf keins von beidem verspürte Eugen Lettke die geringste Lust. Dem deutschen Volk Lebensraum im Osten zu verschaffen war etwas, das ihn nicht die Bohne interessierte. Wenn andere dafür den Hals hinhalten wollten, so mochten sie das von ihm aus tun, solange sie ihn damit in Ruhe ließen.
Leider war ihm nur zu klar, dass sie ihn nicht in Ruhe lassen würden.
Bisher hatten ihn zwei Dinge vor der Einberufung geschützt: anfangs der Sachverhalt, dass er der einzige Sohn einer Kriegswitwe und sein Vater zudem ein hochdekorierter Kriegsheld gewesen war, danach, als es ernst wurde und vielen mit ähnlicher Biographie der UK-Status aberkannt wurde, die Regelung, dass jede geheimdienstliche Tätigkeit automatisch als kriegswichtig zu betrachten sei.
Doch inzwischen bot auch das keine Sicherheit mehr. Nicht in Zeiten, in denen selbst Arbeiter aus Rüstungsbetrieben an die Front geschickt und am Arbeitsplatz durch Frauen oder sogar Kriegsgefangene ersetzt wurden!
Die Sache war die, dass er die Elektropost des Chefs mitlas. Was selbstverständlich strengstens verboten war, aber, nun ja, sie waren schließlich in einem Geschäft tätig, das sich darum drehte, Geheimnisse auszuspähen, und zwar am liebsten streng verbotene, oder etwa nicht? Wie auch immer, er hatte Adamek jedenfalls so lange unauffällig auf die Finger geschaut, bis er dessen Parole herausgefunden hatte, und seither verfolgte er seine Korrespondenz. Deshalb wusste er, dass Himmler heute nicht hier war, um mal nachzuschauen, ob sie hinreichend hübsche Bureaus hatten, sondern um zu entscheiden, ob das, was sie darin taten, auch wirklich kriegswichtig war. Sollte der Reichsführer zu dem Schluss kommen, dass dem Reich besser damit gedient war, denNSAeinzukassieren und dem Reichssicherheits-Hauptamt als Unterabteilung einer Unterabteilung zuzuschlagen, dann würde genau das geschehen. Die betrieben dort schließlich auch Aufklärung, nur eben auf die klassische Weise, aber es würde sich zweifellos ein organisatorisch geeignetes Plätzchen finden.
Man hatte Adamek ferner wissen lassen, dass in diesem Falle die Belegschaft ein weiteres Mal verringert werden würde, insbesondere was die Anzahl der männlichen Mitarbeiter anbelangte, denn jeder waffenfähige Mann werde in dieser schwierigen Zeit an der Front gebraucht, im Kampf für den Endsieg.
Man musste kein Prophet sein, um zu wissen, wen es treffen würde. Den Chef jedenfalls nicht, der saß im Rollstuhl. Den Junior vom Telephondienst, Rudi Engelbrecht mit dem Hinkebein, auch nicht. Was Winfried Kirst, diesen dürren Eigenbrötler, und Gustav Möller mit seiner dicken Brille anbelangte, gab es Argumente dafür und Argumente dagegen; einer der beiden würde wahrscheinlich davonkommen. Aber Dobrischowsky und er waren fällig. Wenn das NSA aufgelöst wurde, würden sie mit dem Gewehr in der Hand gegen den Russen marschieren, das war so sicher wie das »Hitler« nach dem »Heil«. Und im Unterschied zu allen anderen Soldaten an der Ostfront würden sie genau wissen, wie beschissen die Lage war.
Deswegen musste das heute klappen. Deswegen mussten sie das so durchziehen, dass Himmler die Augen aus dem Kopf fielen.
Eugen Lettke zwirbelte sich ein letztes Mal die Bartspitzen, dann drehte er den Wasserhahn wieder zu. Es quietschte so laut und misstönend, wie er es gewohnt war.
Und wie er es bleiben wollte. Er wollte nicht in den Krieg ziehen und niemanden totschießen – aber das hieß nicht, dass er nicht wusste, wie man kämpfte!
***
Der Saal war abgedunkelt. Der Projektor warf ein scharf abgegrenztes Abbild dessen auf die Leinwand, was der Bildschirm vor Helene Bodenkamp zeigte, der Lüfter surrte, die Bogenlampe verbreitete ihren unverkennbaren Geruch nach verbranntem Staub und heißer Kohle. Einige der Männer kämpften mit Zigarettenrauch dagegen an.
Keiner von den SS-Leuten allerdings. Die hielten sich im Hintergrund, reglos wie Statuen.
»Unsere Arbeit«, begann August Adamek mit sanfter, eindringlicher Stimme, »spielt sich auf zwei Ebenen ab. Die erste Ebene ist unmittelbar einsichtig, was ihre Funktionsweise anbelangt: Wir haben Zugriff auf alle Daten, die im Reich erzeugt werden, und können diesen Zugriff auf vielfältige Weise nutzen. Wir können jeden Text lesen, den irgendjemand verfasst, genau wie jeden Elektrobrief, der innerhalb des Reiches verschickt oder empfangen wird. Wir können jeden Kontostand abfragen, jedes Telephon orten, wir können ermitteln, wer welche Fernsehsendung oder Radiosendung gesehen beziehungsweise gehört hat, und unsere Schlüsse daraus ziehen. Selbstredend können wir auch jede Diskussion mitlesen, die im Deutschen Forum stattfindet, auch diejenigen mit geschlossenem Teilnehmerkreis, und auf diese Weise Personen identifizieren, die sich irgendwann einmal in einer Weise über den Führer, die Partei oder den Nationalsozialismus geäußert haben, die es ratsam macht, die Aufmerksamkeit der dafür zuständigen Stellen auf sie zu lenken.«
Allgemeines Nicken. Auch Himmler nickte.
»Hierbei stoßen wir auf zwei Hindernisse«, fuhr Adamek fort. »Das erste ist die schiere Masse an Daten. Wir können zwar jedes Dokument lesen, aber wir können nicht alle Dokumente lesen – das könnten wir nicht einmal dann, wenn wir tausendmal so viele Mitarbeiter hätten, wie wir haben.«
Ehe Himmler auf die Idee kommen konnte, Adamek verlange einfach nur mehr Mitarbeiter – ein Wunsch, der angesichts der Kriegssituation völlig unerfüllbar gewesen wäre –, fuhr er fort: »Unsere Waffe gegen dieses Hindernis sind unsere Komputer. Wir lassen sie die Datenbestände nach bestimmten verräterischen Stichwörtern durchforsten, setzen also Suchfunktionen ein, die wir zudem stetig verbessern, damit sie uns möglichst relevante Ergebnisse liefern.«
Himmler nickte noch einmal, schien sich allerdings schon wieder zu langweilen.
»Das zweite Hindernis ist, dass es sich inzwischen herumgesprochen hat, dass man im Deutschen Forum aufpassen muss, was man schreibt. Sprich, die Feinde unseres Volkes geben sich nicht mehr so unbefangen zu erkennen, wie sie es noch vor einigen Jahren getan haben oder gar vor der Machtergreifung. Tatsächlich sind die Forumseinträge vor 1933 in politischer Hinsicht die ergiebigsten. Doch seither ist eine neue Generation herangewachsen, und es stellt sich die Frage, wie man die schwarzen Schafe unter den Jungen finden kann.«
»Ah«, ließ sich Himmler vernehmen. »Jetzt kommt das Schwarze Forum ins Spiel, nehme ich an.«
»Exakt.« Adamek nickte, und es wirkte auf eine gefährliche Weise so, als hielte er sich für den Lehrer und den Reichsführer SS für einen zu lobenden Schüler. »Wir haben ein Forum eingerichtet, an dem man ohne Bürgernummer und Parole teilnehmen kann, also auf den ersten Blick anonym. Wir haben es mit einigen reichsfeindlichen Äußerungen gefüllt, für die wir uns beanstandete Einträge aus dem Deutschen Forum zum Vorbild genommen haben, und dann einfach abgewartet.«
Er nickte Dobrischowsky zu, der eine Spur zu eifrig erläuterte: »Technisch bedingt gibt es im Weltnetz keine echte Anonymität. Man weiß von jedem einzelnen Buchstaben jederzeit genau, wann er von welchem Eingabegerät ins System gekommen ist. Bei dem Eingabegerät kann es sich um einen Komputer handeln; dieser ist identifizierbar und gehört in der Regel jemandem. Haben wir es mit einem öffentlichen Komputer zu tun – an einer Schule, in einer Bibliothek, auf einem Postamt oder dergleichen –, dann lässt sich der Eingabe meistens über eine Telephonortung eine Person zuordnen. Handelt es sich bei dem Eingabegerät um ein Telephon, ist eine Identifizierung ohnehin gegeben.«
»Und uns überlassen Sie es, uns einen plausiblen Grund auszudenken, wieso wir uns die Personen zur Brust nehmen, die Sie uns melden«, beschwerte sich Himmler.
Adamek neigte den Kopf. »Wenn auch nur das Gerücht aufkommen sollte, dass Äußerungen im Schwarzen Forum nicht wirklich anonym sind, würde die ganze Sache wirkungslos. Und ein zweites Mal ließe sich so etwas nicht aufbauen.«
»Ja, ja, verstehe ich«, meinte Himmler fast jovial. »Das ist die zweite Ebene Ihrer Arbeit, die Sie erwähnten, nehme ich an?«
Adamek sah ihn an und schüttelte mit leisem Lächeln den Kopf. »Nein«, sagte er sanft. »Zu der komme ich jetzt.«
Er gab seinem Rollstuhl einen Schubs, rollte bis direkt unter das helle Rechteck auf der Leinwand und hielt an.
»Alles, wovon wir bis jetzt gesprochen haben, kratzt nur an der Oberfläche«, erklärte er. »Die eigentliche Macht liegt in der Möglichkeit, für sich genommen scheinbar harmlose Daten mithilfe des Komputers auf eine Weise zu verknüpfen, die zu ungeahnten Einsichten führt. Das ist die zweite Ebene unserer Arbeit und diejenige, die wir besser als sonst irgendjemand auf der Welt beherrschen. Wir sind, was diese Art Auswertungen anbelangt, eine eingespielte Truppe, in der Konzepter und Strickerinnen Hand in Hand arbeiten. Einen der Ansätze, die wir entwickelt haben, wollen wir Ihnen heute präsentieren.«
Himmler lehnte sich in seinem Stuhl zurück und legte die Hände an den Fingerspitzen zusammen. »Schön«, sagte er. »Dann präsentieren Sie mal.«
Adamek ließ sich von der unüberhörbaren Skepsis in der Stimme des Reichsführers nicht im Mindesten irritieren. Das wunderte niemanden, der ihn kannte; sich irritieren zu lassen lag einfach nicht in seinem Wesen. Deswegen saß er schließlich auch im Rollstuhl. Es war ein Ski-Unfall gewesen. Jeder hatte ihn gewarnt, die Piste sei gefährlich, doch er hatte sich nicht irritieren lassen.
»Unser Ansatz verdankt seine Wirksamkeit einer Entscheidung des Führers, die aus unserer Sicht ein wahrer Geniestreich war«, begann Adamek. »Ich spreche von der Entscheidung, das Bargeld abzuschaffen. Seit der Einziehung aller Banknoten und Münzen zum 1. Juli 1933 ist im gesamten Reich nur noch mit Geldkarte gezahlt worden beziehungsweise seit der Verbreitung des Volkstelephons ab 1934 zunehmend auch direkt damit, der größeren Bequemlichkeit wegen.«
»Diese Maßnahme zielte in erster Linie darauf ab, uns aus der Zinsknechtschaft des jüdischen Großkapitals zu befreien«, korrigierte Himmler. »Und nebenbei Schwarzmarktgeschäften, der Korruption und ganz allgemein dem Verbrechen die Grundlage so weit wie irgend möglich zu entziehen.«
Adamek nickte höflich. »Das waren zweifellos die Beweggründe des Führers, aber um die geht es mir nicht, sondern um den Effekt, den seine Entscheidung hatte. Der Effekt ist nämlich der, dass wir dank dessen genau wissen, was jeder einzelne Mensch, der innerhalb der Grenzen des Deutschen Reichs lebt, in den vergangenen neun Jahren gekauft hat, und auch, wann er es gekauft hat, wo er es gekauft hat und wie viel er dafür bezahlt hat. Stimmen Sie mir bis dahin zu?«
Auf einen unmerklichen Wink von ihm hatte Helene Bodenkamp eine vorbereitete Tabelle aufgerufen, die nun auf der Leinwand erschien: mehrere Spalten, die jeweils mehrere lange Nummern enthielten, gefolgt von einem Tagesdatum, einer Uhrzeit, einer Mengenangabe und einem Betrag in Reichsmark.
»In der Praxis handelt es sich dabei um eine enorm große, aber sehr einfache Tabelle. Hier sehen wir einen Auszug daraus, und zwar alle Einkäufe, die ich selber getätigt habe. Die Nummer in der ersten Spalte, die, wie Sie sehen, überall die gleiche ist, ist meine Bürgernummer. Die zweite Spalte enthält die Bürgernummer der Person oder die Firmennummer der Firma, an die das Geld gegangen ist. Die dritte Spalte enthält im Falle eines simplen Einkaufs die Artikelnummer, die jedem handelbaren Gegenstand in Deutschland zugeordnet sein muss, oder eine Vertragsnummer, falls es sich um Zahlungen im Rahmen eines Vertrags handelt – ein Beispiel dafür sehen Sie in der zweiten Zeile; das ist die Zahlung der Monatsmiete meiner Wohnung –, oder eine Anlassnummer, wenn es sich um eine sonstige Zuwendung handelt. In der siebten Zeile steht hier die Kennziffer 101, die für Geldgeschenke unter Verwandten zu verwenden ist: Hier war es der Geburtstag meines Neffen Hermann, dem ich zwanzig Mark geschenkt habe. Die letzte Spalte vor dem Betrag enthält eventuelle Mengenangaben.«
Wieder ein Wink an die Programmstrickerin. Die Tabelle schrumpfte zusammen, füllte sich von unten her auf.
»Nun haben wir einen weiteren Filter über diese Liste gelegt, nämlich einen, der anhand der Artikelnummern nur meine Lebensmittelkäufe zeigt«, erläuterte Adamek.
Himmler furchte skeptisch die Stirn. »Woran erkennt man das?«, wollte er wissen. »Welcher Artikel ist ein Lebensmittel? Die Nummern sehen alle völlig unterschiedlich aus, abgesehen von der Artikel-Kennziffer am Anfang.«
»Das sieht man der Artikelnummer nicht an, die Nummern werden fortlaufend vergeben«, erwiderte Adamek. »Aber bei der Anlage jedes Artikels werden alle erforderlichen Angaben hinterlegt, und zwar in einer anderen Tabelle. Fräulein Bodenkamp, zeigen Sie doch mal den Eintrag der Artikeltabelle zu einer der Zeilen, sagen wir, die erste.«
Das Bild verschwand, machte einer Übersicht Platz. Man sah die Artikelnummer, darunter stand: Gloria Kartoffeln
Kategorie: Lebensmittel
Rationiert: Nein
Verweis in Materialtabelle: 1004007
»Hier haben wir die Kategorie angezeigt. Es handelt sich um ein Lebensmittel, wir müssen also, wenn wir weitere Eigenschaften des Artikels abfragen wollen, in die Tabelle Lebensmittel gehen. Fräulein Bodenkamp?«
Sie tippte ein paar Befehle ein, dann erschien eine neue Übersicht:
Material-Nummer: 1004007
Beschreibung: Kartoffeln allgemein
Nährwert: 77 Kalorien
Einheit: 100 g
Und so weiter, eine Liste von Einträgen zu Vitaminen und dergleichen, länger als der Bildschirm.
»Wir sehen also, die Kartoffeln, die ich am Samstag vor zwei Wochen gekauft habe, haben einen Nährwert von 77 Kalorien pro 100 g. Gekauft habe ich zwei Kilogramm …«
»Darf ich fragen, wie Sie das machen?«, unterbrach ihn Himmler. »Im Rollstuhl?«
Adamek neigte den Kopf. »Nun, natürlich kaufe ich nicht selbst ein. Ich habe einen jungen Helfer, der das für mich erledigt. Ich gebe ihm eine Liste mit und meine Geldkarte und überlasse ihm alles Weitere.«
Himmler nickte knapp. »Verstehe. Fahren Sie fort.«
Adamek drehte sich mit seinem Rollstuhl herum und betrachtete das angezeigte Bild, bis er den Faden wieder gefunden hatte. »Wie gesagt, ich habe zwei Kilogramm Kartoffeln gekauft, also einen Nährwert von 1540 Kalorien erworben. Diese Umrechnung von Lebensmittelkäufen in Nährwert können wir nun durch ein Programm automatisch erledigen lassen.«
Wieder ein Nicken in Richtung der Strickerin, wieder wechselte das Bild. Die Tabelle der Lebensmitteleinkäufe erschien erneut, diesmal aber nur mit Bürgernummer, Datum und Anzahl der Kalorien.
»Und das Ganze«, fuhr Adamek fort, »können wir natürlich auch leicht monatsweise aufsummieren. Fräulein Bodenkamp, wenn ich bitten dürfte?«
Eine neue Liste erschien.
Die Überschrift lautete: August Adamek, geboren 5.5.1889, wohnhaft Weimar, Junkerstraße 2
Darunter war aufgelistet:
September 1942 – 73.500 Kalorien
August 1942 – 72.100 Kalorien
Juli 1942 – 68.400 Kalorien
Juni 1942 – 78.300 Kalorien
»Das sind die Nährwerte, die ich in den letzten Monaten gekauft und in der Folge auch verzehrt habe«, erklärte Adamek. »Ungefähr zweieinhalbtausend Kalorien pro Tag, das kommt hin.« Er rollte ein Stück zur Seite. »Nun fügen wir noch einen letzten Schritt hinzu, damit die Auswertung allgemein aussagekräftig wird, und zwar dergestalt, dass wir diese Tabelle mit den Daten des Standesamtes verknüpfen. Auf diese Weise erhalten wir die Kalorien pro Haushalt. Teilen wir diese Zahl noch durch die Anzahl der Mitglieder dieses Haushalts – Vater, Mutter, Kinder, Großeltern und so weiter –, dann landen wir schließlich bei einer Liste, die alle Haushalte aufführt und wie viele Kalorien die Mitglieder dieser Haushalte im Schnitt pro Monat verbrauchen.«
Die Augen des Reichsführers wirkten unnatürlich groß hinter seiner runden Brille. Er nickte, sehr, sehr langsam, aber er nickte. Schien zu begreifen, worauf das alles hinauslief.
»Im Fall meiner Person bleibt das Ergebnis dasselbe, da ich allein lebe«, fuhr Adamek fort. »In anderen Fällen wird das Ergebnis niedriger liegen als zweieinhalbtausend Kalorien, zum Beispiel, wenn Babys oder Kleinkinder zu einem Haushalt gehören, die natürlich weniger essen als Erwachsene. Aber wenn der Schnitt wesentlich höher liegt …« Er hielt inne, sah in die Runde, fixierte dann wieder den Reichsführer SS. »Wir müssen selbstverständlich eine gewisse Schwankungsbreite einkalkulieren. Männer, die schwer körperlich arbeiten, haben einen höheren Energiebedarf. Aber wenn der durchschnittliche Kalorienverbrauch eines Haushalts eine gewisse Obergrenze überschreitet … und das in diesen Zeiten, in denen manche Lebensmittel rationiert sind … ein solcher Ausreißer kann ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass in dem betreffenden Haushalt mehr Menschen leben, als gemeldet sind. Zum Beispiel«, fügte er hinzu, »Menschen, die vor dem Gesetz versteckt werden.«
Himmler hatte die Hände gefaltet, rieb sie sich bedächtig. »Das klingt gut«, sagte er anerkennend. »Das klingt sehr gut.« Er kniff argwöhnisch die Augen zusammen. »Aber das würde ich doch gerne in der Praxis demonstriert sehen.«
Adamek lächelte. Seine Kollegen lächelten ebenfalls. Darauf waren sie natürlich vorbereitet.
»Nichts lieber als das«, meinte Adamek. »Nennen Sie eine Stadt, und wir erstellen eine Liste verdächtiger Haushalte. Hier. Jetzt. Vor Ihren Augen.«
»Irgendeine Stadt?«, fragte der Reichsführer.
»Irgendeine Stadt«, bestätigte Adamek.
Himmler überlegte kurz. Dann sagte er: »Amsterdam.«
Das Lächeln auf den Gesichtern der Männer erlosch schlagartig.
»Amsterdam?«, vergewisserte sich Adamek.
»Ist das ein Problem?«, fragte Himmler.
***
Helene saß wie gelähmt vor ihrer Tastatur. Das hatte sie alles nicht gewusst. Sie hatte die Programme geschrieben, nach Vorgaben, die sie von Herrn Adamek, von Herrn Lettke und von Herrn Dobrischowsky erhalten hatte, genau wie sonst auch. Und wie sonst auch hatte sie nicht gefragt, wozu die Auswertungen dienen sollten; derlei Fragen standen Programmstrickerinnen nicht zu.
Natürlich hatte sie sich ihre Gedanken gemacht. Aber es war schließlich nur um Lebensmittel gegangen, um Kalorienzahlen – was hätte sie da anderes vermuten sollen, als dass es um die Ernährungssituation des Volkes ging? Darum, die Versorgungslage zu untersuchen, herauszufinden, wo die Menschen genug zu essen hatten und wo nicht?
Aber das jetzt … Ihre Hände fühlten sich tonnenschwer an. In ihrem Bauch zitterte etwas ganz elendiglich. Ihr war danach, hinauszurennen und sich auf der Toilette zu verstecken, aber die Völkers würde ihr nachher den Kopf abreißen, wenn sie das wagte.
Vielleicht würde sie es schaffen, sich nicht zu übergeben.
Der Diskussion, die unter den Männern entbrannt war, folgte sie nur mit halbem Ohr. Wurde denn in Amsterdam schon bargeldlos bezahlt? Ja, lautete die Antwort, mehr oder weniger seit der Besetzung der Niederlande. Man hatte den Gulden abgeschafft, alles Bargeld eingezogen und die bargeldlose Reichsmark eingeführt, genau wie in Deutschland. Und standen denn auch alle benötigten Tabellen zur Verfügung?
»Fräulein Bodenkamp?« Die Stimme Adameks. »Helene?«
»Ja?« Sie schreckte hoch.
»Haben wir, Amsterdam betreffend, alle benötigten Tabellen?«
»Ja.« Da standen sie aufgelistet, vor ihr auf dem Schirm. Ihre Hände mussten das getan haben, ohne dass sie es mitbekommen hatte.
»Dann starten Sie die Auswertungen, bitte.«
»Ja«, hörte sich Helene Bodenkamp sagen, gehorsam, wie es einer deutschen Frau geziemte, und dann sah sie ihren Händen zu, wie sie die notwendigen Befehle eintippten.
Und schließlich die Ausführen-Taste drückten.
Warum musste sie gerade an Ruth denken, die Freundin aus Kindertagen? Ruth Melzer, die sich eines Tages im Klassenzimmer ganz nach hinten hatte setzen müssen und den deutschen Gruß nicht hatte machen dürfen, mit dem alle anderen den Lehrer empfingen. Ruth Melzer, die kurz darauf mit ihren Eltern nach Amerika gegangen war, für immer, und von der sie nie wieder etwas gehört hatte.
Während die Auswertung lief und die Prozentzahl auf dem Schirm langsam wuchs – ihr war, als könne sie hören, wie die Silos unten in den Hallen jetzt gerade ratterten und klackerten und wie die Lüfter der Komputer ansprangen, weil die Recheneinheit auf Hochtouren lief –, während also all das Unheimliche, Schreckliche seinen unaufhaltsamen Gang nahm, erläuterte Himmler, wieso ausgerechnet Amsterdam.
»Als die Wehrmacht die Niederlande eingenommen hatte und wir uns die Unterlagen ansehen konnten, haben wir festgestellt, dass die Stadtverwaltung von Amsterdam schon seit langem ein Verzeichnis führt, welcher Religion die in der Stadt wohnhaften Bürger angehören. Das Ganze hatte steuerliche Gründe, aber für uns war es natürlich ein Geschenk der Vorsehung. Anders als im Altreich, wo das Amt für Rassenkunde aufwendige genealogische Untersuchungen anstellen muss, um zu ermitteln, wer Jude ist, hatten wir, was Amsterdam betraf, auf einen Schlag eine komplette Liste zur Hand. Was die notwendigen Maßnahmen natürlich enorm vereinfacht hat.«
»Ja, das war ein echter Glücksfall«, pflichtete ihm Adamek bei.
»Wir haben im Frühsommer mit den Deportationen begonnen«, fuhr Himmler fort, »aber da wir diese Liste haben, wissen wir, dass wir nicht alle Juden erwischt haben. Von manchen heißt es, sie seien ins Ausland gegangen, aber bei einem Abgleich mit den Aufzeichnungen der Grenzbehörden stellten wir fest, dass das nicht stimmen kann. Das heißt, wenn sie nicht gerade über die Nordsee davongeschwommen sind, dann sind sie noch da, irgendwo in der Stadt untergetaucht in der Hoffnung, dass wir eines Tages wieder verschwinden.« Er ballte die Faust, eine Geste jäh aufflammender Wut. »Aber wir verschwinden nicht wieder. Wir sind gekommen, um tausend Jahre zu bleiben.«
Atemlose Stille herrschte nach diesem unvermittelten Ausbruch des Reichsführers. Niemand rührte sich, niemand sagte etwas. Alle starrten nur auf die Prozentzahl auf der Leinwand, die sich langsam der 100 näherte.
Dann verschwand sie, und eine Liste erschien.
Die ersten zwei Zeilen lauteten:
Gies – 6.710 Kalorien pro Tag und Person
van Wijk – 5.870 Kalorien pro Tag und Person
»Treffer«, sagte Lettke in die Stille hinein.
Himmler stand auf. »Was heißt das?«
»Diese Leute kaufen das fast Dreifache dessen an Lebensmitteln, was sie selber verzehren können«, erklärte Adamek. »Fräulein Bodenkamp, bitte die Einträge aus der Haushaltstabelle.«
Helene war es, als habe sich ein ungeheures, unsichtbares Gewicht auf sie gelegt, so schwer, dass sie kaum atmen konnte. Doch ihre Hände, diese Verräterinnen, arbeiteten weiter, tippten die notwendigen Befehle mit unverminderter Flinkheit ein, und die Anzeige auf der Leinwand erweiterte sich um Informationen über die Personen, die sich hinter diesen Familiennamen verbargen.
Die erste Zeile bezog sich auf ein kinderloses Ehepaar, Jan Gies und Miep Gies-Santrouschitz. Geburtsdaten, Geburtsorte – die Ehefrau kam aus Österreich –, Wohnort, Arbeitsstelle.
Hinter der zweiten Zeile verbarg sich ebenfalls ein Ehepaar, Cor van Wijk und Elisabeth van Wijk-Voskuijl. Ebenfalls keine Kinder.
»Vier Personen, die insgesamt auf einen Tagesschnitt von über 25.000 Kalorien kommen«, fasste Adamek zusammen, dessen Fähigkeit zum Kopfrechnen legendär war. »Das entspricht dem Nahrungsbedarf von zehn Personen oder mehr.«
»Die beiden Frauen arbeiten in derselben Firma«, stellte Dobrischowsky fest.
»Was ist das für eine Firma?«, fragte Adamek, an Helene gewandt.
Wieder tanzten die Finger. Die Firma hieß OPEKTA, hatte ihren Sitz in der Prinsengracht 263, betrieb Handel mit Gewürzen und gehörte einem Johannes Kleiman und einem Victor Kugler.
»Sie hat erst im Dezember 41 den Besitzer gewechselt, also nach der Besetzung«, warf Lettke ein. »Das könnte auf ein Tarngeschäft hindeuten. Wer war der Vorbesitzer?«
Helenes Hände riefen die entsprechenden Daten auf.
»Otto Frank.« Dobrischowsky schüttelte den Kopf. »Ist das ein holländischer Name?«
Weiter, weiter, weiter. Ihre Hände tanzten über die Tasten, entrissen den Silos immer weitere Daten. Otto Frank, verrieten sie, war in der Tat kein Holländer, sondern ein deutscher Jude, der im Februar 1934 in die Niederlande ausgewandert war.
»Typisch Jude«, meinte Himmler. »Kommt als Niemand in ein fremdes Land, und ein paar Jahre später ist er reich und lässt Einheimische für sich arbeiten.«
Otto Frank, verrieten die Daten weiter, hatte mit seiner Familie im Merwedeplein 37 gelebt, war dort aber zuletzt am 5. Juli 1942 gesehen worden. Im Bericht des Deportationskommandos war vermerkt, die Familie sei Gerüchten zufolge in die Schweiz geflüchtet.
»Oder auch nicht«, meinte Himmler und zog sein Telephon aus der Tasche.
Helene zuckte unwillkürlich zusammen, als sie diese Bewegung sah. Etwas Unerhörtes haftete ihr an, war es doch strengstens verboten, tragbare Telephone mit in die Amtsräume zu nehmen.
Aber natürlich wäre es niemandem eingefallen, dem Reichsführer SS zuzumuten, sein Telephon am Eingang zu deponieren, wie es für sie alle Pflicht war.
»Schulz?«, rief Himmler schnarrend. »Wir haben hier gerade Hinweise auf versteckte Juden in Amsterdam gefunden. Schicken Sie ein Suchkommando in die Prinsengracht 263 und lassen Sie das Anwesen von oben bis unten durchsuchen. Ja, 263. Außerdem Suchkommandos an folgende Adressen – schreiben Sie mit.« Er las dem Mann in Amsterdam die Adressen der Ehepaare Gies und van Wijk vor sowie die Adressen von Johannes Kleiman und Victor Kugler. »Ausführung sofort, so schnell wie möglich. Und erstatten Sie mir unverzüglich Bericht.«
Er nahm sein Telephon vom Ohr und sagte: »Jetzt heißt es warten.«
Sein Telephon, bemerkte Helene, schimmerte golden und ließ sich zusammenklappen, war also definitiv kein Volkstelephon. Vermutlich handelte es sich um eines der Luxusmodelle, die Siemens kurz vor Ausbruch des Krieges auf den Markt gebracht hatte.
Und so warteten sie. Saßen da, starrten ins Leere, ließen die Zeit verstreichen. Kirst zündete sich eine seiner unvermeidlichen Overstolz an. Adamek kaute auf dem Knöchel seines rechten Daumens herum. Lettke zwirbelte die Enden seines albernen Oberlippenbärtchens. Himmler zog sich mit seinem Adjutanten in den Hintergrund des Saals zurück und erteilte ihm leise ein paar Anweisungen; dann, während der maschinenhaft wirkende SS-Mann aus dem Saal schlüpfte, kehrte er zu seinem Stuhl zurück und ließ sich geräuschvoll wieder hineinfallen.
Endlich, nach hundert Jahren, wie es Helene vorkam, klingelte das Telephon des Reichsführers wieder. »Ja?«, bellte er ungeduldig, lauschte. Dann sagte er: »Fehlanzeige an der Adresse van Wijk.«
»Wie erklären sie ihre Lebensmittelkäufe?«, fragte Adamek.
Himmler starrte ihn finster an. »Haben Sie nicht aufgepasst? Davon habe ich meinen Leuten nichts gesagt, also, warum hätten sie danach fragen sollen?«
»Sie haben recht«, gab Adamek sofort zu. »Bitte entschuldigen Sie, Reichsführer.«
»Falls das hier funktioniert«, sagte Himmler, »werde ich den Teufel tun und irgendjemandem verraten, wie wir Untergetauchte finden.«
Adamek nickte. »Das ist zweifellos ratsam.«
Himmler sah grimmigen Blicks ins Leere. »Dass es überhaupt möglich ist, dass jemand in einem besetzten Gebiet so viele Lebensmittel kaufen kann! Vielleicht sollten wir alles rationieren. Dann könnte niemand heimlich irgendwelche Juden durchfüttern, ohne selber zu verhungern …«
Sein Telephon klingelte wieder. Diesmal ging es um die Suche im Haus Kuglers, die ebenfalls nichts erbracht hatte.
So ging es weiter, eine Adresse nach der anderen. Zuallerletzt meldete sich das Suchkommando aus der Prinsengracht.
»Sie haben das Gebäude von oben bis unten durchsucht«, berichtete Himmler, das Telephon gegen die Brust gedrückt.
»Und?«, fragte Adamek.
»Nichts«, sagte der Reichsführer SS grimmig. »Sie haben nichts gefunden. Nicht das Geringste.«
Helene sah, wie die Männer alle die Augen aufrissen vor Entsetzen. Bestimmt bemerkte niemand, dass sie dagegen erleichtert aufatmete.
***
»Moment«, sagte Lettke in die erschrockene Stille hinein. Es überraschte ihn selber, wie klar und entschieden seine Stimme klang. »Einen Moment, bitte.«
Dann wandte er sich an die Strickerin und sagte: »Ich gehe davon aus, dass wir auch die Grundbuchdaten von Amsterdam haben?«
Das Mädchen nickte mit großen Augen. »Ja. Selbstverständlich.«
»Zeigen Sie uns den Grundriss des Gebäudes.«
Er sah Adamek anerkennend nicken, hörte, wie er »Gute Idee« sagte. Er sah, wie Dobrischowsky an seinem Hemdkragen zerrte, sah Kirst nervös die nächste Zigarette aus seinem silbernen Etui fingern, sah Möller den Kopf einziehen.
Und er sah Himmlers Blick, kalt wie Eis. Wenn das jetzt in die Hose ging, dann rettete ihn nichts mehr.
Der Grundriss des Gebäudes erschien auf der Leinwand. Es war mehrgeschossig und, typisch für die Stadt Amsterdam, die Gebäude einst nach ihrer Fassadenbreite besteuert hatte, sehr schmal, dafür aber tief.
»Kann ich direkt mit Ihrem Sturmbannführer sprechen?«, fragte Lettke, selber erstaunt über seine Kühnheit.
Himmler wog sein Telephon unentschlossen in der Hand, schien nicht sonderlich geneigt.
»Ich kann es an die Lautsprecheranlage anschließen«, bot Dobrischowsky an. »Dann können wir alle mithören. Ist nur ein Handgriff.«
»Also gut«, sagte Himmler.
Dobrischowksy zog ein klobiges Kabel hervor und stöpselte es in den Verstärker ein. Während der alte Kasten knisternd in Gang kam, verband er das andere Ende mit dem Telephon des Reichsführers. »Können Sie uns hören, Sturmbannführer?«, rief er dann.
»Laut und deutlich«, kam es aus den in der Täfelung verborgenen Lautsprechern.
»Eugen Lettke hier«, rief Lettke. »Sturmbannführer, bitte beschreiben Sie uns die Räumlichkeiten, die Sie in der Prinsengracht 263 vorgefunden haben.«
Der Mann am anderen Ende der Verbindung räusperte sich, dann beschrieb er den Aufbau des Hauses in genau der Reihenfolge, in der sie es durchsucht hatten. Alles, was er über das Erdgeschoss sagte, stimmte mit dem Grundriss überein.
Jetzt wurde Lettke auch heiß, und er unterdrückte nur mit Mühe den Impuls, ebenfalls den Kragen seines Hemdes zu lockern.
»Über die Treppe gelangen wir in den ersten Stock«, fuhr die schneidige Männerstimme fort. »Rechter Hand eine Tür, die in einen Lagerraum zur Straßenseite führt, schräg vor mir eine steile Treppe – fast eher eine Leiter – hinauf in den zweiten Stock, geradeaus ein schmaler Flur. Rechts eine weitere Tür in einen weiteren Lagerraum, am Ende des Flurs eine Tür, hinter der nur ein kleiner Raum liegt, der rechter Hand zwei Fenster in den Hof aufweist und offenbar als Bibliothek dient. Ich drehe um, um in den zweiten Stock –«
»Halt!« Lettke spürte sein Herz wie wild pochen. »Gehen Sie noch einmal zurück in den kleinen Raum. Was sehen Sie dort genau?«
»Ein großes Bücherregal. Dies und das. Eine Art Abstellraum.«
»Keine Tür, die weiter nach hinten führt?«
»Nein.«
Sie sahen es alle: Der Grundriss des ersten Stocks zeigte hinter dem kleinen Zimmer weitere Räumlichkeiten.
Es funktionierte. Unglaublich. Das Hochgefühl, das Lettke auf einmal durchströmte, nahm ihm fast den Atem.
»Sturmbannführer«, rief er, »beschreiben Sie, wo genau das Bücherregal steht.«
»An der Wand gegenüber der Tür.«
»Überprüfen Sie, ob es einen Zugang verbirgt.«
»Das haben wir schon. Es ist fest mit der Wand verschraubt.«
»Gehen Sie von der Annahme aus, dass es sich um ein Täuschungsmanöver handelt, und überprüfen Sie es noch einmal.«
»Hmm«, machte der SS-Mann. »Na gut.« Man hörte ihn ein paar Namen in den Hintergrund rufen und Befehle erteilen, dann wurde es still bis auf undefinierbare, weit entfernte Geräusche.
Endlich wurde das Telephon geräuschvoll wieder aufgenommen.
»Sie hatten recht«, sagte der SS-Mann mit hörbarer Verblüffung. »Das Regal ist schwenkbar und die Verriegelung ziemlich gut versteckt. Und dahinter geht es tatsächlich weiter.«
Im Hintergrund war Geschrei zu hören.
»Es halten sich mehrere Personen dahinter auf«, berichtete der SS-Mann.
»Alle verhaften«, befahl Himmler mit schnarrender Stimme. »Personalien feststellen.«
»Zu Befehl, Reichsführer.«
Eine Weile hörte man herrisches Gebrüll, das Schluchzen von Frauen, das Weinen von Kindern, alles weit fort, fast nur zu erahnen. Dann meldete sich der Sturmbannführer wieder. »Wir haben in den verborgenen Räumlichkeiten insgesamt acht Personen vorgefunden, alles Juden. Nach vorläufigen Erkenntnissen handelt es sich um Otto Frank, seine Ehefrau Edith Frank und die beiden Kinder Margot und Anne Frank, ferner um Herman van Pels seine Ehefrau Auguste van Pels und den Sohn Peter van Pels sowie einen Fritz Pfeffer.«
Acht Juden. Lettke gestattete sich ein triumphierendes Lächeln. Damit sollten sie die Nützlichkeit des NSA zur Genüge unter Beweis gestellt haben. Und er hatte wesentlich dazu beigetragen! Wenn das seinen UK-Status nicht verlängerte, dann gab es nichts, was das vermochte.
»Bei einem der Mädchen«, fuhr der SS-Mann fort, »haben wir ein Tagebuch sichergestellt. Sollen wir es zwecks Auswertung weiterleiten?«
Himmler verzog angewidert das Gesicht. »Nein. Vernichten Sie es. Nicht, dass es auf irgendwelchen Wegen unseren Feinden in die Hände fällt und zur Propaganda gegen uns benutzt wird.«
»Zu Befehl, Reichsführer.« Man hörte, wie er nach hinten rief: »Schulze? Verbrennen Sie es. Ja, sofort.«
»Die gefassten Juden sind unverzüglich nach Auschwitz zu überstellen«, ordnete Himmler an. »Und alle, die an dem Komplott beteiligt waren, sie verborgen zu halten, sind zu verhaften.«
»Zu Befehl, Reichsführer.«
Himmler gab Dobrischowsky einen Wink, das Kabel betreffend. »Das genügt jetzt. Alles Weitere geht seinen Gang, auch ohne uns.«
Während Dobrischowsky sein Telephon wieder absteckte, ging Himmler unruhig auf und ab, offensichtlich noch ganz unter dem Eindruck dessen, was sie alle gerade miterlebt hatten. Keiner sagte ein Wort. Zweifellos war es nicht ratsam, die Gedankengänge des Reichsführers zu unterbrechen.
»Dass unser Vaterland«, begann Himmler schließlich, »jenen unglückseligen Krieg 14–17 am Ende so schmählich verloren hat, lag, wie wir heute wissen, nicht daran, dass die deutschen Soldaten versagt hätten, denn das haben sie nicht. Nein, der Krieg ging verloren, weil man der Wehrmacht in den Rücken gefallen ist – verräterische Elemente in der Heimat, angestachelt und geleitet vom Weltjudentum. Das deutsche Volk wäre von seiner Substanz her unbesiegbar gewesen, hätte es nicht den Fehler gemacht, allzu lange Zeit Schädlinge unter sich zu dulden, die ihm heimtückisch alle Kraft und alle Moral aussaugen: die Juden. Die Juden wissen genau, dass es eine natürliche Feindschaft zwischen ihnen und dem arischen Volk gibt, eine Feindschaft, die unweigerlich ausgetragen werden muss, in einem Kampf, den nur eines der beiden Völker überleben kann. Dieser Kampf, meine Herren, findet jetzt statt, in diesem Moment! Und der Arier darf ihn nicht verlieren, denn das wäre gleichbedeutend mit dem Verderben für die gesamte Menschheit, deren Kulturträger er ist.«
Er blieb vor dem Tisch stehen, auf dem sein Telephon lag, nahm es auf. »Wir sind im Osten in einer gefährlichen Situation, das wissen Sie. Unser Schicksal steht auf Messers Schneide. Doch es wäre ein Fehler, zu glauben, es würde sich nur durch die Zahl der Panzerdivisionen entscheiden, die uns zur Verfügung stehen. Das ist nur die äußerliche Seite unseres Kampfes. Dieser Krieg hat aber auch eine Front im Inneren, die genauso wichtig, genauso entscheidend ist wie die Front im Osten, und diese Front gilt unserer Befreiung von den Juden. Es muss uns gelingen, das deutsche Volk vollständig und restlos von den Juden und ihrem verderblichen, zersetzenden, blutsaugerischen Einfluss zu befreien. Nur wenn dies gelingt, werden wir am Ende auch siegen.«
Er steckte das Telephon ein, sah sie der Reihe nach an. »Ich gestehe, dass ich mit Vorbehalten hierhergekommen bin«, sagte er. »Ich habe erwartet, ein unnützes Überbleibsel jener elenden Republik vorzufinden, die den endgültigen Untergang des deutschen Volkes herbeigeführt hätte, wäre nicht der Führer im entscheidenden Moment auf den Plan getreten. Doch, meine Herren, es ist Ihnen gelungen, mich zu überzeugen. Ich sehe nun, dass auch Sie hier an einer Front kämpfen, die der auf dem Felde an Bedeutung nicht nachsteht. Ja, mir scheint, die Grausamkeit und Schärfe der Daten übertrifft die des Stahls noch bei weitem. Was ich heute hier bei Ihnen gesehen habe, gibt mir die Gewissheit, dass von nun an niemand mehr vor uns sicher sein wird, niemand und nirgends. Meine Herren, Sie tragen dazu bei, dass wir ein Reich errichten, in dem abweichende, schädliche Denkweisen einfach nicht mehr existieren. Unsere Macht wird absolut sein in einem nie zuvor gekannten Sinne.«
Die anderen wirkten schwer beeindruckt. Lettke hingegen betrachtete Himmler und fragte sich, was er sich schon gefragt hatte, als er dessen Gesicht zum ersten Mal im Fernsehen gesehen hatte, nämlich woher dieser bebrillte Gnom eigentlich die Dreistigkeit nahm, für das arische Volk zu sprechen. Wer in der Führung – abgesehen vielleicht von Heydrich, dem Chef des Reichssicherheits-Hauptamts – war denn ein Arier? Nicht einmal Hitler selbst.
Das war im Grunde alles völlig lächerlich.
Aber sie waren nun mal an der Macht, und man musste sehen, wie man zurechtkam.
Erstaunlich eigentlich, dass ein so kluger Kopf wie Adamek das Ganze nicht einmal zu hinterfragen schien. Stattdessen saß er da in seinem rostigen Rollstuhl und versprach dem Reichsführer, unverzüglich ein Dossier über alle weiteren verdächtigen Personen in Amsterdam zu erstellen und ihm per Elektropost zukommen zu lassen. »Oder ausgedruckt«, fügte er hinzu. »Wie Sie es wünschen.«
Himmler winkte ab. »Klären Sie das mit dem Deportationskommando«, meinte er. »Viel wichtiger ist, dass Sie unverzüglich darangehen, dieselbe Suche für alle deutschen Städte durchzuführen. Gerade jetzt, da das Schicksal des deutschen Volkes auf Messers Schneide steht, ist es von entscheidender Bedeutung, uns restlos vom Gift der jüdischen Zersetzung zu befreien.«
»Selbstverständlich, Reichsführer«, sagte Adamek.
Lettke ließ sich auf einen Stuhl sinken, auf einmal von abgrundtiefer Erschöpfung erfüllt. Davongekommen. Er war einmal mehr davongekommen.
***
Sie geleiteten den Reichsführer und seine Entourage wieder zu den Autos, alle bis auf Adamek, und sahen den schwarzen Wagen nach, wie sie gelassen wieder von dannen rollten. Kaum waren sie verschwunden, entlud sich die Anspannung, die sie erfüllt hatte, in Gelächter und Schulterklopfen. Sie hatten es geschafft, geschafft, geschafft! Ihr Plan hatte funktioniert! Das NSA würde bleiben, was es war!
Auch Helene bekam Lob ab: Wie gut sie das gemacht hatte und alles so schnell und prompt und ohne einen einzigen Fehler! Sogar die Völkers rang sich zu so etwas wie einem Wort der Anerkennung durch, doch auch das hörte Helene kaum. Sie nickte nur, spürte, wie ihr Gesicht das Lächeln produzierte, das alle zu sehen erwarteten, relativierte das Lob, wie es sich gehörte, denn: Hatten sie nicht alle Anteil daran?
All das tat sie ganz automatisch, musste gar nicht nachdenken, ihre gute Erziehung ließ sie genau wissen, was zu sagen und was zu tun war. Anders wäre es nicht gegangen, nicht, wenn sie hätte darüber nachdenken müssen, denn alles, was sie denken konnte, war, dass sie gerade dazu beigetragen hatte, den Mann, den sie liebte wie nichts anderes auf der Welt, dem sicheren Tod zu überantworten.
Du möchtest mehr über »NSA – Nationales Sicherheits-Amt« erfahren? Werde Teil unserer großen Online-Community und erfahre mehr über Andreas Eschbach, Helene und Arthur.
Willst Du wissen, wie es weitergeht? Dann bestell Dir gleich die vollständige eBook-Ausgabe von »NSA – Nationales Sicherheits-Amt«!
Interview mit Andreas Eschbachzu seinem RomanNSA – Nationales Sicherheits-Amt
Was war die Initialzündung für Ihren neuen Roman?