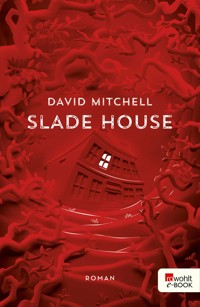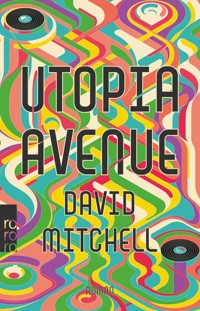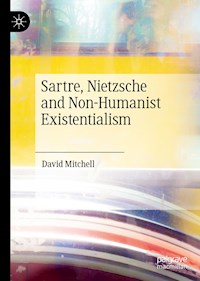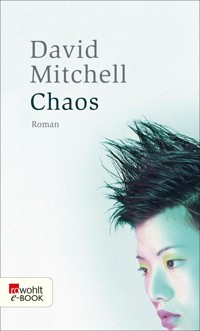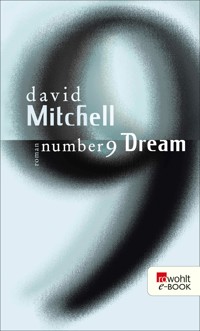
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tagträume und Albträume in Tokio. Der neunzehnjährige Träumer Eiji Miyake kommt aus dem ländlichen Japan nach Tokio, um seinen Vater zu suchen, der die Familie früh verlassen hat. Während er in der faszinierenden großen Stadt herumirrt, gerät er in Berührung mit den Kräften, die ihre geheime Unterwelt beherrschen: Yakuza-Gangs und Cyberpunks. Plötzlich ist das Rätsel der Identität seines Vaters nur noch eines von vielen, die er lösen muss. Warum ist die Grenze zwischen der Welt seiner Erfahrungen und der seiner Träume so verschwommen? Und was hat es mit dem Geheimnis der Zahl 9 auf sich? Diese Fragen verlangen Eiji Einsichten ab, die jedem schwerfielen, erst recht einem Jungen vom Lande, der weniger Geld in der Tasche hat, als das titelgebende Album mit dem Lennon-Song kostet. «Das ist nicht nur ein Vergnügen, das ist große, wirklich großartige Literatur.» (The Observer) «David Mitchell ist atemberaubend gut, einer der besten Erzähler seiner Generation.» (Neue Zürcher Zeitung) «Eine irre Mischung aus Thriller, Tragödie, Fantasy, Videospiel und ein beunruhigendes Panorama des modernen Tokio.» (The Guardian) «‹Number 9 Dream› ist so voller Geschichten, so voller verschiedenster Ebenen, dass der Roman schier zu zerbersten droht. Dass das Ganze trotz allem lesbar bleibt und die Lektüre wirklich Spaß macht, beweist, dass Mitchell einer der interessantesten Autoren der Jetztzeit ist.» (ORF) «Ein hochpoetisches Buch über Selbsterkenntnis und Nachhausekommen.» (Neon)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
David Mitchell
Number 9 Dream
Roman
Aus dem Englischen von Volker Oldenburg
Für Keiko
«Es ist sehr viel einfacher,
die Wirklichkeit zu begraben,
als Träume loszuwerden.»
Don DeLillo, Americana
EINS
PanOpticon
«Die Sache ist ganz einfach. Ich kenne Ihren Namen, und Sie haben einmal meinen gekannt: Eiji Miyake. Ja, der Eiji Miyake. Wir sind beide vielbeschäftigte Leute, Frau Kato, also lassen wir den Smalltalk. Ich bin in Tokio, um meinen Vater zu finden. Sie kennen seinen Namen, Sie kennen seine Adresse. Und Sie werden mir beides geben. Jetzt!» Oder so ähnlich. Ein Spiralnebel aus Sahne zerrinnt in meiner Kaffeetasse, und die Hintergrundgespräche zoomen an mein Ohr. Der erste Vormittag in Tokio, und schon wachse ich über mich hinaus. Mittagspausenlachen, Freitagsintrigen und Untertassengeklapper schwappen durchs Jupiter Café. Ameisen blaffen in ihre Handys. Ameisenweibchen pressen ihre Stimmen nach oben, damit sie femininer klingen. Kaffee, Meeresfrüchte-Sandwiches, Putzmittel, Dampf. Gegenüber auf der anderen Straßenseite sehe ich den Haupteingang des PanOpticons. Ziemlich beeindruckend, der gespenstische Zirkoniumturm. Die oberen Stockwerke verschwinden in den Wolken. Tokio schwitzt unter seinem luftdichten Deckel: 34°C, 86% Feuchtigkeit. So steht es auf dem großen Panasonic-Bildschirm. Tokio ist so nah, dass man es nicht immer sehen kann. Kein Abstand. Alles befindet sich über dir – Zahnärzte, Kindergärten, Tanzschulen. Sogar die Straßen und Bürgersteige stehen auf schmutzigen Stelzen. Venedig mit abgelassenem Wasser. Flugzeugspiegelbilder steigen an den gläsernen Fassaden auf. Ich dachte immer, Kagoshima sei riesig, aber man könnte es problemlos in einer Seitengasse von Shinjuku verlieren. Ich zünde mir eine Zigarette an – Kool, die Marke, die der Motorradtyp vor mir in der Schlange gekauft hat – und beobachte den Verkehr und die Passanten an der Kreuzung Omekaido Avenue und Kita Street. Ameisen in Nadelstreifen, eine Friseurin mit Lippen-Piercing, 12-Uhr-Besoffene, Hausfrauen, beladen mit Kindern. Niemand steht still. Flüsse, Schneestürme, Verkehr, Bytes, Generationen, tausend Gesichter pro Minute. Auf Yakushima sind es tausend Minuten pro Gesicht. Alle diese Leute haben Kartons voll mit Erinnerungen, auf denen «Eltern» steht. Schöne Bilder, schlimme Bilder, verwackelte, furchteinflößende, liebevolle, zerkratzte Negative – das spielt keine Rolle, sie wissen, wer sie in die Welt gesetzt hat. Ich warte auf Akiko Kato. Das Jupiter Café ist das nächste Restaurant beim PanOpticon. Es wäre so viel leichter, wenn du einfach auf ein Sandwich und einen Kaffee hereinkämest. Ich werde dich erkennen, dir meinen Namen sagen und dich davon überzeugen, dass das natürliche Recht auf meiner Seite ist. Wie lassen sich Tagträume in Realität verwandeln? Ich seufze. Nicht sehr gut, nicht sehr oft. Ich muss wohl deine Festung stürmen, um zu bekommen, was ich will. Gar nicht gut. Ein Gebäude von der Größe des PanOpticons hat wahrscheinlich viele Ausgänge und ein eigenes Restaurant. Wahrscheinlich bist du längst eine Kaiserin – mit Sklaven, die dir das Mittagessen bringen. Und wer sagt denn, dass du überhaupt zu Mittag isst? Vielleicht reicht dir ein Menschenherz zum Frühstück, und dann hältst du bis zum Abend durch. Ich bestatte meine Kool zwischen den Überresten ihrer Vorfahren und beschließe, die Observierung zu beenden, wenn die Kaffeetasse leer ist. Ich kriege dich, Akiko Kato. Drei Kellnerinnen arbeiten im Jupiter Café. Eine – die Chefin – ist kalt wie eine Kaiserinwitwe, die ihren Gemahl mit schlechter Laune vergiftet hat, eine röhrt wie ein Esel, und die dritte wendet mir den Rücken zu, aber sie hat den schönsten Hals der Welt. Witwe berichtet Esel von der jüngsten gescheiterten Ehe ihres Friseurs. «Wenn seine Frauen mit seinen Phantasien nicht mehr mithalten können, schmeißt er sie raus.» Die Kellnerin mit dem schönsten Hals verbüßt lebenslänglich an der Spüle. Zeigen Witwe und Esel ihr die kalte Schulter, oder ist es umgekehrt? Das PanOpticon verschwindet mehr und mehr – jetzt haben die Wolken schon den 18. Stock. Während ich den Blick abwende, senkt sich der Schleier noch tiefer. Ich rechne auf einer Papierserviette aus, wie viele Tage ich schon auf der Welt bin – 7290, vier Schaltjahre inbegriffen. Die Uhr zeigt fünf vor eins, und die Ameisen strömen aus dem Café. Wahrscheinlich fürchten sie, dass sie Opfer von Umstrukturierungsmaßnahmen werden, wenn sie nicht Punkt eins an ihren neonbestrahlten Arbeitsplätzen sitzen. Meine Kaffeetasse steht leer in einer Pfütze aus Übergeschwapptem. Gut. Wenn der Stundenzeiger die Eins berührt, gehe ich ins PanOpticon. Ich gebe zu, ich habe Schiss. Schisshaben ist cool. Letztes Jahr kam ein Rekrutierungsbeamter von der Armee an meine Schule, und er meinte, dass keine Kampftruppe Leute haben wolle, die keine Angst kennen – Soldaten ohne Angst würden die gesamte Einheit innerhalb der ersten fünf Kampfminuten mit sich in den Tod reißen. Ein guter Soldat kontrolliert seine Angst und setzt sie ein, um seine Sinne zu schärfen. Noch einen Kaffee? Nein. Noch eine Kool, um meine Sinne zu schärfen.
Die Uhr geht auf halb zwei – die Frist ist abgelaufen. Der Aschenbecher quillt über. Ich schüttle die Zigarettenschachtel – nur noch eine drin. Die Wolken hängen über dem neunten Stock des PanOpticons. Akiko Kato blickt aus dem Fenster ihres klimatisierten Büros in den Nebel. Spürt sie mich, so wie ich sie spüre? Ahnt sie, dass heute einer der Tage ist, die das ganze Leben verändern? Noch eine letzte, allerallerletzte Zigarette: Dann starte ich den Angriff, bevor aus «Schiss haben» «den Schwanz einziehen» wird. Als ich kam, saß ein alter Mann im Jupiter Café. Seitdem spielt er pausenlos mit seinem Vidboy. Er sieht genauso aus wie Laozi in meinem Schulbuch – glatzköpfig, bärtig, spinnert. Neue Gäste kommen, bestellen, essen und trinken eilig und brechen nach wenigen Minuten wieder auf. Zusammen sind es Jahrzehnte. Aber Laozi rührt sich nicht vom Fleck. Die Kellnerinnen denken bestimmt, meine Freundin hätte mich versetzt, oder sie halten mich für einen Psychopathen, der Frauen auf dem Heimweg nachstellt. Eine Fahrstuhlversion von Imagine spielt, und John Lennon schreckt in seinem Sarg auf. Sie ist unglaublich schlecht. Sogar die Verräter, die diesen Albtraum aufgenommen haben, fanden sie zum Würgen. Zwei Schwangere betreten das Café und bestellen Zitroneneistee. Laozi hustet den Husten der Hoffnungslosen und tupft mit dem Hemdsärmel den Schleim vom Display seines Vidboys. Ich ziehe Rauch in meine Lunge und lasse ihn langsam durch die Nase ausströmen. Was Tokio braucht, ist eine ordentliche, reinigende Überschwemmung. Mandolinespielende Gondolieri fahren in Steckkähnen durch Ginza. «Ich meine», fährt Witwe fort, «seine Frauen sind alles geldgeile Trippeltussis, die haben es nicht anders verdient. Wenn du mal heiratest, such dir bloß einen Mann aus, dessen Träume dasselbe Format haben wie deine.» Ich schlürfe den Schaum von meinem Kaffee. Am Tassenrand klebt Lippenstift. Ich konstruiere einen Rechtsfall und lege dem Gericht dar, dass ich, wenn ich genau von dieser Stelle trinke, eine fremde Frau küsse. Das würde die Zahl der Mädchen, die ich geküsst habe, auf drei erhöhen, immer noch unter dem Landesdurchschnitt. Ich schaue mich nach einem küssbaren Mädchen um und entscheide mich für die Kellnerin mit dem lebendigen, klugen, mondbeschienenen Bratschenhals. Eine Strähne hat sich aus ihrem Haar gelöst und streichelt ihren Nacken. Es kitzelt. Ich vergleiche die fuchsienrosa Spuren auf der Tasse mit dem Rosa ihres Lippenstifts. Indizienbeweis, wie man es dreht und wendet. Wer weiß, wie oft die Tasse schon in der Spülmaschine gewesen ist. Wahrscheinlich sind die Lippenstiftatome längst mit den Porzellanmolekülen verschmolzen. Und außerdem, eine Tokioterin mit Stil wie sie hat so viele Verehrer, dass man das Adressbuch eines Palmtops damit füllen kann. Klage abgewiesen. Laozi knurrt seinen Vidboy an. «Scheiß Bioborgs, verdammt. Immer dieselbe Scheiße.» Ich trinke den letzten Schluck Kaffee und setze mir die Baseballmütze auf. Zeit, meinen Erzeuger aufzuspüren.
Die Eingangshalle des PanOpticons – riesig wie der Bauch eines Steinwals – verschluckt mich mit Haut und Haaren. Pfeile auf dem Fußboden tasten meine Füße ab und lotsen mich zu einem freien Platz an der Anmeldung. Eine Tür schließt sich zischend hinter mir, versiegelt die unterirdische Finsternis. Ein Tracerstrahl scannt mich und registriert piepend den Barcode auf meinem ID-Schild. Gelbes Licht geht an, und ich starre auf mein Spiegelbild. Die Verkleidung ist auf jeden Fall gelungen. Overall, Baseballmütze, Werkzeugkiste, Klemmbrett. Eine Frostschöne erscheint vor mir auf dem Bildschirm. Ihr Gesicht ist Symmetrie in Vollendung. SECURITY leuchtet auf dem Abzeichen an ihrem Revers. «Nennen Sie Ihren Namen», sagt sie ausdruckslos, «und Ihren Beruf.» Ich überlege, wie viel Mensch wohl in ihr steckt. Heutzutage vermenschlichen sich die Computer, und die Menschen computerisieren sich. Ich spiele den tief beeindruckten Tölpel. «Tagchen. Ich heiße Ran Sogabe. Ich komme von den Goldfischfreunden.»
Sie runzelt die Stirn. Hervorragend. Sie ist nur ein Mensch. «Goldfischfreunde?»
«Noch nie unsere Werbung gesehen?» Ich singe ein Jingle. «Wir kümmern uns um unsere feuchten Kameraden –»
«Warum wünschen Sie Zutritt zum PanOpticon?»
Ich mache auf verdutzt. «Ich betreue das Aquarium von Osugi und Kosugi.»
«Osugi und Bosugi.»
Ich schaue auf das Klemmbrett. «Ja, genau die.»
«Ich erkenne einige ungewöhnliche Gegenstände in Ihrer Werkzeugkiste.»
«Frisch eingetroffen aus Deutschland. Darf ich Ihnen den Ionenpellet-Popper aus Fluorocarb vorstellen? – Ich brauche Ihnen sicher nicht zu sagen, wie ungeheuer wichtig pH-Stabilität für ein optimales Aquariumsklima ist. Soweit uns bekannt ist, sind wir die ersten Aquaristikspezialisten in diesem Land, die dieses kleine Wunder einsetzen. Darf ich Ihnen kurz –»
«Legen Sie die rechte Hand auf den Zugangsscanner, Herr Sogabe.»
«Ich hoffe, das kitzelt.»
«Das ist Ihre linke Hand.»
«’tschuldigung.»
Eine kurze Ewigkeit vergeht, dann blinkt in grüner Schrift BEFUGT auf.
«Ihr Zugangscode?»
Sie ist wachsam. Ich kneife die Augen zu. «Momentchen: 313–636–969.»
Die Lider der Frostschönen zucken. «Der Zugangscode ist gültig.»
Das will ich auch gehofft haben. Für diese neun Ziffern habe ich dem genialsten Superhacker Tokios ein Vermögen bezahlt. «Für Juli. Ich muss Sie daran erinnern, dass wir jetzt August haben.»
Elendes hirndiarrhöisches Hackerpack. «Äh, is’ ja merkwürdig.» Ich kratze mich im Schritt, um einen Moment Zeit herauszuschinden. «Das ist der Code, den mir Frau» – ein betrübter Blick auf mein Klemmbrett – «Akiko Kato gegeben hat, Partnerin in der Kanzlei Osugi und Kosugi.»
«Bosugi.»
«Oder so. Herrje, wenn mein Zugangscode ungültig ist, muss ich wohl draußen bleiben, nicht? Wie schade. Wenn Frau Kato nachfragt, warum ihre sündhaft teuren Okinawa-Silberrücken an Kotvergiftung krepiert sind, werde ich sie an Sie verweisen. Wie war doch gleich Ihr Name?»
Frostschönes Miene verhärtet sich. Die Übereifrigen sind leicht zu bluffen. «Prüfen Sie Ihren Zugangscode und kommen Sie morgen wieder.»
Ich schnaube verärgert und schüttle den Kopf. «Unmöglich! Wissen Sie, wie viele Fische zu meinem Revier gehören? Früher haben wir das alles nicht so eng gesehen, aber seit das oberste Gebot umfassendes Qualitätsmanagement heißt, operieren wir im Stundentakt. Ein versäumter Termin, und unsere feuchten Kameraden sind Phosphatdünger. Während wir uns hier über Peanuts streiten, drohen im Rathaus von Tokio neunzig Kaiserfische an Atemlähmung zu verenden. Nichts für ungut, aber für unseren Schadensersatzvordruck muss ich darauf bestehen, dass Sie mir Ihren Namen nennen.»
Frostschöne zuckt.
Ich lenke ein. «Warum rufen Sie nicht Frau Katos Sekretärin an. Sie wird Ihnen den Termin bestätigen.»
«Schon erledigt.» Jetzt kriege ich es mit der Angst zu tun. Wenn mein Hacker auch mit meinem Decknamen Mist gebaut hat, bin ich erledigt. «Offenbar ist Ihr Termin erst morgen.»
«Ja. Ganz richtig. Der Termin war für morgen. Aber gestern Nacht wurde vom Fischereiministerium eine landesweite Warnung ausgegeben. Durch verseuchte Silberrücken aus Taiwan ist, äh, eine Ebola-Epidemie ausgebrochen. Der Erreger dringt durch die Filter, nistet sich in den Kiemen ein und … ein ekelhafter Anblick. Die Fische schwellen an, bis ihnen förmlich die Gedärme rausspringen. Die Forschung bastelt fieberhaft an einem Wirkstoff, aber unter uns zwei Hübschen …»
Frostschöne bricht ein. «Ich erteile Ihnen Sonderzutritt für zwei Stunden. Gehen Sie vom Empfang zum Turbofahrstuhl. Folgen Sie strikt den Sensorpfeilen, oder Sie lösen Alarm aus und werden wegen unerlaubten Zutritts belangt. Der Fahrstuhl bringt Sie automatisch in den 81. Stock zu Osugi und Bosugi.» «81. Stock, Herr Sogabe», meldet der Fahrstuhl. «Ich freue mich, Ihnen bald wieder zu Diensten zu sein.»
Die Tür geht auf, und ich betrete einen virtuellen Regenwald aus Topfpflanzen und Farnen. Telefone trillern wie ein ganzes Vogelhaus. Hinter einem Ebenholzschreibtisch setzt eine junge Frau die Brille ab und stellt ihren Wasserzerstäuber weg. «Der Sicherheitsdienst hat Herrn Sogabe angemeldet.»
«Lassen Sie mich raten! Kazuyo, richtig?»
«Ja, aber …»
«Kein Wunder, dass Ran Sie seinen Engel im PanOpticon nennt!»
Die Empfangsdame lässt sich nicht beirren. «Sie heißen?»
«Joji, Rans Lehrling! Sagen Sie jetzt nicht, er hat noch nie von mir erzählt! Normalerweise bin ich für Harajuku zuständig, aber diesen Monat betreue ich seine Kunden in Shinjuku – wegen seiner, äh, seiner Genitalmalaria.»
Ihr Gesicht fällt zusammen. «Wie bitte?»
«Hat Ran das nie erwähnt? Na, wer kann es ihm verdenken? Der Chef glaubt, es handelt sich bloß um eine schwere Erkältung, darum hat Ran seinen Kunden nicht Bescheid gesagt … Alles streng geheim!» Ich lächele verhalten und schaue mich nach Videokameras um. Nichts zu sehen. Ich knie mich hin, klappe die Werkzeugkiste auf, sodass der Deckel ihr die Sicht versperrt, und setze meine Geheimwaffe zusammen. «War verdammt schwierig, hier reinzukommen. Künstliche Intelligenz? Künstliche Dummheit! Frau Katos Büro ist am Ende des Gangs, richtig?»
«Ja, aber … ich muss Sie leider um einen Netzhautscan bitten, Herr Joji.»
«Kitzelt das?» Fertig. Ich klappe die Kiste zu, verstecke die Hände hinter dem Rücken und gehe mit dümmlichem Grinsen auf sie zu. «Wo soll ich hingucken?»
Sie richtet einen Scanner auf mich. «In die Linse.»
«Kazuyo.» Ich vergewissere mich, dass wir allein sind. «Ran hat mir erzählt, dass Sie, na ja – stimmt das?»
«Ob was stimmt?»
«Dass Sie elf Zehen haben.»
«Elf was?» Als sie den Blick auf ihre Füße senkt, jage ich ihr so viel Sofortschlaf-Mikroschrot in den Hals, dass man die gesamte chinesische Armee damit ausschalten könnte. Sie fällt auf die Schreibunterlage. Zu meiner eigenen Belustigung mache ich ein geistreiches Wortspiel im Stil von James Bond.
Ich klopfe dreimal. «Die Goldfischfreunde, Frau Kato!»
Geheimnisvolle Stille. «Herein.»
Ich überzeuge mich, dass im Gang keine Zeugen sind, und trete rasch ein. Frau Katos Bau kommt den Bildern meiner Phantasie sehr nah. Karierter Teppichboden. Vor dem geschwungenen Fenster eine unruhige Wolke. Eine Wand mit altmodischen Rollladenschränken. Eine andere mit Gemälden, die zu geschmackvoll sind, um den Blick zu fesseln. Zwischen zwei halbrunden Sofas steht ein kugelförmiges Aquarium. In einem Korallenpalast und einem gesunkenen Schlachtschiff tummelt sich eine Flotte Okinawa-Silberrücken. Neun Jahre sind vergangen, seit ich Akiko Kato zum letzten Mal begegnet bin, aber sie ist nicht einen Tag älter geworden. Ihre Schönheit ist genauso kalt und unbarmherzig wie damals. Sie blickt von ihrem Schreibtisch auf. «Sie sind nicht der Mann vom Zierfischservice, der sonst immer kommt.»
Ich schließe die Tür ab und lasse den Schlüssel in die Tasche mit der Pistole gleiten. Sie mustert mich.
«Ich bin nicht vom Zierfischservice.»
Sie legt den Stift beiseite. «Was fällt Ihnen ein …»
«Die Sache ist ganz einfach. Ich kenne Ihren Namen, und Sie haben einmal meinen gekannt: Eiji Miyake. Ja, der Eiji Miyake. Stimmt, es ist viele Jahre her. Hören Sie zu. Wir sind beide vielbeschäftigte Leute, also lassen wir den Smalltalk. Ich bin in Tokio, um meinen Vater zu finden. Sie kennen seinen Namen, Sie kennen seine Adresse. Und Sie werden mir beides geben. Jetzt!»
Akiko Kato vergewissert sich mit schnellem Blick, ob ich die Wahrheit sage. Sie lacht. «Eiji Miyake?»
«Ich weiß nicht, was daran so witzig ist.»
«Nicht Luke Skywalker? Oder Zax Omega? Glaubst du wirklich, ich lasse mich von deinem lächerlichen Auftritt beeindrucken und falle vor Ehrfurcht auf die Knie? ‹Junger Insulaner begibt sich auf gefahrvolle Reise, um den Vater zu finden, den er nie kennengelernt hat?› Weißt du, was mit Bengeln wie dir passiert, wenn sie aus ihrer Traumwelt gerissen werden?» Sie schüttelt mit gespieltem Mitleid den Kopf. «Sogar meine Freunde nennen mich die bösartigste Anwältin Tokios. Und du platzt hier rein und glaubst, du kannst mich derart einschüchtern, dass ich vertrauliche Informationen über einen Mandanten herausgebe? Bitte!»
«Frau Kato.» Ich zücke meine Walther PKK 7,65mm, wirbele sie elegant herum und ziele auf sie. «In diesem Raum liegt eine Akte über meinen Vater. Geben Sie sie mir. Bitte.»
Sie spielt die Empörte. «Ist das eine Drohung?»
Ich entsichere die Pistole. «Das will ich meinen. Hände so, dass ich sie sehen kann.»
«Du hast das falsche Drehbuch erwischt, Junge.» Sie greift zum Telefon. Es zerbirst, eine Plastiksupernova. Die Kugel prallt an der Panzerglasscheibe ab und zerfetzt ein Bild mit grellen Sonnenblumen. Akiko Kato stiert auf den Riss. «Du Barbar! Du hast meinen van Gogh zerstört! Das wirst du bezahlen!»
«Was mehr wäre, als Sie je getan haben. Die Akte. Sofort.»
Akiko Kato faucht. «In dreißig Sekunden ist der Sicherheitsdienst hier.»
«Ich kenne die digitalen Schaltpläne dieses Büros. Schalldicht, spionagesicher. Nachrichten gehen weder rein noch raus. Schluss mit dem Getöse. Geben Sie mir die Akte!»
«Du hättest auf Yakushima so ein schönes Leben haben können. Orangen pflücken mit deinen Onkeln und deiner Großmutter.»
«Ich will Sie nicht noch einmal bitten.»
«Wenn das Ganze nur so einfach wäre. Aber dein Vater hat zu viel zu verlieren. Wenn durchsickert, dass er einen unehelichen Hurensprössling gezeugt hat – dich –, würde das so mancher einflussreichen Persönlichkeit die Schamesröte ins Gesicht treiben. Darum haben wir vereinbart, dass ich die Angelegenheit gegen ein bescheidenes Honorar unter Verschluss halte.»
«Das heißt?»
«Das heißt, dass du unser trautes kleines Abkommen gefährdest.»
«Ah, ich verstehe. Wenn ich meinen Vater finde, können Sie ihn nicht länger erpressen.»
«‹Erpressung› ist ein gewagtes Wort für einen Jungen, der noch auf der Suche nach der besten Pickelcreme ist. Als Anwältin deines Vaters bin ich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Schon mal gehört, dieses Wort? Es unterscheidet anständige Bürger von bewaffneten Kriminellen.»
«Ich verlasse dieses Büro nicht ohne die Akte.»
«Dann hast du hoffentlich viel Wartezeit mitgebracht. Ich würde uns ja einen Imbiss bestellen, aber du hast mein Telefon zerschossen.»
Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. «Also schön, lassen Sie uns darüber wie halbwegs Erwachsene reden.» Ich senke die Pistole, und Akiko Kato gönnt sich ein dreistes Siegeslächeln. Das Schlafschrot bohrt sich in ihren Hals. Sie kippt in ihren Stuhl zurück, bewusstlos wie der tiefe blaue Ozean.
Schnelligkeit ist alles. Ich ziehe Akiko Katos Fingerkuppen über die von Ran Sogabe und gehe an ihren Computer. Den Stuhl mit der bewusstlosen Frau schiebe ich in eine Ecke. Unangenehm – ich muss ständig daran denken, dass sie bald wieder zu sich kommt. Alle wichtigen Dateien sind passwortgeschützt, aber die Sperrung der Aktenschränke kann ich aufheben. MI für MIYAKE. Mein Name erscheint im Bildschirmmenü. Doppelklick. EIJI. Doppelklick. Ein vielversprechendes Scheppern, und ein Rollladen gleitet nach unten. Ich gehe die flachen Metallkassetten durch. MIYAE – EIJI – VATERSCHAFT. Die Kassette glänzt golden.
«Fallen lassen.»
Akiko Kato stößt mit dem Fuß die Tür zu und zielt mit einer Zuvre Lone Eagle .440 genau zwischen meine Augen. Stumm sehe ich zu der Akiko Kato, die zusammengesunken auf ihrem Stuhl hängt. Die andere Kato lacht, ein breites, grimassenhaftes Grinsen. Ihre Zähne sind mit Rubinen und Smaragden besetzt. «Ein Bioborg, Dummkopf! Ein Replikant! Hast du nie den Blade Runner gesehen? Wir haben dich beobachtet! Unser Spion hat dich im Jupiter Café aufgespürt – der alte Mann, für den du Zigaretten gekauft hast. Sein Vidboy ist eine Eyecam, die mit dem Zentralrechner des PanOpticons verbunden ist. Und jetzt knie dich hin – langsam – und schieb die Waffe rüber. Langsam. Mach mich nicht nervös. Aus dieser Entfernung zermatscht dir eine Zuvre dein Gesicht so, dass deine eigene Mutter dich nicht wiedererkennen würde. Aber das war ja ohnehin nie ihre Stärke, nicht wahr?»
Ich gehe nicht auf ihre höhnische Bemerkung ein. «Sehr unklug, sich einem Eindringling ohne Schutz zu nähern.»
«Die Akte deines Vaters ist ein hochbrisantes Dokument.»
«Dann hat Ihr Bioborg also die Wahrheit gesagt. Sie wollen das Schweigegeld, das mein Vater Ihnen zahlt, weiter kassieren.»
«Anstatt über moralisches Handeln im Alltag zu sinnieren, solltest du dir lieber überlegen, wie du mich daran hinderst, Rührei aus dir zu machen.» Sie beugt sich hinunter und greift, ohne mich aus den Augen zu lassen, nach der Walther. Ich richte die Kassette auf ihr Gesicht und lasse die Schnappschlösser aufspringen. Die auf der Deckelinnenseite montierte Sprengladung explodiert grell vor ihren Augen. Sie schreit auf, ich mache eine Flugrolle, die Zuvre geht los, Glas splittert, ich hechte auf sie zu, verpasse ihr einen Tritt an den Kopf, entreiße ihr die Waffe – ein zweiter Schuss löst sich –, wirble sie herum und befördere sie mit einem Kinnhaken über das halbrunde Sofa. Eine Flut Silberrücken ergießt sich auf den Teppich. Die echte Akiko Kato bleibt reglos liegen. Ich stopfe die versiegelte Akte meines Vaters in den Overall, packe meine Werkzeugkiste und schließe leise die Tür hinter mir, während die Nässe langsam in den Teppichboden auf dem Gang sickert. Auf dem Weg zum Fahrstuhl pfeife ich lässig Imagine. Das war der leichte Teil. Jetzt muss ich nur noch lebend aus dem PanOpticon hinauskommen.
Ameisen wieseln aufgeregt um die Empfangsdame, die immer noch vornübergekippt in ihrem Regenwald liegt. Abgefahren. Überall, wo ich hingehe, hinterlasse ich eine Spur aus ohnmächtigen Frauen. Ich hole den Fahrstuhl und simuliere das nötige Maß an Besorgnis. «Sick-Building-Syndrom nennt mein Onkel das. Fische werden auch davon befallen, ob Sie’s glauben oder nicht.» Der Fahrstuhl kommt, und eine alte Krankenschwester stürmt heraus und boxt die Schaulustigen zur Seite. Ich gehe hinein und drücke auf Schließen, damit der Fahrstuhl mich entführt, bevor noch jemand anderes einsteigt.
«Nicht so eilig!» Ein blankgeputzter Stiefel zwängt sich in den Spalt, und ein Wachmann drückt die Tür auf. Er ist bullig wie ein Minotaurus, und seine Nüstern blähen sich. «Ground Zero, junger Freund.»
Ich drücke Erdgeschoss, und der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung.
«Na, was sind Sie?», fragt Minotaurus. «Ein Industriespion?»
Blut und Adrenalin rauschen kreuz und quer durch meine Adern. «Was?»
Minotaurus verzieht keine Miene. «Sie wollen wohl ’nen schnellen Abgang hinlegen. Darum haben Sie mich in der Fahrstuhltür eben eingeklemmt.»
Ach so. Ein Scherz. «Sie haben’s erfasst.» Ich klopfe auf die Werkzeugkiste. «Randvoll mit Goldfischspionagematerial.»
Minotaurus lacht schnaubend.
Der Fahrstuhl wird langsamer, und die Tür geht auf. «Nach Ihnen», sage ich, obwohl Minotaurus keine Anzeichen macht, mir den Vortritt zu lassen. Er verschwindet durch eine Seitentür. Die Fußbodenpfeile lotsen mich zur Sicherheitsschranke. Ich strahle die Frostschöne an. «So schnell begegnen wir uns wieder? Da hat das Schicksal seine Hand im Spiel.»
Ihre Augen huschen über den Scanner. «Ich befolge nur die Vorschriften.»
«Oh.»
«Sie haben Ihren Auftrag erledigt?»
«Zur vollsten Zufriedenheit, vielen Dank. Wir von den Goldfischfreunden dürfen mit Stolz behaupten, dass wir in unserer achtzehnjährigen Geschäftstätigkeit noch nie einen Fisch durch fahrlässiges Verhalten verloren haben. Jeder Fisch wird obduziert, um die Todesursache festzustellen. Es ist immer Altersschwäche. Oder eine vom Kunden verschuldete Alkoholvergiftung während der Jahresendfeiern. Wenn Sie Zeit haben, könnte ich Ihnen beim Abendessen mehr darüber erzählen.»
Frostschöne schockgefriert mich. «Wir haben nicht das Geringste gemeinsam.»
«Wir bestehen beide aus Kohlenstoff. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich.»
«Falls Sie vorhaben, mich zu verärgern, um mich davon abzulenken, dass in Ihrer Werkzeugkiste eine Zuvre .440 liegt, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass die Mühe umsonst ist.»
Ich bin Profi. Die Angst muss warten. Wie konnte ich nur so dumm sein? «Das ist völlig unmöglich.»
«Die Waffe ist auf Akiko Kato registriert.»
«Aaah!» Ich öffne kichernd den Kasten und hole die Pistole heraus. «Meinen Sie die hier?»
«So ist es.»
«Sicher?»
«Ganz sicher.»
«Die ist, äh …»
«Ja?» Frostschöne streckt die Hand nach dem Alarmknopf aus.
«… dafür!» Beim ersten Schuss verwandelt sich das Glas in eine Blüte – Alarmsirenen schrillen –, beim zweiten Schuss wird es zum Labyrinth – ich höre Gas zischen –, beim dritten zerbirst es, und ich werfe mich durchs Fenster – schnelle Schrittgeräusche und Geschrei – und lande in der Eingangshalle zwischen den blinkenden Pfeilen. Frauen und Männer gehen erschrocken in Deckung. Lärm und wildes Durcheinander. Aus einem Gang nähern sich stampfenden Schrittes die Wachleute. Ich löse die Zweifachsicherung der Zuvre, schalte auf Plasma-Dauerfeuer, werfe sie den Wachleuten entgegen und hechte zum Ausgang. Die drei Sekunden bis zur Zündung lassen mir nicht genug Zeit – die Explosion reißt mich nach oben, schleudert mich durch die Drehtür und katapultiert mich mit einem Salto die Eingangstreppe hinunter. Eine Waffe, die den Benutzer in die Luft sprengen kann – kein Wunder, dass die Zuvre-Produktion nur neun Wochen nach der Markteinführung eingestellt wurde. Hinter mir Chaos, Qualm und Sprinklerregen. Um mich herum Bestürzung, Auffahrunfälle und das, was ich jetzt am besten gebrauchen kann – verängstigte Leute. «Ein Verrückter!», schreie ich. «Ein Verrückter läuft frei herum! Handgranaten! Er hat Handgranaten! Rufen Sie die Polizei! Wir brauchen Hubschrauber! Hubschrauber! Massenweise Hubschrauber!» Humpelnd eile ich ins nächste Kaufhaus.
Ich nehme die in Plastik eingeschweißte Akte meines Vaters aus der neuen Aktentasche und halte im Geiste den Moment für die Nachwelt fest. Am 24. August um fünf vor halb drei – der Himmel über der Westseite des Yoyogi-Parks ist fleckig wie der Futon eines Junggesellen – erfahre ich, nicht einmal vierundzwanzig Stunden nach meiner Ankunft in Tokio, auf dem Rücksitz eines Bioborg-Taxis die wahre Identität meines Vaters. Nicht schlecht. Ich ziehe die Krawatte gerade und stelle mir vor, dass Anju mit schwingenden Beinen neben mir sitzt. «Siehst du?», sage ich und tippe auf die Akte. «Hier ist alles drin. Sein Name, sein Gesicht, sein Haus, wer er ist und was er ist. Ich hab’s geschafft. Für uns beide.» Ein Krankenwagen fährt mit heulenden Sirenen auf uns zu, und das Taxi schert zur Seite aus. Ich ritze mit dem Fingernagel die Folie auf und nehme die Akte heraus. EIJI MIYAKE. IDENTITÄT DES VATERS. Ich atme tief durch, und Fernes fühlt sich plötzlich nah an.
Seite eins.
Die Tinte reagiert auf die Luft und löst sich schon auf.
Laozi knurrt seinen Vidboy an. «Scheiß Bioborgs, verdammt. Immer dieselbe Scheiße.» Ich trinke den letzten Schluck Kaffee, setze mir die Baseballmütze auf und bereite mich psychisch vor. «Sag mal, Käpt’n», krächzt Laozi, «du hast nicht zufällig ’ne Kippe für mich über?» Ich zeige ihm die leere Schachtel Mild Seven. Er sieht mich traurig an. Ich brauche sowieso neue. Vor mir liegt ein nervenaufreibender Termin. «Gibt’s hier einen Automaten?» «Dahinten» – er nickt – «zwischen den Pflanzen. Ich rauche Carlton.» Ich muss schon wieder einen Tausendyenschein anbrechen. Das Geld verpufft in Tokio einfach. Eigentlich kann ich mir auch noch einen Kaffee bestellen, um meinen Adrenalinspiegel zu pushen, bevor ich der richtigen Akiko Kato gegenübertrete. Als Ersatz für die erfundene Walther PKK. Ich setze meine telepathischen Fähigkeiten ein – «Kellnerin! Du, mit dem schönsten Hals der Welt! Lass die Gläser im Spüler, komm an den Tresen und bedien mich!» Meine Gabe lässt mich heute im Stich. Stattdessen kommt Witwe. Erst jetzt fällt mir auf, dass ihre Nasenlöcher die ideale Föhnsteckdose abgeben – zusammengedrückte kleine Schlitze. Als ich mich für den Kaffee bedanke, nickt sie ungnädig, als sei nicht ich der Gast, sondern sie. Ich trage die Tasse langsam zurück zu meinem Platz, damit nichts überschwappt, mache die Carlton-Schachtel auf und versuche vergeblich, mein Wegwerffeuerzeug zum Zünden zu bringen. Laozi schiebt mir ein Briefchen Streichhölzer mit dem Logo einer Bar namens Mitty hin. Ich zünde mir eine an und dann eine für ihn – er ist ganz in ein neues Spiel vertieft. Er nimmt sie – seine Finger sind hart wie Krokodilhaut –, zieht und stößt ein dankbares Seufzen aus, das nur Raucher verstehen. «Hunderttausend Dank, Käpt’n. Meine Schwiegertochter meckert ständig, ich soll aufhören, aber ich sage ihr, sterben tu ich sowieso, warum der Natur ins Handwerk pfuschen?» Ich mache ein verständnisvolles Geräusch. Die Farne sehen zu perfekt aus, um echt zu sein. Zu grün, zu gleichmäßig gefiedert. In Tokio gedeihen nur Tauben, Krähen, Ratten, Schaben und Anwälte. Ich schaufle Zucker in den Kaffee, lege vorsichtig den Löffel obendrauf und lasse gaaanz langsam Sahne in die Höhlung tröpfeln. Pangäa treibt kreisend auf dem Kaffeeozean und zerfällt in Kontinente. Mit Kaffee zu spielen ist das einzige Vergnügen, das ich mir in Tokio leisten kann. Die ersten drei Monatsmieten für meine Kapsel haben alles Geld verschlungen, das ich mir als Aushilfe bei Onkel Orange und Onkel Pachinko zusammengespart habe, und jetzt stehe ich vor einem Henne-Ei-Problem: Wenn ich nicht arbeite, kann ich nicht in Tokio bleiben und meinen Vater suchen – und wenn ich arbeite, wann suche ich dann meinen Vater? Arbeit. Ein beschissenes Wort, das die Sonne erkalten lässt. Die beiden einzigen markttauglichen Talente, die ich habe, sind Orangenpflücken und auf meiner Gitarre spielen. Der nächste Orangenbaum ist wahrscheinlich fünfhundert Kilometer weit entfernt, und meine Musik hat außer mir noch nie jemand gehört. Jetzt begreife ich, warum die Ameisengesellschaft funktioniert. Darum: arbeiten oder untergehen. Tokio macht aus dir eine Leiche mit Bankkonto. Der Kontostand bestimmt, wo die Leiche wohnt, wie sie sich fortbewegt, wie sie sich kleidet, vor wem sie buckelt, mit wem sie zusammen ist und wen sie heiratet, ob sie sich in der Gosse wäscht oder im Whirlpool planscht. Wenn mein Vermieter, der ehrenwerte Buntaro Ogiso, mich übers Ohr haut, gibt es kein Netz, das mich auffängt. Er wirkt nicht wie ein Betrüger, aber das tun Betrüger nie. Wenn ich – in spätestens ein paar Wochen – meinen Vater kennenlerne, will ich ihm zeigen, dass ich auf eigenen Füßen stehe und nicht auf finanzielle Unterstützung aus bin. Witwe stößt ein divenhaftes Seufzen aus. «Heißt das, das ist die letzte Packung Kaffeefilter?»
Die Kellnerin mit dem schönsten Hals nickt.
Esel mischt sich ein. «Wirklich die letzte?»
«Die allerletzte», bejaht meine Kellnerin.
Witwe blickt kopfschüttelnd gen Himmel. «Wie kann das sein?»
Esel zieht sich aus der Affäre. «Ich habe am Donnerstag welche bestellt.»
Die Kellnerin mit dem schönsten Hals zuckt mit den Achseln. «Lieferungen brauchen drei Tage.»
«Ich hoffe», sagt Witwe streng, «du gibst nicht Eriko-san die Schuld an dieser Katastrophe.»
«Und ich hoffe, du gibst nicht mir die Schuld, nur weil ich gesagt habe, dass uns gegen fünf die Filter ausgehen. Ich wollte nur darauf hinweisen.» Angriff abgeschmettert. «Wie wäre es, wenn ich Geld aus der Kasse nehme und welche kaufen gehe?»
Witwe sieht sie böse an. «Ich bin hier die Restaurantleiterin. Solche Entscheidungen treffe ich.»
«Ich kann nicht gehen», jammert Esel. «Ich war heute Morgen zur Dauerwelle, und es fängt jeden Augenblick an zu schütten.»
Witwe wendet sich wieder an die Kellnerin mit dem schönsten Hals. «Ich will, dass du eine Packung Filter kaufen gehst.» Sie öffnet die Kasse und nimmt einen Fünftausendyenschein heraus. «Bring den Bon mit und zähl das Wechselgeld. Der Bon ist wichtig, sonst ist meine Buchhaltung im Eimer.»
Die Kellnerin mit dem schönsten Hals zieht Gummihandschuhe und Schürze aus, nimmt einen Schirm und verlässt wortlos das Café.
Witwe kneift die Augen zusammen. «Ganz schön zickig, das Mädel.»
«Gummihandschuhe!», lästert Esel. «Als wäre sie ein Handmodel.»
«Die Studenten von heute sind einfach zu verwöhnt. Was studiert sie eigentlich?»
«Arrogantistik.»
«Die glaubt wohl, sie schwebt über den Dingen.»
Sie steht an der Omekaido Avenue und wartet auf Grün. Das Wetter in dieser Stadt ist außerirdisch. Eine dichte Wolkendecke, die jeden Augenblick unter der Last des Regens einzubrechen droht, und trotzdem immer noch heiß wie im Backofen. Die Passanten auf der Fußgängerinsel der Kita Street spüren es. Die beiden jungen Frauen, die die Reklametafel vor Nero’s Pizza Emporium hereinholen, spüren es. Die Brigade alter Leute spürt es. Schierling, Nachtigallen, e-Moll – Wummmmm! Dröhnender Bauchklatscher, unterlegt mit einer Bassimpro. Anju hat Donner geliebt, so wie sie unsere Geburtstage, Baumkronen, das Meer und mich geliebt hat. Wie ein Kobold hat sie gegrinst, wenn es donnerte. Der Regen ist zu hören, bevor man ihn sieht – zitternde Geisterblätter; er sprenkelt die Bürgersteige, klatscht auf Autodächer, prasselt auf Markisen. Meine Kellnerin öffnet einen großen gelb-rot-blauen Schirm. Die Ampel wird grün, und die Fußgänger rennen im unwirksamen Schutz hochgehaltener Zeitungen und Jacken über die Straße. «Sie wird klatschnass», sagt Esel fast vergnügt. Der peitschende Regen radiert die andere Seite der Omekaido Avenue aus. «Egal, Hauptsache, wir kriegen Kaffeefilter», sagt Witwe. Meine Kellnerin verschwindet. Ich hoffe, sie findet einen Platz zum Unterstellen. Das Jupiter Café füllt sich mit heiter gestimmten Gewitterflüchtigen. Ein Blitz zuckt hell über den Himmel, und im Gegenzug geht im Café das Licht aus. Die Flüchtlinge machen «Uuuuuuuuuh!». Ich nehme ein Streichholz und zünde mir noch eine Carlton an. Ich kann Akiko Kato. erst zur Rede stellen, wenn das Gewitter vorbei ist. Wenn ich nass bis auf die Knochen in ihrem Büro auftauche, bin ich so bedrohlich wie ein begossener Chihuahua. Laozi kichert, würgt und schnappt nach Luft. «Junge, Junge, so ein Gewitter hab ich seit 1971 nicht erlebt. Is’ bestimmt der Weltuntergang. Gab’s ’nen Bericht im Fernsehen drüber.»
Eine Stunde später ist die Kreuzung ein Zusammenfluss aus sprudelnden Wassermassen. Unglaublich, dieser Regen. So heftig schüttet es nicht mal auf Yakushima. Die Heiterkeit ist verflogen, und die Gäste sind in Untergangsstimmung. Der Fußboden liegt schon im Wasser – wir sitzen auf Barhockern, Tischen und dem Tresen. Draußen kommt der Verkehr zum Stillstand, die Autos versinken langsam in der schäumenden Flut. Eine sechsköpfige Familie sitzt dicht zusammengedrängt auf dem Dach eines Taxis. Ein Baby hört nicht auf zu schreien. Die Kundschaft spaltet sich in Grüppchen. Von Marinehubschraubern ist die Rede, von El Niño, einer nordkoreanischen Invasion und davon, in ein höheres Stockwerk zu fliehen, auf Bäume zu klettern oder die Ruhe zu bewahren. Ich rauche noch eine Carlton und halte mich raus: Zu viele Kapitäne steuern das Schiff den Berg hinauf. Die Taxifamilie ist nur noch zu dritt. Gegenstände fließen vorbei, die im Wasser nichts zu suchen haben. Jemand hat ein Radio, aber es produziert nur schrille Pfeiftöne. Der Pegel steigt – das halbe Fenster steht schon unter Wasser. Überschwemmte Briefkästen, Motorräder, Verkehrsschilder. Ein Krokodil schwimmt auf das Fenster zu und prallt mit der Schnauze gegen die Scheibe. Niemand schreit. Ich wünschte, jemand schrie doch. In seinem Maul zuckt etwas – eine Hand. Es mustert uns mit einem Auge und entscheidet sich für mich. Dieses Auge kenne ich. Es leuchtet, und das Tier gleitet mit einem Schwanzzucken davon. «Tokio, Tokio», gluckst Laozi. «Wenn’s nicht brennt, ist es ein Erdbeben. Wenn’s kein Erdbeben ist, ist es ’ne Bombe. Und wenn’s keine Bombe ist, dann ist es eine Überschwemmung.» Witwe kräht von ihrer Stange: «Wir müssen die Gäste in Sicherheit bringen. Frauen und Kinder zuerst.» «In Sicherheit wohin?», fragt ein Mann in schmutzigem Regenmantel. «Ein Schritt vor die Tür, und wir werden bis nach Guam gespült!» Esel meldet sich vom allersichersten Platz, dem Kaffeefilterbord. «Wenn wir hierbleiben, ertrinken wir!» Die Schwangere fasst sich an den Kugelbauch und flüstert: «O nein, nein, nicht jetzt.» Ein Priester erinnert sich an sein Alkoholproblem und trinkt aus seinem Flachmann. Laozi summt ein Seemannslied. Das schreiende Baby schreit weiter. Ein Schirm schießt durch die reißende Flut, ein gelb-rot-blauer Regenschirm, und dahinter keuchend und wild mit den Armen rudernd meine Kellnerin. Ich überlege nicht: Ich springe aufs Fensterbrett und reiße das obere Fenster auf, das noch über dem Wasserspiegel liegt. «Nicht», rufen die Flüchtlinge im Chor, «das ist unser sicherer Tod!» Ich werfe Laozi meine Baseballmütze zu. «Ich hol sie später wieder ab.» Dann ziehe ich die Turnschuhe aus, stemme mich aus dem Fenster und – die Strömung hat eine sagenhafte Kraft: Sie drischt auf mich ein, zieht mich in brutal schnellem Wechsel nach unten oder trägt mich. Im Schein des Blitzlichts erkenne ich den Tokyo Tower, der bis zur Mitte unter Wasser steht. Kleinere Gebäude gehen unter, während ich vorbeigespült werde. Die Zahl der Todesopfer muss in die Millionen gehen. Nur das PanOpticon ragt scheinbar sicher hinein ins Herz des Tornados. Das Meer senkt und hebt sich, der Wind heult, eine Symphonie des Wahnsinns. Manchmal sind die Kellnerin und der Schirm ganz nah, manchmal ganz weit weg. Aber dann, ich spüre, dass ich mich nicht mehr über Wasser halten kann, paddelt sie plötzlich auf ihrem Schirm auf mich zu. «Ein schöner Retter bist du mir», sagt sie und nimmt meine Hand. Sie lächelt, schaut an mir vorbei, und unbeschreibliches Grauen tritt in ihr Gesicht. Ich dreh mich um und blicke in den Schlund des Krokodils. Ich reiße mich von ihr los, stoße mit aller Kraft das Schirmboot fort und blicke meinem Tod ins Angesicht. «Nein!», schreit meine Kellnerin. Ich bin ruhig und stark. Das Krokodil richtet seinen fetten Leib auf und taucht unter – nicht einmal der Schwanz ist noch zu sehen. Ob es mir nur Angst einjagen wollte?
«Beeil dich», ruft meine Kellnerin, doch schon bohren sich messerscharfe Zähne in meinen rechten Fuß und ziehen mich nach unten. Ich schlage wild auf die Bestie ein, aber ebenso könnte ich mit einer Zeder kämpfen. Tiefer, immer tiefer, ich trete um mich, wehre mich, aber das führt nur dazu, dass immer dickere Blutwolken aus meiner Wade quellen. Wir sinken hinab auf den Grund des Pazifiks. Dort unten gibt es eine richtige Stadt – und dann begreife ich, was das Krokodil im Schilde führt: Es will mich vor dem Jupiter Café töten und zeigen, dass auch Reptilien einen Sinn für Humor haben. Die Gäste und Flüchtlinge sehen in hilflosem Entsetzen zu. Das Unwetter scheint vorüber, denn überall ist swimmingpoolblaue swingende Heiterkeit, und ich könnte schwören, dass ich Lucy in the Sky with Diamonds höre. Das Krokodil mustert mich mit Akiko Katos Augen, ein Blick, der mich ermuntert, es von der lustigen Seite zu sehen, dass ihm meine aufgedunsene, gut versteckte Leiche in den nächsten Wochen als Leckerbissen für zwischendurch dienen wird. Je schwächer ich werde, desto leichter wird mir. Ich sehe, wie Laozi sich meine letzte Carlton nimmt und meine Mütze absetzt. Dann macht er eine Geste, als wollte er sich die Augen ausstechen, und zeigt auf das Krokodil. Ein Gedanke flutscht mir aus dem Hirn. Gestern hat mein Vermieter mir die Schlüssel gegeben – der für den Schaufensterrollladen ist fingerlang und könnte mir als kleiner Dolch dienen. Aus unmittelbarer Nähe zuzustechen ist kein Kinderspiel, aber das Krokodil hält ein kleines Nickerchen und merkt gar nicht, dass ich ihm den Schlüssel zwischen die Lider schiebe und bis zum Anschlag reinramme. Spritz, patsch, sapsch. Krokodile schreien, sogar unter Wasser. Der Kiefer löst sich, und das Ungeheuer schießt in Spiralbewegungen davon. Laozi klatscht pantomimisch Beifall, aber ich bin schon drei Minuten ohne Luft, und bis an die Oberfläche ist es unvorstellbar weit. Mühsam paddle ich nach oben. Stickstoff sprudelt in meinem Hirn. Träge fliege ich dahin, und der Ozean singt. Auf dem Steinwal liegt meine Kellnerin, mir treu ergeben bis zum Schluss, das Gesicht im flachen Wasser, eingerahmt von einem fließenden Haarteppich. Unsere Blicke begegnen sich ein letztes Mal, und dann sinke ich, überwältigt von der Schönheit meines Todes, in langsamen, traurigen Kreisen hinab.
Als der erste rote Lichtstrahl das Schloss des Morgens öffnet, entzünden die Priester des Yasukuni-Schreins meinen Scheiterhaufen aus Sandelholz. Es ist das stattlichste Begräbnis seit Menschengedenken, und das ganze Land versinkt in Trauer. Am Kudanshita-Bahnhof wird der Verkehr umgeleitet, damit Zehntausende von Menschen mir die letzte Ehre erweisen können. Die Flammen züngeln an meinem Leichnam hoch. Botschafter, Verwandte, Staatsoberhäupter, Yoko Ono in Schwarz. Die Sonne reißt die Tür des Tages auf, und mein Leichnam beginnt zu brennen. Seine Kaiserliche Majestät hat den Wunsch geäußert, sich bei meinen Eltern zu bedanken, und so sind sie zum ersten Mal nach fast zwanzig Jahren wieder vereint. Die Journalisten fragen sie, wie sie sich fühlen, aber beide sind so von ihrer Trauer überwältigt, dass sie kein Wort herausbringen. Ich wollte nie eine so pompöse Zeremonie, aber ein Held ist nun mal ein Held. Meine Seele steigt mit meiner Asche auf und schwebt zwischen Fernsehhubschraubern und Tauben. Ich lasse mich auf dem Tori-Tor nieder, welches so gewaltig ist, dass ein Kriegsschiff hindurchfahren könnte, und ich genieße den neuen Blick in die Herzen der Menschen, den der Tod gewährt.
«Ich hätte die beiden nie im Stich lassen dürfen», denkt meine Mutter.
«Ich hätte die drei nie im Stich lassen dürfen», denkt mein Vater.
«Ob ich die Kaution behalten kann?», denkt Buntaro Ogiso.
«Ich habe ihn nicht mal nach seinem Namen gefragt», denkt meine Kellnerin.
«Wenn John doch hier sein könnte», denkt Yoko Ono. «Er würde ein Requiem komponieren.»
«Blöder Bengel», denkt Akiko Kato. «Eine lebenslange Einnahmequelle ist vorzeitig versiegt.»
Laozi kichert, würgt und schnappt nach Luft. «Junge, Junge, so ein Gewitter habe ich seit 1971 nicht erlebt. Is’ bestimmt der Weltuntergang. Gab’s im Fernsehen ’nen Bericht drüber.» Aber kaum hat er den Satz beendet, ist der Regenguss vorbei. Die beiden Schwangeren lachen. Ich denke an ihre Babys. Was für Bilder sehen Babys während der neun Monate, die sie dadrinnen eingepfercht sind? Kiemen, Sümpfe, Kriegsschauplätze? Für Menschen in Mutterleibern müssen Vorstellung und Wirklichkeit ein und dasselbe sein. Draußen blicken Fußgänger argwöhnisch zum Himmel hinauf und machen mit ausgestreckter Hand den Tropfentest. Schirme klappen zu. Bühnenhimmelwolken ziehen davon. Die Tür geht auf, und meine Kellnerin betritt mit schwingender Tüte das Café. «Hast dir ganz schön Zeit gelassen», mosert Witwe. Meine Kellnerin stellt die Filter auf den Tresen. «Lange Schlangen an den Kassen. Das Warten hat eine Ewigkeit gedauert.» «Hast du den Donner gehört?», fragt Esel, und ich denke, dass sie vielleicht doch kein schlechter Mensch ist, nur ein schwacher, der unter Witwes Einfluss steht. «Klar hat sie ihn gehört!», schnaubt Witwe. «Den hat sogar meine Tante Otane gehört, und die ist seit neun Jahren tot.» Mein Gefühl sagt mir, dass sie das Testament gefälscht und ihre Tante die Treppe runtergestoßen hat. «Bon und Wechselgeld, wenn ich bitten darf. Die Geschäftsleitung schätzt mich als gewissenhafte Buchhalterin, und diesen Ruf will ich mir nicht versauen.» Meine Kellnerin gibt ihr den Bon und einen Haufen Münzen. Ihre große Waffe heißt Gleichgültigkeit. Die Uhr zeigt halb drei. Mit einem Zahnstocher zeichne ich ein Pentagramm in den Aschenbecher. Mir kommt der Gedanke, dass ich mich vielleicht vergewissern sollte, ob Akiko Kato überhaupt da ist, bevor ich ins PanOpticon gehe – wenn ich mich an ihrer Sekretärin vorbeidränge und dann an ihrem Monitor einen gelben Zettel, «Bin Donnerstag zurück», vorfinde, sehe ich verdammt alt aus. Ihre Visitenkarte steckt in meinem Portemonnaie. Als ich elf war, habe ich sie mir aus der Dokumentenkiste meiner Großmutter geborgt, mit der Absicht, Voodoo zu lernen und sie als Totem zu benutzen. AKIKO KATO. RECHTSANWÄLTIN. OSUGI & BOSUGI. Dieselbe Adresse in Shinjuku, dieselbe Telefonnummer. Mein Herz schlägt schneller. Ich schließe einen Vertrag mit mir selbst – noch einen Eiskaffee, noch eine Carlton, dann rufe ich an. Ich warte ab, bis meine Kellnerin am Tresen steht, dann gehe ich, um mir einen Kaffee und ihre guten Wünsche zu holen. «Gläser!», ruft Witwe so scharf, dass ich irrtümlich glaube, sie meint mich. Esel kommt an den Tresen, und meine Freundin geht wieder an die Spüle. Ich stehe kurz vor einer Koffeinvergiftung, aber es würde bescheuert aussehen, wenn ich jetzt einen Rückzieher mache. «Einen Eiskaffee, bitte.» Ich warte, bis Laozi das nächste Mal von den Bioborgs gekillt wird, und tausche eine Carlton gegen ein neues Spiel. Ich versuche, einen Mandelsplitter zu halbieren, aber er bohrt sich unter meinen Fingernagel.
«Osugi und Bosugi, guten Tag.»
Ich bemühe mich, einen Touch Autorität in meine Stimme zu legen. «J-jaa …» Die Stimme kiekst, als wären meine Eier noch im freien Fall der Pubertät. Ich erröte, täusche ein Husten vor und setze fünf Oktaven tiefer zum Neustart an. «Ist Akiko Kato heute im Haus?»
«Möchten Sie mit ihr sprechen?»
«Nein. Ich möchte wissen, ob … ja. Ja, bitte.»
«Bitte, was?»
«Würden Sie mich bitte mit Akiko Kato verbinden. Bitte.»
«Darf ich erfahren, mit wem ich spreche?»
«Dann ist sie, äh, in der Kanzlei?»
«Darf ich erfahren, mit wem ich spreche?»
«Es handelt sich um eine» – Katastrophe – «vertrauliche Angelegenheit.»
«Sie können sich auf unsere absolute Diskretion verlassen, aber ich muss Sie um Ihren Namen bitten.»
«Ich heiße, äh, Taro Tanaka.» Idiotischster aller Idiotennamen. Trottel.
«Herr Taro Tanaka. Aha. Darf ich Sie nach dem Grund Ihres Anrufs fragen?»
«Es handelt sich um, äh, eine juristische Angelegenheit.»
«Können Sie sich bitte etwas genauer ausdrücken, Herr Tanaka?»
«Äh. Nein. Leider nicht.»
Langgezogenes Seufzen. «Frau Kato ist in einem Meeting mit den Seniorpartnern und möchte nicht gestört werden. Aber wenn Sie mir Ihre Nummer und den Namen Ihrer Firma nennen und mir grob Ihr Anliegen schildern, werde ich ihr ausrichten, dass Sie um Rückruf bitten.»
«Kein Problem.»
«Für welche Firma arbeiten Sie, Herr Tanaka?»
«Äh …»
«Herr Tanaka?»
Ich geh unter und lege auf.
Stil: 4 minus. Aber dafür weiß ich jetzt, dass Akiko Kato in ihrem Netz lauert. Ich zähle die Stockwerke am PanOpticon hinauf, bis mein Blick bei siebenundzwanzig an die Wolken stößt. Ich puste dir Rauch entgegen, Akiko Kato. Dein Leben, in dem Eiji Miyake nichts als eine neblige Erinnerung von einer nebligen Gebirgsinsel vor der Südküste Kyushus ist, dauert nicht mal mehr eine halbe Stunde. Stellst du dir jemals vor, mir zu begegnen? Oder bin ich nur ein Name auf einem gewissen Schriftstück? Die Eisberge in meinem Kaffee klirren und verschmelzen miteinander. Ich gieße den Sirup und die Sahne hinein und sehe zu, wie sie im Glas herumwirbeln und die Farbe verlieren. Die Schwangeren vergleichen Babyzeitschriften. Meine Freundin geht von Tisch zu Tisch und leert die Aschenbecher in einen Eimer. Komm hierher, mach meinen leer. Sie kommt nicht. Witwe hängt strahlend am Telefon. Mir fällt ein Mann auf, der gerade über die Kita Street geht. Ich könnte schwören, dass er die Straße schon vor ein paar Minuten überquert hat. Ich behalte ihn im Auge, verfolge seinen Weg durch die den Pfützen ausweichende Menge. Er geht über die Straße und wartet, bis das Männchen grün wird. Er geht über die Omekaido Avenue, wartet, bis das Männchen grün wird. Dann geht er wieder über die Kita Street, wartet und überquert wieder die Omekaido Avenue. Ich beobachte ihn eine, zwei, drei volle Runden lang. Ein Privatdetektiv, ein Bioborg, ein Irrer? Gleich wird sich die Sonne durch die Wolkendecke reiben. Ich stoße den Strohhalm ins Eis und sauge. Meine Blase lässt sich nicht länger ignorieren. Ich gehe zur Toilette und drehe den Türknauf – abgeschlossen. Ich kratze mich am Hinterkopf und schleiche verlegen zu meinem Platz zurück. Als die Tür aufgeht – eine Office Lady –, sehe ich schnell woandershin, damit sie nicht merkt, dass ich der Klotürrüttler war, und so drängelt sich ein schüchternes Mädchen in Schuluniform vor, das eine Viertelstunde später als bonbonbunter feuchter Traum in Minirock und fünffingerbreitem Oberteil wieder herauskommt. Ich stehe auf, aber diesmal kommen mir eine Mutter und ihr kleines Kind zuvor. «Notfall!», kichert die Mutter, und ich lächle verständnisvoll. Ist das vielleicht einer dieser Träume, in denen du dich immer weiter von deinem Ziel entfernst, je näher du ihm kommst? «Hey», kreischt meine Blase, «tu was, und zwar dalli, sonst garantiere ich für nichts!» Ich bleibe neben der Tür stehen und versuche, an Dünen zu denken. Noch einer von Tokios Teufelskreisen – um aufs Klo zu gehen, musst du dir ein Getränk bestellen, das deine Blase füllt. Auf Yakushima suche ich mir zum Pinkeln einfach einen Baum. Mutter und Kind sind fertig, und ich gehe hinein. Mit angehaltenem Atem schiebe ich den klemmenden Riegel vor, klappe den Klodeckel hoch und pisse drei Kaffee. Die Luft geht mir aus, und ich muss einatmen – so schlimm stinkt es gar nicht. Urin, Margarine, künstlicher Lavendel. Ich will die Brille abwischen, aber dann überlege ich es mir anders. Ein Waschbecken, ein Spiegel, ein leerer Seifenspender. Ich drücke ein paar Mitesser aus und betrachte aus verschiedenen Winkeln mein Spiegelbild: ich, Eiji Miyake, Tokioter. Täusche ich mich, oder stimmt mein Eindruck, dass jedes Lachen, jedes Miau und jeder versteckte Blick mir gelten? Ein guter Pickeltag. Ist meine Kyushu-Bräune schon verblichen? Mein Spiegelbild spielt das Anstarrspiel. Es gewinnt, und ich schaue als Erster weg. Ich mache mich über eine Vulkankette aus Mitessern her. Es klopft, und jemand dreht den Türknauf. Ich verwuschle meine Gelfrisur und fummle den Riegel auf.
Es ist Laozi. Ich nuschele eine Entschuldigung, weil er so lange warten musste, und beschließe, meinen Angriff auf das PanOpticon ohne weitere Verzögerungen zu starten. Und dann, ganz plötzlich, läuft Akiko Kato durchs Bild. Echt, real, leibhaftig, nur durch fünf Millimeter Glas und höchstens einen Meter Luft von mir getrennt. Der ersehnte Zufall ist eingetreten, dabei hatte ich die Hoffnung schon aufgegeben. Sie dreht in Zeitlupe den Kopf, sieht mich an und geht weiter. Für einen kurzen Augenblick wirft mich der Schock aus dem Gleichgewicht. Akiko Kato eilt auf die Kreuzung zu, und die Männchen werden grün. In meiner Phantasie ist sie nicht gealtert – die Wirklichkeit verhält sich anders, aber meine Erinnerungen sind erstaunlich exakt. Hinterhältige Schläue, Adlernase, eine gefühllose Schönheit. Los! Ich warte, dass die Tür aufgeht, renne nach draußen und …
Deine Baseballmütze, du Penner!
Ich sause zurück ins Jupiter Café, hole meine Mütze und düse zur Kreuzung, wo die grünen Männchen bereits blinken. Nach zwei Stunden im runtergekühlten Café fängt meine Haut in der Nachmittagshitze an zu knistern und platzt auf. Akiko Kato ist schon am anderen Ufer – ich riskiere es und renne hinterher. Mopeds fahren knatternd an, während ich über Zebrastreifen und Pfützen springe, der Ampelmann ist rot, und ein Bus hupt mich wütend an, aber ich schaffe es auf die andere Seite, ohne dass ich auf einer Kühlerhaube lande. Mein Opfer ist schon am Aufgang zum PanOpticon. Beschimpfungen einsteckend und Entschuldigungen austeilend, schlängle ich mich stromaufwärts durch die Menge – wenn sie das Gebäude betritt, ist die Gelegenheit, ihr auf neutralem Boden zu begegnen, dahin. Aber Akiko Kato geht nicht ins PanOpticon. Sie geht weiter in Richtung Bahnhof Shinjuku – ich sollte ihr nachlaufen und sie aufhalten, aber plötzlich überfällt mich das Gefühl, dass sie nicht mehr, sondern weniger Verständnis für mein Anliegen zeigen wird, wenn ich sie mitten auf der Straße anspreche. Immerhin bitte ich sie um einen Gefallen. Sie wird glauben, dass ich sie verfolge – und da hätte sie recht. Was ist, wenn sie das Ganze falsch versteht, bevor ich ihr alles erklären kann? Was ist, wenn sie laut «Vergewaltigung!» schreit? Aber ich kann sie auch nicht einfach so in der Menge verschwinden lassen. Ich folge ihr aus sicherer Entfernung und erinnere mich daran, dass sie den erwachsenen Eiji Miyake gar nicht kennt. Sie dreht sich nicht ein einziges Mal um – warum sollte sie auch? Wir gehen unter einer Reihe dürrer, abtropfender Bäume. Akiko Kato schüttelt ihre langen Haare und setzt eine Sonnenbrille auf. Eine Unterführung bringt uns unter den Schienen hindurch, und wir tauchen im grellen Sonnenlicht auf der mit Autos und Menschen vollgestopften Yakusuni Street wieder auf. Aus den vielen Bistros und Handyläden plärrt Gitarrenmusik. Im realen Leben Leute zu verfolgen ist schwierig. Ich stoße mir das Schienbein an einem Fahrrad. Die Sonne dampfbügelt die Straße durch ihre vom Regen gereinigte Linse. Schweiß klebt mir das T-Shirt auf die Haut. Hinter einem Eisladen mit neunundneunzig Eissorten biegt sie ab und verschwindet schnell in einer Seitenstraße. Ich schlage mich durch den Frauendschungel vor einer Boutique und folge ihr. Keine Sonne, Mülltonnen auf Rollen, Feuerleitern. Eine Chicago-Kulisse. Sie bleibt vor einem Haus stehen, das aussieht wie ein Kino, und vergewissert sich, dass ihr niemand gefolgt ist – ich beschleunige meinen Schritt, als hätte ich es furchtbar eilig, weiche ihrem Blick aus und drehe im Vorbeigehen den Schirm der Mütze nach vorne, damit sie mein Gesicht nicht sieht. Als ich umdrehe, ist Akiko Kato im Ganymed-Kino verschwunden. Das Kino hat seine besten Zeiten hinter sich. Heute läuft ein Film mit dem Titel PanOpticon. Das Plakat – eine Reihe schreiender russischer Holzpuppen – verrät nichts über die Handlung. Ich zögere. Ich will eine rauchen, aber ich habe die Zigaretten im Jupiter Café liegenlassen und muss mich mit einer Brausebombe begnügen. Der Film fängt in knapp zehn Minuten an. Ich ziehe an der Tür, merke, dass ich drücken muss, und gehe hinein. Das menschenleere Foyer ist mit psychedelischem Teppichboden ausgelegt. Ich übersehe die Stufe, stolpere und verstauche mir fast den Knöchel. Abgeschabter Glanz und der Geruch nach Spachtelmasse. Ein bedauernswerter Kronleuchter spendet vergilbtes Licht. Die Kartenverkäuferin legt sichtbar genervt ihre Stickerei beiseite. «Ja?»
«Ist hier, äh, das Kino?»
«Nein. Das Kriegsschiff Yamato.»
«Ich bin Gast.»
«Schön für Sie.»
«Äh. Der Film. Worum, äh, geht’s da?»
Sie fädelt einen Faden ein. «Sehen Sie irgendwo ein Schild, auf dem ‹Hier Verkauf von Inhaltsangaben› steht?»
«Ich wollte nur …»
Sie seufzt, als hätte sie es mit einem Schwachsinnigen zu tun. «Sehen Sie ein Schild, auf dem ‹Hier Verkauf von Inhaltsangaben› steht, oder sehen Sie keines?»
«Nein.»
«Und was, bitte schön, sagt Ihnen das?»
Ich würde sie erschießen, aber ich habe die Walther PKK in meiner letzten Phantasie vergessen. Ich könnte auch einfach wieder gehen, aber ich weiß, dass Akiko Kato irgendwo in diesem Gebäude steckt. «Einmal, bitte.»
«Tausend Yen.»
Damit ist mein Budget für heute aufgebraucht. Sie gibt mir ein Papierticket. An manchen Stellen liegt herabgefallener Putz. Eigentlich hätte der Laden schon vor Jahrzehnten dichtmachen müssen. Sie wendet sich wieder ihrer Stickarbeit zu und überlässt mich einem Schild mit dem fürsorglichen Hinweis: ZUM KINO – FÜR UNFÄLLE AUF DER TREPPE WIRD NICHT GEHAFTET . Die steile Treppe führt in rechten Winkeln nach unten. An den lackierten Wänden hängen Filmplakate. Ich erkenne kein einziges. Bei jedem Treppenabschnitt denke ich, es ist der letzte, aber es geht immer weiter. Im Brandfall bitten wir das Publikum, schweigend zu verkohlen. Kann es sein, dass es wärmer wird? Plötzlich bin ich unten angekommen. Es riecht nach Bittermandel. Eine Frau mit dem kahlen Schädel einer Chemotherapiepatientin versperrt mir den Weg. Als unsere Blicke sich treffen, sehe ich, dass ihre Augen leere Höhlen sind. Ich räuspere mich. Sie rührt sich nicht vom Fleck. Ich versuche, mich an ihr vorbeizuquetschen, aber ihre Hand schnellt mir entgegen. Zeige- und Mittelfinger und Ringfinger und kleiner Finger sind zu Schweineklauen verwachsen. Ich versuche, nicht hinzusehen. Sie nimmt mein Ticket und zerreißt es. «Popcorn?»
«Nein, vielen Dank.»
«Mögen Sie kein Popcorn?»
«Ich, äh, ich mache mir nicht viel aus Popcorn.»
Sie denkt über meine Worte nach. «Das heißt, Sie wollen nicht zugeben, dass Sie kein Popcorn mögen.»
«Weder mag ich es, noch mag ich es nicht.»
«Warum spielen Sie dann mit mir?»
«Ich spiele nicht mit Ihnen. Ich habe vorhin viel zu Mittag gegessen. Ich habe keinen Hunger.»
«Ich kann es nicht vertragen, wenn Sie lügen.»
«Ich glaube, Sie verwechseln mich.»
Sie schüttelt den Kopf. «Verwechslungen kommen nie bis hier unten.»
«Also gut, ich kaufe Ihr Popcorn.»
«Das geht nicht. Ich habe keins.»
Irgendetwas muss ich verpasst haben. «Warum haben Sie mir dann welches angeboten?»
«Denken Sie nach. Ich habe Ihnen keins angeboten. Wollen Sie jetzt den Film sehen oder nicht?»
«Ja.» Allmählich geht mir die Sache auf den Senkel. «Ich will ihn sehen.»
«Warum verschwenden Sie dann meine Zeit?» Sie hält den Vorhang auf. In dem steil abfallenden Kinosaal sitzen genau drei Zuschauer. In der ersten Reihe erkenne ich Akiko Kato. Neben ihr sitzt ein Mann. Unten ganz außen sitzt ein Mann im Rollstuhl, offenbar tot: Der Kopf ist nach hinten gekippt, als wäre sein Genick gebrochen, sein Mund steht offen, und er rührt sich nicht. Ich folge seinem Blick hinauf zu dem gemalten Nachthimmel an der Kinodecke. Dann gehe ich leise den Mittelgang hinunter auf das Paar zu, damit ich es belauschen kann. Aus der Vorführerkabine dringt ein lauter Knall, und ich gehe in Deckung. Ein Schuss oder eine amateurhaft aufgerissene Chipstüte? Weder Akiko Kato noch ihr Begleiter drehen sich um – ich schleiche weiter, bis ich ein paar Reihen hinter ihnen bin. Es wird dunkel, und der Vorhang geht hoch. Dahinter erscheint ein Rechteck aus flackerndem Licht. Werbung für eine Fahrschule: Der Spot ist entweder sehr alt, oder die Fahrschule nimmt nur Schüler mit einer Schwäche für Frisuren und Klamotten aus den Siebzigern. Dazu spielt YMCA. Es folgt Werbung für einen Schönheitschirurgen namens Apollo Shigenobo, der all seinen Patienten ein Dauergrinsen ins Gesicht fräst. Sie singen eine Hymne auf die Gesichtskorrektur. Im Kino auf Yakushima freue ich mich immer auf die Filmvorschauen – dann braucht man sich die Filme nicht mehr anzusehen –, aber hier gibt es keine. Eine martialische Stimme kündigt den Film an, PanOpticon, gedreht von einem Regisseur, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, und preisgekrönt auf einem Filmfestival in einer Stadt, von der ich nicht mal weiß, auf welchem Kontinent sie liegt. Kein Vorspann, keine Musik. Mittenrein.
In einer schwarzweißen Winterstadt bahnt sich ein Omnibus den Weg durch die Menschenmengen. Ein Fahrgast mittleren Alters beobachtet das Straßengeschehen. Dichter Schnee, Zeitungsverkäufer, Polizisten prügeln auf einen Schwarzmarkthändler ein, vom Krieg ausgemergelte Gesichter in leeren Geschäften, ein verkohltes Brückengerippe. Beim Aussteigen erkundigt sich der Mann nach dem Weg – der Busfahrer zeigt mit einem Nicken auf eine riesige Mauer, die den Himmel verdeckt. Der Mann geht an der Mauer entlang und sucht nach einem Eingang. Bombentrichter, Zerstörung, wilde Hunde. In einer kreisförmigen Ruine unterhält sich ein haariger Irrer mit einem Feuer. Schließlich kommt der Mann an eine niedrige Holztür. Er bückt sich und klopft. Niemand öffnet. Er entdeckt eine Konservendose an einem Bindfaden, der irgendwo im Mauerwerk verschwindet, und spricht hinein. «Jemand da?» Der Film ist japanisch untertitelt – die Sprache besteht nur aus Zisch-, Nuschel- und Knacklauten. «Ich bin Dr.Polonski. Direktor Bentham erwartet mich.» Er hält die Dose an sein Ohr und hört ertrinkende Matrosen. Die Tür öffnet sich in einen trostlosen Hof. Der Arzt duckt sich und tritt ein. Eigenartiger Gesang hallt durch den Wind. «Kröterich zu Ihren Diensten, Doktor.» Ein ungewöhnlich kleiner Mann löst sich aus seiner Verbeugung, und Dr.Polonski springt erschrocken zurück. «Hier entlang, wenn ich bitten darf.» Der Schnee steckt voller Kieselsteine. Beschwörungsformeln ertönen, verstummen wieder und erheben sich aufs Neue. An Kröterichs Gürtel baumelt ein Schlüsselbund. Vorbei an kartenspielenden Aufsehern durch ein Labyrinth aus Käfigen. «Da wären wir», krächzt er. Der Arzt macht eine steife Verbeugung, klopft an und betritt ein schmuddeliges Büro.
«Doktor!» Der Direktor ist gebrechlich und betrunken. «Bitte, nehmen Sie doch Platz.»
«Danke sehr.» Dr.Polonski bewegt sich vorsichtig durch den Raum – in dem nackten Fußboden fehlt die Hälfte der Dielenbretter. Er setzt sich auf einen Kinderstuhl. Direktor Bentham fotografiert eine Erdnuss in einem großen Glas mit Flüssigkeit. Dann sagt er: «Ich schreibe gerade eine Abhandlung über das Verhalten von Knabberzeug in Brandy mit Soda.»
«Was Sie nicht sagen?»
Der Direktor blickt auf seine Stoppuhr. «Was wollen Sie trinken, Doc?»
«Ich trinke nicht, wenn ich im Dienst bin. Vielen Dank.»
Der Direktor schüttet die letzten Tropfen Brandy in einen Eierbecher und lässt die leere Flasche einfach zwischen zwei Dielenbretter fallen. Ein ferner Schrei und ein Klirren. «Zum Wohl!» Der Direktor leert den Eierbecher. «Mein lieber Doktor, erlauben Sie mir, dass ich gleich auf ein scherzhaftes Thema zu sprechen komme. Ein schmerzhaftes, meine ich, ein schmerzhaftes. Unser Doktor Koenig ist vor Weihnachten an der Schwindsucht gestorben, und durch den Krieg im Osten und was weiß ich nicht alles haben wir noch keinen Ersatz für ihn gefunden. Gefängnisse sind in Kriegszeiten nicht von Vorrang, außer bei Wohnzimmerpolitikern. Dabei haben wir so große Hoffnungen in unser Projekt gesetzt. Ein utopisches Gefängnis, das die geistigen Fähigkeiten der Insassen fördert und ihnen erlaubt, in Gedanken frei zu sein. Das …»
«Mr.Bentham», unterbricht Dr.Polonski. «Das Problem?»
«Das Problem» – der Direktor beugt sich vor – «ist Voorman.»
Polonski verändert behutsam die Sitzhaltung, damit er nicht dasselbe Schicksal erleidet wie die Brandyflasche. «Ist Voorman ein Häftling?»
«Ganz recht, Doktor. Voorman ist der Häftling, der behauptet, Gott zu sein.»
«Gott.»
«Jedem das Seine, sage ich immer, aber er hat die anderen Häftlinge dazu gebracht, an seinen Wahn zu glauben. Wir haben ihn isoliert – vergebens. Haben Sie den Gesang gehört, als Sie hereinkamen? Voormans Psalm. Ich befürchte Unruhen, Doktor. Krawalle.»
«Ich verstehe Ihre Lage, aber wie …»
«Ich möchte, dass Sie Voorman untersuchen. Stellen Sie fest, ob er den Wahnsinn nur vortäuscht oder ob seine Tapire tatsächlich Amok laufen. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass es sich um eine Geisteskrankheit handelt, schicke ich ihn in eine Anstalt, und wir können beruhigt zu Tee und Törtchen nach Hause gehen.»
«Für welches Verbrechen wurde Voorman verurteilt?»
Direktor Bentham zuckt mit den Achseln. «Wir haben die Akten im letzten Winter als Heizmaterial verfeuert.»
«Woher wissen Sie, wann die Häftlinge entlassen werden?»
Der Direktor ist verblüfft. «Entlassen? Die Häftlinge?»
Akiko Kato dreht sich um. Ich gehe rechtzeitig in Deckung. Glaube ich. Am Ende der Reihe steht eine Ratte aufrecht in einem See aus silbernem Leinwandlicht. Sie sieht mich an, dann verschwindet sie in den Polstern. «Ich will hoffen», flüstert Akiko Katos Begleiter, «dass die Sache dringend ist.»
«Gestern ist ein Geist in Tokio aufgetaucht.»
«Sie haben mich aus dem Verteidigungsministerium geholt, um mir eine Geistergeschichte zu erzählen?»
«Der Geist war Ihr Sohn, Abgeordneter.»
Mein Vater ist genauso sprachlos wie ich.
Akiko Kato wirft das Haar zurück. «Und ich versichere Ihnen, er ist ein sehr lebendiger Geist. Der hier in Tokio nach Ihnen sucht.»
Mein Vater schweigt für eine halbe Ewigkeit. «Will er Geld?»