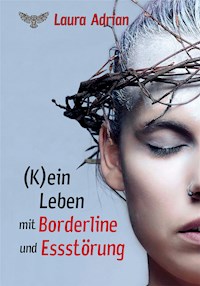3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Merlins Bookshop
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Teil 1: Lucy ist ein ganz normales Mädchen. Eigentlich. Zumindest auf den ersten Blick. Vielleicht ein bisschen schüchtern, ein wenig still, aber mehr auch nicht. Welch trauriges Doppelleben sie führt, welches Geheimnis sie wahrt und wie es unter ihrem dunklen Make-up aussieht, weiß kaum jemand. Über fünf Jahre geht sie durch die Hölle. Sie wird dazu gezwungen ihren Körper zu verkaufen, erfährt Gewalt, wird gedemütigt und erpresst. Bereits im Alter von dreizehn Jahren lernt sie ihren zukünftigen Zuhälter kennen, der sie ein Jahr später, mit gerade einmal vierzehn Jahren zur Prostitution zwingt. Doch davon ahnt in ihrer Schule jedoch niemand etwas … Nicht einmal ihre Familie bekommt zu Beginn etwas mit. Lucy führt ein perfektes Doppelleben. Wobei „perfekt“ in dieser Geschichte eindeutig das falsche Wort ist … Ein Roman, der einen Blick hinter die Fassaden zeigt und das Tabuthema Zwangsprostitution in Deutschland aufgreift. Eine (vielleicht) wahre Geschichte. Meine Geschichte? Der zweite Teil ist im November 2017 erschienen: Barfuß durch die Scherben der Vergangenheit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Lucy ist ein ganz normales Mädchen. Eigentlich. Zumindest auf den ersten Blick. Vielleicht ein bisschen schüchtern, ein wenig still, aber mehr auch nicht. Welch trauriges Doppelleben sie führt, welches Geheimnis sie wahrt und wie es unter ihrem dunklen Make-up aussieht, weiß kaum jemand.
Über fünf Jahre geht sie durch die Hölle. Sie wird dazu gezwungen ihren Körper zu verkaufen, erfährt Gewalt, wird gedemütigt und erpresst. Bereits im Alter von dreizehn Jahren lernt sie ihren zukünftigen Zuhälter kennen, der sie ein Jahr später, mit gerade einmal vierzehn Jahren zur Prostitution zwingt. Doch davon ahnt in ihrer Schule jedoch niemand etwas … Nicht einmal ihre Familie bekommt zu Beginn etwas mit. Lucy führt ein perfektes Doppelleben. Wobei „perfekt“ in dieser Geschichte eindeutig das falsche Wort ist …
Ein Roman, der ein Blick hinter Fassaden zeigt und das Tabuthema Zwangsprostitution in Deutschland aufgreift. Eine (vielleicht) wahre Geschichte. Meine Geschichte?
Laura Adrian
Nur die
Hölle
könnte schlimmer sein!
Leben zwischen Zwangsprostitution und Alltag
Roman
Alle Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen ist rein zufällig. Original Ausgabe erschienen im August 2017 bei Merlins Bookshop.
Copyright © Merlins Bookshop
Korrektorat & Lektorat: Merlins Bookshop
Verlag: Merlins Bookshop, Inh. Dietmar Noss, Waldstr. 22, 65626 Birlenbach
Alle Rechte liegen bei Merlins Bookshop, Inh. Dietmar Noss, Waldstr. 22, 65626 Birlenbach
Cover: Merlins Bookshop unter Verwendung eines Fotos von RAWfeelings Photography by Alex Apprich, Model & MUA: Carmen Bannert http://www.rawfeelings-photography.com .
ISBN-13: 978-3-96248-001-1
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung von Merlins Bookshop zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie das Speichern und Verarbeiten in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 - Gedankenkarussell (Monolog)
Kapitel 2 - Eine behütete Kindheit
Kapitel 3 - Zeit verändert
Kapitel 4 - Eine nette Internetbekanntschaft
Kapitel 5 - Das erste Treffen
Kapitel 6 - L - wie Liebe oder l - wie leblos
Kapitel 7 - Der Tag danach
Kapitel 8 - Ein bescheidenes Wochenende
Kapitel 9 - Immer erreichbar
Kapitel 10 - Gewaltsamer Übergriff
Kapitel 11 - Probleme über Probleme
Kapitel 12 - Verletzungen der Seele sieht man nicht
Kapitel 13 - Die Ruhe vor dem Sturm
Kapitel 14 - Der Tag, an dem ich mein Lachen verlor
Kapitel 15 - Make-up, Rasierklinge, Lügen und Flucht in eine Routine
Kapitel 16 - Nur starke Menschen zerbrechen
Kapitel 17 - Ein Arzttermin und weitere Sorgen
Kapitel 18 - Ich sehe alles, ich kontrolliere dich!
Kapitel 19 - Wie viel Schmerz kann ein Mensch ertragen?
Kapitel 20 - Ein seltsames Treffen
Kapitel 21 - Start der Klassenfahrt
Kapitel 22 - Der letzte Abend in der Jugendherberge
Kapitel 23 - Ein lebendiger Albtraum
Kapitel 24 - Schlimmer geht immer
Kapitel 25 - (V)erkauftes Leben
Kapitel 26 - Hoffnungslos versagt … Die Maske fällt
Kapitel 27 - Die schlimmste Tat
Kapitel 28 - Endstation Krankenhaus
Letztes Kapitel - Nachwort
„Schweig still mein Herz! Ich höre Dich schlagen, doch jeder Schlag tut weh.
Schweig still meine Angst! Ich höre deine Stimme, doch bin ich unfähig zu handeln.
Schweigt still meine Gedanken! Ich höre eure Worte, doch sie ergeben keinen Sinn.
Schweigt still meine Träume! Ich sehe eure Bilder, doch sind sie nicht real für mich.
Schweig still meine Seele! Ich spüre deine Wunden, doch ich kann sie nicht heilen.
Schweig still!“
Text & © RAWfeelings Photography by Alex Apprich
http://www.rawfeelings-photography.com
Dieses Buch widme ich allen Opfern von häuslicher und/oder sexueller Gewalt, Zwangsprostitution und allen Helfern, die sich für Opfer und gegen Täter starkmachen.
Hinweis: Mein Ziel ist es nicht, jemanden an den „Pranger“ zu stellen. Ich möchte niemandem Schuld zuweisen, verurteilen oder Ähnliches. Mit diesem Buch verfolge ich ein ganz anderes Ziel: Ich möchte Aufmerksamkeit! Ich möchte auf das Thema Zwangsprostitution in Deutschland (oder auch in anderen Ländern) aufmerksam machen und zeigen, was die Taten mit den Opfern anrichten, wie lange sie leiden und zu welchen „perfekten“ Überlebenskünstlern die meisten werden. Denn viele Mädchen (oder auch Jungen), die die Hölle auf Erde durchmachen müssen, sind zu grandiosen Schauspielern geworden, die ein anscheinend glückliches Leben führen, immer für andere da sind und ihre wahren Gedanken und Gefühle hinter einer Fassade, einem künstlichen Lächeln verstecken. In den seltensten Fällen sieht man ihnen direkt an, wie schlecht es ihnen wirklich geht.
Des Weiteren ist es mein Ziel, Mut zu machen. Mut hinzuschauen. Das Schlimmste an häuslicher Gewalt, Mobbing, Schlägen, Erpressung oder Ähnlichem ist nämlich, wenn nach Jahren jemand kommt und sagt „Ich habe es immer geahnt …“.
Jedes Wegschauen tut den Opfern fast genauso weh wie die Taten selbst. Sicherlich ist es nicht die beste Lösung, sich selbst in Gefahr zu bringen, Selbstjustiz zu üben oder gar selbst zu einem Racheengel zu werden. Davon sollten Sie absehen! Ich meine mit „hinsehen“, dass man den Opfern Hilfe anbieten kann, Beratungsstellen aufzusuchen, Kontakt zur Polizei herzustellen … es gibt viele Anlaufstellen, die unterstützen und beraten können.
DURCH WEGSCHAUEN LÖST MAN KEINE PROBLEME!
Für alle die Hilfe brauchen, gibt es unter anderem diese Anlaufstelle:
Wildwasser Kreis Groß-Gerau e.V.
Verein gegen sexuellen Missbrauch
Darmstädter Straße 101
65428 Rüsselsheim
Tel. 06142/965760
Kapitel 1 - Gedankenkarussell (Monolog)
„Wer bin ich eigentlich?“ Diese Frage habe ich mir schon sehr oft gestellt, aber bis jetzt habe ich noch nie eine zufriedenstellende Antwort darauf gefunden. Ich weiß, dass ich Lucy Mayer heiße, vor drei Wochen achtzehn Jahre alt geworden bin, dass ich einen Meter siebenundsechzig groß und siebenundsechzig Kilo schwer bin, lange braune Haare habe, dunkelbraune Augen ... aber das sind ja alles äußerliche Merkmale. Das sagt nicht aus, wer ich wirklich bin. Oder vielleicht doch?
Ich bin die Person im Spiegel, doch ist mein Spiegelbild tatsächlich „Ich“. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich mir stundenlang über solche sinnlosen Fragen den Kopf zerbrechen kann. Überhaupt denke ich viel zu viel nach. Ich stelle mir Fragen, auf die kaum ein anderer Mensch kommt, ich zweifle an der Realität, meiner eigenen Existenz, versuche zu sterben, will gleichzeitig leben und versuche glücklich zu sein, obwohl ich innerlich zerbreche.
Ich bin einfach verrückt! Oder ist es die Welt, die verrückt ist?
Wieder eine Frage, die mir eine weitere schlaflose Nacht bescheren kann.
Vielleicht liegt das alles daran, dass mein Leben ein bisschen „anders“ ist. Ich bin nicht normal. Eventuell wirke ich nach außen noch halbwegs wie ein normaler Teenager, aber das alles ist Schein, Maskerade. Ich bin nicht die, die ich vorzugeben behaupte. Doch das weiß kaum jemand. Ich führe ein perfektes Doppelleben. Wobei der Begriff „perfekt“ in meinem Leben eigentlich vollkommen fehl am Platz ist. Nichts ist perfekt. Mein Leben ist peinlich, zum Schämen, von Angst durchzogen, von Gewalt, Zwang und dem Wunsch auszubrechen. Wie bereits erwähnt: Bei mir ist nichts normal. Mein „normales“ Leben habe ich vor fünf Jahren verloren. Ich habe es zu Grabe getragen und beerdigt, an diesem Tag wurde mein altes Leben ausgelöscht. Von einem auf den anderen Tag hat sich seitdem vieles verändert. Alles ist anders geworden, aber gleichzeitig ist es doch gleich geblieben. Ein einziges Erlebnis hat mich getötet und mir im selben Moment ein neues Leben beschert. Es ist alles so verwirrend. Manchmal blicke ich da selbst nicht mehr durch.
„Wer bin ich eigentlich?“ Diese doofe Frage geht mir leider nicht mehr aus dem Kopf! Egal was ich mache, sie scheint mich förmlich zu verfolgen. Ununterbrochen kreist sie in meinem Kopf umher. Doch je mehr ich über die Antwort nachdenke, desto mehr scheine ich mich von mir selbst zu entfernen. Ich weiß einfach nicht mehr wer ich bin! Das ist doch bescheuert! Wie kann man sich schließlich selbst verlieren?!
Vielleicht – oder hoffentlich! – bringen mir die folgenden Seiten Klarheit. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es ausprobieren. Und wer weiß: Vielleicht ordnet sich dadurch ja mein Gedankenchaos und meine Gefühle sortieren sich neu. Vielleicht entdecke ich zufällig irgendwo unter diesem Trümmerhaufen mein richtiges „Ich“. Vielleicht lebt es ja noch. Vielleicht ist es noch nicht umgekommen und versteckt sich nur irgendwo zwischen den Schuttbergen meiner Vergangenheit und wartet darauf gefunden zu werden. Vielleicht, vielleicht, vielleicht …
Dies ist der erste Teil meiner Geschichte. Der Anfang. Der Anfang vom Ende …
Kapitel 2 - Eine behütete Kindheit
An meine Kindheit kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Unser Haus stand direkt an einer Hauptstraße, aber da es nur eine Kleinstadt war, lebten wir trotzdem relativ ruhig.
Wir – das waren mein Bruder Ben, mein Vater, meine Mutter und ich. Wir alle stellten nach außen hin eine echte Bilderbuchfamilie dar. Meine Mutter war im Elternbeirat der Grundschule, mein Vater arbeitete als gut verdienender Mitarbeiter in einer großen Firma, auf Veranstaltungen wurde ich immer von beiden Elternteilen begleitet, einmal im Jahr gab es einen großen Familienurlaub und jeden Sonntag war Familientag, an dem wir gemeinsam Ausflüge und Unternehmungen machten. Mir und meinem Bruder fehlte es wirklich an nichts.
Ein paar Zeilen weiter oben schrieb ich zwar „nach außen hin waren wir eine perfekte Bilderbuchfamilie“, aber auch hinter den Türen gab es bei uns nicht viel zu bemängeln. Sicherlich hatten wir öfters mal kleine Streitereien und besonders mit meinem zwei Jahre jüngeren Bruder geriet ich regelmäßig aneinander, doch in welcher Familie ist das nicht so? Wenn vier Leute unter einem Dach wohnen, ist es manchmal schwierig und erst recht, wenn zwei Leute davon Kinder in der Vorpubertät sind! Oh Gott, was mein Bruder und ich uns alles geleistet haben! Wir haben uns wegen einer Fernbedienung geprügelt, gegenseitig Legosteine geklaut, die Wände angemalt und den anderen ins Bad eingeschlossen und von außen das Licht ausgemacht.
Aber wenn es darauf ankam, dann hielten wir immer zusammen. So wie Geschwister nun mal sind. Wir haben uns geschlagen und vertragen. Doch nie würde ich meinen kleinen Bruder missen wollen. Ab und zu hätte ich ihn zwar zum Mond schießen können, aber sehr wahrscheinlich wäre ich dann in die nächste oder spätestens übernächste Rakete gestiegen, um ihn wieder zurückzuholen.
Und auch mit meinen Eltern war es ähnlich. Es gab immer mal wieder Diskussionen, kleinere Streitereien, aber danach war auch alles wieder gut. Ich glaube, solche Auseinandersetzungen sind in Familien „normal“. Ich habe das nie als besonders schlimm wahrgenommen oder gar deswegen einen Schaden davongetragen. Ich kann über diese wenigen Kleinigkeiten nicht meckern. Sie waren Kinderkram, nichts Großartiges, einfach nur banal.
Es war eigentlich alles super. Das Einzige, was mich ab und zu ein wenig traurig machte, war, dass mein Vater oft arbeiten war. Er hatte eine Anstellung in einer großen Autofirma und war dadurch selten zu Hause. Zwar musste er nie auf Geschäftsreisen, aber dafür arbeitete er im Schichtdienst. Eine Woche hatte er Frühschicht, danach die Woche Spätschicht, dann wieder früh, dann spät – immer im Wechsel. Das war für mich, besonders im Grundschulalter, doof. Eine Woche lang sah ich meinen Vater gar nicht, weil er um zwölf Uhr, wenn ich noch in der Schule war, bereits auf die Arbeit fuhr und erst nach zweiundzwanzig Uhr am Abend zurückkam, wenn ich schon im Bett lag. Und die andere Woche, wenn er Frühschicht hatte, sah ich ihn ebenfalls kaum. Denn wenn er um vierzehn Uhr von der Arbeit kam, verschwand er meistens in die Garage, um an seinem Auto zu schrauben oder sonst etwas an unserem großen Haus mit riesigem Garten zu werkeln. Das fand ich schade. Ich hätte gerne mehr von meinem Vater gehabt, mehr mit ihm gespielt und mehr mit ihm unternommen. Aber immerhin war er an jedem Wochenende zu Hause und hatte da Zeit für mich und meinen Bruder. Außerdem wusste ich ja, dass er arbeiten musste, um Geld zu verdienen. Ohne Geld kein eigenes Haus, kein großer Garten, keine Ausflüge und so weiter.
Meine Mutter war, bis ich in die 5. Klasse ging, durchgehend zu Hause. Sie widmete sich ganz meinem Bruder, mir und dem Haushalt. Jeden Tag kochte sie frisch für uns und half uns bei den Hausaufgaben. Zusammengefasst kann ich nur wiederholen: Meine Kindheit war echt, wie sie im Buche steht. Ich hatte Eltern, die für mich da waren, war in der Schule beliebt, schrieb gute Noten, hatte täglich Kontakt mit Freunden, tollte im Garten herum, erlebte auf den Feldern und in den Wäldern unserer Kleinstadt Abenteuer, baute Lager und hatte auch sonst alles, was zu einer grandiosen Kindheit dazugehört.
Ich lebte wie eine kleine Prinzessin. Noch wusste ich zwar nicht ganz zu schätzen, was ich alles hatte, doch trotzdem war ich jeden Tag dankbar. Es verging kein Tag, an dem ich nicht lachte. Und selbst wenn ich einmal traurig war und weinte, dauerte es meist nicht lange, bis ich wieder lachte.
Ich würde behaupten, ich hatte eine wunderschöne, unbeschwerte Kindheit. Ich wuchs sehr behütet und mit viel Liebe auf.
Ich muss lachen, wenn ich daran denke, wie ich mit sieben Jahren unbedingt einen Prinzen kennenlernen wollte. Ich wollte eine Prinzessin werden und in ein großes Schloss ziehen. In meinem Garten sollten mindestens zehn Pferde wohnen. Ich hatte mir sogar schon die Namen für diese Pferde ausgedacht! Und auch von meinem Prinzen hatte ich schon genaue Vorstellungen. Er sollte dunkle Haare haben, blaue Augen und ganz viele Muskeln. Schließlich musste er ja täglich die ganzen Pferdeboxen misten und mich im Ernstfall verteidigen können!
Stundenlang übte ich, auf Stöckelschuhen zu laufen und mich vor dem Spiegel wie eine Prinzessin zu bewegen. Jeder Schritt, jede Handbewegung, jeder Haarschwung musste sitzen. Denn im Fall der Fälle musste sich der Prinz innerhalb von Sekunden in mich verlieben. Da durfte ich mir keinen Patzer oder Fehltritt erlauben. Wenn ein Prinz vor meiner Tür stünde, hätte ich nur eine Chance und die dürfte nicht schiefgehen.
Wenn ich heute daran denke, wie wohl ich mich damals in meinem Körper gefühlt habe und wie schön ich mich selbst fand, steigen mir Tränen in die Augen. Schon lange kann ich den Anblick meines eigenen Spiegelbildes nicht mehr ertragen. Ich hasse es. Mein Körper widert mich an. Doch damals war ich noch sehr beeindruckt von mir selbst. Ich konnte es kaum erwarten, von einem kleinen Mädchen zu einer jungen Frau zu werden. Ich legte sehr viel Wert auf mein Äußeres, mein Auftreten und mochte mein Spiegelbild. Heute wünsche ich mir oft diese schöne, unbeschwerte Zeit und das Gefühl, sich im eigenen Körper wohlzufühlen, zurück. Ich wünsche mir, dass ich nie erwachsen geworden wäre, nie in die Pubertät gekommen und somit nie an diese bescheuerten Typen geraten wäre. Dann wäre ich nämlich nie abgestürzt, hätte nie angefangen mich selbst zu verkaufen, meinen Körper zu hassen und mir selbst den Tod zu wünschen …
Kapitel 3 - Zeit verändert
Wann genau mein Leben begonnen hat sich zu verändern, kann ich nicht genau benennen. Es waren viele Faktoren, die schlussendlich dazu beigetragen haben, dass ich den Lebenslauf hinlegte, den ich hingelegt habe. Am besten beginne ich mit dem Wechsel von der Grundschule auf die Realschule, denn da fingen bereits die ersten Veränderungen an.
Nach der 4. Klasse wechselte ich auf die Realschule in unserer Stadt. Meine damalige Klassenlehrerin in der Grundschule meinte zwar, dass ich intelligenzmäßig auch das Können fürs Gymnasium hätte, aber dass die Realschule in unserer Stadt trotzdem besser für mich wäre. Denn würde ich aufs Gymnasium gehen, müsste ich mit dem Bus fahren und dafür würde mir laut ihren Einschätzungen das Selbstbewusstsein fehlen. Ich wäre zu schüchtern und zu ängstlich, um mich im Schulbus gegen die älteren Schüler zu behaupten. Deshalb wäre es besser, wenn ich erst einmal in „Ruhe“ meinen Realschulabschluss machen würde, einen nicht ganz so weiten Schulweg hätte und somit mit keinem Schulbus fahren müsste. In der Realschule unserer Stadt wäre ich deswegen laut ihren Erfahrungswerten und Fachkenntnissen bestens aufgehoben.
Meine Eltern sahen diese Entscheidung ähnlich. Auch sie waren dafür, dass ich nach dem Abschluss der 4. Klasse auf die städtische Realschule wechselte anstatt auf eines der Gymnasien im Umkreis. Ich sollte nicht direkt den vollen Lernstress und Zeitdruck einer weiterführenden Schule abbekommen. Auf einer Realschule wäre ich kognitiv ausreichend gefördert, aber hätte zeitgleich noch die Chance meine Freizeit am Nachmittag zu genießen, positiv zu nutzen und mich selbst weiter zu entwickeln. Ich müsste nicht den gesamten Nachmittag durchlernen oder eventuell sogar Nachhilfeunterricht nehmen, um den Schulstoff zu verstehen, so wie es die meisten Gymnasiasten spätestens ab der 7. Klasse taten.
Mir persönlich war die Entscheidung, ob ich nach der Grundschule auf die Realschule oder ein Gymnasium wechselte, eigentlich relativ egal. Mir war es gleichgültig, ob ich mit einem Bus fahren musste oder nicht. Das einzig schlagfertige und im Endeffekt auch entscheidende Argument für mich waren die Aufstehzeiten. Und da punktete eindeutig die Realschule in unserer Stadt. Denn egal, auf welches Gymnasium ich gehen würde, ich müsste mindestens fünfundvierzig Minuten früher aufstehen, um den Bus zu erwischen, als wenn ich mit dem Fahrrad in die Realschule fahren würde. Und diese fünfundvierzig Minuten weniger Schlaf jede Nacht waren das Gymnasium echt nicht wert!
Außerdem hatte ich nach dem Abschluss der 10. Klasse immer noch die Chance auf ein Gymnasium zu wechseln und mein Abitur nachzuholen. Oder alternativ könnte ich parallel zu meiner Ausbildung auf der Berufsfachschule mein Fachabitur machen. Oder, falls ich das nicht wollte, hätte ich selbst in 20 Jahren noch die Möglichkeit mein Abitur auf einer Abendschule nachzuholen. Also alle Türen standen mir weiterhin offen. Um meinen Werdegang in sechs Jahren nach dem Abschluss meiner mittleren Reife brauchte ich mir noch keine Gedanken zu machen.
Meine Grundschullehrerin berief sich bei ihrer Empfehlung für meine weitere Schullaufbahn wie bereits gesagt, hauptsächlich auf mein mangelndes Selbstvertrauen. Ob ich zu diesem Zeitpunkt wirklich so wenig Selbstvertrauen hatte, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich weiß, dass ich nicht gerne im Mittelpunkt stand und eher zu den ruhigeren Schülern zählte, aber so schlimm, wie die Lehrerin mein Selbstvertrauen hinstellte, war es garantiert nicht!
Ja, ich war eine Schülerin, die gerne und viel träumte, sich bei Trubel häufig zurückzog und nicht immer unter Leuten sein musste, aber dennoch besaß ich zu dieser Zeit ein einigermaßen gesundes Selbstvertrauen. Vor allem besaß ich mehr Selbstvertrauen als heute!
Doch nicht nur meine schulische Situation sollte sich nach der 4. Klasse ändern, sondern auch in meinem gewohnten Familienleben sollte es zu Veränderungen kommen. Meine Mutter hatte sich dazu entscheiden, dass mein Bruder und ich nun alt genug wären, um zwei Tage in der Woche nach der Schule ein paar Stunden alleine zu verbringen. Sie wollte wieder arbeiten gehen. Vorerst wollte sie nur montags und donnerstags arbeiten, doch, wenn das gut ging, wollte sie in einem Jahr ihre Arbeitszeit auf einen dritten und später vielleicht auch auf einen vierten Arbeitstag erhöhen. Aber bis dahin sollten mein jüngerer Bruder und ich nur zwei bis maximal drei Stunden an den besagten Tagen alleine sein.
Da meine Mutter ihren Arbeitsbeginn drei Wochen vor dem offiziellen Schulstart des neuen Schuljahres hatte, hatten wir alle noch ein bisschen Zeit uns an die neue Situation zu gewöhnen. Wobei mein Bruder und ich diese Umstellungen im Augenblick durchweg positiv sahen. Denn endlich hatten wir mal unter der Woche sturmfreie Bude und das auch noch regelmäßig! Allein der Gedanke nach Hause zu kommen und „alleine“ zu sein, ließen uns gefühlte zwanzig Zentimeter wachsen. Wir fühlten uns dadurch groß und erwachsen. Die Herausforderungen, eventuellen Probleme und die neue Verantwortung, die dadurch ebenfalls auf uns zukam, blendeten wir aus. Oder wahrscheinlich war uns diese auch gar nicht bewusst. Wir sahen nur die positiven Seiten.
In den letzten drei Wochen der Sommerferien lief diese neue Herausforderung für die ganze Familie tatsächlich perfekt. Meine Mutter ging in ihrem neuen Job als Verkäuferin in einem Stoffgeschäft total auf. Auch wenn sie in der Zeit zuvor nie wirklich unentspannt oder unausgeglichen gewirkt hat, so veränderte sie die neue Arbeit dennoch zum Positiven. Sie wirkte zufriedener und ausgeglichener. Und auch für uns Kinder war es ein Traum, ohne Aufpasser das Haus für uns alleine zu haben. In der Woche, in der unser Vater noch zu Hause war, verlief die Zeit ohne Mama noch halbwegs „normal“. Bei ihm hatten wir zwar auch schon ein paar Freiheiten mehr, zum Beispiel gab es Fastfood zum Mittagessen, wir durften länger an unsere PCs und ins Internet, aber trotzdem gab es noch gewisse Regeln, an die wir uns halten mussten. Doch in der Woche, in der er ebenfalls nicht zu Hause, sondern auf Arbeit war, gab es gar keine Regeln mehr. Mein Bruder beobachtete am Fenster meine Mutter und wartete, bis sie mit ihrem Auto wegfuhr und sobald er das Auto nicht mehr sah, rannten wir gemeinsam in Windeseile zum Fernseher und schalteten ihn an. Selbst beim Mittagessen lief die „Glotze“ wie meine Mutter dazu immer sagte. Wir taten in den sechs Stunden, in denen wir alleine waren, eigentlich alles, was verboten war. Wir schauten morgens schon fern, aßen auf der Couch, plünderten den Süßigkeitenschrank, surften im Internet und spielten stundenlang PC-Spiele. Nur kurz bevor ein Elternteil nach Hause kam, räumten wir eilig alles auf, leerten ein Brettspiel aus und taten so, als würden wir spielen. Oder jeder von uns zog sich in sein Zimmer zurück, nahm ein Buch in die Hand oder legte eine Kassette ein.
Was im Haus passierte, wenn unsere Eltern weg waren, war und blieb unser Geheimnis. Sozusagen unser „Geschwistergeheimnis“. Nie hätte einer von uns daran gedacht, den anderen zu verpetzen, denn dann hätten wir beide Ärger bekommen! Und das wollte keiner von uns!
Als die Schule dann anfing, hatten wir keine Zeit mehr den gesamten Tag vorm Fernseher oder Computer zu verbringen. Schließlich mussten wir vormittags in die Schule. Doch sobald wir zu Hause waren, schalteten wir wieder sofort den Fernseher ein, wärmten uns das vorgekochte Mittagessen in der Mikrowelle auf und aßen bei dem Anblick unserer Lieblingsserie auf der Couch im Wohnzimmer. Uns blieben zwar nur zwei bis drei Stunden zur freien Verfügung – oder wenn unser Vater Frühschicht hatte, und schon um vierzehn Uhr nach Hause kam noch weniger Zeit – aber diese Zeit nutzten wir, um alles Mögliche zu tun. Unser Ziel war es, in diesen sturmfreien Stunden alles zu machen, außer das, was wir tun sollten, nämlich Hausaufgaben.
Nach ein paar Wochen verlor dieses ständige Herumlungern, das zwanghafte Fernsehschauen und ja nicht zu viel bewegen allerdings seinen Reiz. Es war nichts Besonderes mehr nach Hause zu kommen und alleine zu sein, sondern zweimal in der Woche normaler Alltag. Klar hatte es weiterhin seine Vorteile sturmfrei zu haben, aber es war kein „Zwang“ mehr dahinter alles Unerlaubte auszuprobieren. Stattdessen wurden mein Bruder und ich wieder zu lieben und braven Kindern, die zwar weiterhin die Vorzüge auf der Couch zu Essen ausnutzten, und auch danach den Fernseher nicht ausschalteten, aber dennoch nach dem Essen mit ihren Hausaufgaben anfingen.
Das erste Mal wurden mir die tatsächlichen Nachteile zweier berufstätiger Elternteile kurz nach dem ersten Schulhalbjahr bewusst. Ich war nun schon seit knapp sieben Monaten in der neuen Schule, aber hatte noch immer keinen richtigen Anschluss gefunden. Aus meiner alten Grundschulklasse war zwar meine damalige beste Freundin wieder mit mir in die Klasse gekommen, aber außer ihr hatte ich keine weiteren festen Kontakte. Ich lungerte mal hier rum, mal da, unterhielt mich mit Leuten aus der einen Clique und mit Leuten aus der anderen Clique. Ich kam mit jedem aus, doch gehörte nirgends dazu. Ich wurde überall geduldet, aber mehr auch nicht. Ich hatte keine festen Leute, mit denen ich richtig reden – also nicht nur über Hausaufgaben, Schulaufgaben, anstehende Projektaufgaben oder belangloses Zeug – sondern richtig reden konnte. Egal, zu welcher Gruppe ich kam, ich fühlte mich überall als Fremdkörper. Ich war da, aber mehr nicht. War ich weg, interessierte es niemanden. Niemand fragte nach mir, suchte mich oder vermisste mich. Zu Beginn des Schuljahres war mir das alles noch relativ egal, schließlich hatte ich meine beste Freundin, mit der ich ein festes Team bildete, und in der Klasse gab es auch noch keine wirklich festen Gruppen. Alle waren noch in der Gruppenfindungsphase. Doch kurz vor dem Halbjahr änderte sich das. In dieser Zeit begannen sich klaren Gruppen in der Klassengemeinschaft herauszukristallisieren. Es gab die „Coolen“, die schon ihren ersten Freund oder Freundin hatten, ständig über Mode diskutierten und in denen die Mädchen bereits erste Schminkversuche starteten. Dann gab es die „Zocker“, die den gesamten Tag über Computerspiele, neue Windows-Systeme, Technik und so einen Kram diskutierten, die „Anime-Fans“, die selbst im Unterricht ihre Mangahefte nicht aus der Hand legen konnten, und sich sogar teilweise so kleideten wie ihre Lieblingsfiguren, und dann gab es noch die Gruppe der „Allrounder-Normalos“, die ebenfalls eine feste Gruppe bildeten, aber keine festen Wiedererkennungsmerkmale hatten. Und zu guter Letzt gab es meine beste Freundin und mich. Wir gehörten zu keiner Gruppe dazu, aber wurden von allen akzeptiert und das Wichtigste: Wir hatten uns beide. Wir verbrachten jede Pause zusammen, gingen gemeinsam aufs Klo, ließen die andere Hausaufgaben abschreiben, tuschelten zusammen im Unterricht und trafen uns regelmäßig nachmittags nach der Schule, um noch mehr Zeit zusammen zu verbringen. Wir waren unzertrennlich. Zumindest dachte ich das im ersten Halbjahr. Ein paar Wochen nach dem Halbjahreszeugnis sollte sich das alles jedoch schlagartig ändern ...
Vom einen auf den anderen Tag wurde mir meine beste Freundin plötzlich fremd. Sie redete nur noch über Jungs, änderte ihren Kleidungsstil und meinte, dass ich ihr zu langweilig sei. Immer häufiger stand sie in den Pausen bei den „Coolen“ und immer weniger bei mir. Nach knapp vier Wochen grüßte sie mich morgens nicht einmal mehr und setzte sich auch im Unterricht von mir weg. Ab diesem Zeitpunkt saß ich alleine an einem Doppeltisch in der ersten Reihe. An dem sogenannten „Strebertisch“. Und ja verdammt, das war ich auch! Ich war alleine, und ich war eine Streberin! Aber nicht, weil ich stundenlang zu Hause saß und lernte, sondern weil ich ein unwahrscheinlich aufnahmefähiger Mensch war, dem es leicht fiel, schnell Informationen und Lernstoff abzuspeichern. Aber das war meinen Mitschülern egal. Für sie war ich die Streberin aus der ersten Reihe.
Solange ich noch mit meiner besten Freundin befreundet war, trauten sich die anderen kaum, zu mir einen doofen Spruch zu sagen oder mich zu beleidigen, doch das änderte sich nun. Da ich im Unterricht alleine saß und auch in den Pausen häufig alleine auf dem Schulhof herumstand, wurde ich zu einem idealen Opfer für sie.
Zu Beginn waren es lediglich ein paar doofe Sprüche, die ich abbekam, aber da ich mich nicht wehrte, steigerten sich diese anfänglichen Neckereien zunehmend weiter. Bald kamen Beleidigungen dazu, dann wurden mir Stifte geklaut, Spitzerdreck in den Ranzen geschüttet, mein Mäppchen flog aus dem Fenster raus und noch vieles mehr. Meine ehemalige beste Freundin schaute bei all dem tatenlos zu und einmal hörte ich sie sogar sagen, dass sie es bereute, mit so einem „Opfer“ wie mir befreundet gewesen zu sein. Dieser Satz von ihr verletzte mich fast noch mehr als die Streiche und Beleidigungen der anderen Mitschüler. Als ich sie nach dem Unterricht darauf ansprach, antwortete sie lediglich: „Ja Lucy, ist halt so! Du bist so etwas von einem Opfer, du kleidest dich total altmodisch, bist verklemmt, voll der Spießer und dazu noch ein Streber. Ich kann mich nicht mehr mit dir blicken lassen, schließlich gehöre ich jetzt zu den Coolen. Die dulden niemanden wie dich in ihrer Clique.“
Am liebsten hätte ich an diesem Tag, an dem mir meine ehemals beste Freundin „durch die Blume“ unsere langjährige Freundschaft gekündigt hatte, mit meiner Mutter darüber geredet. Zu gerne wäre ich ihr weinend in die Arme gefallen und hätte mich bei ihr ausgeweint. Doch das ging nicht, denn es war Donnerstag und sie war arbeiten. Deshalb zog ich mich – wie in den letzten Tagen schon so oft – allein in mein Zimmer zurück, ließ mich aufs Bett fallen und weinte in mein Kissen.
Zwar hätte ich mit meiner Mutter noch am Abend reden können oder am nächsten Tag, aber irgendwie brachte ich es nicht übers Herz, ehrlich zu ihr zu sein. Meine Mutter war momentan so glücklich mit ihrem neuen Job, freute sich über meine guten Noten in der Schule und war unwahrscheinlich stolz darauf, wie mein Bruder und ich alleine zurechtkamen, wenn sie arbeiten war. Hätte ich ihr jetzt erzählt, dass ich in der neuen Schule ganz und gar nicht zurechtkam, dort keine Freunde hatte, ausgegrenzt wurde, todunglücklich war und nun auch noch meine beste Freundin sich von mir abgewandt und die Freundschaft gekündigt hatte, wäre sie sicherlich traurig geworden. Und das wollte ich nicht! Ich wollte meine Mutter nicht traurig sehen und erst recht wollte ich nicht der Grund für ihre Traurigkeit sein! Außerdem war sie am Abend nach ihrer Arbeit immer so müde, und an den anderen Tagen hatte sie genug im Haushalt zu tun. Nein, ich konnte und wollte ihr nicht die Wahrheit erzählen. So schlimm war das alles ja auch nicht. Ich konnte damit leben. Sicherlich würden auch bald wieder bessere Zeiten kommen.
Woher ich diesen Optimismus nahm, konnte ich selbst nicht sagen, aber dieser unzerstörbare Optimismus sollte mir in den nächsten Jahren noch des Öfteren das Leben retten. Egal, wie scheiße es mir ging, ich hielt immer an dem Glauben fest, dass es irgendwann wieder besser werden würde. Außerdem zog ich mich lieber in mein Zimmer zurück und weinte alleine, anstatt über meine Probleme und Sorgen zu reden. Ich bildete mir ein, dass meine Probleme Kinderkram waren, ich damit meine Eltern nur unnötig belasten würde und nun mit fast zwölf Jahren nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit zu meinen Eltern rennen konnte. Ich musste anfangen, mein Leben und meine Probleme selbst zu managen. Schließlich redeten doch alle von Verantwortung.
Ich glaube, dass dieses „falsche“ Denken bereits ein wichtiger Punkt war, weshalb ich später so tief abstürzte. Ich hatte nie den Mut über meine Probleme zu reden oder Gefühle zu zeigen. Ich fraß lieber alles in mich hinein und machte es mit mir selbst aus.
Ich glaube nicht, dass dieses „nicht reden wollen, beziehungsweise können“ an meinen Eltern oder ihrer Erziehung lag, denn mein Bruder hat ja dieselbe Erziehung wie ich genossen und nicht mit dieser Problematik zu kämpfen. Ich weiß auch nicht, wieso ich immer alles mit mir selbst ausmachen wollte, nie redete, mich nie wehrte und die Fehler grundsätzlich bei mir suchte, aber ich weiß, dass mich dieses Verhalten zu einem perfekten Opfer gemacht hat ...
Wenn ich genauer darüber nachdenke, frage ich mich, ob ich nicht bereits zu dieser Zeit mich selbst verloren hatte? Vor einem Jahr war ich noch das glückliche Mädchen, das überall gemocht wurde, gerne in den Spiegel schaute, lebensfroh war – und jetzt? Jetzt schien ich ein anderer Mensch zu sein!
Gewiss war diese Zeit noch harmlos im Gegensatz zu dem, was ich ein paar Jahre später erlebte, aber im Nachhinein würde ich vielleicht trotzdem diese Phase schon als Anfang vom Ende bezeichnen. Ohne, dass ich es bewusst wahrnahm, hatte ich mich selbst und mein Leben verändert.
Hatte meine Grundschullehrerin vor einem halben Jahr recht? Besaß ich wirklich kein Selbstvertrauen? Oder war es einfach nur eine Verkettung unglücklicher Umstände, die mich in die Rolle des Außenseiters drängten?
Ich denke, das ist schwer zu sagen, doch Fakt war, dass ich mir die negativen Aussagen meiner Mitschüler sehr zu Herzen nahm. Jeder andere Mensch hätte wahrscheinlich gesagt: „Du musst über die doofen Kommentare drüberstehen!“, „Mach dein Ding und lass dich nicht beirren!“, oder „Die sind doch alle nur neidisch auf deine guten Noten!“, doch ich konnte über diese Worte nicht einfach so darüberstehen. Jeden Kommentar, jede Aussage, jede Beleidigung nahm ich mit nach Hause.
Ich fragte mich oft, ob ich tatsächlich so ein verkehrter Mensch war, ob meine Mitschüler nicht vielleicht recht hatten, ich es nicht anders verdient hatte etc. Aber nie fragte ich mich, ob mir nicht eventuell unrecht getan wurde. Nie gab ich meinen Mitschülern die Schuld, wenn ich mich abends in den Schlaf weinte oder nachmittags traurig im Bett lag, sondern selbst in solchen Situationen suchte ich noch die Schuld bei mir.
Dieses Gefühl, selbst für das mobbende Verhalten meiner Mitschüler verantwortlich zu sein, war auch einer der Hauptgründe, wieso ich das alles stillschweigend hinnahm und ich mich niemanden anvertraute. Ja, ich redete mir ein, dass ich es nicht wert war, dass man sich um mich kümmerte, dass meine Eltern und Lehrer sicherlich wichtigere Probleme hatten als sich um mich und meine Sorgen zu kümmern!
Woher dieses plötzliche Loch in meinem Selbstwertgefühl stammte, ist mir bis heute ein Rätsel. Ich nehme an, dass zu dieser Zeit schlichtweg zu viele Veränderungen, Neuerungen und Probleme auf mich einschlugen. Ich war überfordert, ohne dass ich es mitbekam, und als ich es dann merkte, war es schon zu spät. Echt krass, wie sehr Worte die eigene Selbstwahrnehmung eines Menschen angreifen, ihn verletzen und das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zerstören können! So ein paar unüberlegte Worte können fast schon mehr Schaden anrichten als manche Waffen.
Das Mobbing in der Schule wurde für mich zum Alltag. Es wurde eine ganze Weile lang nicht schlimmer, aber auch nicht besser. Es stabilisierte sich. Ich saß weiterhin im Unterricht alleine in der ersten Reihe, war eine Streberin, die durchweg gute Noten schrieb, bekam deswegen von meinen Mitschülern doofe Sprüche zu hören, stand auf den Pausenhof in den Pausen alleine da, bekam regelmäßig Beleidigungen ab, hatte keine Freunde, zog mich zunehmend weiter zurück und weinte fast jeden Abend. An meinem 12. Geburtstag gratulierte mir kaum jemand, aber jeder wollte ein Stück meines mitgebrachten Kuchens essen. Ich war der absolute „Buhmann“ in der Klasse, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte. Von Woche zu Woche wurde ich unzufriedener mit meinem Leben. Allerdings kam ich immer noch nicht auf die Idee, mit einem Lehrer oder meinen Eltern darüber zu reden. Stattdessen zog ich es vor, mich ins Lernen zu flüchten. Denn ich merkte, wenn ich gute Noten schrieb, wurde ich von den Lehrern gelobt und bekam auch zu Hause von meinen Eltern gesagt, dass sie stolz auf mich und meine Leistungen seien. Das klingt jetzt wahrscheinlich etwas doof, aber dadurch konnte ich dann ausnahmsweise auch ein bisschen stolz auf mich selbst sein.
Nur wenn mich jemand bestätigte und mir mitteilte, dass ich etwas gut gemacht hatte und er oder sie stolz auf mich war, konnte ich ebenfalls stolz auf mich sein.
Bekam ich kein Lob oder Bestätigung zu hören, fühlte ich mich durchweg nutzlos und wertlos. Ich machte mein Selbstwertgefühl extrem von den Ansichten anderer abhängig und begann mich fast nur noch über Leistungen zu definieren. Brachte ich keine Bestleistungen, fühlte ich mich direkt schlecht. Meiner Meinung und meinem Empfinden nach war lernen und gute Noten schreiben das Einzige, was ich konnte. Als ich dann am Ende des Schuljahres eine Auszeichnung als Klassenbeste bekam, fühlte ich mich kurzzeitig richtig gut und geehrt! In diesem Augenblick konnte ich für ein paar Minuten die Beleidigungen und doofen Sprüche meiner Mitschüler vergessen. Schließlich hatte ich etwas geschafft, was sonst niemand aus der Klasse erreicht hatte. Ich war nicht nur „gut“, sondern „die Beste“!
Kapitel 4 - Eine nette Internetbekanntschaft
Nach den Sommerferien steigerte sich das Mobbing meiner Mitschüler nochmals drastisch. Zuvor waren es lediglich ein paar Neckereien und doofe, unüberlegte Sprüche, die mir meine Klassenkameraden an den Kopf schmissen, die hauptsächlich auf meinen Sitzplatz in der ersten Reihe und meine überdurchschnittlich guten Noten bezogen waren, doch im neuen Schuljahr wurde das alles anders. Ich stand in den Pausen nicht mehr alleine herum, sondern ich stand in der Mitte und meine Mitschüler standen um mich herum. Ich wurde ausgelacht, mein Ranzen wurde im Kunstunterricht mit Kleister vollgeschmiert, mir wurde gesagt wie hässlich und fett ich sei, es wurde sich über meine Figur lustig gemacht, in den Schulkorridoren wurde ich „aus Versehen“ angerempelt, und wenn ich auf Toilette ging, war, wenn ich wieder heraus wollte, meistens ganz zufällig die Tür verklemmt. Ich war prinzipiell der Sündenbock von allen und die Lachnummer der gesamten Schule ...
Wie ich mich damals gefühlt habe, kann ich gar nicht mehr in Worte fassen. Am liebsten hätte ich in dieser Zeit eine Mütze besessen, die mich, wenn ich sie aufsetzte, unsichtbar werden ließ. Ich wollte einfach nur noch weg. Weg von den Problemen, den Sorgen, meinen doofen Klassenkameraden und vielleicht auch weg von mir selbst.
Meine Eltern bekamen von den zunehmend schlimmer werdenden Mobbingattacken in der Schule sehr wenig bis gar nichts mit. Wie auch? Ich erzählte schließlich nichts. Zusätzlich ging meine Mutter seit dem neuen Schuljahr vier Tage die Woche arbeiten. Bis auf Freitagnachmittag waren mein Bruder und ich somit die ersten paar Stunden nach dem Unterricht alleine daheim. Wobei ich keinen meiner Elternteile die Schuld für meine Verschwiegenheit zuschieben möchte! Bitte nicht falsch verstehen! Ich denke, ich hätte, selbst wenn sie vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar gewesen wären, nicht mit ihnen geredet. Außerdem bekamen meine Eltern sehr wohl mit, dass ich mich veränderte. Besonders meine Mutter fragte häufig nach, wieso ich so traurig schaute, nachmittags nicht mehr mit Freunden draußen war und auch sonst kaum etwas von der Schule erzählte. Aber auf diese Fragen antwortete ich immer, dass alles ok sei und ich lediglich müde wäre. Nervten meine Mutter oder mein Vater dann noch weiter, stand ich auf und verschwand in mein Zimmer. Ich konnte nicht darüber reden. Ich wollte nicht bemitleidet werden und wollte niemanden mit meinen Problemen belasten. Deshalb litt ich lieber still und alleine in meinen privaten vier Wänden unter meiner Zudecke.
Mitte Oktober sollte sich mein Leben noch einmal radikal ändern. Mitte Oktober brach für mich meine Welt zusammen. Wobei ... eigentlich tat sie das erst ein paar Wochen später, Mitte Oktober war alles noch rosarot und wunderschön. Kurzzeitig schien alles perfekt zu werden.
In den Herbstferien meldete ich mich in einem sozialen Netzwerk an. Meine Eltern behaupteten zwar, dass ich mit zwölf Jahren noch zu jung wäre, um im Internet ein eigenes Profil zu haben, aber solange sie nichts davon wussten, konnten sie mich ja nicht daran hindern. Außerdem was sollte da schon passieren? Das „gefährliche“ Internet würde mich bestimmt nicht verschlingen. Die Behauptung, dass soziale Netzwerke für mein Alter noch zu gefährlich seien, hielt ich für ein Gerücht. Schließlich besaß fast jeder aus meiner Klasse einen Account und denen ging es auch noch allen gut! Dass nicht das Internet an sich gefährlich war, sondern die Leute, die sich in solchen Netzwerken rumtrieben, daran dachte ich aktuell noch nicht ...
Die ersten Tage in dem sozialen Netzwerk verliefen noch recht unspektakulär. Ich orientierte mich erst einmal in den ganzen Gruppen und Chats und musste die ganzen komischen Begriffe, die dort verwendet wurden, kennenlernen. Doch je mehr Zeit ich in diesem Netzwerk verbrachte, desto sicherer fühlte ich mich und desto mehr getraute ich mich von mir preiszugeben. Auf meinem Profil lud ich ein Foto von mir hoch und schrieb darunter, dass ich schon 15 Jahre alt sei. Warum genau ich das tat, wusste ich selbst nicht, aber ich fühlte mich dadurch cooler.
In den ersten Tagen bekam ich mal hier einen Like für ein Profilbild, mal da einen Like für mein Fotoalbum, in dem ich mittlerweile insgesamt vier Bilder hochgeladen hatte, hin und wieder eine Freundschaftsanfrage und ab und zu eine Spieleaufforderung, aber im Grunde genommen war es noch relativ langweilig und eintönig. Nach einer Woche hatte ich in meiner Freundesliste zehn „Freunde“, die ich zum Teil noch nicht einmal kannte, und insgesamt fünfzehn Likes für meine Bilder bekommen. Ein bisschen stolz machten mich diese Reaktionen auf meine Fotos von zum Teil wildfremden Leuten schon, doch es war nichts, worüber ich mich jetzt extrem freute. Richtige Glücksgefühle löste erst eine Freundschaftsanfrage eines Jungen aus meiner Umgebung aus. Zunächst dachte ich, es sei ein Versehen, dass er mir eine Freundschaftsanfrage gesendet hatte. Schließlich war er schon 19 Jahre alt, sehr, sehr gut aussehend, gut gebaut ... ein wahrer Mädchenschwarm! Also nicht der Typ Mann, der sich im Normalfall mit so einem Mauerblümchen wie mir abgab. Deshalb wollte ich auch erst seine Freundschaftsfrage nicht annehmen. Ich freute mich zwar sehr über die Anfrage, aber irgendetwas konnte da nicht stimmen. Wieso wollte solch ein gut aussehender Typ mit einem so hässlichen Mädchen wie mir befreundet sein? Doch als ich am nächsten Tag erneut im Internet war, erlebte ich ein wahres Wunder. Der gutaussehende Typ, der Cedric Hartmann hieß, hatte alle meine Bilder gelikt und mein Profilbild sogar kommentiert! Mit einem leicht mulmigen Gefühl in der Magengegend und extremen Herzklopfen las ich mir seinen Kommentar durch.
„Wow! Was für eine hübsche junge Frau! (Smiley mit Herzaugen) Ich hoffe, sie nimmt meine Freundschaftsanfrage an!“
Ungläubig las ich den Kommentar direkt ein zweites Mal und anschließend ein drittes Mal durch. Ich konnte nicht glauben, was dort stand! Ich war so unwahrscheinlich glücklich. Mein Grinsen ging von einem Ohrläppchen zum anderen Ohrläppchen, einmal übers gesamte Gesicht und ich spürte, wie mein Herz vor Aufregung gegen meinen Brustkorb hämmerte. Mit zittrigen Händen bestätigte ich über die Maus mit einem Klick seine Freundschaftsanfrage. Dann lehnte ich mich auf meinem Drehstuhl zurück und atmete tief durch.
Ein Junge hatte mir geschrieben, dass er mich hübsch fand! Da hatte ich noch nie von einem Jungen gehört! Normalerweise bekam ich lediglich zu hören, dass ich fett sei (obwohl ich Normalgewicht hatte), dass meine Pickel, die ich ab und zu hatte, abstoßend seien und dass ich mit meiner hässlichen Fresse aussah wie ein Dämon. Die Beleidigungen, die ich in der Schule zu hören bekam, waren unendlich. Hätte ich alle aufgeschrieben, hätte ich garantiert ein ganzes Buch daraus binden können.
Zu gerne hätte ich Cedric direkt angeschrieben und ihm mitgeteilt, wie sehr ich mich über die Internetfreundschaft mit ihm freute. Aber hieß es nicht, dass Männer den ersten Schritt machen sollten? Würde es nicht vielleicht doof kommen, wenn ich ihn jetzt direkt schon anschrieb? Oh Mann! Ich hatte von Jungs doch gar keine Ahnung! Um dem Problem, etwas Falsches zu schreiben, aus dem Weg zu gehen, entschied ich mich deswegen vorerst dazu, mich still zu verhalten und auf eine Reaktion von ihm zu warten. Während ich mit meinen Hausaufgaben anfing, ließ ich den Bildschirm meines PCs jedoch keine Sekunde aus den Augen. Ich fieberte förmlich einer Reaktion von ihm entgegen. Ich konnte mich kaum auf etwas Anderes konzentrieren. Es war, als ob ich Schmetterlinge im Bauch gehabt hätte. Ich war komplett hibbelig und konnte nur sehr schwer still sitzen. Ununterbrochen drehte ich mich auf dem Drehstuhl hin und her und wartete auf eine Antwort. Fast schon im Zehnsekundentakt kontrollierte ich, ob er online war oder eine Reaktion von ihm kam. Doch er ließ mich warten.
Erst kurz vor siebzehn Uhr, gerade als ich meinen Computer schon frustriert abschalten wollte, ging er online. Und dummerweise kam genau in diesem Augenblick auch meine Mutter von ihrer Arbeit nach Hause. Ich hörte ihr freudiges Hallo-Rufen in der Eingangstür und kurz darauf ihre Schritte. Sie kam auf mein Zimmer zu. Eigentlich hätte ich versuchen sollen, den Computer schnellstmöglich auszuschalten, damit ich nicht aufflog, aber das konnte ich nicht machen. Nicht jetzt! Nicht jetzt, wo er gerade online gegangen war!
Eilig öffnete ich eine zweite Internetseite und gab bei der der Suchmaschine das Wort „Zebras“ ein. Wieso ich genau diesen Begriff wählte, konnte ich nicht sagen, aber es war das Erste, was mir einfiel. Gut überlegt war dieser Begriff zwar nicht, aber vielleicht würde mir meine Mutter trotzdem abkaufen, dass wir in der Schule im Biologie-Unterricht gerade das Thema „Zebras“ durchnahmen.
Es klopfte an der Tür und kurz darauf wurde meine Tür mit Schwung geöffnet.
„Hallo Lucy, ich bin wieder zu Hause.“
„Ja Mama, das sehe ich. Kannst du aber das nächste Mal ERST anklopfen, dann auf ein ‚Herein‘ warten und danach die Tür aufmachen und nicht immer direkt in mein Zimmer stürmen?“
Meine Mutter wusste genau, dass ich es hasste, wenn sie, ohne anzuklopfen, die Tür öffnete. Und dieses Anklopfen und trotzdem direkt ohne Aufforderung die Tür aufreißen, war nicht wesentlich besser!
„Ach Lucy, stell dich nicht so an! Ich bin deine Mutter und darf immer in dein Zimmer kommen. Außerdem habe ich dir ebenfalls schon mehrfach erklärt, dass du und dein Bruder maximal eine Stunde am Tag ins Internet dürft, und ihr haltet euch auch nicht daran“, konterte sie.
„Ja, aber das ist etwas Anderes!“, versuchte ich zu widersprechen.
„Nein, ist es nicht“, unterbrach sie mich, „und jetzt machst du deinen PC aus und widmest dich deinen Hausaufgaben.“
Kurz überlegte ich, ob ich eine Diskussion darüber anfangen sollte, ob das tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge waren oder nicht. Doch ich entschied mich dagegen. Diese Diskussion war sinnlos. Meine Mutter wollte nicht verstehen, dass ich meine Privatsphäre sehr schätzte und ich es hasste, wenn jemand einfach so, ohne Aufforderung, in mein Zimmer kam. Stattdessen konzentrierte ich mich auf das Wesentliche und versuchte ihr möglichst glaubhaft zu erklären, dass ich das Internet für meine Hausaufgaben brauchte. Anhand ihrer hochgezogenen Augenbrauen konnte ich erkennen, dass sie mir nicht so ganz glaubte, jedoch schien sie kein Argument zu finden, das ihre Zweifel belegten, deshalb erlaubte sie mir notgedrungen, das Internet bis zum Abendessen weiter zu benutzen. Aber nur für schulische Zwecke und auch nur bis es Abendessen gab. Danach war Schluss mit Computer.
„Ich vertraue dir Lucy. Ich hoffe, du belügst mich nicht! Ich kann und will dich nicht kontrollieren, aber sollte ich mitbekommen, dass du mich anlügst und deine schulischen Leistungen darunter leiden, wird das Internet abgestellt. Dann gibt es nur noch kontrollierten Internetzugang für dich und deinen Bruder und keine dauerhaftes Wlan mehr“, redete sie mir noch ins Gewissen, bevor sie aus meinem Zimmer ging und die Tür hinter sich schloss. Mit genervter Stimme antwortete ich ihr: „Ja, ja, Mama. Ich würde dich nie belügen!“
Meine Mutter hatte die Tür eigentlich schon fast zu, doch nach dieser Aussage steckte sie noch einmal ihren Kopf hinein.
„Ja, ja, heißt so viel wie ‚Leck mich am Hintern‘. Das weiß ich auch. Ich vertraue dir, enttäusche mich nicht!“, lächelte sie mich an und schloss danach die Tür endgültig.
Ein paar Sekunden lauschte ich noch, ob sie sich auch tatsächlich von meinem Zimmer entfernte und nicht vor der Tür wartete, um in zwei Minuten einen erneuten Kontrollblick in mein Zimmer zu werfen. Sie schien allerdings tatsächlich zu gehen. Die Schritte entfernten sich und ein bisschen später hörte ich, wie sie in der Küche mit meinem Bruder redete.
„Puh …“, erleichtert schnaufte ich durch. Das war gerade noch mal gut gegangen! Zu hundert Prozent glaubte sie mir zwar nicht, dass ich das Internet zum Hausaufgabenerledigen brauchte, aber sie konnte mir nicht das Gegenteil beweisen und fragte auch glücklicherweise nicht genauer nach. Zumindest für heute hatte ich Glück und Erfolg mit meiner Taktik.
Sofort wendete ich mich wieder meinem Bildschirm zu. Als ich mich erneut bei dem sozialen Netzwerk einloggte, erschien auf dem Bildschirm die Mitteilung „Sie haben eine neue Nachricht“. Unmittelbar schlug mein Herz wieder zwei Schläge schneller. Voller Vorfreude öffnete ich die Mitteilung:
„Hallo Lucy, vielen Dank, dass du meine Freundschaftsanfrage angenommen hast. Ich freue mich sehr, mit einer so attraktiven jungen Frau wie dir befreundet sein zu dürfen. Deine Fotos sehen echt toll aus! Wie alt bist du eigentlich? Unter dem einen Bild steht 15 Jahre, stimmt das?“
Mein Herz fühlte sich an, als wenn es gleich zerspringen würde. Mein Kopf war wahrscheinlich schon knallrot und meine Hände begannen zu schwitzen. Unglaublich, was so ein Text gefühlsmäßig und körperlich bei mir auslösen konnte! Ich war in meinem Leben noch nie richtig verliebt gewesen und ich glaube so schnell verliebt man sich auch nicht, aber dennoch war ich offensichtlich auf einen ganz guten Weg in Richtung erstes Verliebtsein. Solche körperlichen Reaktionen und merkwürdigen Gefühle kannte ich bis jetzt noch gar nicht! Oje, war das aufregend!
Mit zittrigen und schwitzigen Fingern antwortete ich. Erst überlegte ich, ihm die Wahrheit über mein Alter zu schreiben, aber dann löschte ich den Text und schrieb ihm, dass ich tatsächlich fünfzehn sei. Ich getraute mich nicht, ihm die Wahrheit zu sagen, schließlich wollte er garantiert nicht mit einer zwölfjährigen befreundet sein! Außerdem war es ja auch keine richtige Lüge, sondern lediglich eine Notlüge!
Noch konnte ich nicht genau einordnen, woran ich war. Ob ich tatsächlich verliebt war, oder ob ich mich einfach nur freute, dass so ein cooler Typ mit mir befreundet sein wollte. Ich glaube, in den ersten Tagen war es eher das Letztere. Ich war überglücklich, nicht mehr alleine zu sein, jemanden zu haben, der sich für mich interessierte, der da war, der zuhörte. Und das war Cedric für mich von Anfang an. Er gab mir etwas, was mir im wahren Leben fehlte. Dass er ein absolutes Arschloch war, das gezielt meine Lage ausnutzte und mit meinen Gefühlen lediglich spielte, merkte ich erst viel, viel später. Nämlich erst dann, als es schon zu spät war. … Doch bis wir an diesen Punkt meiner Geschichte kommen, dauert es noch ein bisschen. Jetzt sind wir erst noch am Anfang und zu diesem Zeitpunkt war alles noch rosarot.
Die Zeit bis zum Abendessen verging wie im Fluge. Ständig schrieb ich mit ihm im Chat hin und her. Ich blendete alles um mich herum aus. Es kam mir vor, als wenn ich ihn schon jahrelang kennen würde. Mich mit ihm auszutauschen, fühlte sich total vertraut an. Wir schrieben über alles Mögliche, kamen von einem Thema zum anderen und hätten wahrscheinlich noch stundenlang weiterschreiben können, doch meine Mutter unterbrach pünktlich um 19 Uhr unsere tolle Unterhaltung.
Ihre Essensrufe hallten durchs Haus. Auf den ersten Ruf hatte ich schon mit „Ja Mama, ich komme gleich“, geantwortet, doch als sie jetzt ein zweites Mal nach mir rief, konnte ich sie nicht mehr auf „gleich“ vertrösten. Ich musste SOFORT kommen.
Deprimiert schrieb ich ihm noch, dass ich jetzt zum Abendessen musste, aber morgen direkt nach der Schule wieder online gehen würde. Dann schaltete ich den PC aus und eilte ins Esszimmer, wo mein Bruder schon seine erste Portion Pfannkuchen verspeiste und meine Mutter ungeduldig wartete.
„Warst du etwa bis eben im Internet?“, begrüßte sie mich mit tadelndem Gesichtsausdruck.
„Nein, natürlich nicht. Ich musste nur noch schnell meinen Schulranzen für morgen fertigpacken“, widersprach ich, ohne nachzudenken.
Seit Anfang des Schuljahres hatte ich mir angewöhnt, grundsätzlich zu widersprechen, wenn meine Eltern irgendetwas behaupteten oder fragten. Egal, ob der Widerspruch nun Sinn machte oder nicht. Hauptsache etwas Anderes behaupten und nur nicht derselben Meinung sein wie sie.
„Du darfst nicht lügen!“, maulte mein Bruder mich sofort mit vollem Mund an.
„Und du darfst nicht mit vollem Mund reden!“, fauchte ich zurück und setzte mich auf meinen Stuhl.
„Hört auf zu streiten“, unterbrach meine Mutter unsere aufkeimende Streiterei. „Lucy, du musst nicht lügen. Ich hasse es, angelogen zu werden. Und Ben, du musst dich nicht immer einmischen.“
Genervt lud ich mir eine Portion Pfannkuchen auf meinen Teller. Eigentlich war mir mein Appetit bei dieser tollen Tischstimmung schon wieder vergangen, aber ich wollte keinen weiteren Streit provozieren. Dass Mütter und kleinere Brüder immer so anstrengend sein mussten!
Eine ganze Weile aßen wir schweigend vor uns hin. Keiner schien sich zu getrauen, etwas zu sagen, niemand wusste, welches Thema er anschneiden sollte. Die Stimmung war im Keller.
„Bis du mit deiner Ausarbeitung über Zebras fertig geworden?“, versuchte meine Mutter die Stille zu durchbrechen und mich zu einem Gespräch zu bewegen. Doch ich war in diesem Moment so in Gedanken versunken, dass ich gar nicht verstand, was sie von mir wollte. „Hä? Welche Ausarbeitung?“, antwortete ich deshalb etwas verwirrt. Als ich dann aber in ihr verdutztes Gesicht schaute, hängte ich schnell hintenan: „Ach so, ja! Damit bin ich fast fertig. Ich habe im Internet einige gute Seiten gefunden, die sehr informativ waren. Ich denke, ich werde morgen damit fertig.“
„Okay, das ist schön. Wenn du noch Hilfe brauchst, können wir gerne noch mal zusammen in ein paar Tierbüchern nachschauen, ob wir dort noch etwas über Zebras finden“, bot sie mir an.
„Ja, nein, ich denke, es ist ausreichend, was ich im Internet gefunden habe“, lehnte ich jedoch dankend ihr Angebot ab. „Das ist ja lediglich eine kleine Ausarbeitung, die ich da machen muss und kein riesiges Referat.“
Dass Eltern immer so nachhaken mussten! Das war echt nervig.
„Okay, wenn ich mir die Ausarbeitung anschauen und noch mal drüber lesen soll, dann sage einfach Bescheid“, versuchte sie noch einen zweiten Anlauf zu starten.