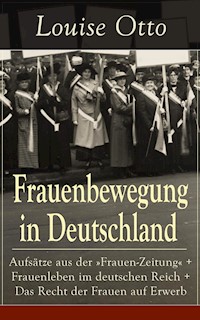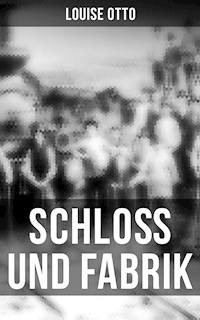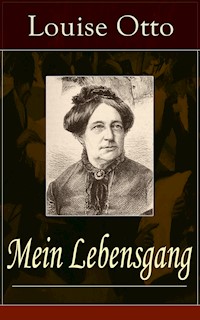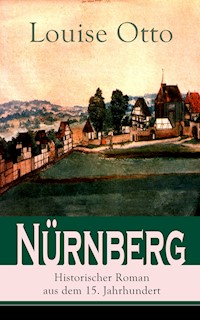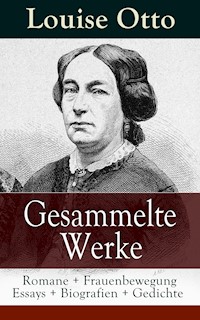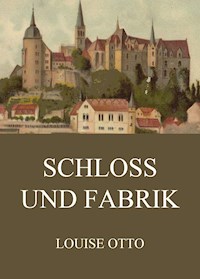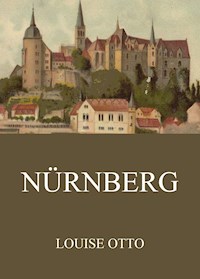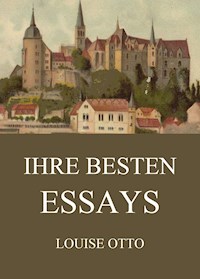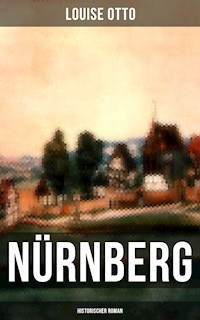
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Louise Ottos Buch 'Nürnberg' taucht der Leser tief in die Geschichte der Stadt Nürnberg während des 16. Jahrhunderts ein. Der historische Roman zeichnet sich durch eine detaillierte Darstellung des gesellschaftlichen Lebens, politischer Intrigen und kulturellen Feinheiten jener Zeit aus. Durch Ottos geschickten Einsatz von historischen Fakten und fesselnder Erzählweise wird der Leser in den Bann dieser Epoche gezogen. Der literarische Stil ist geprägt von lebendiger Sprache und einer Atmosphäre, die die Vergangenheit zum Leben erweckt. Dieses Werk ist ein beeindruckendes Beispiel historischer Literatur, das sowohl Kenner als auch Neulinge begeistern wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 761
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nürnberg
Inhaltsverzeichnis
Erster Band
Vorwort zur zweiten Auflage
Es war im Sommer 1856, als ich zum ersten Male nach Nürnberg kam. Eine Reise nach der Schweiz, die ich von meiner Vaterstadt Meißen aus (das man auch zuweilen seiner alterthümlichen Bauart wegen »Klein-Nürnberg« genannt), angetreten, führte mich dahin. Man reiste damals noch nicht mit der fliegenden Eile von heutzutage – ich wenigstens war da gerade in der glücklichen Lage, an der Seite einer Freundin ohne zwingendes Ziel rein des Vergnügens willen zu reisen und Alles mitzunehmen, was sich Interessantes am Wege bot. Von all dem dünkte uns Nürnberg das Interessanteste, so bald wir es nur betraten – und nicht eher verließ ich es wieder, bis all seine Merkwürdigkeiten und Herrlichkeiten sich mir erschlossen und alle Denkmäler aus der Blüthezeit mittelalterlicher Kunst mir ihre Geschichte erzählt hatten.
Als ich im Sonnenuntergang auf der Veste stand und über die Mauern des Burggartens hinabblickte und hinein in die unzähligen Gassen und Gäßlein der alten Stadt, auf all die Thürme und Giebel, die Chörlein und Brunnen, die da sprachen von einer glorreichen Vergangenheit, wie kaum eine andere deutsche Stadt sie erlebt und von der wenigstens in keiner andern so viel treu behütete Erinnerungszeichen bis auf unsere Tage gekommen, daß man Nürnberg wohl nennen mag: das Reliquienkästlein des deutschen Reichs – da ward die ganze alte Zeit lebendig vor mir und die Jahrhunderte versanken, wie der eine sinkende Tag.
Da war mir, als sähe ich da unten nicht nur Albrecht Dürers Standbild, sondern den Meister selbst, da er noch als Lehrling beim Meister Wohlgemuth arbeitete und mit dem Patriziersohn Willibald Pirkheimer das edelste Freundschaftsbündniß schloß – da sah ich die deutschen Kaiser einziehen und wie auf Kaiser Friedrichs III. Wink Elisabeth Behaim den Dichter Konrad Celtes auf offnem Markt mit dem Lorber krönte – sah wie Kaiser Maximilian I. bald auf der Veste einkehrte beim Burggrafen von Zollern, an der Seite seinen lustigen Rath Kunz von der Rosen, bald selbst Quartier nahm im Hause Scheurls, das noch unverändert steht – sah wie die Baubrüder arbeiteten nach dem System des Achtorts in der Bauhütte neben der Lorenzkirche und Hüttentag hielten – sah die beiden Loosunger und die Genannten aus den edelsten Nürnberger Geschlechtern: Tucher, Holzschuher, Muffel, Behaim u.s.w. zum Rathhaus gehen – sah hinein in Peter Vischers Gießhütte und in Adam Krafts Werkstatt am Steig und –
Was ich da sah im Sonnenuntergang und im Mondschein, das sollte zu mehr werden, denn zu einem flüchtigen Reiseeindruck – als ich andern Tags noch einmal in der herrlichen Lorenzkirche weilte, dem schönsten Denkmal gothischer Baukunst und geschmückt mit Werken eines heiligen Kunsteifers, wie eben nur jene Blüthezeit des Mittelalters ihn aufzuweisen hat, da that auch ich bei all diesen Werken reiner Begeisterung und bei meiner eigenen ein Gelübde: zu versuchen, an all diese Denkmale noch selbst durch ein geschriebenes Denkmal zu mahnen.
Als ich wieder heimgekehrt, kam mir Nürnberg nicht aus dem Sinn – aber meine Aufgabe schien mir zu groß, als daß ich gleich so ohne Weiteres an deren Lösung gegangen wäre – konnte man doch von jenen Nürnberger Meistern selbst lernen, wie man mit Ernst und Fleiß arbeiten muß, will man etwas Rechtes erreichen. Ueber ein Jahr lang habe ich denn nur im Mittelalter und in Nürnberg im Geist gelebt; ein Freund und Gönner, der Culturhistoriker Hofrath Gustav Klemm, Oberbibliothekar der Königl. Bibliothek in Dresden, der früher selbst lange in Nürnberg gelebt, war mir freundlich behülflich, Alles zu suchen, was jene Bibliothek von alten Werken darauf Bezügliches enthielt – und nicht eher, bis ich durch die fleißigsten Studien ganz auf dem gewählten Schauplatz zu Hause war, ging ich an meine Arbeit. Aber ich wollte in ihr nicht allein ein culturhistorisches Bild liefern, sondern auch ein poetisches Kunstwerk – wollte Ewiges dar stellen im Endlichen, wie es meine Helden – die Baubrüder, ja auch selbst gethan.
So erschien denn mein »Nürnberg« 1859. Es war mein erster historischer Roman – und ich hatte die Freude, ihn vom Publikum wie Kritik in gleicher Weise beachtet und – was bei mir viel sagen will, da mein entschiedener Parteistandpunkt mir immer viele principielle Widersacher schuf – einstimmig anerkannt zu finden. Ich darf mich mit Freuden auf die Urtheile der angesehensten Zeitungen und auf Namen berufen wie Gutzkow, Alfred Meißner, August Silberstein, Karl Frenzel, Ludwig Eckhardt, Hermann Klencke, Heinrich Kurz, Hermann Marggraf u.s.w. Was mich aber am meisten freute, das war, daß aus Nürnberg selbst mir die vielfachste Zustimmung zu Theil ward und daß Andere, wenn sie nach Nürnberg reisten, mir versicherten, mein Buch sei dafür der beste Führer.
Jahre vergingen – die letzten Sommer führten mich wieder nach »Nürnberg« – da grüßte mich dort mehr als ein Freund deutscher Kunst und Größe mit der bangen Bemerkung: »Es ist gut, daß Sie jetzt noch kommen – denn bald werden Sie Ihr Nürnberg nicht mehr finden!«
Die Stadt, die bisher die Erinnerungen ihrer reichsstädtischen mittelalterlichen Größe so treu gehütet, hatte an der Zerstörung derselben begonnen – im Interesse des Nivellirungssystems der modernen Industrie sollten die alten Mauerkronen fallen sammt Thürmen und Thoren – –
Da gedachte ich wieder meines Nürnberg und da ich erfuhr, daß die erste Auflage bis auf das letzte Exemplar schon längst vergriffen war und ich darüber nur keine Mittheilung erhielt, weil der Verlag, in dem es damals erschien, an eine andere Firma übergegangen, so erschien es mir an der Zeit, jetzt eine zweite Auflage davon zu veranstalten und es namentlich auch Allen, die sich für die alte Reichsstadt und ihre einstige Kunstblüthe interessiren, nochmals zu bieten, als ein Denkmal ihrer Herrlichkeit – wie ja auch Holzschnitt und Photographie sich eben jetzt noch bemühen, festzuhalten, was noch vom alten Nürnberg steht, weil man ja nicht weiß, wie lange es noch der modernen Zerstörungssucht widerstehen kann.
Und so sende ich denn diesen Roman zum zweiten Male in neuer Gestalt und nochmals durchgesehen, wenn sonst auch unverändert, hinaus in die Welt und hoffe, daß er keine ungünstigere Aufnahme findet, als das erste Mal. Und somit grüß' ich all die Freunde, die er schon fand und die er mir selbst erwarb – und vor Allem grüße ich Nürnberg selbst und in ihm die Hüter und Förderer des »Germanischen Museums«, denen ich mein Werk nochmals zu Füßen lege.
Leipzig, 1874. Die Verfasserin.
An Nürnberg
Du edles Nürnberg bist wie eine Blume Im deutschen Reich, so herrlich anzusehn! Du blühst dir selbst und aller Zeit zum Ruhme, Läßt Balsamdüfte durch die Lande wehn! Und deine Zauber wirken fort und fort In Kunst und Wissenschaft, in Bild und Wort. Dahin zog es von je die edlen Geister, Die gern sich sonnen in des Lebens Glanz, Die Herrn und Fürsten und die großen Meister Von jeder Kunst im schön verbundnen Kranz. Dort kämpfte man zuerst für Recht und Licht Und huldigte der Schönheit und der Pflicht. Auch ich sah dich – und deine Steine sprachen, Von Allen Thürmen hallte Glockenklang, Und tausend Stimmen aus vergangnen Tagen Vereinten sich wie feiernder Gesang, In deinen Kirchen, deinen Monumenten, Schrieb Kunst die Chronik mit geweihten Händen. Die Baukunst, die dem Namen der Germanen Die höchste Ehr im Tempelbau erschuf, Und die, entrückt dem Eingriff der Profanen, Die freie Steinmetzzunft weiht dem Beruf Zu zeigen, wie das Ewige erscheint Im Endlichen, wenn es die Kunst vereint. Solch Ringen war's, das nach dem höchsten Ziele Baubrüder von St. Lorenz hier gepflegt, Wie sie einst aufgerissen die Profile Albertus Magnus Lehre treu gehegt: Das ward auch hier, auch mir ein Offenbaren Vom Tempelbau des Schönen und des Wahren. Und also ging ein Auf- und Vorwärtsstreben Grad durch die Zeit und durch das deutsche Reich. Die Reichsstadt durfte hoch das Haupt erheben, Stellt' Bürgerthum dem Fürstenthume gleich, Und nur dem Kaiser, den sie mit gebüret Gab sie die Huldigung, die ihm gebüret. Und edle Frauen durften stolz sich zeigen, Die Kunst beschützen, wie die Wissenschaft, Den Lorberkranz erwählten Dichtern reichen, Die Anmuth fügen zu der kühnen Kraft, Und von der Blüthe solchen Bürgerthumes Gehört für sie ein Theil des höchsten Ruhmes. All dies in deinen Mauern wohl geborgen Du edles Nürnberg zeigte mir der Geist, Und was ich sah, und was ich konnt erhorchen, Das dich vor aller Welt noch einmal preist: Das hab ich, wie ich mich an dir erhoben Dich auch erhebend in mein Werk gewoben! –
Erstes Capitel. Der Wandergeselle
An einem sonnenklaren Maientage des Jahres 1489 wanderte ein schlanker Jüngling auf der breiten Heerstraße, die von Westen nach Nürnberg führte, der ehrwürdigen Reichsstadt zu. Schon waren ihm viele Menschen begegnet zu Fuß wie zu Roß und hoch mit Kaufmannsgütern beladene Wagen, umgeben von zahlreichem Geleit, denn ohne solches wagte Niemand die Waaren zu versenden, die so noch oft genug in die Hände der rohen Raubritter fielen, die ihr Wesen gerade am Aergsten von ihren düstern Burgen herab in der Nähe der freien Reichsstadt trieben, deren Reichthum sie beneideten, deren Bürgerstolz sie haßten und deren Bürgern sie schon darum gern einen Verlust und Schaden zufügten, weil diese selbst oft genug den hohlen Glanz des Ritterthums verdunkelten, und wo es in ihrer Macht war, sich nicht scheuten, seine Angehörigen, wenn sie dieselben eines Frevels überführen und habhaft werden konnten, nach ihren strengen Gesetzen zu strafen und zu richten.
Schon an diesem belebten Verkehr hätte der Jüngling erkennen müssen, daß er dem Ziel seiner weiten Wanderschaft sich endlich näherte – aber als er jetzt aus dem gewaltigen Reichsforste trat, durch den sein Weg zuletzt geführt: da lag sie vor ihm, die große, sich weit ausbreitende Stadt, in der doch ein Giebel dicht an den andern gedrängt den Nachbar zu überragen strebte, indeß zahlreiche Thürme miteinander wetteiferten den Himmel zu begrüßen und in kunstvollen Formen sich von ihm abzuzeichnen. Höher darüber thronte die Veste, die vor etwa fünfzig Jahren neu erbaut worden war von den Bürgern Nürnbergs, nachdem sie Ludwig der Bärtige von Baiern 1420 niedergebrannt und Markgraf Friedrich von Brandenburg sie sammt allen Rechten einige Jahre später an die Stadt Nürnberg verkauft hatte. Da und dort blinkten die grünen Wellen der Pegnitz, welche die Stadt durchströmt und in zwei Hälften schneidet: die Lorenzer und die Sebalder Seite, so genannt nach ihren Kirchen, den herrlichsten Denkmalen gothischer Baukunst. Da und dort, besonders aus den Vorstädten steigt düsterer Rauch auf, der kommt aus den gewaltigen Schornsteinen der zahlreichen Gießhütten, in denen die Kunst und das Handwerk zugleich arbeiten im innigsten Verein, um nützliche Geräthe zu schaffen für den Hausgebrauch und vollendete Werke monumentaler Kunst zur Ehre Gottes für die erhabenen Tempel, in denen alle Künste sich vereinigen dem Herrn zu dienen und alles Volk ihm zuzuführen.
Auf einer kleinen Anhöhe hat der Wanderer sich niedergelassen, und indessen er die Stadt betrachtet, in die seine Sendung lautet, und ihm das Herz groß und weit wird bei ihrem Anblick und dem Gedanken, daß er da drinnen Brüder seiner Zunft und Kunstgenossen finden wird, in deren Mitte eine reiche Zukunft voll begeisternder Thätigkeit ihn erwartet, können wir ihn selbst betrachten.
Er ist lang und schlank und von edlem Wuchse, sein Gesicht glatt und fein, nur jetzt etwas von der Frühlingssonne auf langer Wanderschaft gebräunt, unter der edelgebauten Stirn scheinen hohe Gedanken zu wohnen, und noch mehr leuchtet aus den tief dunklen Augen das Feuer echter Begeisterung. Das üppige braune Haar, halblang in der Mitte gescheitelt und rundum glatt geschnitten, bedeckt ein kleiner runder Strohhut. Ueber den enganliegenden Beinkleidern von bräunlichem Leder trägt er eine Art kurze Blouse von rothbrauner Farbe, am schwarzen Ledergürtel hängt ein kurzes breites Schwert und um die Schultern am festen Riemen ein ledernen Sack. Die kurzen Stiefeln von ungeschwärztem Leder bezeugen in ihrem abgerissenen Zustand auch die Weite des Weges, den sie zurückgelegt.
Nachdem er das letzte Stück Brod, das er in dem Sack gefunden, der seine ganze Habe enthielt, verzehrt, ging er auf's Neue mit rüstigen Schritten auf die Stadt zu und betrat sie bald durch ein langes düsteres Thor. Er wußte nirgend Bescheid und bog ohne Weiteres in die enge Gasse ein, die ihn in der Richtung des Kirchthurms zu führen schien, den er sich von Weitem als sein Wanderziel ausersehen. Aber bald verschwand ihm dieser vor den höher aufsteigenden nahen Giebeln, die in den engen, oft krummlinigen Straßen seinen Blick beschränkten, und er ging durch dieselben ohne Plan und Ziel, nur gelockt von der Neuzeit des Anblickes, der sich ihm bot, der Bewunderung und Freude, die ihn erfüllten.
Der Wanderer kam von Straßburg und hatte am Rhein und in Franken, das er jetzt durchzogen, wohl manchen stattlichen Bau und manche aufblühende Stadt gesehen; auch war ihm wohl das Sprüchlein bekannt, demnach kein Fürst so schön wohne wie die Fugger zu Augsburg und die Tucher zu Nürnberg: aber Alles, was er hier sah, übertraf doch seine Erwartungen. Hohe, oft fünfstöckige jedoch schmale und tiefe Häuser kehrten die Giebelseite der Straße zu, so zwar, daß die verschiedenen Geschosse sich treppenartig übereinander thürmten und von der Straße aus den Aufblick nach oben beschränkten. Viele Fenster, meist hoch und weit, oft oben in Bogen gewölbt, schmückten die Häuser, symmetrisch und doch mannigfaltig vertheilt. Zuweilen vereinigten sich zwei oder drei Fensterfelder zu einem vorspringenden Chörlein, das schöne Wappenschilder von zierlicher Steinmetzarbeit schmückten. Wie der Giebel war meist auch die obere Gruppe der Fenster pyramidisch angeordnet und der Giebel selbst Treppenförmig ausgeschnitten, an manchen Häusern auch die einzelnen Stufen mit aufstrebenden Steinverzierungen gekrönt. Ueber den weiten Eingang der Häuser stieg häufig ein kunstgerechter Spitzbogen empor mit steinernem Laubwerk umwunden, oder zeigten sich buntgemalte Wappenschilder oder Zunftzeichen. Und wo ein Haus eine Straßenecke bildete, da fehlte selten an der scharfen Ecke ein vorspringender Wegstein mit einem steinernen oder ehernen Standbild; bald war es ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln, bald ein Ritter mit geschwungenem Speer oder ein Lindwurm. Wo ein weiterer Platz sich zeigte, da stand inmitten gewiß ein Brunnen mit schönen Statuen oder feinem Gitter darum, oder war irgend ein künstliches Druckwerk daran, daß wie von selbst das Wasser heraus und gen Himmel sprang, an der Erde im weiten Steinbecken sich sammelnd.
Hatte der neue Ankömmling auch schon da und dort gleich schöne Bauwerke und Steinmetzarbeiten gesehen, noch nirgend war es ihm vorgekommen, daß sie so dicht zusammen sich drängten, so gleichsam den Bedürfnissen des täglichen Lebens dienten, zu ihnen zu gehören schienen. Und welch' ein wogendes Leben war das auch, das sich dazwischen bewegte! Auf Wagen oder Schleifen wurden Waarenballen von geschäftigen Händen aufgethürmt zu weiterer Versendung, oder abgeladen und in die weiten Hofräume der Häuser geschafft. Ueberall waren die Erdgeschosse Werkstätten, aus denen ein munter bewegtes Leben voll rüstiger Arbeit klang, oder Kaufläden, an deren Fenstern kunstvolle Geräthschaften oft von Gold und Silber blitzten, so daß unser Fremdling schon bei sich selbst eine solche Gasse die Goldschmiedsgasse nannte, noch ehe er wußte, daß sie wirklich diesen Namen führte. Zwischen den geschäftigen Arbeitern, die aus den Werkstätten ab und zu gingen, schritten stattliche Herren, die zum Rath gingen, manche in Pelz und Sammt gekleidet, gleich als ob sie Edelleute wären, indeß sie doch nur bürgerlicher Herkunft, aber den geachtetsten Geschlechtern Nürnbergs angehörend, hatten sie unkundlich selbst vom Kaiser die Erlaubniß zu solch reicher Tracht erhalten, die sonst allein dem Adel zukam. Daneben wandelten gleich reich gekleidete Frauen, die nicht nur mit den Schleppen ihrer seidenen Damastkleider, sondern auch mit ihren weiten hängenden Aermeln die Straße fegten, dem Rath zum Trotz, der schon einmal eine Verordnung wider die Länge solcher Aermel erlassen. Aber neben dem Stolz, der wie aus der Kleidung auch aus der Haltung dieser Frauen sprach, lag auch etwas so Ehrbares und Züchtiges in ihrem Auftreten, das allen Begegnenden Achtung einflößte und die sie erblickenden Männer, mochten sie dem weltlichen oder geistlichen Stande angehören, nöthigte mit höflichen Grüßen an ihnen vorüberzugehen. Und auch unter den einfacher gekleideten Bürgermädchen, von denen manches den schönen Fremdling mit schelmischen Augen neugierig musterte, gab es liebliche Erscheinungen, an denen Alles nett und sauber war, von dem goldgestickten Riegelhäubchen herab bis zum Schuh, der bis an den Knöchel reichte. Wenn sie das Wasser schöpften, am Brunnen sich neigten und dann das Gefäß zum Kopf mit den bloßen Armen emporhoben, so war so viel Grazie in diesen Bewegungen, als Würde bei dem stolzen Auftreten jener Patrizierinnen.
All' dies Leben und Treiben voll Anmuth und Schönheit der Häuser wie ihrer Bewohner war wohl geeignet den Fremden zu fesseln und gleichsam zu übertäuben, daß er ziel- und planlos durch dasselbe schritt, bis er plötzlich sich am Fuße der Veste gewahrend sich doch besann, daß er hier unmöglich auf dem rechten Wege sein könne und daß es Zeit werde, nun einmal danach zu fragen.
Er befand sich eben in einer im Augenblick ziemlich menschenleeren Gasse, als an einem der Häuser eine Thür sich öffnete und ein junger Bursche daraus hervortrat; hinter ihm hörte man polternde Stimmen und vernahm zuletzt die Worte:
»Und somit lass' es dir gesagt sein, halte dich dazu, Albrecht, und verträumere die Zeit nicht, wie es deine Art ist!«
Dem knabenhaften Jüngling, dem diese Worte mit rauhem Tone ausgesprochen galten, schoß das Blut in's feine blasse Gesicht und in die klaren schwärmerischen Augen trat etwas wie eine Thräne. Er schüttelte die langen braunen Locken zurück, die so üppig fast wie Löwenmähnen auf seine Schultern niederflossen, hob einen Topf mit grüner Farbe darauf, indeß er in der andern Hand Pinsel und Richtscheit trug. Diese Hände, zumal die auf das Haupt emporgehaltene, erschienen so weiß, klein und durchsichtig, als wären sie von Alabaster künstlerisch gemeißelt. Die Gestalt war fast klein und schwächlich, aber es lag etwas freudig Selbstbewußtes in ihrer Haltung und sprach von der edlen Stirn trotz der Thräne des Unmuthes im Auge und dem Roth der Scham auf den Wangen, daß der Fremde unwillkürlich davon angezogen ward und gerade ihn sich ausersah nach dem Wege zu fragen.
»Gott grüße Euch!« rief er ihm zu; »wie es scheint, seid Ihr hier zu Hause und könnt mich berichten; wie heißt hier diese Gasse?«
»Unter der Veste,« antwortete Albrecht bescheiden den Gruß erwiedernd.
»Da bin ich wohl weit von meinem Ziel?« antwortete der Wanderer mit etwas fremdartigem Idiom, »ich bin an die Bauhütte der freien Steinmetzzunft von Nürnberg gewiesen.«
»Da habt Ihr freilich dahin noch durch manche Straße und manches Gäßlein zu gehen,« antwortete Albrecht, »und da Ihr fremd hier zu sein scheint, werdet Ihr Euch schwerlich zurecht finden. Ein Stücklein Wegs aber kann ich Euch jedenfalls geleiten und ich bitt' Euch mir zu folgen. Und welche Hütte sucht Ihr wohl? Die große steinerne Bauhütte zu St. Sebald, welche die Baubrüder aufgeschlagen haben, da sie die schöne Sebaldskirche bauten, steht noch dem Rathhaus gegenüber, und bis dahin haben wir nicht weit; wollt Ihr aber in die Bauhütte bei der St. Lorenzkirche, drinnen wieder fleißig gearbeitet wird, weil ein hoher Chor und eine neue Kapelle zum schönen Bau hinzu gestiftet worden, so müssen wir auf die Lorenzer Seite über die steinerne Brücke hinüber.«
»Ihr seid hier wohl bewandert, junger Freund,« antwortete der Fremde, »es ist die Bauhütte von St. Lorenz, in die ich gesandt bin; aber wiewohl mir Euer Geleit gar willkommen ist, so will ich Euch doch nicht veranlassen um deswillen einen Umweg zu machen, da Ihr wohl keine Zeit zu verlieren habt –«
Albrecht erröthete, weil er aus dieser Bemerkung schloß, daß der Fremde die scheltenden Worte, mit denen er vorhin entlassen worden, und wohl gar die Schimpfreden, die vorhergegangen, könne gehört haben. Er unterbrach ihn daher schnell, indem er antwortete: »Mein Weg führt mich auch in diese Gegend. Mein Meister ist gut und wacker, und gerade weil ich an ihm einen nachsichtigen Herrn habe, kann ich's nur seinen rohen Knechten nicht zu Dank machen.«
»Und wer ist Euer Meister?« fragte der Fremde.
»Der Maler Michael Wohlgemuth,« antwortete Albrecht; »vielleicht habt Ihr von ihm gehört, denn sein Name klingt wohl weit in das Reich hinaus, da von vielen entfernten Orten Bestellungen an ihn kommen.«
»Ei freilich kenn' ich seinen Namen und habe schon manch' ein schönes Gemälde in glänzenden Farben auf Goldgrund von ihm gesehen. Hätte ich gewußt, daß es seine Werkstatt war, aus der Ihr tratet, so würde ich der Lust nicht haben widerstehen können mich drinnen umzusehen,« erklärte der Wanderer.
Wenn Ihr hier bleibt,« antwortete der Lehrling des Malers, »so findet Ihr Euch schon ein andermal wieder in Michael Wohlgemuth's Werkstatt ›unter der Veste‹, und es wird mich freuen Euch wieder zu sehen und dem Meister zuzuführen, dessen Verehrer Ihr seid!«
»Ihr wollt also wohl auch ein Maler werden?« sagte der Fremde.
»Ich hoffe es zu Gott,« antwortete Albrecht, »da er mir einmal diesen Drang gegeben, der mir keine Ruhe ließ, obwohl ich mich meinem Vater zu lieb erst dessen eigenem Handwerk widmen wollte.«
»Und wer ist Euer Vater?« fragte der Andere, in dem der etwa siebzehnjährige Jüngling immer größere Theilnahme erregte.
Dieser antwortete: »Der Goldschmied Dürer. Ich hatte immer die meiste Freude daran ihm die Risse und Zeichnungen zu machen zu seinen Werken und viel lieber zu zeichnen als zu hämmern und zu gießen. Da er es aber nicht anders wollte, dacht' ich, ich könne meine Neigung bezwingen, und gab mir alle Mühe in seiner Werkstatt. Aber zuweilen kam es mir hart an und ich grämte mich schier, daß ich darauf verzichten sollte, ein Maler zu werden. Da bat auch die Mutter den Vater für mich, und er that mich zum Meister Wohlgemuth in die Lehre – und nun hab' ich die doppelte Pflicht etwas Rechtes zu lernen und ein rechter Maler zu werden, einmal weil mir's im Innern eine Stimme immer gesagt, daß für mich kein Heil ist außer bei dieser Kunst, und dann weil es meinem Vater hart angekommen, mich aus seiner Werkstatt und in die fremde Lehre zu thun. Solches sag' ich mir täglich, und werde nicht müde zu beten und zu arbeiten, damit es mir gelinge!«
»Dann wird es Euch gelingen!« rief der Fremde und legte seine Hand liebreich auf die Schultern des jüngeren Begleiters. »Durchglüht von echter Begeisterung für die Kunst wachsen uns selbst die Flügel, die uns emportragen in ihr göttliches Reich. Wie Euch zur Malerei, so drängte mich's zur Baukunst, und Nichts wäre im Stande gewesen mich ihr zu entziehen. Nicht wie Euch einem Handwerk, dem Priesterstande wollte man mich weihen, aber mich drängte es zum Hohenpriesterthum der Kunst, und ich denk' ihr zu opfern mit reinen und fleißigen Händen. Gottesdienst ist die Kunst, und selig ist es ihr zu dienen in rechter Treue, und wenn es sein muß, sich selbst ihr zu opfern!«
»Amen!« sagte Albrecht Dürer; »Ihr sprecht mir aus der Seele und es klingt fast so schön, als hört' ich meinen Freund Willibald. Aber ich darf nicht länger mit Euch plaudern. Hier an der Brücke bin ich am Ziel, und Ihr seid es bald, Ihr braucht nur über sie zu gehen, dann der geraden Straße zu folgen, dann führt Euch links die dritte Gasse an Euer Ziel. Seht hier die Brücke: sie ist kunstvoll gebaut in einem einzigen Bogen nach dem Muster der Rialtobrücke in Venedig – ich kann nicht hinübergehen ohne zu wünschen, auch einmal nach Venedig selbst zu kommen. Waret Ihr schon dort?«
»Noch nicht,« antwortete der Fremde, »aber wir werden es schon beide einmal sehen. Doch vorerst muß man sich umsehen im deutschen Lande, deutsche Art und Kunst kennen lernen und bei deutschen Meistern arbeiten, ehe man in's Ausland geht. Da muß man erst fest sein in heimischer Kunst, damit die fremde sie wohl läutere, aber nicht verderbe und verdränge. Und nun habt Dank, wenn wir jetzt scheiden müssen, vielleicht such' ich Euch bald heim in Meister Wohlgemuth's Werkstatt unter der Veste, bis dahin vergeßt den Steinmetzgesellen Ulrich aus Straßburg nicht!«
Um einzuschlagen in die dargebotene Hand, legte Albrecht Pinsel und Richtscheit aus seiner Hand auf einen der vorspringenden kleinen Steinsitze an der schön geschnörkelten Hausthür, vor der er stand, und sagte:
»Da drinnen im Haus des Rathsherrn Muffel giebt's Treppengeländer anzustreichen – da gehört freilich keine Kunst dazu, noch giebt's etwas dabei zu lernen, aber der Meister meint, dergleichen bringe ihm mehr ein als die künstlichen Gemälde, weshalb er solche Arbeit niemals von der Hand weis't. Seine Knechte aber denken mich zu demüthigen, wenn sie mich so in die Häuser der Vornehmen schicken mit gemeiner Arbeit, da ich lieber in der Werkstatt säße und conterfeite. Aber ich denke, es muß Alles geschehen der Kunst zu Nutz, und thue es willig. Und nun Gott zum Gruß!«
»Gott zum Gruß, wackerer Jünger der Kunst,« sagte Ulrich; »mir sei es ein gutes Zeichen, daß gerade ein solcher der erste Nürnberger war, mit dem ich in dieser edlen Reichsstadt das erste Wort gewechselt, das viele gegeben!«
Ulrich schritt über die Brücke und hatte nicht mehr weit zu gehen, da stand er vor der Bauhütte zu St. Lorenz, über deren Eingang das Wappen der freien Steinmetzzunft zu Nürnberg prangte: zwei goldene Hämmer inmitten eines himmelblauen Feldes, zur linken Seite ein Cirkel, zur rechten ein Winkelmaß. Daneben ragte die prachtvolle Lorenzkirche; die geöffneten Thüren und ein aufsteigendes Gerüst an der einen Seite zeigte an, daß man auf's Neue an ihrer Verschönerung arbeitete und neben dem ersten ein zweiter Thurm seiner Vollendung entgegen wuchs. Aus der Bauhütte klang es von emsigen Meißeln und Feilen fleißiger Steinmetzen.
Ulrich näherte sich der Thür und schlug dreimal daran mit seinem Schwert.
Alsbald öffnete sich dieselbe und ein Mann in mittleren Jahren trat heraus. In seinen langen braunen Bart mischte sich das erste Grau und tiefe Linien liefen über seine hohe Stirn. Er trug eine kurze Blouse ohne Aermel, da er zur Arbeit das kurze Obergewand ausgezogen und mit einer Lederschürze vertauscht hatte. Seine grauen Lederbeinkleider reichten bis zu den Stiefeln von ungeschwärztem Leder. Um die Hüften hatte er einen breiten Gürtel, an dem allerlei Werkzeuge hingen. Er musterte den Anklopfenden mit einem prüfenden Blick, reichte ihm die Hand, nickte befriedigt zu der Art seines Händedruckes, und indem er sein Ohr dem Munde des Fremden näherte, sagte er:
»Gebt das Paßwort.«
Ulrich flüsterte es ihm leise in's Ohr.
Darauf nickte der Werkmeister zustimmend, denn das war der Herausgetretene, nahm den Gesellen an der Hand und führte ihn mit sich in die Hütte, in welche jedem Profanen zu treten verboten war, und die nur dem sich öffnete, der das Paßwort der freien Maurer zu geben vermochte.
Ulrich trat ein und grüßte nach der Sitte aller Wandergesellen, die eine fremde Bauhütte betraten: »Gott grüße Euch! Gott weihe Euch! Gott lohne Euch! Euch Obermeister Erwiederung, Gruß Euch Pallirer und Euch hübschen Gesellen!«
»Gott grüße Euch!« antwortete der Werkmeister, »seid uns willkommen im Namen der freien Steinmetzzunft zu Nürnberg!« und reichte ihm noch einmal die Hand.
Dann trat der Pallirer zu ihm, der dem Werkmeister als Vorgesetzter der Gesellen und Lehrlinge zur Seite stand. Hatte der Werkmeister für die Arbeitvertheilung an die Einzelnen und das Material zu sorgen, so war es das Amt des Pallirers, wie auch sein Titel aus drückte, vorzüglich die Verschönerung der Arbeit zu berücksichtigen. Außerdem hatte Jeder von beiden noch besondere Obliegenheiten, wie der Beruf sie mit sich brachte. Der Pallirer Andreas, welchen Ulrich begrüßte, war dem Werkmeister ähnlich gekleidet, aber an Jahren jünger als dieser, groß und breitschultrig, eine stämmige fast athletische Gestalt. Sein Gesicht war wettergebräunt und rabenschwarzes Haar fiel in glatten Strähnen nach hinten zurück. Er reichte dem Ankömmling die Hand und sagte auch: »Gott grüße Euch, wie wir Euch danken für Euren Gruß.«
Die Gesellen und Lehrlinge alle, die ringsum arbeiteten und, seit Ulrich eingetreten war, schon aufgehört hatten durch Meißeln und Feilen Geräusch zu machen, legten nun alle ihr Werkzeug hin, und einer ging nach dem Andern auf Ulrich zu, ihn mit Gruß und Handschlag willkommen zu heißen. Dann hielt dieser dem Werkmeister seinen Hut umgekehrt hin und sagte:
»Nun bitte ich um eine Gabe, dann um ein Stück Stein, dann um Werkzeug! Damit helfet mir auf, daß Euch Gott auch helfe.«
Darauf legte der Werkmeister, der den Lohn zu zahlen hatte, Geld in den Hut, nicht als ein Almosen, sondern als einen Vorlohn, und fragte Ulrich nach seinen Zeugnissen.
»Gott danke dem Meister und Pallirer und den ehrbaren Gesellen!« antwortete Ulrich dankend, öffnete seine Ledertasche und holte ein großes gelblich schimmerndes Papier hervor. Darauf stand mit zierlichen Buchstaben geschrieben, daß der Steinmetzgeselle Ulrich Wüll von ehrlicher Geburt sei und als Oblate im Kloster der Benediktiner erzogen; daß er mit fünfzehn Jahren sich in der Bauhütte zu Straßburg als Lehrling gemeldet und darin aufgenommen worden; daß er vier Jahre als Lehrling gelernt und sich brav gehalten, darauf die Prüfung als Geselle bestanden in vorzüglicher Weise; daß er wohl erfahren sei in der geweiheten Lehre des Albertus Magnus, vertraut und geschickt in der Führung des Winkelmaßes und Richtscheites, und daß man allerlei schöne und zierliche Arbeit ihm anvertrauen könne. Und so war seiner Brauchbarkeit und Sittlichkeit das beste Zeugniß gegeben. Versehen war diese Schrift mit dem großen Siegel der Hauptbauhütte zu Straßburg, das diese Umschrift hatte und inmitten eine Mutter Gottes, auf den Feldern zur Seite Cirkel und Richtscheit.
Der Werkmeister erkannte die Echtheit dieses Documentes. Alsbald wies er Ulrich einen unbehauenen Stein an, reichte ihm das Werkzeug und hieß ihn daran ein Probestück ablegen.
Ulrich wälzte sich den schon winkelrecht behauenen Stein zurecht und begann daran mit dem Cirkel, Winkelmaß und Richtscheit zu messen, und ohne sich eines Maßbrettes zu bedienen, das Profil aufzureißen nach dem Grundsatz des Achtortes, der bei dem Kirchenbau im Großen wie im Kleinen galt. Der Pallirer sah ihn dabei aufmerksam zu, und manche von den zehn Gesellen und fünf Lehrlingen, die in der Hütte arbeiteten und ihre vorige Beschäftigung wieder aufgenommen hatten, schielten von der eigenen Arbeit neugierig zu der des neuangekommenen Baubruders hinüber, und bewunderten ihn schon, weil er das Maßbrett verschmähte. Einer der Gesellen schob ihm sogar das seinige zu, weil er meinte, Ulrich habe nur keines erhalten.
Dieser aber zeigte auf das, welches zu seiner Seite lag, dankte dem Gesellen und sagte: »Wenn ich hier mitarbeite den Bau zu fördern, werde ich auch das Maßbrett zur Hand nehmen und danach arbeiten, weil dadurch Zeit und Mühe erspart wird; aber wenn ich ein Probestück ablegen soll, so muß ich zeigen, daß ich mich auf den Grundsatz des Achtortes selbst verstehe und daß ich ein Maßbrett in meinem Kopfe trage.«
Der Pallirer nickte beifällig aber schweigend dem lächelnd aufhorchenden Werkmeister zu. Alle Gesellen arbeiteten schweigend weiter, aber der, welcher seinen Platz neben Ulrich hatte, verwendete fast kein Auge von ihm, so weit als die eigene Arbeit es zuließ.
Die Steinmetzgesellen nannten Alle den blonden Bruder Hieronymus zum Unterschied von andern dieses Namens, denn er fiel überall auf durch sein üppiges goldglänzendes Haar. Seine Augen waren blau und sanft, aber es lag doch ein Ausdruck von Energie in seinen Zügen, die weder schön noch regelmäßig waren, aber doch das Gepräge geistigen Adels trugen. Er gehörte mit unter die jüngeren Gesellen, obwohl er einige Jahre mehr zählen mochte als Ulrich.
Etwa eine Stunde konnte verflossen sein seit dessen Ankunft, als das Mittagsglöckchen läutete. Bei seinem ersten Klange legten Alle in der Hütte die Arbeit weg. und standen mit gefalteten Händen schweigend da, indeß der Werkmeister ein kurzes Gebet sprach. Nach dessen Vollendung, als Alle sich anschickten die Hütte zu verlassen, sagte er zu Ulrich:
»Ihr scheint ein guter und geschickter Arbeiter zu sein und Eure Zeugnisse lauten günstig. Heute werdet Ihr müde sein von der Reise, da mögt Ihr der Ruhe pflegen und Euch Quartier suchen; aber morgen um fünf Uhr, wenn sie Morgen läuten von der St. Lorenzkirche, da seid in der Hütte zum Frühgebet und zur Arbeit, da wird Euch auch der Hüttenmeister empfangen.«
Ulrich dankte und trat aus der Hütte. Draußen aber faßte ihn der blonde Hieronymus unter dem Arm und sagte: »Quartier brauchst Du Dir nicht zu suchen, Bruder Ulrich, das findest Du bei mir, wir können die Mahlzeit und das Lager theilen.«
»Vergelt' es Dir Gott, Bruder Hieronymus!« sagte Ulrich, denn er hatte vorhin den Namen des Steinmetzen schon gehört und gemerkt, weil sein Träger ihm auch gefiel. »Der große Aeneas Sylvius scheint recht zu haben, der Nürnberg eine feine Stadt nennt voll wohlerzogener und gastfreier Leute.«
»Das ist wohl nur gut nürnbergisch,« antwortete Hieronymus, »und ich bin selbst ein Nürnberger Kind, aber Baubrüder, mein' ich, sollen in allen Stücken auch Brüder sein und miteinander arbeiten und streben in wie außer den Hütten.«
»Ich denke auch so,« antwortete Ulrich, »und will's Gott, so soll es Dich nicht gereuen, daß Du mir zuerst also freundlich begegnest.«
»Meine Wohnung ist nicht weit von hier,« sagte Hieronymus, »in einem Seitengäßlein von St. Katharinen.«
Bald war sie erreicht, und die Baubrüder traten in ein kleines Haus, in dem sich unten die Werkstatt eines Formenschneiders und Rädleinmachers des Meister Sebald befand. Oben an der Stiege aber wartete ein altes Mütterlein, bot den Einkehrenden fröhlichen Gruß und eilte das Mittagsessen für sie aufzutragen.
»Es langt schon für Zwei!« rief sie wohlmeinend dem fremden Gast entgegen.
Zweites Capitel. Nürnbergs Geschlechter
Es war ein stattliches aber etwas düsteres Haus, in das Albrecht Dürer mit Farbentopf und Pinsel im Dienst des Meisters Michael Wohlgemuth gesandt worden war. Im Erdgeschoß befand sich ein Comptoir mit kleinen Fenstern hinter vorspringenden, aber künstlich gearbeiteten Eisengittern, welche diesen Räumen ein gefängnißartiges Ansehen gaben. Darin saß und arbeitete mit seinen Gehülfen Herr Gabriel Muffel, der Chef eines großen Handelsgeschäftes und Genannter des großen Rathes, wie denn seine Familie von Alters her zu den edelsten rathsfähigen Geschlechtern von Nürnberg gehörte.
Die übrigen Räume des Erdgeschosses dienten zu großen Waarenlagern, die ihre Vorräthe auch in die geräumige Hausflur und den Hofraum erstreckten, der durch ein Hintergebäude geschlossen war. Aufseher und Auflader waren hier gleicherweise mit Verzeichnen, Schnüren und Aufpacken der Waaren viel beschäftigt, und Niemand achtete auf den jungen Burschen, der sich seinen Weg durch die Vorräthe bahnte und mit elastischen Schritten die Stiege hinaufsprang, denn seine Sendung lautete in das erste Stockwerk.
Wie lebhaft es unten zugegangen, hier war es sehr still, und Albrecht wußte nicht, sollt' er diese stille Einsamkeit ehren durch leises Auftreten und lautloses Spähen, oder sollt' er, um sich bemerkbar zu machen, sie durch irgend einen Laut unterbrechen. Er stand in einem Vorsaal mit dunkel gemalten Wänden und mehreren hohen Flügelthüren von schwerem Eichenholz mit kunstvollem Schnitzwerk und goldenen Leisten geschmückt; eben so zierte schöngeschnitztes Getäfel die Decke und der Fußboden zeigte nach venetianischer Art ein buntes Mosaik; er war mit Gyps übergossen und da hinein bunte Steinchen eingedrückt, die oben glatt geschliffen waren und schön geölt glänzten, als wären es köstliche Edelsteine. Außer der Stiege, die er heraufgekommen, zogen sich von hier aus noch andere kleine hölzerne Wendeltreppen mit zierlichen Geländern hinab und hinauf, den häuslichen Verkehr zu erleichtern.
Nachdem Albrecht nach allen Seiten vergeblich gespäht und gewartet, ob nicht Jemand kommen möchte, dachte er an Wohlgemuth's Knechte, die ihn wieder roh empfangen und anlassen würden, wenn er länger bliebe, als sie die Dauer der Arbeit berechneten, und daß er schon an der Seite des fremden Wandergesellen mehr Zeit zu dem Wege gebraucht, als der Fall gewesen sein würde, wenn er ihn allein mit seinen gewohnten geflügelten Schritten zurückgelegt. Dann faßte er sich ein Herz und pochte an die eine Thür, und da dies ohne Erfolg blieb, an die zweite. Da auch hier Niemand antwortete, ihm aber gleichwohl war, als habe er dahinter seufzen hören, öffnete er dieselbe leise und schaute in ein schmales, aber tiefes Gemach, an dessen Fenster eine weibliche Gestalt an einem eichenen Pulte saß und schrieb.
Albrecht stand eine Weile betroffen still. Das Gemach selbst erschien wie ein Museum der Kunst. Der Fußboden war mit kostbaren Teppichen bedeckt, auch die Tapeten an den Wänden waren von gleichen Mustern kunstreich gewirkt, die schön geschnitzten Sessel mit gelbem Sammt überzogen und die meisten Tische hatten marmorne Platten. Darauf standen allerlei zierliche Geräthschaften für den Hausgebrauch, aber alle von funkelndem Silber und Gold. Große Spiegel von venetianischem Glas wetteiferten in Glanz mit ihren goldenen Rahmen und mehrere Heiligenbilder mit bunten Farben auf Goldgrund gemalt hingen dazwischen. Das schönste Bild aber des Zimmers war seine Bewohnerin.
So ohngefähr hätte Albrecht die Madonna malen mögen. Sie war von mittelgroßer Gestalt, feinem Wuchs und zart gerundeten Formen. Röthlich blonde Locken umflutheten von der edlen Stirn herab bis zum blendendweißen Nacken das edle Antlitz, hinten hielt sie mit zwei dicken Zöpfen vereinigt ein silberner Pfeil zusammen. Der ganze Schmelz reiner Jungfräulichkeit verschönte das blendende Weiß und das zarte Roth ihres Antlitzes. Aber die blauen Augen schimmerten von Thränen und schwere Seufzer hoben ihren Busen. Sie trug ein Kleid von dunkelrothem wollenen Damast mit Puffenärmeln und einem viereckig ausgeschnittenen Schneppenleibchen. Daran hing eine kleine goldgestickte Tasche und ein Schlüsselbund an stählerner, kunstreich gearbeiteter Kette, zwei Reihen heller Bernsteinperlen umspielten den Hals.
Sie hörte nicht, daß Jemand die Thür geöffnet hatte, aber sie fühlte, daß die Strahlen fremder Blicke sie berührten, erschrocken schob sie die Papiere zusammen, unter denen sie geschrieben, und wendete sich nun erst zu dem Eintretenden um.
»Verzeiht, edle Jungfrau, wenn ich Euch störe,« sagte Albrecht, »aber ich bin hierher beschieden ein Geländer anzustreichen, und fand Niemanden mir meine Arbeit anzuweisen.«
Ursula Muffel – denn die Jungfrau war die einzige Tochter des Hauses – erhob sich und sagte: »Kommt Ihr vom Meister Wohlgemuth, so will ich selbst mit Euch gehen.«
Albrecht bejahte, und während Ursula einen Blick in den Spiegel warf, mit dem angehauchten Taschentuch über die verweinten Augen fuhr und ein kleinzusammengefaltetes Papier in ihrem Kleide verbarg, hatte Albrecht ein silbernes Krucifix in die Augen gefaßt, und als Ursula sich zu ihm umkehrte, ward sie gewahr, wie er sich ganz nah auf dasselbe beugte.
»Verzeiht meine Unschicklichkeit,« sagte er fast erröthend zurückfahrend; »ich wollte nur sehen, ob ich mich nicht täusche, daß dies Stück wirklich aus meines Vaters Händen hervorgegangen – und es ist wirklich so, da ist sein Zeichen.«
»So seid Ihr ein Sohn des wackern Goldschmieds Albrecht Dürer in der Winklerstraße?« versetzte Ursula, »denn bei diesem hat es mein Vater mir zum Geschenk machen lassen, da ich gefirmelt ward.«
»Ich habe es selbst gezeichnet und gegossen da ich noch in meines Vaters Werkstatt lernte,« antwortete Albrecht, »und es kann mich stolz machen, daß es in solche Hände gekommen ist.«
Indeß sie so sprachen, schritt Ursula voran über eine Flur kleiner Treppen und Gänge, bis sie im zweiten Stock an eine offene Galerie und eine noch höher führende Freitreppe kamen, an welcher, weil es die Wetterseite über dem Hofraum war, das Holzgeländer seiner ehemaligen Farbe sich beraubt zeigte, welche Albrecht wieder erneuern sollte.
»Und Ihr seid nicht bei dem Handwerk Eures Vaters geblieben,« fragte Ursula, »da Ihr doch schon ein so künstliches Werk zu Stande gebracht?«
Albrecht schüttelte mit dem Kopf: »So fragen mich wohl die Leute immer, und mein Vater selbst meinte, die Zeit sei mir nun gar verloren, die ich zuvor in seiner Lehre zugebracht; aber ich hab' einmal das Zeichnen und Malen nicht lassen können, und scheint es mir leichter jedes andere Opfer, und wär's mein Leben selbst, zu bringen, wenn man's fordert, denn daß ich der Kunst entsagen möchte. Und was ich zuvor schon gelernt, das will ich Alles für sie nützen, damit mir Niemand nachsagen könne, ich habe je meine Zeit mit unnützen Dingen verloren.«
Während er das sagte, knieete er schon an dem bezeichneten Geländer und fing an zu pinseln. Ursula dachte dabei lächelnd zugleich mit vornehmer Geringschätzung und weiblichem Mitleid: Armer Junge! das ist auch eine rechte Kunst, für die es lohnt sich zu begeistern, hier das Geländer anzustreichen, eine Arbeit, die ich selbst ganz gut verrichten könnte, wenn mir's nicht um meine schönen weißen Hände wäre! – Aber bei diesem Gedankengang warf sie einen Blick auf die Hände, die hier den Pinsel führten, und sah, daß sie an Weiße und Zartheit den ihrigen nichts nachgaben, und wie jetzt von obenherein ein Strahl der mittäglichen Sonne vereinzelt durch die Skulptur des vorspringenden Dachgeländers dringend auf den Scheitel des Jünglings fiel und einen Heiligenschein um seine glänzenden Locken wob, indeß er bescheiden mit freudiger Zuversicht die niedere Arbeit verrichtete, da erschien er ihr plötzlich in einem höhern Lichte, als vorher, und was sie auch von seinem Kunstglauben halten mochte, Eines schien ihr gewiß: daß ein hohes Streben und ein edles Gemüth in diesem zarten Jüngling lebte – und daran knüpfte sich die verzeihliche Selbstsucht eines eben ängstlich gefolterten Herzens, ob nicht gerade in diesem ihr der Himmel den Boten gesandt, dem sie vertrauen könne, wo sie eben vergeblich über einen solchen nachgesonnen und diese Unmöglichkeit nicht die geringste Ursache ihrer Thränen gewesen.
Nach einer langen Pause also, in der diese Gedanken und Empfindungen sie bewegt hatten, fuhr sie plötzlich mit der Frage heraus:
»Könnt Ihr lesen?«
»Ei freilich kann ich das!« sagte Albrecht, zugleich stolz auf diese Kunst, deren Erlernung damals Manchem, der in minderer Armuth aufgewachsen als er, versagt war, und auch wieder ärgerlich, daß die Jungfrau bei ihm diese Kenntniß zu bezweifeln schien.
»Könnt Ihr verschwiegen sein und wollt Ihr mir einen Dienst erweisen?« fragte sie weiter mit beklommenem Athem.
»Beides, wenn Ihr es fordert und ich das letztere wirklich vermag,« sagte er bescheiden.
Ursula's Unruhe schien zu steigen, ihre Wangen glühten höher, ihre Pulse gingen schneller, man sah es an allen Bewegungen ihres Körpers, hörte es an der noch mehr beklommenen Stimme, mit der sie sprach:
»Wolltet Ihr, statt hier zu malen, wohl einen Gang für mich thun? Ich habe sonst Niemanden, den ich schicken könnte.«
»Herzlich gern,« antwortete Albrecht, »ich werde hier ohnehin nicht vor Mittag fertig.«
»Dann kommt in einer Viertelstunde wieder hinunter in dasselbe Zimmer, in dem Ihr mich vorhin fandet,« sagte Ursula und eilte die Stiege wieder hinab.
In ihrem Gemach angelangt zog sie das Papier wieder hervor, das sie zu sich gesteckt, weil sie es sonst nirgend sicher hielt. Nun mußte sie es doch von sich geben und fremden Händen vertrauen. Sie durchlas das schön geschriebene Brieflein noch einmal, drückte dann ein Siegel von weißem Wachs darauf und schrieb die Aufschrift: »An den hochedelgeborenen Herrn Stephan von Tucher.« Nun zählte sie die Minuten, bis Albrecht kam, überlegte sich zehnmal, was und wie sie es ihm sagen könnte, ohne vor ihm zu erröthen, und wußte doch keinen Rath, denn zweierlei mußte ja doch immer heraus: daß er schweigen mußte und wem er den Brief übergeben sollte.
Endlich kam Albrecht, und Ursula fühlte, daß sie sich vergeblich vorbereitet hatte, denn sie war ganz eben so um Worte verlegen, wie sie es vorhin gewesen war. Die Finger zitterten sichtbar, welche den Brief hielten, und endlich sagte sie zu Albrecht:
»Eure guten Augen bürgen mir für Eure Verschwiegenheit – nicht wahr?«
»Was mir anvertraut worden, das plaudere ich niemals aus,« antwortete Albrecht, »und da ich sehe, daß Euch so sehr an meinem Schweigen gelegen, so könnt Ihr Euch doppelt darauf verlassen, daß ich das unerwartete Vertrauen einer edlen Jungfrau nicht durch eitles Ausreden mißbrauchen werde.«
»So nehmt diesen Brief und tragt ihn zu dem, an welchen die Aufschrift lautet,« sagte sie – der Name selbst schien nicht über ihre schönen Lippen zu wollen. »Kennt Ihr ihn?« fragte sie dann hastig, und damit mehr den Zustand ihres Herzens verrathend, als wenn sie den Namen selbst erröthend und zitternd ausgesprochen.
»Ei, wie sollt' ich den feinen Herrn nicht kennen!« antwortete Albrecht. »Aus meines Vaters Werkstatt ist manch' ein zierliches Silbergeräth für das schöne Haus in der Hirschelgasse hervorgegangen, und mein Meister hat den Herrn Hans von Tucher selbst conterfeiet in seiner Pilgrimstracht, in der er das heilige Land durchreist hat; danach hat er auch das Bild seines Herrn Sohnes Stephan zu malen angefangen – aber es ist noch nicht fertig, weil derselbe jetzt gar nicht zum Sitzen zu bewegen.«
Ursula horchte hoch auf und sagte dann: »Nun so geht in das schöne türkische Haus in der Hirschelgasse und seht Euch darin um nach dem jungen Herrn. Aber Niemandem als ihm selbst gebt den Brief, und saget auch Niemandem, wer Euch sendet. Seht, ich hätte ja fürwahr keinen bessern Boten als Euch finden können; wenn man Euch dort kennt, so könnt Ihr ja sagen, daß Euer Meister Wohlgemuth Euch sendet.«
Der Jüngling erröthete vor der zugemutheten Lüge, die der jungen Dame sehr geläufig schien, indeß er selbst so ohne Arg und Falsch war, daß auch die kleinste Lüge ihm ein Verbrechen erschien. Er sagte darum halb verweisend: »Will's Gott, so geht es ohne Lüge ab. Vertrauen verdienen und schweigen können ist ein Anderes denn lügen, dazu bin ich nichts nütz.«
»Ihr sollt es auch nicht,« sagte Ursula beschämt; »wenn nicht im Auftrag Eures Meisters, so erinnert ihn um meinetwillen daran, daß er sein Bild soll vollenden lassen!« und wieder erschrak sie, daß sie sich durch unvorsichtige Worte verrathen, und fühlte auch, daß es ihr wie Albrecht ginge: das Lügen und Heucheln war ihr auch nicht geläufig. »Und nun geht,« sagte sie nach einer Pause, »um 12 Uhr wird er wohl nach Hause kommen, und die Antwort bringt mir, wenn Ihr Nachmittag wieder kommt und hier Euere Arbeit vollendet.«
Es war immerhin kein kleines Opfer, das Albrecht Dürer der Jungfrau Ursula brachte mit diesem Gange. Da er ihr Verschwiegenheit gelobt, mochte er auch in seiner Werkstatt nicht sagen, daß er ihr Botendienste geleistet, woran die Gesellen gewiß weitere Fragen und vielleicht unsaubere Späße geknüpft hätten; wenn ihn aber jetzt Einer oder der Andere auf der Straße gewahrte, noch ehe es Mittag geläutet, so traf ihn der gerechte Vorwurf, daß er vor der Zeit von der Arbeit gelaufen und wohl noch Schlimmeres gethan als die Zeit verträumert habe, wie man ihm denn vorhin schon als Warnung mit auf den Weg gegeben. Aber eine Bitte konnte er nimmer abschlagen, und wo er Jemand helfen und einen Dienst leisten konnte, that er es immer ohne an sich selbst dabei zu denken, am wenigsten vermochte sein kindlich weiches Gemüth eine Thräne in einem Frauenauge zu sehen, ohne gerührt zu werden und den Wunsch zu haben sie zu trocknen. Hatte er auf den ersten Blick doch die holde Tochter des reichen Hauses glücklich gepriesen, in dem Alles strahlte von Glanz und Pracht, von Wohlleben und Kunst, und hatte es ihm doch dann so weh gethan, daß sie nicht glücklich schien, trotzdem sie wohl Alles besaß, was das Leben schön und heiter machen konnte. Also gab es doch auch Thränen inmitten des Reichthums, und nicht nur die Sorge um das tägliche Brod oder die Sehnsucht nach höherer Ausbildung, die an den Verhältnissen des materiellen Lebens scheiterten, waren es, welche Thränen erpreßten, wie er bisher gemeint.
Unter solchen Gedanken war er, um sich weniger der Gefahr auszusetzen gesehen zu werden, so viel als möglich durch kleine Gäßchen und ihm bekannte Durchhäuser gegangen, welche bei der Nürnberger Bauart üblich waren, als er in die Hirschelgasse kam und das erst vor wenig Jahren vollendete Tucher'sche Haus betrachtete. Der Besitzer desselben, Hans von Tucher, zu den ältesten und vornehmsten Geschlechtern Nürnbergs gehörig und um seiner dem Reich geleisteten Verdienste willen vom Kaiser in den Adelstand erhoben, hatte, aus dem gelobten Lande von einer Pilgerfahrt dahin zurückgekehrt, dies Haus ganz in türkischem Geschmack erbauen lassen. Von Außen kennzeichneten es die runde Kuppel in der Mitte und die Rundthürme zu beiden Seiten, und gaben ihm fast das Ansehen einer Moschee. Innen war Alles mit orientalischer Pracht eingerichtet, und Albrecht mußte gestehen, daß gegen diesen Luxus von gold- und silbergewirkten Teppichen und Tapeten, marmornen und vergoldeten Möbeln, schwellenden Sammtpolstern, schweren Seidenvorhängen u.s.w. die Einrichtung des Muffel'schen Hauses, die er vorhin bewundert, ärmlich erschien. Ja hier wetteiferte die Kunst selbst mit der Natur und bemühte sich nicht nur orientalische Pracht, sondern auch orientalische Gewächse zu entfalten. Im Hofraum befand sich unter einer runden Kuppel von buntem Glas ein Gebäude, welches einem Feentempel glich. Hohe Palmen und lauter großblätterige und wunderbar blühende Pflanzen wuchsen darin, in mussivisch ausgelegten Becken mit klarem Wasser spielten goldene Fischlein, und aus zierlichen, von Kupfer getriebenen, aber reich versilberten Figuren sprangen Wasserstrahlen, die Gewächse benetzend oder in silbernen Becken sich sammelnd.
Man wies Albrecht dahinein, als er nach dem jungen Herrn Stephan fragte, denn hier befand sich der Gesuchte und betrachtete eine große weiße Blume, die sich eben aus ihrer dichten grünen Hülle entfalten wollte. In seinen Augen schimmerte freilich keine Thräne, aber es sprach finsterer Unmuth daraus, der eben so sehr mit seiner blühenden, zauberischlächelnden Umgebung contrastirte, wie die Thräne Ursulas mit dem Glanz der ihrigen.
Stephan Tucher war ziemlich groß und von stolzer Haltung, die auch in dem weiten faltigen Gewand sichtbar war, das er nach Art der Saracenen trug, um auch den Hausanzug zu dem Hause selbst zu passen. Sein dunkles Haar war sorgfältig gepflegt wie der kleine Bart über seinen Lippen und duftete nach köstlichen Oelen. In seinen Augen glühte das Element eines unruhigen Feuers, das sie zu zwingen schien sich immer hin und her zu bewegen und das die hochgeschwungenen Brauen nicht milderten. Seine Nase war stolz gehoben und ein Zug von Eitelkeit spielte um seine an beiden Seiten aufwärts gezogene Oberlippe, unter der große, blendendweiße Zähne hervorblitzten. Er galt für einen schönen Mann, schien das sehr wohl zu wissen und großen Werth darauf zu legen – vielleicht eben deshalb hatte er für den bescheidenen, schwärmerischen Albrecht nichts Anziehendes.
Er grüßte höflich, eilte sogleich auf Stephan zu, der den Gruß nicht erwiederte, sondern den Eintretenden allein mit einer Miene ansah, als wolle er fragen: wer so unverschämt sei ihn zu stören? und die Worte würden wohl auch gefolgt sein, wenn nicht Albrecht sie abgeschnitten, indem er sagte: »Verzeiht, Herr, aber nur wenn ich Euch ganz allein fände, sollt' ich dies Brieflein in Euere Hände legen.«
Ohne ein Wort der Erwiederung nahm es Stephan und lös'te mit Hast das Siegel, so daß das feine Papier daneben zerriß. Mit flammenden Blicken las er:
»Hochedelgeborner, vielgeliebter Herr! Wenn Euere Minne der meinigen an Größe gleicht, so könnet Ihr harren und aushalten in Geduld, bis daß die Zeit oder die Heiligen uns helfen den stolzen Sinn der Väter versöhnen. Laßt um meinetwillen nicht Feindschaft werden zwischen Euch und Eurem Vater. Nie werde ich einen andern Mann minnen denn Euch, aber fahret Ihr fort in mich zu dringen das Gebot Gottes und der Menschen zu übertreten, so muß ich in ein Kloster flüchten und den Schleier nehmen, denn auch ich bin zu stolz die Schwiegerin eines Mannes zu werden, der in mir nur die Enkelin eines Hingerichteten verachtet. So vermelde ich Euch meinen Gruß und bleibe Euere vielgetreue Ursula.«
Getäuschte Erwartung, Leidenschaft und Zorn loderten in Stephan auf, er war in einer furchtbaren Erregung und gab sich keine Mühe dieselbe zu verbergen. Er stampfte mit den Füßen und lief wie ein wüthend gewordenes eingesperrtes Raubthier in seinem Käfig hin und her. Albrecht's Gegenwart schien er ganz vergessen zu haben. Endlich fuhr er ihn an:
»Du bist ein Betrüger! wer gab Dir diesen Brief?«
Albrecht schlug die Augen verwundert auf im Bewußtsein seiner Unschuld und sagte: »Den Brief gab mir Jungfrau Ursula Muffel mit eigener Hand und war dabei sehr ängstlich, daß es Niemand erführe.«
»Es ist ihre Hand!« sagte Stephan zu sich selbst, »aber wer bist Du? Du gehörst nicht zu den Dienern ihres Hauses, aber ich habe Dich schon irgendwo gesehen; Du wirst meiner Rache nicht entgehen, wenn Du mich belügst!«
»Herr!« antwortete Albrecht mit edler Glut und entschlossen keinen unwürdigen Verdacht zu dulden: »Ich kann Eurem Gedächtniß gern zu Hülfe kommen; ich heiße Albrecht Dürer und bin Lehrling beim Meister Wohlgemuth unter der Veste, der Euch begonnen hat zu conterfeien, in seiner Werkstatt habt Ihr mich gesehen. Heut' habe ich im Hause des hochedlen Rathsherrn Muffel zu malen, da hatte Jungfrau Ursula besseres Vertrauen zu mir denn Ihr, und da sie einen Boten brauchte zu Euch, auf dessen Treue und Schweigen sie bauen mochte, hat sie mich erwählt. Den Brief hat sie vor meinen eigenen Augen gesiegelt, von ihrem Schreibpult genommen und dabei geweint wie schon vorher. Sie hat mir auch geheißen ihr Nachmittag Antwort zu bringen. Und da ich von dem Gemälde geredet, das Meister Wohlgemuth von Euch begonnen, hat sie gesagt, Ihr möchtet es bald vollenden lassen.«
Während Albrecht sprach, hatten Stephan's Augen wieder auf dem Briefe geweilt, und es war als betrachte er seine Zeilen nun im mildern Lichte. »Antwort sollst Du bringen?« fuhr er jetzt empor, »wozu Antwort? Doch ja! bring' ihr diese.« Er riß die schöne weiße Blume ab, die er vorhin betrachtet hatte, und pflückte dann eine der dunkelsten Purpurblüthen eines Granatbaumes, gab beide in Albrecht's Hand und sagte: »Bringe ihr die Blumen als Antwort und sag' ihr: die rothe gleiche meiner Empfindung und die weiße der ihrigen.«
Albrecht nahm die Blumen und wollte gehen. Da besann sich Stephan doch noch, daß er sich voll roher Rücksichtslosigkeit gegen die Briefsenderin wie gegen ihren Boten benommen – und wollte beides durch eine neue Rohheit gut machen. Er nahm ein Goldstück aus seiner Tasche, gab es Albrecht, der es erst nahm, weil er dachte, er solle vielleicht damit noch einen Auftrag vollziehen, und sagte: »Hier, damit Du schweigst und keinem Menschen ein Wort von diesem Botengange sagst.«
Albrecht legte das Goldstück rasch auf den nächsten Blumenstock, als sei es glühend, und es schien, als jage es auch solche Glut in sein Gesicht. Mit bebender Stimme rief er: »Um Gold thue ich weder das Rechte noch das Unrechte. Ich habe Jungfrau Ursula versprochen zu schweigen, da könnt Ihr ruhig sein.« Und während der arme Lehrling hoch aufgerichtet hinausschritt, weil er trotz all' seiner Armuth eine Demüthigung abgeworfen und das Gold nicht genommen, das ihm in anderer Weise sehr willkommen gewesen, da er oft an dem Nöthigsten Mangel litt und sich dafür schönes Werkzeug hätte kaufen können, blieb der reiche Patriziersohn zerfallen mit sich selbst, mit seiner Familie, der Geliebten und darum mit der ganzen Welt in seinem prächtigen türkischen Kiosk zurück, und verwünschte diese Pracht, weil ihm nicht vergönnt war die schönste Blume hineinzuverpflanzen, die unter Nürnbergs Jungfrauen ihm erblüht war.
Und es war nur ein leidiges Vorurtheil seines stolzen Vaters, das ihn so unglücklich machte.
Sein Vater war seit seiner Rückkehr aus dem heiligen Lande Loosunger des großen Raths, wie denn überhaupt seit einiger Zeit in der Nürnberger Verfassung der Mißbrauch eingerissen war, daß nur aus den Geschlechtern der Holzschuher und Tucher die Loosunger hervorgingen.
Werfen wir, um dies und weiter Folgendes zu erklären, einen Blick auf die Nürnberger Verfassung.
Schon seit 1219 war Nürnberg zur freien Reichsstadt erhoben worden und eine Urkunde Friedrichs II. bestätigte ihr das Recht: keinen andern Schutzherrn zu haben als die römischen Könige und Kaiser. Die Stadt hatte das Recht, sich nach einer selbstgegebenen republikanischen Verfassung selbst zu regieren, und verdankte dieser gleich andern Städten des Mittelalters ihre Blüthe.
Das Stadtregiment bestand in einem großen und in einem kleinen Rath. Der erstere ward aus den vornehmsten Bürgern der Stadt gewählt, welche darum den Namen der »Genannten« führten. Der kleine Rath, der das eigentliche Stadtregiment führte, ward mit zweiundvierzig Männern besetzt, wovon vierunddreißig aus den edlen rathsfähigen Geschlechtern und acht aus der Gemeine gewählt wurden. Jene vierunddreißig theilten sich in acht alte Genannte und sechsundzwanzig Bürgermeister, von denen dreizehn geschworne Schöffen waren. Von den Bürgermeistern war ein Jahr hindurch abwechselnd ein junger und ein alter Bürgermeister im Amt. Von den alten Bürgermeistern wurden sieben als oberste Regenten ausgewählt, die sieben älteren Herren (Septemviri). Aus diesen wurden drei oberste Hauptmänner (Triumviri) und von diesen wieder zwei zu Schatzmeistern (Duumviri) ernannt, welche auch die Loosunger hießen, weil sie die Loosung (Steuer) zu verwalten hatten. Der älteste dieser Loosunger (denn dieser Name war zu unserer Zeit der gebräuchliche) im Amt ward als der Vornehmste und Oberste im ganzen Rath geachtet.
Diese Loosunger standen in höchstem Ansehen, ihnen waren alle Schätze der Stadt anvertraut, sie hatten alle Einnahmen und Ausgaben zu besorgen und die auswärtigen Aemter mußten ihnen Rechnung ablegen. Zu alten Genannten wurden meistens nur solche Personen gewählt, deren Verwandte schon im Rathe und Bürgermeister waren, da sie dann während deren Lebensdauer nicht zur Würde eines Bürgermeisters oder zu einem andern höheren Grade gelangen konnten. Sie hatten im kleinen Rath ihre Stimme zuletzt, und nur wenn die Frage bis zu ihnen reichte, abzugeben.
In den kleinen Rath konnten übrigens nur solche gewählt werden, die zu den alten Geschlechtern gehörten, so nannte man diejenigen Nürnberger Bürger, oder vielmehr Patrizier, deren Ahnen und Urahnen auch im Regiment gewesen. Fremdlinge und das gemeine Volk, wie die Verfassungsurkunde sich ausdrückt, hatten keine Gewalt. Nur ausnahmsweise wurden auch solche, welche erst seit kurzer Zeit nach Nürnberg gekommen, als besondere Auszeichnung, sowie Einheimische ihrer Geburt und ihres Stammes wegen in den Rath aufgenommen; doch konnten sie es nicht höher als bis zum jüngern Bürgermeister bringen.
Wenige Geschlechter nur waren es, deren Sprößlinge es bis zum alten Bürgermeister bringen konnten, noch weniger waren es, woraus die sieben alten Herren, sehr wenige, aus denen die Hauptmänner, und am wenigsten, woraus die Loosunger gewählt werden konnten. So war es denn endlich dahin gekommen, daß lange Zeit hindurch nur die Holzschuher und Tucher dieser Würde theilhaft waren.
1469 war noch Niclas Muffel Loosunger und lange Zeit einer der geachtetsten Männer gewesen, bis es plötzlich an den Tag kam, daß er öffentliche Gelder veruntreuet hatte. Um ein Beispiel zu geben, ward er in strenger Haft gefangen gehalten und dann hingerichtet. Er hinterließ fünf Söhne, die vier ältesten wanderten aus, der jüngste Sohn, Gabriel, aber blieb, um das Geschlecht fortzusetzen.
Gabriel Muffel gehörte nun auch zu den Genannten des großen Rathes, und hatte es sich angelegen sein lassen, die Schmach vergessen zu machen, die durch seinen Vater auf sein Geschlecht gekommen. Waren doch nun zwanzig Jahre seit jenem Unglückstag verstrichen, bisher hatte ihn auch wirklich Niemand dasselbe entgelten lassen. Jetzt war er seit einigen Jahren Witwer und hatte nur seine Tochter Ursula bei sich, die eben an jenem unglücklichen Erichstag, da ihr Großvater gerichtet ward, zur Welt gekommen. Sie hatte nur noch einen Bruder, der sich jetzt bei einem Oheim in Mailand in der Lehre befand, um später das Geschäft des Vaters zu übernehmen.
Ursula Muffel war nicht nur eines der schönsten sondern auch der klügsten Mädchen von Nürnberg. Geschwisterlos aufgewachsen und früh der Mutter beraubt, hatte sie gleich mancher Jungfrau Nürnbergs an wissenschaftlicher Bildung Gefallen gefunden. Sie konnte nicht nur lesen und schreiben, sondern verstand auch italienisch und lateinisch, und war in manchen Stücken von ihres Vaters Geschäft wohl erfahren, so daß sie ihm auch im Rechnen und Briefschreiben oft beizustehen pflegte. Dabei war sie bescheiden und sittig und auch in allen erblichen Künsten wohl geübt. Sie hatte die oberste Leitung des Hauswesens, und die Ordnung und Anmuth, die sie darin zu verbreiten wußte, legte sie auch an ihrer zierlichen Kleidung an den Tag.
Stephan Tucher, nur eben erst von weiten Reisen zurückgekehrt, hatte sie an einem Osterfeiertag gesehen bei einem Feste der patrizischen Geschlechter, und da war es ganz von selbst gekommen, wie es immer kommt: daß das Paar sich schnell zusammengefunden und nur Aug' und Ohr für einander gehabt hatte.