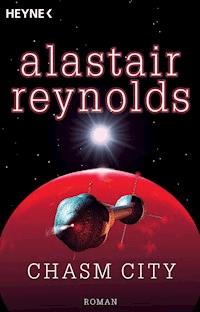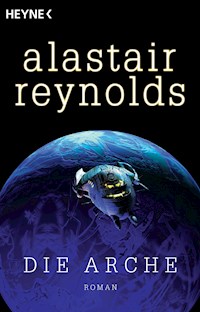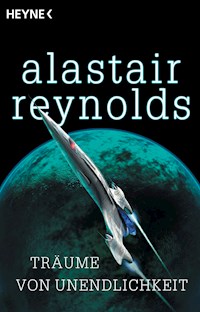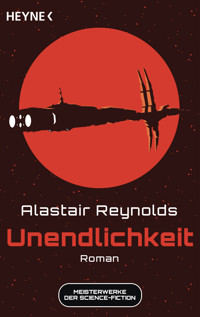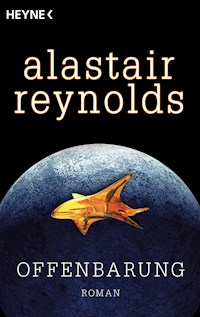
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Inhibitor-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Die letzte Chance der Menschheit
Das Lichtschiff Sehnsucht nach Unendlichkeit hat die letzten Überlebenden Resurgams nach ihrer Flucht vor den Unterdrückern auf den weit abseits gelegenen Planeten Ararat gebracht. Seit 20 Jahren haben die Flüchtlinge hier nun eine neue Welt aufgebaut und leben in einem vorsichtigen Frieden mit den geheimnisvollen Ureinwohnern, den Schiebern. Dann aber erreicht eine furchtbare Nachricht die Siedler: Die Unterdrücker haben die menschliche Kolonie auf Ararat entdeckt und drohen, den Planeten auszulöschen. Die letzte Hoffnung der Menschheit ruht nun in der Geburt eines Kindes, das bereits mit großem Wissen zur Welt kommen wird: Aura.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1358
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
www.diezukunft.de
DAS BUCH
Kann ein Planet einfach verschwinden und einen Moment später wieder da sein? Quaiche beobachtet dieses wundersame Ereignis, als er auf Hela strandet, einem Mond, der den Gasriesen Haldora umkreist. Er gründet an Ort und Stelle eine bizarre Religion, die immer mehr Anhänger findet, weil sie in Haldora einen Ort der Erlösung sehen: Karawanen von wandernden Kathedralen umrunden den Mond, damit die Gläubigen Haldora ständig im Blickfeld haben, wenn sich das Wunder von neuem ereignet. Was verbirgt sich hinter diesem rätselhaften Planeten? Womöglich eine raffinierte optische Täuschung, die ein Tor zu einem Paralleluniversum verhüllen soll? Und könnte er damit tatsächlich ein Ort der Erlösung für die Menschheit sein, die sich in einem hoffnungslosen Abwehrkampf gegen die »Unterdrücker« befindet, schier allmächtigen Maschinenwesen, dafür geschaffen, alles organische Leben im Universum zu vernichten?
Mit »Offenbarung« findet Alastair Reynolds atemberaubendes Zukunftsszenario seinen Höhepunkt, das mit »Unendlichkeit« begann und mit »Chasm City«, »Die Arche« sowie »Träume von Unendlichkeit« fortgesetzt wurde.
»In der Welt der Space Operas gibt es nur wenige ganz große Autoren neben Dan Simmons, Iain Banks und Peter F. Hamilton. Alastair Reynolds hat sich zweifellos einen Platz in diesem Kreis verdient.« – Mike Rowley
»Alastair Reynolds’ Bücher sind wahre Glanzstücke moderner Science Fiction.« – Stephen Baxter
DER AUTOR
Alastair Reynolds wurde 1966 im walisischen Barry geboren. Er studierte Astronomie in Newcastle und St. Andrews und arbeitete lange Jahre als Astrophysiker für die Europäische Raumfahrt-Agentur ESA, bevor er sich als freier Schriftsteller selbstständig machte. Reynolds lebt in der Nähe von Leiden in den Niederlanden.
Inhaltsverzeichnis
Für meine Großeltern
»The Universe begins to look more like a great thought than like a great machine.«1
SIR JAMES JEANS
Sie steht allein am Ende der Mole und schaut zum Himmel auf. Der Brettersteg, der sie mit dem Strand verbindet, schimmert silbrig blau im Mondlicht. Das Wasser ist schwarz wie Tinte und schlägt leise gegen die Stützen. Westlich der Bucht flimmern weit draußen am Horizont grünliche Flecken, als läge eine ganze hell erleuchtete Galeerenflotte auf dem Meeresgrund.
Bekleidet ist sie, wenn man es so nennen kann, mit einer weißen Wolke aus künstlichen Schmetterlingen. Nun befiehlt sie ihnen, näher zu kommen. Sie legen die Flügel übereinander und bilden so etwas wie eine Rüstung. Nicht dass ihr kalt wäre – der Abendwind ist warm und gesättigt mit dem exotischen Duft ferner Inseln –, aber sie fühlt sich verwundbar, so als ruhe das Auge einer Macht auf ihr, die weit älter und stärker ist als sie. Wäre sie einen Monat früher gekommen, als noch zehntausende den Planeten bevölkerten, das Meer hätte ihr sicher nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Doch abgesehen von ein paar unverbesserlichen Schlafmützen und einigen wenigen Neuankömmlingen wie ihr selbst sind alle Inseln jetzt leer. Sie ist neu hier – genauer gesagt, sie war lange Zeit fort –, und nun weckt ihr chemisches Signal das Meer. Die Flecken vor der Bucht sind erst nach ihrer Landung aufgetaucht. Das ist kein Zufall.
Das Meer hat sie wiedererkannt, auch nach so vielen Jahren.
»Wir sollten jetzt gehen«, ruft ihr Beschützer von dem schwarzen Landkeil herüber, wo er, auf seinen Stock gestützt, ungeduldig auf sie wartet. »Du bist hier nicht sicher, seit sie den Ring nicht mehr zusammenhalten.«
Ach ja, der Ring: Sie kann ihn sehen, er durchschneidet den Himmel wie eine plump übertriebene Darstellung der Milchstraße. Die zahllosen Steinsplitter blitzen und funkeln, wo das Licht der näheren Sonne auf sie fällt. Als sie eintraf, wurde der Ring noch von den Planetenbehörden überwacht: Alle paar Minuten blitzte der rosarote Leuchtschweif einer Steuerrakete auf, weil eine der Drohnen ein Stück Schutt beschleunigte, bevor es die Planetenatmosphäre streifen und ins Meer stürzen konnte. Sie hatte mitbekommen, dass die Einheimischen sich etwas wünschten, wenn sie diese Blitze sahen. Sie waren nicht abergläubischer als andere Planetenbewohner, aber sie wussten eben, wie gefährdet ihre Welt war – und dass sie ohne die Blitze keine Zukunft hatte. Es hätte die Behörden nichts gekostet, den Ring auch weiterhin überwachen zu lassen : Die selbstreparierenden Drohnen hatten ihre Pflicht in den letzten vierhundert Jahren seit der Neubesiedlung tadellos erfüllt. Sie abzuschalten, war eine rein symbolische Geste gewesen, die den Zweck hatte, die Evakuierung voranzutreiben.
Durch den Schleier des Rings sieht sie den zweiten, ferneren Mond: den Mond, der nicht zerstört wurde. Von den Menschen hier ahnte kaum jemand, was damals geschehen war. Sie wusste es. Sie hatte es mit eigenen Augen gesehen, wenn auch aus sicherer Entfernung.
»Wenn wir noch lange bleiben …«, mahnt ihr Beschützer.
Sie dreht sich um und schaut zum Land zurück. »Nur eine kleine Weile noch. Dann können wir gehen.«
»Ich fürchte, dass jemand das Schiff stehlen könnte. Und ich mache mir Sorgen wegen der Nestbauer.«
Sie nickt, denn sie versteht seine Ängste, aber sie wird sich nicht abhalten lassen, das zu tun, wozu sie hergekommen ist.
»Dem Schiff wird nichts geschehen. Und von den Nestbauern haben wir nichts zu befürchten.«
»Sie scheinen sich aber sehr für uns zu interessieren.«
Sie streift einen künstlichen Schmetterling ab, der sich auf ihre Stirn verirrt hat. »Das war schon immer so. Sie sind einfach neugierig.«
»Eine Stunde«, sagt er. »Dann lasse ich dich allein zurück.«
»Das glaube ich dir nicht.«
»Du kannst es ja darauf ankommen lassen.«
Sie lächelt. Er wird sie nicht im Stich lassen, das weiß sie genau. Aber seine Nervosität ist berechtigt: Beim Anflug auf den Planeten mussten sie ständig gegen den Strom der unzähligen Flüchtlingsschiffe anschwimmen, die nach außen drängten. Als sie in den Orbit gingen, waren die Transitfahrstühle bereits gesperrt: Die Behörden gestatteten niemandem mehr, auf diesem Weg zur Oberfläche zu gelangen. Nur mit Heimtücke und Bestechung war es ihnen gelungen, Plätze in einer Gondel zu bekommen. Sie hatten das ganze Abteil für sich allein gehabt, aber ihr Begleiter hatte behauptet, alles sei vom Geruch der Panik durchdrungen; die chemischen Signale der Menschen hätten das Mobiliar imprägniert. Sie war froh gewesen, keine so feine Nase zu haben. Sie ist ohnedies schon verängstigt genug: mehr, als sie ihm zeigen will. Und als die Nestbauer sie bis in dieses System verfolgten, war die Angst noch größer geworden. Das halb durchsichtige Schiff mit dem kunstvoll geriffelten, von Kammern durchzogenen Spiralrumpf ist eines der letzten Raumschiffe im Orbit. Sind die Nestbauer hinter ihr her, oder sind sie nur als Zuschauer gekommen?
Sie wendet sich wieder dem Meer zu. Vielleicht bildet sie es sich nur ein, aber die leuchtenden Flecken scheinen ihr zahlreicher und größer geworden zu sein; nun erinnern sie nicht mehr an eine Galeerenflotte, sondern eher an eine versunkene Stadt. Und sie kriechen auf die Spitze der Mole zu. Der Ozean wittert ihre Gegenwart: Winzige Organismen schweben über dem Wasser, dringen in die Haut ein, wandern mit dem Blut in ihr Gehirn.
Wie viel das Meer wohl wissen mag? Es muss die Evakuierung gespürt haben, die ihm so viele menschliche Bewusstseine entzogen hat. Sicherlich vermisst es das Kommen und Gehen der Schwimmer und die neuronalen Informationen, die sie mitbrachten. Vielleicht hat es sogar mitbekommen, dass die Überwachung des Rings eingestellt wurde: Zwei oder drei kleine Fragmente des früheren Mondes sind bereits ins Wasser gestürzt, allerdings nicht in der näheren Umgebung dieser Inseln. Doch inwieweit mag dem Ozean bekannt sein, was geschehen wird?
Sie gibt den Schmetterlingen einen neuen Befehl. Ein Teil des Schwarms löst sich von ihrem Ärmel, die Tiere legen die Flügel aneinander und bilden vor ihrem Gesicht eine taschentuchgroße Fläche mit gezacktem Rand. Die Flügel an den Kanten flattern weiter. Das Tuch wechselt die Farbe und wird durchsichtig, nur der Rand bleibt violett. Sie legt den Kopf in den Nacken und schaut durch den Schuttring hinauf in den Abendhimmel. Die Schmetterlinge blenden, ein Rechentrick, den Ring und den Mond aus. Der Himmel verdunkelt sich ganz allmählich, die Schwärze vertieft sich, die Sterne treten heller hervor. Sie überlegt nur kurz, dann wählt sie einen Stern aus und betrachtet ihn genauer.
Der Stern ist nicht weiter bemerkenswert, abgesehen davon, dass er nur ein paar Lichtjahre entfernt und damit von diesem System aus gesehen der nächste ist. Aber er ist zum Meilenstein geworden, zur vordersten Welle einer Flut, die nicht mehr aufzuhalten ist. Sie war dabei, als jenes System vor dreißig Jahren evakuiert wurde.
Die Schmetterlinge vollführen einen weiteren Rechentrick. Sie konzentrieren sich auf diesen einen Stern und holen ihn näher heran. Er wird heller und zeigt schließlich Farbe. Jetzt ist er nicht mehr weiß, nicht einmal bläulich weiß, sondern hat einen unübersehbaren grünen Schimmer.
Ein unnatürliches Grün.
Vasko schwamm ans Ufer. Scorpio ließ den jungen Mann nicht aus den Augen. Die ganze Fahrt über hatte er über den Tod durch Ertrinken nachgedacht und sich vorgestellt, wie es wäre, in den lichtlosen Tiefen zu versinken. Es hieß, wenn man schon sterben müsste, wäre Ertrinken nicht die schlimmste Todesart. Woher die Leute das wissen wollten, und ob es auch für Schweine galt, war allerdings fraglich.
Solchen Gedanken hing er immer noch nach, als das Boot allmählich zum Stehen kam. Der elektrische Außenbordmotor raste weiter, bis er ihn ausschaltete.
Scorpio stocherte mit einem Stock im Wasser herum. Nach seiner Schätzung war es höchstens einen halben Meter tief. Er hatte gehofft, durch eine der Fahrrinnen näher an die Insel heranzukommen, aber es musste auch so gehen. Selbst wenn er mit Vasko keinen Treffpunkt vereinbart hätte, die Zeit reichte nicht aus, um wieder aufs offene Meer hinauszufahren und sich auf die Suche zu machen. Fahrrinnen waren schon bei ruhiger See und völlig wolkenlosem Himmel nur mit Mühe zu finden.
Scorpio ging zum Bug, griff nach dem plastikummantelten Seil, das Vasko als Kopfkissen benützt hatte, und wickelte sich ein Ende fest um das Handgelenk. Dann sprang er mit einer einzigen fließenden Bewegung über Bord und landete spritzend im flachen Wasser. Die flaschengrünen Fluten reichten ihm nur knapp über die Knie. Das Leder seiner Stiefel und seiner Gamaschen war so dick, dass er die Kälte kaum spürte. Das Boot war ein paar Grad abgetrieben, seit er ausgestiegen war, aber er straffte die Leine mit einem Ruck, und der Bug kam herum. Dann nahm er die Leine über die Schulter, watete los und zog das Boot hinter sich her. Die Steine unter seinen Füßen waren tückisch, doch hier leisteten ihm seine krummen Beine ausnahmsweise gute Dienste. Er schritt unbeirrt voran, bis ihm das Wasser nur noch bis zur Hälfte der Stiefelschäfte reichte. Als das Boot den Grund berührte, zerrte er es noch etwa zehn Schritte weiter, mehr wagte er nicht.
Auch Vasko war jetzt im Seichten angekommen. Der junge Mann stellte die Schwimmbewegungen ein und stand auf.
Scorpio zog das Boot am Dollbord zu sich heran und stieg ein. Der dicke Schorf aus korrodiertem Metall löste sich, dicke Brocken blieben ihm in der Hand. Das Boot hatte mehr als hundertundzwanzig Stunden im Wasser hinter sich, dies war vermutlich seine letzte Fahrt. Er beugte sich über die Seite und ließ den kleinen Anker fallen. Das hätte er auch früher schon tun können, aber Anker korrodierten ebenso leicht wie Bootsrümpfe. Man verließ sich besser nicht allzu fest auf sie.
Noch ein Blick zu Vasko. Der balancierte mit weit ausgebreiteten Armen auf das Boot zu.
Scorpio sammelte die Kleider seines Begleiters ein und stopfte sie in seinen Rucksack, der bereits Verpflegung, frisches Wasser und die Sanitätsausrüstung enthielt. Dann schwang er sich den Ranzen auf den Rücken und watete die letzten Schritte an Land, wobei er nicht versäumte, sich gelegentlich nach Vasko umzusehen. Scorpio wusste, dass er den Jungen hart angefasst hatte, aber der Jähzorn hatte ihn übermannt, und er war nicht mehr fähig gewesen, sich zu beherrschen. Diese Entwicklung beunruhigte ihn. Dreiundzwanzig Jahre war es her, seit er zum letzten Mal im Zorn und nicht in Ausübung seiner Pflicht die Hand gegen einen Menschen erhoben hatte. Aber jetzt sah er ein, dass man auch mit Worten Gewalt ausüben konnte. Früher hätte er darüber nur gelacht, doch inzwischen hatte er längst ein neues Leben begonnen. Er hatte geglaubt, gewisse Dinge überwunden zu haben.
Natürlich hatte die Aussicht auf ein Wiedersehen mit Clavain diese Wut geweckt. Ängste, Emotionen, die zurückreichten in die blutigen Sümpfe der Vergangenheit waren übermächtig geworden. Clavain wusste, was Scorpio gewesen war. Clavain wusste auch, wozu er fähig war.
Er blieb stehen und wartete, bis der junge Mann ihn eingeholt hatte.
»Sir …« Vasko war außer Atem und zitterte vor Kälte.
»Wie war es?«
»Sie hatten Recht, Sir. Es war kälter, als es den Anschein hatte.«
Scorpio nahm den Rucksack ab. »Das dachte ich mir, aber Sie haben sich gut gehalten. Ich habe Ihre Sachen hier. Damit werden Sie rasch wieder warm. Sie bedauern doch nicht, dass Sie mitgekommen sind?«
»Nein, Sir. Ich wollte schließlich ein Abenteuer.«
Scorpio reichte ihm seine Sachen. »Wenn Sie erst in meinem Alter sind, werden Sie darauf nicht mehr so scharf sein.«
Es war windstill wie so oft, wenn die Wolkendecke tief über Ararat hing. Die nähere Sonne – das Gestirn, um das Ararat kreiste – hing als verwaschener Fleck tief am westlichen Himmel. Ihre weiter entfernte binäre Schwester blitzte wie ein weißer Diamant am gegenüberliegenden Horizont durch eine Wolkenlücke. Offiziell hießen die beiden Sonnen P Eridani A und B, aber alle Welt sprach nur von der Hellen und der Matten Sonne.
Im silbrig grauen Tageslicht schwappte das Wasser wie eine schmutzige, graugrüne Suppe um Scorpios Stiefel. Doch obwohl man nicht bis auf den Grund sehen konnte, war die Dichte schwimmender Mikroorganismen für Ararat vergleichsweise gering. Vasko war beim Schwimmen dennoch ein gewisses Risiko eingegangen, aber es war richtig gewesen, denn auf diese Weise waren sie mit dem Boot viel näher ans Ufer gekommen. Scorpio verstand nicht viel von solchen Dingen, aber er wusste immerhin, dass wichtige Begegnungen zwischen Menschen und Schiebern zumeist in Bereichen des Ozeans stattfanden, wo das Wasser so mit Organismen übersättigt war, dass regelrechte Flöße aus organischer Materie entstanden. Hier war die Konzentration so niedrig, dass kaum Gefahr bestand, die Schieber könnten in ihrer Abwesenheit das Boot auffressen oder es mithilfe lokal begrenzter Gezeitenströmungen aufs offene Meer hinaustragen.
Sie hatten die sanft ansteigende Felsebene erreicht, die vom Meer aus nur als schwarzer Strich zu sehen gewesen war. Hier und dort stand das Wasser in flachen grauen Tümpeln, in denen sich der bedeckte Himmel spiegelte. Dahinter ragte in einiger Entfernung ein weißer Pickel auf. Den steuerten sie an.
»Sie haben mir noch immer nicht gesagt, was wir eigentlich hier wollen«, sagte Vasko.
»Das werden Sie noch früh genug erfahren. Zunächst werden Sie mal dem Alten begegnen. Finden Sie das nicht aufregend genug?«
»Es macht mir eher Angst.«
»Er kann einem auch Angst machen, aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Er hält nichts von Demutsgebärden.«
Das Boot zu ziehen, war anstrengend gewesen, aber nachdem sie zehn Minuten gegangen waren, hatte Scorpio sich wieder erholt. Der Pickel wurde zu einer Kuppel, die auf dem Boden stand, und entpuppte sich schließlich als aufblasbares Zelt, gehalten von Leinen und Heringen, die in den Fels geschlagen waren. Am unteren Rand wies das weiße Gewebe Salzwasserflecken in verschiedenen Grüntönen auf. An mehreren Stellen war es notdürftig geflickt. Ringsum lagen Muschelstücke auf dem Boden oder lehnten schräg an der Zeltwand. Jemand hatte sie wie Treibholz aus dem Meer geholt und bewusst künstlerisch arrangiert.
»Sie sagten doch vorhin, Clavain sei gar nicht am anderen Ende der Welt, Sir?«, fragte Vasko.
»Ja?«
»Warum konnte man uns nicht einfach mitteilen, dass er sich stattdessen hier aufhält?«
»Weil es für diesen Aufenthalt einen bestimmten Grund gibt«, antwortete Scorpio.
Sie gingen um das Zelt herum, bis sie den luftdichten Eingang fanden. Daneben stand ein summender Kasten, der Energie erzeugte, den Innendruck aufrechterhielt und den Bewohner mit Wärme und anderen Annehmlichkeiten versorgte.
Scorpio fuhr mit dem Finger über den scharfen Rand einer Muschelscherbe, die offensichtlich aus einem größeren Stück herausgeschnitten worden war. »Sieht so aus, als hätte er Strandgut gesammelt.«
Vasko zeigte auf die äußere Tür, die bereits offen stand. »Sieht aber nicht so aus, als wäre jemand zu Hause.«
Scorpio öffnete die innere Tür. Ein Hochbett mit ordentlich zusammengefalteten Decken und ein kleiner Klapptisch. Ein Ofen und ein Nahrungssynthesiser. Eine Karaffe mit gefiltertem Wasser und ein Karton mit Lebensmitteln. Eine Luftpumpe, die noch lief, auf dem Tisch etliche kleinere Muschelstücke.
»Man kann nicht feststellen, wann er zum letzten Mal hier war«, bemerkte Vasko.
Scorpio schüttelte den Kopf. »Er ist wahrscheinlich noch nicht lange weg, allenfalls ein bis zwei Stunden.«
Vasko suchte nach dem Beweis, auf den Scorpio seine Behauptung stützte. Er würde ihn nicht finden: Schweine wussten seit langem, dass den Standardmenschen der feine Geruchssinn fehlte, den sie selbst von ihren Vorfahren geerbt hatten. Und sie hatten – auf die harte Tour – gelernt, dass die Menschen daran nicht gern erinnert wurden.
Sie verließen das Zelt und verschlossen die innere Tür hinter sich, wie sie sie vorgefunden hatten.
»Was nun?«, fragte Vasko.
Scorpio reichte ihm den zweiten Armbandkommunikator, den er am Handgelenk getragen hatte. Das Gerät war bereits auf eine abhörsichere Frequenz eingestellt, sie brauchten also nicht zu befürchten, dass jemand von den anderen Inseln mithörte. »Sie können mit den Dingern umgehen?«
»Ich denke schon. Was genau soll ich damit anfangen?«
»Sie warten hier, bis ich zurückkomme. Ich gehe davon aus, dass ich Clavain mitbringe. Aber falls er vor mir hier auftauchen sollte, sagen Sie ihm, wer Sie sind und wer Sie geschickt hat. Dann rufen Sie mich an und fragen Clavain, ob er mit mir sprechen möchte. Kapiert?«
»Und wenn Sie nicht wiederkommen?«
»Dann melden Sie sich am besten bei Blood.«
Vasko betastete das Armband. »Das hört sich so an, als machten Sie sich Sorgen um seinen Geisteszustand, Sir. Glauben Sie, er könnte gefährlich sein?«
»Das hoffe ich sogar«, antwortete Scorpio, »denn wenn er nicht gefährlich ist, nützt er uns nicht viel.« Er klopfte dem jungen Mann auf die Schulter. »Sie warten hier, während ich die Insel umrunde. Es dauert höchstens eine Stunde. Wahrscheinlich finde ich ihn irgendwo am Meer.«
Scorpio breitete seine Stummelarme aus, um das Gleichgewicht zu halten, und schritt über die flachen, felsigen Strände der Insel. Ob er dabei unbeholfen oder gar komisch aussah, war ihm egal.
Als er vor sich im immer dichter werdenden Abendnebel eine Gestalt zu erkennen glaubte, wurde er langsamer und kniff die Augen zusammen. Er sah nicht mehr so gut wie damals in seiner Jugend in Chasm City. Einerseits hoffte er, die Erscheinung möge sich als Clavain herausstellen. Doch zugleich wünschte er sich, sie wäre nur ein Hirngespinst, eine optische Täuschung, entstanden durch das Zusammenspiel von Felsen, Licht und Schatten.
Er hatte Angst, obwohl er es nur ungern zugab. Seit er Clavain zum letzten Mal gesehen hatte, waren sechs Monate vergangen. Eigentlich keine lange Zeit, schon gar nicht im Verhältnis zum bisherigen Leben des Mannes. Dennoch wurde Scorpio das Gefühl nicht los, dass ihm eine Begegnung mit einem Menschen bevorstand, den er seit Jahrzehnten nicht mehr getroffen hatte und der von der Zeit und vom Leben bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden war. Was würde er tun, falls er erkennen müsste, dass Clavain tatsächlich den Verstand verloren hatte? Würde er es überhaupt erkennen? Scorpio hatte so lange unter Standardmenschen gelebt, dass er ziemlich sicher war, ihre Absichten, ihre Stimmungen und ihre allgemeine geistige Verfassung richtig einschätzen zu können. Die Unterschiede im Denken von Menschen und Hyperschweinen waren angeblich gar nicht so groß. Aber wenn es um Clavain ging, nahm Scorpio sich jedes Mal wieder vor, alle Erwartungen auszuschalten. Clavain war anders als andere Menschen. Die Geschichte hatte ihn geprägt und zu einem einmaligen Wesen, womöglich sogar zu einem Ungeheuer gemacht.
Scorpio war fünfzig Jahre alt. Er kannte Clavain, seit er vor einem halben Leben von dessen früherer Partei im Yellowstone-System gefangen genommen worden war. Clavain hatte den Synthetikern wenig später den Rücken gekehrt, und nachdem auf beiden Seiten etliche Vorbehalte ausgeräumt worden waren, hatten er und Scorpio schließlich begonnen, für dieselbe Sache zu kämpfen. Mithilfe einer Horde von Soldaten und verschiedenen zwielichtigen Existenzen aus dem Dunstkreis von Yellowstone hatten sie ein Schiff gestohlen, um damit ins Resurgam-System zu fliegen. Auf dem Weg dorthin waren sie von Clavains ehemaligen Synthetikergenossen unentwegt verfolgt und angegriffen worden. Von Resurgam waren sie dann – mit einem ganz anderen Schiff – hierher auf den blaugrünen Wasserplaneten Ararat gekommen. Seit dem Aufbruch von Resurgam hatten die beiden kaum noch Kämpfe zu bestehen gehabt, hatten aber beim Aufbau der zeitlich befristeten Kolonie auch weiterhin zusammengearbeitet.
Mit sorgfältiger Planung hatten sie ganze Gemeinden ins Leben gerufen. Wenn es dabei zum Streit gekommen war, dann immer nur in wirklich wichtigen Dingen. Sobald einer von beiden zu hart oder zu weich werden wollte, war der andere zur Stelle und sorgte für den nötigen Ausgleich. Diese Jahre hatten Scorpios Charakter so weit gestärkt, dass er aufhörte, die Menschen mit jedem Atemzug zu hassen. Allein schon deshalb stand er in Clavains Schuld.
Nur war die Welt leider nicht so einfach.
Schließlich war Clavain vor fünfhundert Jahren geboren worden und hatte den größten Teil dieser Zeit bei vollem Bewusstsein durchlebt. Wenn nun der Clavain, wie ihn Scorpio und übrigens auch die meisten Kolonisten kannten, nur eine Übergangsphase wäre, ein kurzer, trügerischer Sonnenstrahl an einem ansonsten stürmischen Tag? Zu Anfang ihrer Bekanntschaft hatte Scorpio ihn stets mit halbem Auge beobachtet, um einen etwaigen Rückfall in die Haltung des gewissenlosen Schlächters sofort zu erkennen. Aber er hatte nicht nur nichts Verdächtiges bemerkt, sondern mehr als genügend Hinweise darauf erhalten, dass Clavain zu Unrecht als Monstrum in die Geschichte eingegangen war.
Doch in den letzten zwei Jahren war ihm diese Gewissheit unter den Fingern zerronnen. Clavain war nicht etwa grausamer, streitsüchtiger oder gewalttätiger geworden, aber er hatte sich unzweifelhaft verändert. Es war, als zeigte sich eine Landschaft von einem Augenblick zum anderen in einem neuen Licht. Scorpio wusste zwar, dass von anderer Seite ähnliche Zweifel an seiner eigenen Stabilität gehegt wurden, aber das war ihm nur ein schwacher Trost. Er kannte seinen eigenen Geisteszustand und durfte hoffen, dass er nie wieder einen Menschen so verletzen würde, wie er es in der Vergangenheit getan hatte. Aber was im Kopf seines Freundes vorging, konnte er nur vermuten. Sicher war lediglich, dass der Clavain, den er kannte, der Clavain, an dessen Seite er gekämpft hatte, sich ganz in sich zurückgezogen hatte und in einer Welt lebte, zu der er niemandem Zugang gewährte. Schon bevor er sich auf dieser Insel verschanzt hatte, war Scorpio an einen Punkt gelangt, wo er den Mann kaum noch verstand.
Aber er machte dafür nicht Clavain verantwortlich. Das hätte niemand getan.
Er setzte seinen Weg fort, bis er sicher sein konnte, dass die Gestalt Wirklichkeit war, dann ging er weiter, bis er Einzelheiten unterscheiden konnte. Die Gestalt kauerte so reglos am Meeresufer, als hätte sie sich in einen Traum verirrt, während sie nichts ahnend die Fauna in einem der Gezeitentümpel beobachtete.
Es war Clavain. Scorpio hätte ihn auch dann sofort erkannt, wenn er die Insel für unbewohnt gehalten hätte.
Das Schwein atmete auf. Wenigstens war sein Freund noch am Leben. Das zählte zunächst einmal als Sieg, was immer dieser Tag noch bringen mochte.
Als er auf Rufweite herangekommen war, spürte Clavain seine Gegenwart und sah sich um. Nach Scorpios Landung war ein heftiger Wind aufgekommen, der dem alten Mann das lange weiße Haar in das leicht gerötete Gesicht wehte. Der sonst so stets sauber gestutzte Bart war in der Zwischenzeit ebenfalls gewachsen und wirkte ungepflegt. Die dürre Gestalt steckte in einem schwarzen Anzug und hatte ein dunkles Tuch oder einen Mantel um die Schultern. Clavain stand in unbequemer Haltung da, die Knie gebeugt, in den Hüften abknickend, als hätte er nur kurz innegehalten.
Scorpio war überzeugt, dass er seit Stunden so auf das Meer hinausstarrte.
»Nevil«, sagte er.
Clavain bewegte die Lippen, aber das Zischen der Brandung übertönte seine Stimme.
»Ich bin es – Scorpio«, rief ihm das Schwein zu.
Wieder setzte Clavain zum Sprechen an. Seine Stimme klang wie eingerostet, kaum mehr als ein Flüstern. »Ich sagte doch, ich will nicht, dass du hierher kommst.«
»Ich weiß.« Scorpio war näher getreten. Immer wieder wehte der Wind das Haar in diese Greisenaugen, die so tief in ihren Höhlen lagen und so trostlos ins Nichts starrten. »Ich weiß, und wir haben deine Bitte immerhin sechs Monate lang respektiert.«
»Sechs Monate?« Das war fast ein Lächeln. »So lange ist es schon her?«
»Sechs Monate und eine Woche, wenn du es genau wissen willst.«
»Das hätte ich nicht gedacht. Mir kommt es vor, als wäre es erst gestern gewesen.« Clavain drehte den Kopf und schaute wieder aufs Meer hinaus. Die Kopfhaut unter dem schütteren weißen Haar hatte den gleichen rosaroten Farbton wie Scorpios Schwarte.
»Manchmal kommt es mir auch sehr viel länger vor«, fuhr er fort. »So als hätte ich nie etwas anderes getan, als meine Tage hier zu verbringen. Manchmal ist es, als gäbe es auf dem ganzen Planeten keine Menschenseele außer mir.«
»Wir sind aber noch da«, sagte Scorpio. »Alle einhundertsiebzigtausend. Und wir brauchen dich nach wie vor.«
»Ich hatte ausdrücklich verlangt, nicht gestört zu werden.«
»Außer in wichtigen Fällen. So war es vereinbart, Nevil.«
Clavain stand quälend langsam auf. Er war immer größer gewesen als Scorpio, doch jetzt wirkte die hagere Gestalt wie eine flüchtig an den Himmel geworfene Skizze, die Arme und Beine nur mit schrägen Strichen andeutete.
Scorpio betrachtete Clavains Hände, die so feingliedrig waren wie die eines Chirurgen. Oder vielleicht eines Vernehmungsbeamten. Die langen Fingernägel kratzten mit einem Geräusch über den feuchten schwarzen Stoff der Hose, das dem Schwein durch Mark und Bein ging.
»Und?«
»Wir haben etwas gefunden«, sagte Scorpio. »Wir wissen nicht genau, was es ist, oder wer es geschickt hat, aber wir glauben, dass es aus dem Weltraum kommt. Und wir vermuten, dass jemand darin sein könnte.«
Generalmedikus Grelier schritt durch die kreisrunden, grün erleuchteten Flure der Körperzuchtanlage.
Er summte und pfiff vor sich hin. Hier war er in seinem Element. Inmitten von brummenden Maschinen und halb fertigen Menschen fühlte er sich am wohlsten. Ein erwartungsvoller Schauer überfiel ihn, wenn er an das Sonnensystem dachte, das vor ihnen lag. Von diesem System hing so viel ab – nicht unbedingt für ihn selbst, aber doch für seinen Nebenbuhler um die Gunst der Königin. Grelier suchte sich vorzustellen, wie sie es aufnehmen würde, wenn Quaiche ein weiteres Mal versagte. Wie er Königin Jasmina kannte, sicherlich nicht allzu gnädig.
Der Gedanke entlocke ihm ein Lächeln. Seltsam war, dass ein System, auf dem so viele Hoffnungen ruhten, noch immer keinen Namen hatte; niemand hatte sich bisher um die abgelegene Sonne und ihre Brut von unscheinbaren Planeten gekümmert. Was hätte man auch für eine Veranlassung gehabt? Sicherlich war das System in den Astrogations-Datenbanken der Gnostische Himmelfahrt und so gut wie aller anderen interstellaren Raumschiffe irgendwo eingetragen, nebst einigen knappen Anmerkungen zum Typ seiner Sonne, den wichtigsten Eigenschaften seiner Welten, zu erwartenden Risiken und so weiter. Aber diese Datenbanken waren nicht für menschliche Augen bestimmt; sie wurden lediglich von anderen Maschinen abgefragt und aktualisiert, die lautlos und schnell alle für die Menschen zu langweiligen oder zu schwierigen Schiffsaufgaben erledigten. Der Eintrag bestand nur aus einer Kette von Binärzahlen, ein paar tausend Einsen und Nullen. Er war in der gesamten Fluggeschichte der Gnostischen Himmelfahrt nicht mehr als dreimal aufgerufen und ein einziges Mal aktualisiert worden, schon daran zeigte sich, wie unbedeutend das System war.
Grelier wusste das. Er hatte nachgesehen, aus reiner Neugier.
Und nun gab es vielleicht zum ersten Mal überhaupt jemanden, der sich nicht nur flüchtig für das System interessierte. Einen Namen hatte es zwar immer noch nicht, aber das wurde inzwischen immerhin als so störend empfunden, dass Königin Jasminas Stimme jedes Mal etwas gereizter klang, wenn sie sich gezwungen sah, von ›dem System vor uns‹ oder ›dem System, auf das wir zufliegen‹ zu sprechen. Dennoch würde sie sich nicht herbeilassen, einen Namen zu vergeben, bevor sich das Ziel als lohnend herausgestellt hätte. Und die Entscheidung darüber lag ausschließlich in den Händen von Quaiche, dessen Stern als Favorit der Königin im Sinken begriffen war.
Grelier blieb vor einem der Vivifikationstanks stehen. Hinter der grünen Glaswand schwebte, gestützt von durchsichtigem Polstergel, ein Körper. Am Tanksockel reihten sich Nährstoffventile wie Orgelregister aneinander, einige waren hineingeschoben, andere herausgezogen. Mit diesen Schiebern wurde die empfindliche biochemische Umgebung der Nährstoffmatrix gesteuert. Seitlich angebrachte Ventilräder aus Bronze regulierten die Zufuhr von Massenchemikalien wie Wasser oder Salzlösung.
Am Tank hing das Protokoll der Klongeschichte des Körpers. Grelier blätterte die laminierten Seiten durch und überzeugte sich, dass alles in Ordnung war. Die meisten Körper in der Anlage waren nie dekantiert worden, aber dieses Exemplar – erwachsen und weiblich – hatte man bereits einmal aufgewärmt und verwendet. Dank der Regenerationsverfahren waren die Verletzungen, die man ihm dabei zugefügt hatte, bereits am Verschwinden, die Wunden im Bauchbereich verheilten glatt, und das neue Bein war nur noch wenig kürzer als sein heil gebliebenes Gegenstück. Jasmina hielt nicht viel von zusammengeflickten Körpern, aber ihr Verbrauch war inzwischen so hoch, dass die Anlage mit der Produktion nicht mehr nachkam.
Grelier strich liebevoll über das Glas. »Sehr schön. Weiter so.«
Auch bei den anderen Körpern führte der Generalmedikus stichprobenartige Kontrollen durch. Manchmal genügte ihm ein Blick, doch meistens blätterte er das Protokoll durch und nahm kleinere Korrekturen an den Einstellungen vor. Er war sehr stolz darauf, seine Arbeit mit der Ruhe des Fachmanns zu erledigen. Er prahlte nie mit seinen Fähigkeiten, und er machte keine Zusagen, wenn er nicht ganz sicher war, dass er sie auch einhalten konnte – ganz anders als Quaiche, der das Blaue vom Himmel versprach, seit er die Gnostische Himmelfahrt betreten hatte.
Zunächst hatte er damit auch Erfolge erzielt. Grelier, seit langem der engste Vertraute der Königin, hatte erleben müssen, wie ihm dieser Windbeutel gleich nach seiner Ankunft den Rang ablief. Wenn er sie in Arbeit hatte, schwärmte sie nur noch davon, wie Quaiche ihrer aller Schicksal verändern würde: Quaiche hin und Quaiche her. Sie hatte sogar angefangen, Greliers Leistungen zu bemängeln – der Ausstoß an neuen Körpern sei zu langsam, und die Wirksamkeit der Behandlung gegen das Aufmerksamkeitsdefizit lasse zusehends nach. Grelier hatte bereits überlegt, irgendeine wahrhaft spektakuläre Tat zu begehen, um sie auf sich aufmerksam zu machen und sich ihre Gunst zurückzuerobern.
Jetzt war er froh, dass er dieser Versuchung widerstanden hatte. Er hatte nur etwas Geduld gebraucht. Quaiche schaufelte sich sein eigenes Grab, indem er Erwartungen weckte, die er unmöglich erfüllen konnte. Bedauerlicherweise – für Quaiche, wenn auch nicht für Grelier – hatte ihn Jasmina unerbittlich beim Wort genommen. Wenn Grelier die Königin richtig einschätzte, dann stand der arme alte Quaiche ganz kurz davor, als Galionsfigur zu enden.
Grelier kam nun zu einem männlichen Erwachsenen, bei dem ihm während der letzten Untersuchung gewisse Entwicklungsstörungen aufgefallen waren. Er hatte die Einstellungen des Tanks korrigiert, aber damit wohl nichts bewirkt. Für einen Laien sah der Körper ganz normal aus, aber er ließ die vollkommene Symmetrie vermissen, nach der Jasmina geradezu süchtig war. Grelier schüttelte den Kopf und fasste nach einem der blanken Ventilräder. Die Entscheidung war wie immer schwierig. Der Körper blieb hinter den üblichen Qualitätsmaßstäben zurück, aber das galt auch für die Geflickten. War dies der Zeitpunkt, um Jasmina von einer Senkung der Standards zu überzeugen? Schließlich war sie es, die die Anlage bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit strapazierte.
Nein, entschied Grelier. Wenn er aus dieser ganzen schäbigen Quaiche-Geschichte eine Lehre gezogen hatte, dann die, dass man von seinen Standards nicht abgehen sollte. Jasmina würde sich empören, wenn er einen Körper sterben ließe, aber langfristig würde sie seinem Urteil, seinem unerschütterliches Festhalten an erstklassiger Arbeit die Achtung nicht versagen.
Er blockierte die Salzlösungszufuhr, indem er das Messingrad zudrehte. Dann kniete er nieder und schob die meisten Nährstoffventile hinein.
»Tut mir Leid«, sagte er zu dem glatten, ausdruckslosen Gesicht hinter dem Glas, »aber du warst einfach nicht gut genug.«
Er warf einen letzten Blick auf den Körper. In wenigen Stunden würden die grotesken Folgen des Zellabbaus für jedermann sichtbar sein. Man würde den Körper in seine chemischen Bestandteile zerlegen und diese innerhalb der Anlage anderweitig wieder verwenden.
Sein Kopfhörer vibrierte. Er legte einen Finger an die Muschel. Eine Stimme ließ sich vernehmen.
»Grelier … ich hatte Sie bereits erwartet.«
»Ich bin schon unterwegs, Madame.«
Auf dem Vivifikationstank begann ein rotes Licht zu blinken, gleichzeitig heulte eine Sirene auf. Mit einem Schlag auf die Handsteuerung schaltete Grelier Sirene und Blinklicht ab. In der Körperzuchtanlage kehrte Ruhe ein. Nur gelegentlich gluckerte es in einer Nährstoffleitung, oder ein Ventil schloss sich mit leisem Klicken.
Grelier nickte zufrieden. Alles war unter Kontrolle. Gemächlich setzte er seinen Weg fort.
Im gleichen Augenblick, in dem Grelier das letzte Nährstoffventil schloss, verzeichneten die Sensoren der Gnostische Himmelfahrt eine Anomalie. Sie dauerte nur etwas mehr als eine halbe Sekunde, war aber so ungewöhnlich, dass im Datenstrom ein Merker gesetzt wurde: ein Signal, das auf ein besonderes Ereignis hinwies.
Für die Sensorsoftware war die Sache damit erledigt: Die Anomalie hatte sich nicht weiter ausgebreitet, alle Systeme arbeiteten wieder normal. Der Merker war eine reine Formalität; ob eine Reaktion darauf erfolgen sollte, wurde auf einer anderen Ebene von einer etwas intelligenteren Monitorsoftware entschieden.
Diese zweite Schicht – sie hatte die Aufgabe, die Funktion aller schiffsweit aktiven Sensor-Subsysteme zu überwachen – registrierte den Merker zusammen mit mehreren Millionen anderen, die im gleichen Zyklus gesetzt worden waren, und wies ihm eine Klassifizierung in ihrem Aufgabenprofil zu. Seit dem Ende der Anomalie waren knapp zwei hunderttausendstel Sekunden vergangen: für Rechnerverhältnisse eine Ewigkeit, aber bei der Ausdehnung des cybernetischen Nervensystems eines Lichtschiffs unvermeidlich. Jedes Signal hatte von einem Ende der Gnostische Himmelfahrt zum anderen drei bis vier Kilometer Kabel durch den Hauptrumpf zu überwinden, hin und zurück sogar sechs bis sieben Kilometer.
Auf einem Schiff dieser Größe ging alles langsam, aber das war nicht weiter von Belang. Dank seiner riesigen Masse reagierte ein Lichtschiff ohnehin nur träge auf äußere Reize: Blitzschnelle Reflexe brauchte es ebenso wenig wie ein Brontosaurus.
Die Monitorschicht arbeitete den Stapel ab.
Sie überprüfte mehrere Millionen Ereignisse, von denen die meisten harmlos waren. Die eingebaute Wahrscheinlichkeitsstruktur erlaubte ihr, die meisten Merker ohne Zögern zu deaktivieren. Sie verwiesen auf vorübergehende Störungen, die nicht auf gravierende Hardwareprobleme schließen ließen. Nur etwa hunderttausend waren ansatzweise verdächtig.
An dieser Stelle verfuhr die zweite Ebene wie immer: Sie fasste die hunderttausend anomalen Ereignisse zu einem Paket zusammen, fügte ihre eigenen Anmerkungen und vorläufigen Erkenntnisse hinzu und schickte das Ganze an die Monitorsoftware der dritten Ebene.
Diese Softwareschicht hatte die meiste Zeit gar nichts zu tun: Sie war nur dazu da, die Anomalien zu studieren, die von den weniger intelligenten Schichten an sie weitergeleitet wurden. Nachdem sie geweckt worden war, widmete sie dem Dossier gerade so viel Aufmerksamkeit, wie ihr elementares Bewusstsein aufzubringen vermochte. Für eine Maschinenintelligenz stand sie noch unterhalb der Gammastufe, aber sie verrichtete diese Aufgabe schon so lange, dass sie einen riesigen Schatz an heuristischer Erfahrung angesammelt hatte. So fand sie es kränkend offensichtlich, dass mehr als die Hälfte der Ereignisse ihrer Beachtung in keiner Weise würdig waren. Die restlichen Fälle waren allerdings interessanter, und sie nahm sich die Zeit, sie genauer zu betrachten. Zwei Drittel dieser Anomalien waren schon öfter aufgetreten: Sie gingen auf Systeme zurück, die tatsächlich unter wenn auch nur vorübergehenden Störungen litten. Doch da keines dieser Systeme etwas mit kritischen Funktionen des Schiffes zu tun hatte, konnte man in aller Ruhe abwarten, bis sich die Störungen verschlimmerten.
Bei einem Drittel der interessanten Fälle handelte es sich um neue. In etwa neunzig Prozent davon wusste die Software, dass bei den betroffenen Bauteilen und der Programmierung solche Fehler hin und wieder zu erwarten waren. Nur eine Hand voll davon bezog sich auf potenziell kritische Bereiche, und diese Ausfälle ließen sich samt und sonders mit routinemäßigen Reparaturverfahren beheben. Die Schicht schickte unverzüglich entsprechende Anweisungen an die Instanzen, die für die Wartung der Infrastruktur zuständig waren.
So gelangten neue Einträge in die Pufferspeicher von Servomaten, die bereits an verschiedenen Orten innerhalb des Schiffes mit anderen Reparatur- und Wartungsaufgaben betraut waren. Es mochte Wochen dauern, bis diese Arbeiten an die Reihe kamen, aber irgendwann würden sie erledigt werden.
Damit blieb ein kleiner Restbestand von Fehlern, die potenziell bedenklich waren. Sie waren nicht so einfach zu erklären, und die Schicht wusste auch nicht sofort, welche einschlägigen Befehle sie an die Servomaten absetzen sollte. Aber sie war nicht übermäßig beunruhigt, soweit sie zu solchen Regungen überhaupt fähig war: Sie wusste aus Erfahrung, dass solche Macken im Allgemeinen nicht bösartig waren. Dennoch blieb ihr nichts anderes übrig, als die rätselhaften Ausnahmen an die nächsthöhere Schicht der Bordsoftware zu verweisen.
So wurde auch die Anomalie durch drei zunehmend intelligentere Schichten nach oben weitergereicht.
Als die letzte Schicht geweckt wurde, befand sich nur noch ein auffälliges Ereignis in dem Paket: die ursprüngliche Sensoranomalie, die nach etwas mehr als einer halben Sekunde wieder verschwunden war. Keine der unteren Schichten hatte den Fehler mithilfe der gängigen Statistiken und Suchvorschriften aufzuklären vermocht.
Dass sich ein Ereignis so weit nach oben vorarbeitete kam nur ein- bis zweimal pro Minute vor.
Nun wurde zum ersten Mal eine echte Intelligenz mobilisiert. Die Gamma-Persönlichkeit, der die Überwachung von Ausnahmen der sechsten Schicht oblag, war Teil der letzten Verteidigungslinie zwischen der Cybernetik und der lebendigen Schiffsbesatzung. Sie hatte die schwierige Entscheidung zu treffen, ob ein Fehler schwer wiegend genug war, um einem der menschlichen Inspektoren vorgelegt zu werden. Im Laufe der Jahre hatte sie gelernt, nicht allzu oft Alarm zu schlagen: Ihre Herren bekämen sonst womöglich den Eindruck, es wäre Zeit für ein Upgrade. So zauderte die Unterpersönlichkeit etliche Sekunden, bis sie zu einem Entschluss kam.
Schließlich erklärte sie die Anomalie zu einem der seltsamsten Fälle in ihrer Geschichte. Auch eine eingehende Überprüfung sämtlicher Logikpfade im System lieferte keine Erklärung für eine so vollkommen und radikal außergewöhnliche Erscheinung.
Um effektiv arbeiten zu können, brauchte die Unterpersönlichkeit eine abstrakte Vorstellung von der realen Welt. Das Modell durfte nicht zu komplex sein, musste sie aber befähigen, angemessen zu beurteilen, was die Sensoren an externen Phänomenen erwarten konnten und was so drastisch unwahrscheinlich war, dass es als Halluzination interpretiert werden musste, die erst in einer späteren Phase in die Datenverarbeitung eingeflossen war. Sie musste die Gnostische Himmelfahrt als physisches, im Raum eingebettetes Objekt begreifen. Sie musste verstehen, dass die von den Schiffssensoren aufgezeichneten Ereignisse von Objekten und Quanten im gleichen Raum ausgelöst wurden: von Staubkörnern, Magnetfeldern und den Radarechos von näheren Himmelskörpern, sowie von der Strahlung weiter entfernter Welten, Sterne, Galaxien oder Quasare, dem kosmischen Hintergrundgeräusch. Dazu musste sie präzise abschätzen können, wie die Daten auszusehen hatten, die sie von solchen Objekten empfing. Diese Vorschriften hatte niemand für sie aufgestellt: Sie hatte sie im Lauf der Zeit selbst formuliert und mithilfe jeweils neuer Informationen korrigiert. Es war ein Verfahren, das niemals abgeschlossen werden konnte, doch sie trieb das Spiel nun schon so lange, dass sie sich als wahren Meister betrachtete.
Zum Beispiel wusste sie, dass Planeten – oder vielmehr die entsprechenden abstrakten Objekte in ihrem Modell – sich keinesfalls so verhielten. Bei einem Ereignis der äußeren Welt war ein solcher Fehler vollkommen unerklärlich. Das bedeutete, dass bei der Datenerfassung etwas schief gelaufen sein musste.
Die Persönlichkeit verfolgte diesen Ansatz noch ein wenig weiter. Auch damit war die Anomalie nur schwer zu erklären. Sie war ungemein selektiv, nur der Planet selbst war davon betroffen. Nichts sonst, nicht einmal seine Monde, war auch nur im Geringsten von der Normalität abgewichen.
Die Unterpersönlichkeit änderte ihre Meinung: Die Anomalie musste von außen kommen, und daraus folgte, dass ihr eigenes Modell der realen Welt schockierend fehlerhaft war. Auch dieses Ergebnis gefiel ihr nicht. Sie hatte schon sehr lange keinen zwingenden Grund mehr gesehen, das Modell so drastisch zu revidieren, und war über eine solche Zumutung empört.
Außerdem konnte sie auf Grund dieser Beobachtung nicht ausschließen, dass für die Gnostische Himmelfahrt selbst … nun ja, nicht gerade Gefahr im Verzug war – der fragliche Planet war immer noch Dutzende von Lichtstunden entfernt –, aber dass sich das Lichtschiff womöglich auf einem Kurs befand, auf dem irgendwann in der Zukunft mit nicht unerheblichen Risiken gerechnet werden musste.
Das gab den Ausschlag. Die Unterpersönlichkeit traf eine Entscheidung: In diesem Fall hatte sie keine andere Wahl. Sie musste die Besatzung informieren.
Und das konnte nur eines bedeuten: eine Direktbotschaft an Königin Jasmina.
Die Unterpersönlichkeit stellte fest, dass die Königin derzeit auf dem von ihr bevorzugten Betrachtungsmedium Statusberichte abrief. Es übernahm kraft ihrer Vollmacht die Kontrolle über die Datenleitung und löschte beide Bildschirme für eine Notfallmeldung.
Dann formulierte sie einen einfachen Text: SENSOR-ANOMALIE : ERBITTE ANWEISUNG.
Die Nachricht flimmerte nur für einen Moment – deutlich kürzer als das ursprüngliche Ereignis, das immerhin eine halbe Sekunde gedauert hatte – über die Bildschirme der Königin und forderte ihre Aufmerksamkeit.
Dann besann sich die Unterpersönlichkeit hastig eines Besseren.
Vielleicht war es doch ein Fehler. Die Anomalie war zwar unerklärlich gewesen, aber sie hatte sich von selbst behoben. Die tieferen Schichten hatten keine weiteren ungewöhnlichen Beobachtungen gemeldet. Der Planet benahm sich genau so, wie es sich in den Augen der Unterpersönlichkeit gehörte.
Nach einer weiteren Bedenkzeit gelangte sie endlich zu dem Schluss, das Ereignis ließe sich als Wahrnehmungsstörung interpretieren. Es genügte, alles noch einmal durchzugehen, alle Einzelheiten aus der richtigen Perspektive zu betrachten und nicht nur in eingefahrenen Bahnen zu denken. Als Unterpersönlichkeit war genau das ihre Aufgabe. Wenn sie jede Anomalie, die sie nicht sofort erklären konnte, blindlings weitergäbe, könnte die Besatzung sie ja auch durch eine Softwareschicht ohne eigene Intelligenz ersetzen. Oder, schlimmer, durch ein klügeres Upgrade.
Sie löschte den Text vom Bildschirm und ersetzte ihn durch die Daten, die sich die Königin zuvor angesehen hatte.
Dann schlug sie sich weiter mit dem Problem herum, bis man ihr etwa eine Minute später eine neue Anomalie in den Postkasten warf. Diesmal ging es um eine winzige Schubschwankung von einem Prozent im steuerbordseitigen Synthetikertriebwerk. Damit hatte sie einen reizvollen neuen Notfall zu bearbeiten und konnte die Planetenfrage vorerst zurückstellen. Eine Minute war selbst für ein Schiff mit derart langsamen Nachrichtenverbindungen eine lange Zeit. Mit jeder weiteren Minute, die verging, ohne dass sich der Planet daneben benähme, musste die lästige Geschichte zwangsläufig an Dringlichkeit verlieren.
Die Unterpersönlichkeit würde sie nicht vergessen – dazu wäre sie gar nicht fähig –, aber es gab in der nächsten Stunde sicherlich zahllose andere Dinge zu erledigen.
Gut. Die Entscheidung war gefallen. Man würde so tun, als wäre überhaupt nichts passiert.
So kam es, dass Königin Jasmina nur einen Sekundenbruchteil lang über die Sensoranomalie informiert wurde. Und so kam es, dass kein menschliches Besatzungsmitglied der Gnostische Himmelfahrt – weder Jasmina, noch Grelier, Quaiche oder irgendein anderer Ultra – jemals erfuhr, dass der größte Gasriese des Systems, das sie ansteuerten, des Systems mit dem fantasielosen Namen 107 Piscium, mehr als eine halbe Sekunde lang einfach aufgehört hatte zu existieren.
Königin Jasmina hörte die Schritte des Generalmedikus auf dem Metallboden des Korridors, der ihren Kommandoraum mit dem Rest des Schiffes verband. Grelier vermittelte wie immer den Eindruck, es nicht sonderlich eilig zu haben. Ob sie seine Loyalität zu sehr strapaziert hatte, als sie Quaiche umschmeichelte ? Möglich wäre es. Und in diesem Fall wäre es vermutlich Zeit, Grelier wieder einmal zu zeigen, wie sehr sie ihn schätzte.
Ein Flackern auf den Anzeigeschirmen des Schädels erregte ihre Aufmerksamkeit. Die Berichte, die sie durchblätterte, verschwanden und wurden für einen Moment durch eine Textzeile ersetzt – irgendetwas von einer Sensoranomalie.
Königin Jasmina schüttelte den Schädel. Sie war ohnehin überzeugt, dass das grässliche Ding besessen war, aber jetzt wurde es offenbar auch noch senil. Sie hätte es am liebsten fortgeworfen, aber sie war abergläubisch, und angeblich waren noch jedem, der den Rat des Schädels missachtete, schreckliche Dinge zugestoßen.
Jemand klopfte höflich an die Tür.
»Herein, Grelier.«
Die Panzertür schob sich auf. Grelier trat in den Raum. Seine weit aufgerissenen Augen leuchteten weiß, bis sie sich auf das Halbdunkel eingestellt hatten. Grelier war schlank und wirkte stets adrett. Sein dichtes schlohweißes Haar war am Oberkopf zu einer ebenen Fläche geschoren. Die Züge waren platt und wenig ausgeprägt wie bei einem Boxer. Er trug einen sauberen weißen Arztkittel und eine Schürze; die Hände steckten wie immer in Handschuhen. Seinen Gesichtsausdruck fand Jasmina jedes Mal wieder komisch: Er schien jeden Moment in Tränen oder in Gelächter ausbrechen zu wollen. Doch das täuschte: Der Generalmedikus neigte nicht zu extremen Gefühlsäußerungen.
»Viel zu tun in der Körperzucht, Grelier?«
»Könnte man sagen, Madame.«
»Ich rechne mit einem Nachfrageschub. Die Produktion muss unvermindert fortgesetzt werden.«
»In diesem Punkt kann ich Sie beruhigen.«
»Ich wollte es nur klarstellen.« Sie seufzte. »Genug geplaudert. An die Arbeit.«
Grelier nickte. »Sie haben bereits angefangen, wie ich sehe.«
Während sie auf ihn wartete, hatte sie sich am Thron festgeschnallt. Knöchel und Oberschenkel wurden von Lederriemen gehalten, um den Bauch lag ein breites Band, der rechte Arm war an der Armlehne fixiert, nur der linke Arm war noch frei. Mit der linken Hand hielt sie den Schädel so, dass er ihr das Gesicht zuwandte und sie die Anzeigeschirme sehen konnten, die aus den Augenhöhlen quollen. Bevor sie nach dem Schädel griff, hatte sie den rechten Arm in einen rauen schwarzen Eisenkäfig geschoben, der seitlich an die Armlehne geschraubt war. Im Innern dieses so genannten Schmerzminderers befanden sich mehrere mit Schrauben verstellbare Platten, die sich schon jetzt unangenehm fest an ihre Haut pressten.
»Tun Sie mir weh«, befahl die Königin.
Über Greliers Gesicht huschte der Schatten eines Lächelns. Er trat an den Thron und prüfte die Einstellung des Schmerzminderers. Dann zog er eine Schraube nach der anderen um genau eine Vierteldrehung an. Die Platten pressten sich fester auf den Unterarm der Königin, der seinerseits auf fest montierten Tafeln lag. Grelier betätigte die Schrauben des Foltergeräts mit so liebevoller Sorgfalt, als stimme er ein Saiteninstrument.
Es war nicht angenehm. Aber das war so gewollt.
Nach etwa einer Minute hielt Grelier inne und trat hinter den Thron, wo er einen kleinen Sanitätskasten aufbewahrte. Jasmina sah zu, wie er eine Rolle Schlauch herausnahm und ein Ende in einer übergroßen Flasche mit strohgelber Flüssigkeit versenkte. Das andere Ende steckte er auf eine Injektionsspritze. Dabei summte und pfiff er vor sich hin. Die Flasche hängte er an einen Haken an der Rückseite des Throns, die Injektionsnadel stieß er der Königin in den rechten Oberarm und bewegte sie so lange hin und her, bis er die Vene gefunden hatte. Dann kam er wieder nach vorne, wo auch der Körper ihn sehen konnte.
Es war ein weiblicher Klon, aber das war nicht zwangsläufig so. Obwohl alle Körper aus Jasminas eigenem Genmaterial gezüchtet wurden, konnte Grelier in einem frühen Entwicklungsstadium eingreifen und das Geschlecht beliebig verändern. Gewöhnlich schuf er Jungen oder Mädchen. Doch hin und wieder gönnte er sich das Vergnügen, abstruse Neutren oder zwischengeschlechtliche Varianten entstehen zu lassen. Steril waren sie alle, aber nur deshalb, weil es zu viel Zeit gekostet hätte, sie mit funktionsfähigen Fortpflanzungsorganen auszustatten. Der Einbau der neuronalen Kopplungsimplantate, die Jasmina benötigte, um die Körper steuern zu können, war schon aufwändig genug.
Die Königin spürte, wie der Schmerz plötzlich nachließ. »Ich will keine Betäubung, Grelier.«
»Schmerz, der nicht gelegentlich abflaut, ist wie Musik ohne Pausen«, entgegnete er. »Sie müssen mir vertrauen, das haben Sie bisher doch immer getan.«
»Ich vertraue Ihnen, Grelier«, sagte sie widerwillig.
»Aufrichtig, Madame?«
»Ja. Aufrichtig. Sie waren immer mein Favorit. Das wissen Sie doch?«
»Ich tue nur meine Arbeit, Madame. Und ich bemühe mich, sie so gut zu tun, wie es in meinen Kräften steht.«
Die Königin legte den Schädel in ihren Schoß und fuhr ihm mit der freien Hand durch die weißen Stoppeln.
»Ohne Sie wäre ich verloren. Gerade jetzt.«
»Unsinn, Madame. Ihr Wissen ist inzwischen so umfassend, dass ich befürchten muss, von Ihnen überflügelt zu werden.«
Das war kein leeres Kompliment: Obwohl Grelier sein ganzes Leben der Erforschung von Schmerzen gewidmet hatte, holte Jasmina rasch auf. Sie besaß überragende Kenntnisse im Bereich der Physiologie. Sie verstand etwas von Nocizeption ; sie kannte den Unterschied zwischen epikritischen und protopathischen Schmerzen; sie wusste, was präsynaptische Blockaden und neospinale Nervenbahnen waren. Sie konnte Prostaglandin-Promotoren und GABA-Agonisten auseinander halten.
Aber sie kannte den Schmerz auch von einer Seite, die Grelier verborgen bleiben musste. Er begnügte sich damit, ihn anderen zuzufügen, er erlebte ihn nicht von innen heraus. Hier war das Objekt seiner Bemühungen im Vorteil. Er mochte noch so viel theoretisches Wissen erwerben, in diesem Punkt würde sie ihm immer voraus sein.
Wie die meisten seiner Zeitgenossen glaubte Grelier, nur das dumpfe Pochen eines eingerissenen Niednagels vertausendfachen zu müssen, um zu wissen, wie Höllenqualen sich anfühlten.
Er hatte keine Ahnung.
»Ich mag viel dazugelernt haben«, sagte sie, »aber in der Kunst des Klonens werden Sie immer der Meister bleiben. Meine Bemerkung vorhin war ernst gemeint, Grelier: Ich rechne tatsächlich mit einem Anwachsen der Nachfrage. Können Sie meinen Bedarf decken?«
»Sie sagten, die Produktion müsse unvermindert fortgesetzt werden. Das ist nicht ganz das Gleiche.«
»Aber Sie arbeiten doch im Moment nicht mit voller Leistung ?«
Grelier zog die Schrauben nach. »Ich will ganz offen sein: Wir sind hart an der Grenze. Im Augenblick bin ich noch gewillt, Einheiten auszumustern, die unseren bisherigen strengen Maßstäben nicht genügen. Aber wenn die Produktionsleistung noch gesteigert werden soll, müssen wir die Maßstäbe senken.«
»Sie haben heute eine Einheit ausgemustert?«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich nehme an, Sie wollten Ihre Qualitätsansprüche besonders deutlich machen.« Sie hob mahnend den Zeigefinger. »Ich habe nichts dagegen. Diese Haltung ist der Grund, warum Sie für mich arbeiten. Natürlich bin ich enttäuscht – ich weiß genau, welchen Körper Sie abgeschaltet haben –, aber Maßstäbe sind dazu da, um eingehalten zu werden.«
»Das war immer meine Devise.«
»Schade, dass das nicht jeder auf diesem Schiff von sich behaupten kann.«
Er summte und pfiff ein Weilchen vor sich hin, bevor er wie nebenbei bemerkte: »Ich hatte von Ihrer Mannschaft immer einen hervorragenden Eindruck, Madame.«
»Meine Stammbesatzung ist nicht das Problem.«
»Dann bezieht sich Ihre Kritik also auf jemanden, der von außerhalb kommt? Hoffentlich nicht auf mich?«
»Tun Sie nicht so, als wüssten Sie nicht ganz genau, wen ich meine.«
»Doch nicht etwa Quaiche?«
»Lassen Sie das Theater, Grelier. Ich weiß doch, wie Sie zu Ihrem Nebenbuhler stehen. Und soll ich Ihnen sagen, was daran besonders komisch ist? Sie beide haben mehr gemeinsam, als Ihnen bewusst ist. Zwei Standardmenschen, die von ihrer Kultur ausgestoßen wurden. Ich hatte große Hoffnungen in Sie beide gesetzt, aber von Quaiche muss ich mich nun wohl leider trennen.«
»Sie geben Ihm aber doch sicher eine letzte Chance, Madame ? Immerhin befinden wir uns im Anflug auf ein neues System.«
»Das hätten Sie wohl gerne? Er soll ein letztes Mal versagen, damit meine Strafe danach umso härter ausfällt?«
»Ich hatte nur das Wohl des Schiffes im Auge.«
Sie lächelte. »Aber gewiss doch, Grelier.« Seine Lügen amüsierten sie. »Nun, ich habe noch nicht entschieden, was mit Quaiche geschehen soll. Auf jeden Fall muss ich mich ernsthaft mit ihm unterhalten. Durch unsere Handelspartner sind einige neue Informationen über ihn in meine Hände gelangt, die von großem Interesse sind.«
»Was Sie nicht sagen!«, bemerkte Grelier.
»Die Angaben, die er bei seiner Einstellung über seine beruflichen Erfahrungen machte, entsprechen offenbar nicht ganz der Wahrheit. Ich hätte mich eingehender nach seinem Werdegang erkundigen müssen. Aber das ändert nichts daran, dass er zu dick aufgetragen hat, was seine früheren Erfolge betrifft. Ich wollte einen verhandlungssicheren Agenten, der sich unter planetaren Bedingungen instinktiv zu Hause fühlt. Einen Mann, der mit Standardmenschen wie mit Ultras zurechtkommt, der imstande ist, vorteilhafte Geschäfte für uns auszuhandeln und Schätze zu entdecken, auf die wir allein niemals gestoßen wären.«
»Hört sich ganz nach Quaiche an.«
»Nein, Grelier, nicht nach Quaiche, sondern nach der Persönlichkeit, die Quaiche uns vorspielte. Nach der Fiktion, die er uns präsentierte. In Wirklichkeit ist seine Karriere alles andere als beeindruckend. Hier und dort ein Treffer, aber ebenso viele Fehlschläge. Er ist ein Glücksritter: ein Prahlhans, ein Opportunist und ein Lügner. Und außerdem ist er verseucht.«
Grelier zog eine Augenbraue hoch. »Verseucht?«
»Er hat ein Indoktrinationsvirus im Blut. Wir haben die gängigen Untersuchungen durchgeführt, aber dieses Virus war nicht in unserer Datenbank, und deshalb wurde es übersehen. Zum Glück ist es nicht hochgradig ansteckend – wobei wir ohnehin kein leichtes Opfer wären.«
»Um welchen Typ von Indoktrinationsvirus handelt es sich?«
»Ein primitives Mischmasch: ein unausgegorenes Gebräu aus religiösen Symbolen der letzten dreitausend Jahre, ohne theistischen Überbau wahllos zusammengewürfelt. Es gibt ihm keinen umfassenden Glauben, sondern gaukelt nur fromme Gefühle vor. Offenbar hat er sich überwiegend unter Kontrolle. Dennoch mache ich mir Sorgen, Grelier. Was ist, wenn sich sein Zustand verschlimmert? Ich will niemanden um mich haben, der in seiner Impulsivität unberechenbar ist.«
»Sie wollen sich also von ihm trennen?«
»Noch nicht sofort. Erst wenn 107 Piscium hinter uns liegt. Er soll eine letzte Chance bekommen, sich zu bewähren.«
»Wieso glauben Sie, er könnte diesmal etwas finden?«
»Ich rechne nicht damit, aber ich bin davon überzeugt, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn man ihm den richtigen Anreiz gibt.«
»Und wenn er einfach verschwindet?«
»Auch daran habe ich gedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Quaiche noch etwas einfällt, womit er mich überraschen könnte. Jetzt brauche ich ihn nur noch selbst, und zwar halbwegs lebendig. Können Sie das für mich erledigen?«
»Jetzt gleich, Madame?«
»Warum nicht? Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist.«
»Die Schwierigkeit ist«, gab Grelier zu bedenken, »er ist eingefroren. Wenn wir uns an die Standardprozedur halten, dauert es sechs Stunden, um ihn wachzubekommen.«
»Und wenn nicht?« Wie lange mochte der neue Körper wohl noch durchhalten? »Wie viele Stunden könnten wir einsparen ? Eine realistische Schätzung!«
»Höchstenfalls zwei, wenn wir nicht riskieren wollen, dass er uns unter den Händen stirbt. Und auch dann wird es ein klein wenig ungemütlich werden.«
Jasmina strahlte den Generalmedikus an. »Er wird es schon verkraften. Ach ja, noch etwas, Grelier.«
»Madame?«
»Bringen Sie mir den Ehernen Panzer.«
Seine Geliebte half ihm aus dem Tank. Quaiche ließ sich zitternd und von Würgekrämpfen geschüttelt auf die Reanimationsliege sinken, und Morwenna machte sich daran, die vielen Schläuche und Nadeln aus seinem malträtierten Standardkörper zu ziehen.
»Lieg doch still«, ermahnte sie ihn.
»Mir ist nicht gut.«
»Natürlich nicht. Was erwartest du, wenn dich die Dreckskerle im Schnellverfahren auftauen?«
Es war wie ein Tritt zwischen die Beine, nur dass die Leistengegend den ganzen Körper umfasste. Er hätte sich am liebsten eingerollt, wäre in sich hineingekrochen und hätte sich ganz klein zusammengefaltet wie ein Stück Papier in den Händen eines Origamikünstlers. Sein Magen rebellierte, aber es war einfach zu anstrengend, sich zu übergeben.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!