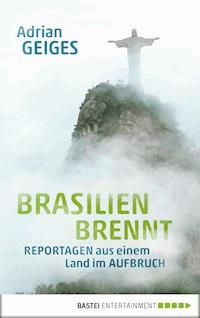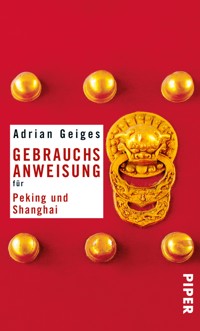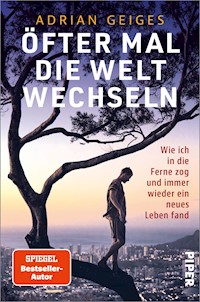
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Viele träumen davon, ganz neu anzufangen, in exotischer Natur zu leben oder in einer aufregenden Metropole zu arbeiten. Adrian Geiges ermutigt dazu. Sein Leben gleicht einer Abenteuerreise. Er zog in die Sowjetunion, erlebte mit, wie sie zusammenbrach und das neue Russland entstand. Bürger von New York war er ebenso wie Bürger von Hongkong. Er wirkte als Topmanager in Shanghai und wohnte in einer Favela von Rio de Janeiro. In diesem Buch zeigt er, wie Leben im Ausland bereichert. Er gibt all jenen Inspiration und Rat, die selbst in die Welt aufbrechen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, München
Covermotiv: Lukas Rodriguez / pexels
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Der Sinn des Lebens
»Geh doch rüber in die DDR«
Verfolge deinen Traumberuf, egal was die anderen sagen
Etwas anderer Urlaub
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein
Sich in Gefahr begeben
Den Job kündigen, wenn er am schönsten ist
Kulturschocks in Hongkong und anderswo
Mit 37 Chinesisch lernen
New York
Eine extreme Perspektive
Länder besuchen, in die keiner will
Eine andere extreme Perspektive
Europäische Flüchtlinge in Afrika
Kreuzfahrten frei nach Hannes Wader
Vom Hausbesetzer zum Hausbesitzer
Im Reich der Sinne
Sicherheitstipps für Abenteurer
Stichwortverzeichnis
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Register
Der Sinn des Lebens
Sammeln von spannenden Erfahrungen
Wir Menschen sind Abenteurer. Wir wollen Neues sehen, hören, riechen und spüren. Das lässt sich schon bei Babys und Kleinkindern beobachten. Sie klettern auf jede Erhöhung, nehmen alles in die Hand und stecken es in den Mund. Die Erwachsenen aber versuchen sie zu bremsen, und im späteren Leben wird uns erklärt: »Es ist besser, brav in die Schule zu gehen, als irgendwohin auszubüxen.« »Wer zu oft den Arbeitsplatz wechselt, schadet seiner Karriere.« »Überall lauern Gefahren!« Und so vergessen viele die Träume ihrer Jugend und machen jahrzehntelang das Gleiche. Dieselbe Arbeit, die sie nicht befriedigt. Sie wohnen am selben Ort und treffen immer dieselben Leute.
Nun denke ich grundsätzlich: Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Wer die Stabilität liebt, darf gerne so leben. Aber den meisten reicht das nicht. Sie versuchen abends und am Wochenende aus ihrem Alltag auszubrechen, indem sie exzentrischen Hobbys nachgehen oder wilde Klubs besuchen. Und sie freuen sich das ganze Jahr auf ein paar Wochen Urlaub – und das halbe Leben auf die Rente, in der sie nachzuholen versuchen, was sie bis dahin versäumt haben.
Meine Erfahrung ist: Es besteht kein Grund, so lange zu warten. Ich habe mich entschieden, mein ganzes Leben zum Abenteuer zu machen. Diese Erfahrung möchte ich in diesem Buch mit dir teilen. Zugegeben, ich bin da vielleicht etwas extrem. Als mich meine Mutter in den Sandkasten schickte, entgegnete ich: Da war ich schon mal. Später habe ich immer nach vier, fünf Jahren den Arbeitsplatz gewechselt, bin in ein anderes Land gegangen oder beides zusammen. So weit muss man es nicht treiben. Ein bisschen davon würde aber, denke ich, den meisten guttun. Gäbe es ein solches Bedürfnis nicht, würden die Deutschen nicht 70 Millionen Urlaubsreisen im Jahr buchen, wenn nicht gerade Corona ist. Und das gilt keineswegs nur für uns Deutsche, die selbst ernannten Urlaubsweltmeister. Bei den Chinesen beispielsweise stieg die Zahl der Auslandsreisen von 20 Millionen im Jahr 2003 auf 134 Millionen im Jahr 2019. Da sind die vielen Reisen innerhalb Chinas noch gar nicht mitgerechnet, dabei ist das ein großes Land mit unterschiedlichen Kulturen und Klimazonen.
Ich bin Journalist, da lernt man schon von Berufs wegen jeden Tag neue Menschen und Orte kennen. Reisen werden im Normalfall von den Arbeit- oder Auftraggebern bezahlt. Und in den meisten Ländern sind Korrespondentenvisa leichter zu bekommen als andere Arbeitsvisa, da Korrespondenten für Medien in ihrem jeweiligen Heimatland berichten und daher den Einheimischen nicht die Arbeitsplätze wegnehmen. All das sind Gründe, die mich dazu bewegt haben, diesen Beruf zu wählen.
Aber auch Angehörige anderer Branchen können die Welt wechseln. In allen Ländern, in denen ich lebte, lernte ich Unternehmensberaterinnen und Handwerker kennen, Restaurantbesitzer und Fotografinnen, die sich entschlossen haben, in der Fremde zu arbeiten, weil sie es interessant finden, der lockeren Mentalität oder des sonnigen Wetters wegen. Auch in scheinbar geregelten Berufen ist das möglich. Meine Tochter besuchte die deutsche Schule in Peking. Lehrer können für einige Jahre in einer der deutschen Auslandsschulen unterrichten, ohne ihren Beamtenstatus in Deutschland zu verlieren. Eine prima Chance, aus dem Alltagstrott auszusteigen, in diesem Fall sogar völlig risikofrei. Umso erstaunlicher: Es fällt schwer, die Stellen zu besetzen, weil sich nicht genügend Bewerber melden.
Oft fühlen wir uns von Zwängen eingeengt und fragen uns: Passt das in meine Karriereplanung? Doch wozu soll die Karriere dienen? Worin besteht der Sinn des Lebens? Für mich im Sammeln von spannenden Erfahrungen. Nun mag man entgegnen: Leichter gesagt als getan, schließlich müssen wir unsere Kinder versorgen und die Miete bezahlen. Das ist richtig, aber mein Lebenslauf zeigt: Wenn man das verwirklicht, was einen erfüllt, wenn man etwa Sprachen lernt und in fremde Länder zieht, ist das auch für die Karriere hilfreich.
Meist sind es eingefahrene Gewohnheiten und Angst vor dem Unbekannten, die uns davon abhalten. Dabei ist ein Ausstieg aus dem Alltag, etwa eine Weltreise, einfacher, als man denkt. Davon zeugt auch das Beispiel meiner Kollegin Meike Winnemuth. Ich lernte sie kennen, als sie zur Chefredaktion von Park Avenue gehörte, einer damaligen Zeitschrift von Gruner + Jahr. Ich war China-Korrespondent des Stern, der ebenfalls in diesem Verlagshaus erscheint. So beauftragte sie mich mit einer Reportage zum Thema »Young Hot China« über junge, aufregende chinesische Talente, von der Schriftstellerin bis zum Rockmusiker. Später gewann Winnemuth bei Günther Jauch eine halbe Million. Sie wollte sie nutzen, um ein Jahr lang in zwölf verschiedenen Städten zu leben, in denen sie jeweils für einen Monat eine Wohnung mietete: Sydney, Buenos Aires, Mumbai, Shanghai, Honolulu, San Francisco, London, Kopenhagen, Barcelona, Tel Aviv, Addis Abeba und Havanna. Am Ende merkte sie: Sie hatte den Gewinn von Wer wird Millionär? gar nicht gebraucht! Die Honorare für Artikel, die sie über diese Städte schrieb, reichten aus, um ihre einjährige Weltreise zu finanzieren.
Nun magst du einwenden: Meike Winnemuth hatte damals schon eine gewisse Bekanntheit und gute Kontakte, es ist nicht für jeden so einfach. Doch auch sie hat einmal irgendwo begonnen. Das gilt natürlich auch für mich, und deshalb werde ich meine Geschichte von Anfang an erzählen. Es stimmt, bei Reisen um die Welt und der Arbeit in anderen Ländern sind Hindernisse zu überwinden. Aber die Mühen werden dir mit Glück vergolten. Wie der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt sagte: »Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst.«
Der Wunsch, aus dem Alltagstrott auszubrechen und in die Ferne zu ziehen, wird bei mir schon in der Kindheit geweckt, durch die Bücher Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und Jim Knopf und die Wilde 13 des Schriftstellers Michael Ende. Weil es auf der kleinen Insel Lummerland zu eng geworden ist, fahren der schwarze Junge Jim Knopf und der weiße Lokomotivführer Lukas mit seiner Dampflok Emma in die Welt hinaus und erleben dabei die verrücktesten Abenteuer. Sie schaffen es bis nach China, wo bunte Bäume wachsen, Brücken aus Porzellan das Wasser überspannen und Glöckchen aus Silber läuten. Im Muff der damaligen Bundesrepublik beschuldigten Rezensenten Michael Ende, »Opium für Kinder« zu schreiben. Statt sie auf den Ernst des Lebens vorzubereiten, würden sie hier zur Fantasterei verführt (genau, ich bin ein Beispiel dafür!). Das konnte aber den Erfolg der Bücher nicht aufhalten und verhinderte auch nicht die Verfilmung durch die Augsburger Puppenkiste.
Als ich etwas älter bin, lese ich das Werk Reise um die Erde in 80 Tagen des französischen Schriftstellers Jules Verne, inspiriert übrigens durch eine wahre Geschichte, nämlich die des US-Amerikaners George Francis Train. Der fuhr tatsächlich, vor der Erfindung des Flugzeugs, mit Schiffen und Zügen in genau 80 Tagen um die Welt. Wer war dieser Mann? Das lässt sich nicht in einem Satz zusammenfassen, denn er hat in seinem Leben dies und das getan. Er arbeitete als Kaufmann in Chicago und ging dann nach Australien. Er startete in London eine Straßenbahn, die von Pferden gezogen wurde – dem Unternehmen war allerdings kein Erfolg vergönnt. Er nahm am Amerikanischen Bürgerkrieg teil, klugerweise nicht mit der Waffe in der Hand, sondern indem er in England und Irland Vorträge hielt, in denen er die Position der Nordstaaten erläuterte. In den USA gründete er dann eine Eisenbahngesellschaft, diesmal mit Erfolg. Das Geld, das er damit gewann, investierte er als Reeder in die Schifffahrt. Gleichzeitig war er Schriftsteller und schrieb elf Bücher. Er kandidierte als US-Präsident, erfolglos, wobei er gleichzeitig behauptete, australische Revolutionäre hätten ihm die Präsidentschaft einer noch zu gründenden australischen Republik angetragen. Auch hat er sich einen Namen als Frauenrechtler gemacht und wurde, weil er die aufkommende Frauenbewegung unterstützte, sogar inhaftiert. Er finanzierte die Zeitschrift Die Revolution, ein wichtiges Blatt der damaligen Frauenbewegung. Kurzum – dieser Mann ist ein echtes Vorbild!
Auch bei mir mischt sich der Drang, die Welt kennenzulernen, in meinem weiteren Leben zunehmend mit dem Wunsch, die Welt zu verändern. Zu meiner neuen Lektüre gehören die Reportagen von Egon Erwin Kisch. Die Titel seiner Bücher sprechen für sich: Der rasende Reporter;Zaren, Popen, Bolschewiken;Die Reise um Europa in 365 Tagen;Asien gründlich verändert;China geheim;Wagnisse in aller Welt und viele mehr. Kisch war nicht nur Reporter, sondern auch Revolutionär. Das beeinflusst mich. Der Schriftsteller Friedrich Torberg schreibt, Kisch habe ihm gesagt: »Weißt du, mir kann eigentlich nichts passieren. Ich bin ein Deutscher. Ich bin ein Tscheche. Ich bin ein Jud. Ich bin aus gutem Hause. Ich bin Kommunist. Ich bin Corpsbursch. Etwas davon hilft mir immer.«
»Geh doch rüber in die DDR«
Ein ungewöhnliches Auslandsstudium
Wer direkt nach dem Abitur sein Studium aufnimmt, hat mit dem Leben schon abgeschlossen. Ich meine hier ein Studium in Deutschland, schlimmstenfalls in der eigenen oder der nächsten Stadt. Es gibt viele Möglichkeiten, zunächst einmal etwas von der Welt zu sehen – Freiwilligenarbeit im Ausland, Work and Travel, Sprachaufenthalt, ein Job als Au-pair … Du kannst auch dein ganzes Studium im Ausland absolvieren, zumindest aber eines oder mehrere Auslandssemester einplanen.
Als ich vor dem Abi stehe, bieten sich dafür viel weniger Chancen als heute. Und man findet nichts darüber im Internet, denn das existiert noch nicht. So plagt mich das Gefühl, dass ich gern vor der Uni etwas anderes machen möchte, aber leider weiß ich nicht, was. Da erreicht mich ein ungewöhnliches Angebot, das mir gerade recht kommt.
Wie schon im vorherigen Kapitel angedeutet, trifft auf mich die Lebensweisheit zu: »Wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz. Wer mit 30 noch Kommunist ist, hat keinen Verstand.« Zu diesem Zeitpunkt bin ich erst 18 und ein überaus aktiver Kommunist, Mitglied der DKP und ihrer Jugendorganisation Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, und das ausgerechnet am Rande des Südschwarzwalds, damals auch im politischen Sinn eine der schwärzesten Gegenden Westdeutschlands. Aus dieser Region um Freiburg im Breisgau stammt auch Hans Filbinger. Im Dritten Reich war er NSDAP-Mitglied, noch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs verurteilte er als Richter junge Soldaten zum Tode, weil sie sich weigerten, weiter für Hitler zu morden. Trotzdem steigt er damals zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg auf. Das empört mich und viele aus meiner Generation und ist für mich einer der Gründe, aus Protest weit nach links zu gehen.
Und so spricht mich eines Tages die Kreisvorsitzende unserer Jugendorganisation an: »Kannst du dir vorstellen, für ein Jahr zur weiteren Qualifizierung ins sozialistische Ausland zu gehen?« Ich muss keine Sekunde nachdenken, bin sofort begeistert: ein Jahr ins Ausland, dazu noch in ein sozialistisches! Das hat damals viel Exotik, denn es ist sehr schwer, auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs zu studieren. Trotzdem frage ich natürlich nach: »In welches Land? Und an was für eine Hochschule?« »Das darf ich dir noch nicht sagen, die genauen Umstände sind streng geheim. Aber du wirst rechtzeitig Direktiven bekommen.«
Das klingt aus heutiger Sicht schräg. Aber wir sprechen von der Zeit des Kalten Kriegs, und da leuchtet es mir ein. Gegen Lehrerinnen, Lokomotivführer und sogar Briefträger werden damals Berufsverbote verhängt, nur weil sie Mitglied in einer linken Organisation sind. Ein längerer Aufenthalt in einem sozialistischen Land brächte also auf jeden Fall schwere Nachteile, wenn er bekannt würde. Was sich aber unabhängig von diesen speziellen Umständen auf heute übertragen lässt: Ein Auslandsstudium verspricht Spannung, und du solltest diese Chance ergreifen, auch wenn die Einzelheiten vorher unklar oder sogar dubios sind.
Einige Wochen später erfahre ich bei einem Vorbereitungstreffen mit meinen zukünftigen fünf Mitstudenten aus der Bundesrepublik, dass es in die DDR geht. In die DDR! Man muss sich das einmal vorstellen in der damaligen Zeit. Egal ob wir Jugendliche lange Haare trugen, als Hippies der freien Liebe frönten oder das konservative Schulsystem kritisierten – bei jeder Abweichung hielten die Alten uns Jungen damals entgegen: »Geht doch rüber in die DDR, wenn es euch hier nicht passt.« Und ich sollte es tatsächlich tun!
Es läuft alles sehr konspirativ, wie heute vielleicht beim Besuch einer lateinamerikanischen Drogengang oder einer Reise durchs Afghanistan der Taliban. Als Westdeutscher braucht man für die DDR ein Visum, doch wir haben keins, aus Sicherheitsgründen, damit niemand weiß, wo wir hinfahren. Ohne irgendwelche Unterlagen gehe ich am Berliner Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße zur Passkontrolle. Die DDR-Grenzsoldaten sind als unfreundlich und aggressiv bekannt. Doch ich sage die Zauberformel, die uns vorher eingetrichtert wurde: »Ich bin avisiert.« Der Grenzer schaut auf den Namen im Pass und vertauscht schlagartig das übliche grimmige Gesicht mit einem freundlichen, fast thailändischen Lächeln. Schließlich sind es pro Tag nicht so viele Leute, die »avisiert« werden. In einer Kladde hat er ein Einlegevisum bereitliegen – ich bekomme ein separates Blatt statt eines Stempels in den Pass, damit die feindlichen Grenzschützer der BRD nach meiner Rückreise später nicht erkennen können: Ich habe ein Jahr in der DDR gelebt.
Den Anweisungen folgend, gehe ich aus dem Bahnhof die Friedrichstraße rechts entlang und biege Unter den Linden rechts ab. Dort werden wir erwartet im Gebäude des Zentralrats der Freien Deutschen Jugend (FDJ), wo heute das ZDF-Hauptstadtstudio untergebracht ist. Bald trudeln auch die anderen fünf Studenten ein, die ich von dem Vorbereitungstreffen kenne. Es begrüßt uns Hans Pischke, der sich als Betreuer unserer westdeutschen Seminargruppe vorstellt. Er werde uns im Fach »Dialektischer und historischer Materialismus« unterrichten, also in marxistischer Philosophie. Andere Dozenten würden uns anderes revolutionäres Wissen beibringen. »Und vor allem sollt ihr hier den realen Sozialismus kennenlernen«, sagt Hans. »Bisher, bei Delegationen, habt ihr die Schokoladenseite der DDR gesehen. Jetzt werdet ihr erfahren, wie es hier wirklich ist.« Hinter dem Wort »Delegationen« verbergen sich die organisierten Kurzreisen in den Osten, die wir bisher erlebt haben. Jetzt hält man uns für reif genug, auch die »Übergangsprobleme der sozialistischen Entwicklung« zu verstehen, wie man das hier nennt.
In einem olivgrünen Kleinbus, Zweitakter Marke Barkas B 1000, verlassen wir Berlin und knattern Richtung Norden – mit unbekanntem Ziel. Dozent Hans sagt: »Wir fahren zu einem der geheimsten Orte der DDR« – was viel verspricht, da die DDR insgesamt schon als geheimnisvolles Land gilt. Auf dem Weg erzählt Hans von dem »Objekt«, wie er sich ausdrückt, in dem wir das nächste Jahr unseres Lebens verbringen werden: »Es war einst das Liebesnest von Hitlers Propagandaminister Goebbels. 1936 schenkte Berlin dem Joseph Goebbels zum 39. Geburtstag ein idyllisches Stück Land mit See, Bäumen und Wiesen und baute ihm ein Landhaus. Der Kriegsverbrecher vergnügte sich dort mit Schauspielerinnen und anderen Gespielinnen. 1945 besetzten sowjetische und polnische Soldaten das Gebäude, gegen erheblichen Widerstand von Schergen der Waffen-SS, die sich da verschanzt hatten. In einem Lazarett pflegten die Freunde dort verwundete Soldaten.« Als »Freunde« bezeichnet man in der DDR Sowjetbürger, vor allem sowjetische Soldaten. »1946 übergaben die Freunde das Objekt der Freien Deutschen Jugend, seither bilden wir dort Verbandsfunktionäre aus. 1950 verlieh Wilhelm Pieck der Schule seinen Namen. Deshalb heißt sie Jugendhochschule Wilhelm Pieck.« Das klingt kultig in meinen Ohren. Wilhelm Pieck, das erste Staatsoberhaupt der DDR, starb 1960. Er hatte schon zu Lebzeiten einer Schule seinen Namen »verliehen«? Immerhin erfahren wir auf diese Weise, wie der Ort heißt, an dem wir ab heute studieren werden.
Nach einer Stunde Fahrt Richtung Norden biegen wir am Wandlitzer See rechts ab in einen Waldweg. Ein Schild in Deutsch, Englisch und Französisch erklärt das Gebiet zur militärischen Sperrzone, Zugang verboten für Patrouillen der alliierten Streitkräfte (die ansonsten die DDR inspizieren durften). Der Mischwald verdichtet sich. Einige Minuten später fällt uns auf: Ein Maschendrahtzaun versperrt mitten im Wald den Zugang zu einem Gelände. Der Barkas stoppt. Hinter Kiefern und Birken versteckt sich ein Wachhäuschen. Ein Volkspolizist tritt heraus. Wie ein Grenzsoldat lugt er in den Kleinbus, erkennt den Dozenten Hans und winkt uns durch. Wir fahren auf das Gelände der Jugendhochschule Wilhelm Pieck, der höchsten Bildungsstätte der Freien Deutschen Jugend! Hier, so wissen wir jetzt, studieren der politische Nachwuchs der DDR, junge Revolutionäre aus aller Welt – und wir sechs linke Jugendliche aus der Bundesrepublik.
Nach einigen Metern erhebt sich aus dem Wald eine Schlossanlage im Stil der Stalinzeit, in dem pompösen Barock, den ich von Bildern aus der Sowjetunion kenne. Aus dem Goebbels’schen Landhaus war die FDJ bald herausgewachsen, erfahren wir. So entstand in den 1950er-Jahren diese Schlossanlage aus sechs gigantischen Bauten, die einen gepflegten Park von der Größe eines Fußballstadions einrahmt.
Dozent Hans bringt uns, »die männlichen Genossen aus der BRD«, zum »Haus 1«, einem ockerfarben angestrichenen Wohnheim. Die einzige Genossin in unserer Gruppe verabschiedet sich, sie muss ins »Haus 2«, das Frauenwohnheim. Unser Zimmer ist vollgestellt mit fünf Betten. Ein Spülbecken oder eine Toilette gibt es darin nicht, die ganze Etage teilt sich einen Waschraum. Ich denke: »Man kann sich an alles gewöhnen«, und das bestätigt sich dann auch so.
Wir erkunden die Umgebung. Die Jugendhochschule liegt am Wasser, dem Bogensee. Dort entdecken wir das Liebesnest von Goebbels, das jetzt als Kindergarten genutzt wird für den Nachwuchs der Jugendhochschul-Mitarbeiter. Eine Kindergärtnerin zeigt uns, wie sich die Fenster des hellen Kaminzimmers versenken lassen, eine Spezialkonstruktion, die für den Naziführer angefertigt worden war. So hatte Goebbels in den Bogensee springen können, der sich direkt unter seinem Fenster befand. Mittlerweile ist der Wasserspiegel des Sees etwas gesunken. Wir spazieren um ihn herum, was etwa eine halbe Stunde in Anspruch nimmt, die Stiefel tief im Laub.
Am Abend steigen wir die Treppen, breit wie eine vierspurige Autobahn, hoch zum pompösesten Gebäude der Schlossanlage, dem Lektionsgebäude. Für diesen Tempel des Wissens wurde extra ein Hügel aufgeschüttet. Auf der Spitze des Gebäudes thront eine übermenschengroße Heldenstatue, ein Arbeiter und eine Bäuerin schwenken gemeinsam eine Fahne. Die Statue lässt keinen Zweifel aufkommen: Es kann sich nur um die rote Fahne handeln. Hunderte andere gehen den gleichen Weg, in blauen Hemden mit gelbem FDJ-Abzeichen, in bunten Tüchern aus Afrika, in zerrissenen Jeans aus Dänemark.
Im Großen Lektionssaal mit 525 Plätzen klingt Musik aus Lautsprechern, das »Solidaritätslied« mit dem Text von Bertolt Brecht und der Musik von Hanns Eisler: »Schwarzer, Weißer, Brauner, Gelber! Endet ihre Schlächterein! Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein.« Dieser Idealismus entspricht genau meinen damaligen Wunschträumen.
»Der 31. DDR-Lehrgang und der 22. Internationale Lehrgang der Jugendhochschule Wilhelm Pieck sind eröffnet«, deklamiert ein Redner. Die 150 internationalen Studenten hören mit per Kopfhörer, eingesteckt in Buchsen an den Stühlen. Die Jugendhochschule besitzt die modernste Simultan-Dolmetsch-Anlage der DDR, weshalb sie in ihrer Geschichte ein einziges Mal für die Außenwelt geöffnet wird: Als Bundeskanzler Helmut Schmidt 1981 die DDR besucht, hält er hier seine Pressekonferenz ab.
Nach den Reden tanzen unsere Mitstudenten aus Äthiopien auf der Bühne ein kriegerisches Gleichnis über den revolutionären Befreiungskampf in Afrika. Studentinnen aus Vietnam bewegen sich graziös zu einem Lied über Ho Chi Minh. Im Saal sitzen auch Mitstudenten von der PLO aus Palästina und vom ANC aus Südafrika, Sandinistinnen aus Nicaragua und Angehörige von Befreiungsbewegungen aus Angola und Namibia, Verfolgte des Militärregimes aus Chile und bärtige Männer aus Afghanistan, Linke aus kapitalistischen Ländern wie Finnland und sogar Japan. Ich fühle mich als Teil einer großen internationalen Bewegung.
Dazu kommen die 300 Studierenden aus der DDR selbst, in ihren blauen FDJ-Hemden. Es gibt keinen anderen Ort, an dem DDR-Jugendliche so intensiv mit Gleichaltrigen aus derart vielen Ländern zusammenleben wie hier. In ihren besten Zeiten sind an der Jugendhochschule 53 Länder vertreten. Auch ich als westdeutscher Abiturient habe zwar bis dahin schon Italiener und Spanier kennengelernt, aber noch keine Menschen aus Afrika, Lateinamerika und Asien. Wobei die Seminare nach Sprachen und Ländern getrennt ablaufen, nur bei großen Vorlesungen und Veranstaltungen kommen alle im Lektionssaal zusammen.
Wir studieren in einem Seminarraum, klein wie eine Wäschekammer, mit brauner Velourstapete und grauem Linoleum auf dem Fußboden. Unsere westdeutsche Gruppe sitzt im Viereck statt frontal wie in den DDR-Klassen üblich. Die erste Stunde widmet sich dem Fach »Wissenschaftlicher Kommunismus«. Bürgerlich und vereinfacht ausgedrückt ist dies die Politiklehre des Marxismus, im Unterschied zur Philosophie (»Dialektischer und historischer Materialismus«) und zur Wirtschaftslehre (»Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus«). An der Jugendhochschule Wilhelm Pieck ist es aber nicht angesagt, die Dinge bürgerlich oder gar vereinfacht auszudrücken. Es wird großer Wert darauf gelegt: Der Marxismus ist nicht einfach eine Idee, wie man die Welt sehen kann; er ist eine Wissenschaft, die die Gesellschaft erklärt; und er ist die einzige wissenschaftliche Erklärung der Gesellschaft. Weitere Studienfächer sind »Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung« und »Theorie und Praxis der Jugendarbeit«.
Den wissenschaftlichen Kommunismus unterrichtet Rainer Hille, der mit seinem verschmitzten Lächeln wie ein großer Lausejunge wirkt. Mit etwa 30 ist er jünger als die meisten anderen Dozenten an der Jugendhochschule. Zum Einstieg sagt er: »Ich habe eine Drushba-Trasse mitgebracht.« Aus seiner abgenutzten Wildledertasche packt er einen länglichen Karton aus und aus dem länglichen Karton eine Flasche Rostocker Klarer. Schnapsgläser verstecken sich hinter den Gesammelten Werken von Marx und Engels. Rainer sagt: »Lasst uns auf die Freundschaft anstoßen!« Als Genossen duzen wir uns und sprechen die Lehrer mit Vornamen an. »Drushba-Trasse«, so nennt sich das Projekt einer 2750 Kilometer langen Erdgasleitung in der Sowjetunion, an der auch Jugendliche aus der DDR mitarbeiten. Im Gegenzug bekommt die rohstoffarme DDR Erdgas. Junge Tiefbauer und Lkw-Maschinisten aus der DDR reizt nicht nur das Geld, sondern auch das Abenteuer im Ausland. Was der Rostocker Klare mit der Drushba-Trasse zu tun hat, kann auch der gut geschulte Dozent für wissenschaftlichen Kommunismus nicht erklären. Das ist vielleicht eher etwas für die Philosophiestunde …
Nach dem Freundschaftstrunk wendet sich der Unterricht seiner wissenschaftlichen Bestimmung zu. Dozent Rainer referiert die Dimitroff’sche Faschismus-Definition, »aus aktuellem Anlass, die Neonazis erheben in der BRD ihr Haupt«. Auf Karteikarten notieren wir das Zitat des bulgarischen Kommunisten Georgi Dimitroff, der 1933 im Reichstagsbrand-Prozess den Naziführer Göring der Lüge überführte: »Der Faschismus an der Macht ist … die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals.« Ich bin mit diesen Ideen vertraut, weiß über das enge Verhältnis der Nazis zu Großunternehmern wie Thyssen und Flick Bescheid, über Hitlers Rede vor dem Düsseldorfer Industrieclub 1932, die den Nazis Wahlkampfspenden und schließlich die Macht brachte. Als Hausaufgabe müssen wir einen Abschnitt in Lenins Werk Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus lesen, wichtige Stellen unterstreichen und »konspektieren«, also schriftlich zusammenfassen.
Ein wissenschaftliches Studium ist das nicht. Wir benutzen keine Originalquellen außer den marxistischen »Klassikern«. Die werden gebüffelt und auswendig gelernt. Anders als die FDJler führen wir in unserer Seminargruppe kontroverse Diskussionen. Doch dabei geht es nicht darum, ohne Vorurteile zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Vielmehr sollen uns die Dozenten von den Positionen der DDR-Staatspartei SED überzeugen.
Ein weiteres Gebäude der Jugendhochschule ist das »Kulturhaus«, mit der Kantine im Erdgeschoss und Klubräumen im Obergeschoss. Die Kneipe auf der Balustrade nennt sich »Rue«, aber französische Weine werden nicht serviert. Das Angebot ist landesüblich reduziert, die Speise- und Getränkekarte Makulatur. Was mich nicht stört, denn ich verachte die Konsumgesellschaft. Es gibt Club-Cola, ein braunes, süßes Wasser, das aussieht wie Cola, und DDR-Bier vom Fass aus Krügen, an denen man sich die Lippen schneidet, weil Glas abgesplittert ist. Das kann den Geist der internationalen Solidarität und Freundschaft nicht trüben.
In inoffiziellen Meetings an den Abenden lebt dort ein Spiel wieder auf, das entstanden ist in einem Freundschaftslager von SDAJ und FDJ am Scharmützelsee, einer jährlichen Werbe-Show der DDR für West-Jugendliche. Die Regeln sind für Genossen aus aller Welt leicht zu verstehen, unabhängig vom kulturellen Hintergrund: Das Bier aus zerdepperten Krügen muss mit der linken Hand getrunken werden. Wer versehentlich in alter Gewohnheit die rechte nimmt, muss eine Runde ausgeben und außerdem fünf DDR-Mark in die Solidaritätskasse spenden. Angeblich wird das Geld für Krankenhäuser in Vietnam und Schulen in Nicaragua verwandt. Das Spiel nennt sich »Teddy-Klub«.
Man kann gegen dieses Spiel alles Mögliche einwenden, insbesondere dass es den Alkoholismus fördert. Einige Wochen später verbietet die Hochschulleitung den »Teddy-Klub« – allerdings mit einer eigenartigen Begründung: »Es ist eine große Errungenschaft der Jugend der DDR: Seit 1946 haben wir eine einheitliche Jugendorganisation – die Freie Deutsche Jugend. Deshalb können wir eine spalterische Organisation wie den Teddy-Klub nicht zulassen.« Das ist natürlich albern, schließlich handelt es sich bei dem Teddy-Klub nicht um eine Organisation, nur um ein Spiel. Doch es zeigt uns: Die DDR sieht jede Art von spontaner Betätigung außerhalb der Kontrolle des Staats als gefährlich an. Mit solchen Erlebnissen lernen wir in dem Jahr, wie gewünscht, die DDR kennen, allerdings nicht mit den erhofften Resultaten.
»Die Ersten im Weltall, die Ersten auf der Erde« – unter diesem Motto kündigt sich die nächste Explosion an der Kaderschmiede an: ein Besuch von Sigmund Jähn, dem ersten Fliegerkosmonauten der DDR und ersten Deutschen im Weltall. Mir ist er gut bekannt, denn das DDR-Fernsehen feiert ihn in einer Art Endlosschleife.
Ich lerne ein weiteres ostdeutsches Wort: »Spalierbildung«. Ein Spalier zu bilden heißt: Alle 300 Studenten des DDR-Lehrgangs und alle 150 Studenten des internationalen Lehrgangs reihen sich an beiden Seiten des Wegs zum Lektionsgebäude auf. Alle klatschen frenetisch, um einen wichtigen Gast zu begrüßen, und rufen: »Hoch, hoch, hoch«, auch dann schon, wenn der Gast sie noch gar nicht hören oder sehen kann, auch dann noch, wenn der Gast sie längst nicht mehr hören oder sehen kann.
Wir kommen aus der West-Linken, sind eher antiautoritär drauf. Hier in der DDR erleben wir Rituale, wie wir sie aus der Bundesrepublik gar nicht mehr kennen: Fackelmärsche, Antreten zu Appellen, endloses Beifallklatschen und Bejubeln von irgendwelchen Parteiführern. Das schockiert uns. Auf der anderen Seite erleben wir, wenn wir mit den Studierenden aus der DDR sprechen: Da sind kritische Leute dabei. Die sagen wie wir: Vieles muss sich ändern in der DDR, sie braucht mehr Freiheit, mehr Offenheit.
Heute also bilden wir so ein Spalier für Sigmund Jähn. Er hält einen Vortrag, und am Abend quetsche ich mich in den Empfang für ihn im Kulturhaus. Rotkäppchen-Sekt wird ausgeschenkt. Ich stoße mit Jähn an, einem bescheiden wirkenden Mann. Er habe »die totale Glückseligkeit« erlebt, als er die Erde von oben sah, sagt er.
Der Weltraumfahrer Jähn ist nicht der einzige DDR-Prominente, der die Jugendhochschule besucht. Auch Künstler treten dort auf wie etwa die Puhdys (Alt wie ein Baum), City (Am Fenster) und Karat (Über sieben Brücken musst du gehen, das Original, Peter Maffay spielt später eine Coverversion davon).
Zum Studium an der Jugendhochschule gehören auch Exkursionen in verschiedene Teile der DDR, um »den realen Sozialismus kennenzulernen«. Real wie in Bernburg an der Saale. Wir kämpften gegen die Umweltverschmutzung in der Bundesrepublik, deren Ursache für uns auf der Hand lag: die Gier der Konzerne, die sich nicht um Mensch und Natur scheren. Sie klären Abwässer nicht und filtern auch nicht die Abgase, weil sie sparen, um ihren Profit zu steigern. Aber so etwas wie die Saale in der DDR haben wir noch nie gesehen. Es fließt kein Fluss – es schäumt eine Seifenlauge. Nur am Rand der weißen Brühe rinnt ein ungefähr ein Meter schmaler Streifen Wasser.
Wir treffen die Sekretäre der FDJ-Kreisleitung und sprechen sie darauf an. Sie tun so, als wüssten sie nicht, von welchem Problem die Rede ist. Gleichzeitig bekunden sie »ihr volles Vertrauen in die Partei, alles zu tun für das Wohl des Volkes, auch in Fragen der Umwelt«. Ein FDJ-Funktionär, der in Berlin studiert hat, meint: »Wir haben uns daran gewöhnt, für uns gehört es zu unserer Heimat. Immer wenn ich nach Bernburg zurückkomme und die Saale rieche, fühle ich: Ich bin wieder zu Hause.«
Am meisten beeindrucken mich in dem Jahr an der Jugendhochschule die jungen Frauen und Männer aus fernen Ländern. Sie engagieren sich in ihrer Heimat für eine bessere Welt, etwa gegen das Apartheidregime in Südafrika oder gegen die Militärdiktatur in Chile. In ihren Kämpfen geht es um Leben und Tod. Bei manchen von ihnen sieht man in der Gemeinschaftsdusche oder beim Schwimmen die Narben, die von der Folter herrühren. Sie beeinflussen mein Leben entscheidend, spornen mich an, diese Länder später selbst kennenzulernen. Und sie sind ein Grund, warum wir damals über die DDR zwar sarkastische Witze reißen, uns aber nicht klar gegen das System dort auflehnen, trotz der Mauer, der Verfolgung politisch Andersdenkender und eben auch der Umweltzerstörung: »Bei allen noch bestehenden Problemen«, wie wir verharmlosend sagen, haben wir das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen »im Kampf für eine gerechte Welt«, gegen die reichen Länder, die die armen ausbeuten. Gut gemeint, aber das führt nicht immer zu richtigen Schlüssen. Zu viel Moralismus kann verblenden.
Da dieses Studium so streng geheim ist, können wir fast keinen Austausch pflegen mit Leuten zu Hause. Internet und Handys gibt es damals ohnehin nicht, aber wir dürfen auch nicht von einem Festnetz telefonieren oder Briefe mit der Post senden, weil es heißt: Das ist viel zu gefährlich, dann kriegen die westdeutschen Geheimdienste heraus, wo ihr seid. Die Adresse darf keiner wissen. Es gibt nur einen Weg, um zum Beispiel mit den Eltern Kontakt zu halten: Die können Briefe schicken an den Bundesvorstand der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend in Dortmund. Wenn dann irgendwann jemand vom Bundesvorstand in die DDR fährt, nimmt er sie mit. Es dauert zwei, drei Monate, bis ein Brief ankommt, und in umgekehrter Richtung dauert es genauso lang.
So irre vieles war, was wir damals politisch vertreten haben: In keiner Sekunde meines Lebens habe ich es bereut, diese hochinteressante Erfahrung gemacht zu haben. Und die gelernten marxistischen Formeln werden später für mich einen praktischen Nutzen bekommen, nämlich in China, wo bis heute das gleiche politische System herrscht, auch wenn seine Wirtschaft ganz anders funktioniert als die der DDR.
Während ich diese Zeilen schreibe, ist meine Tochter gerade zu einem Auslandssemester nach Hongkong geflogen. Das scheint nicht in die Zeit zu passen: Wegen der Pandemie-Bestimmungen muss sie dort zunächst drei Wochen im winzigen Zimmer eines Quarantänehotels verbringen. Außerdem hat Chinas Regierung dort gerade die letzten Reste von Demokratie erstickt. Doch auch meine Tochter wird dabei Erfahrungen sammeln, von denen sie in ihrem weiteren Leben zehren wird.
Merkzettel
Verfolge deinen Traumberuf, egal was die anderen sagen
Wenn du Schauspielerin werden willst oder Balletttänzer, Schriftstellerin oder Soulsänger, werden dich deine Eltern warnen: Damit fährst du im späteren Leben Taxi oder beziehst Hartz IV. Ähnlich geht es mir, als ich davon träume, Journalist zu werden. Doch die schlimmste Zurückweisung kommt nicht aus der Verwandtschaft, sondern von einem meiner Idole: Doro Peyko, Chefredakteurin des linksgerichteten Jugendmagazins Elan, das ich damals lese. Als Gymnasiast schon schreibe ich ihr einen Brief und bitte sie um Tipps, wie ich meinen Berufswunsch verfolgen soll. Sie schickt mir eine zweiseitige Antwort, mit der Schreibmaschine getippt. Bei einem meiner vielen Umzüge habe ich diesen Brief verloren, aber an den Inhalt erinnere ich mich noch genau.
Der Beruf des Journalisten sei gar nicht so toll, wie ich mir das vorstelle, behauptet sie. Die meisten würden in Lokalzeitungen über Schützenvereine berichten oder als Pressereferenten die Skandale ihrer Unternehmen vertuschen. Einige bekämen gar nicht erst eine Stelle und seien arbeitslos. Warum ist Doro dann selbst Journalistin geworden? Auf diese Frage geht sie nur indirekt ein: Es gebe nur wenige Zeitschriften, die engagiert und kritisch berichten. Die hätten selten Stellen zu vergeben, es sei Illusion, einen solchen Weg zu planen. Und Elan als Arbeiterjugend-Magazin rekrutiere seinen Nachwuchs aus politisch und gewerkschaftlich aktiven Jugendlichen, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben.
Ich ignoriere den Rat und beginne nach dem Jahr in der DDR ein Magisterstudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Publizistik im Hauptfach, Geschichte und Politik als Nebenfächer. Ein ausgesprochenes Journalistik-Studium gibt es damals nur in Dortmund, doch ich bin mit einem Abiturdurchschnitt von 2,1 knapp zu schlecht, um dort aufgenommen zu werden. Das Publizistik-Studium in Münster jedoch, so stellt sich bald heraus, hat ein Problem, unter dem nicht nur ich leide: Fast alle wählen es, um in den Journalismus zu gehen. Doch darauf bereitet es nicht vor, es ist eine rein theoretische Beschäftigung mit Kommunikationswissenschaft.
So breche ich das Studium nach drei Semestern ab. Das ist damals nicht unehrenhaft, sondern Standard in der Medienbranche. Fast alle großen Kollegen, mit denen ich später zu tun habe, brachen ihr Studium ab oder begannen gar nicht erst eins: Gerd Ruge und Stefan Aust, Günther Jauch und Dieter Lesche, der langjährige Chefredakteur von RTL, und viele mehr. Na ja, beim Fernsehen mag das ja gehen, wendest du vielleicht ein, aber in der sonstigen Wirtschaft? Auch dort fällt mir der eine oder andere Studienabbrecher ein, der es zu etwas gebracht hat: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Ferdinand Alexander Porsche, Heike Makatsch, Wolfgang Joop, Alice Schwarzer, Carsten Maschmeyer …
Trotzdem würde ich heute dazu raten, ein Studium abzuschließen. Aber nicht, weil man es braucht, um Reporter oder Auslandskorrespondentin zu werden. Die Art, wie an Unis geschrieben wird, mit Fremdwörtern und Schachtelsätzen, ist das Gegenteil von journalistischer Sprache. Für sie gilt, was Martin Luther sagte: »dem Volk aufs Maul schauen«. Oder wie er genauer ausführte: »Man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch reden, wie diese Esel tun, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt darum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden.« Sinn eines Studiums kann es sein, sich ein Fachwissen anzueignen, sei es Jura oder Volkswirtschaft, Chinesisch oder Physik. Das bringt für die journalistische Arbeit mehr als ein Journalistik- oder gar Publizistik-Studium. Und, das wäre für mich das Hauptargument: Man bekommt mehr Wahlmöglichkeiten, wenn man später doch nicht in die Medien möchte oder diese wieder verlassen will.
Ich hingegen erinnere mich an den Rat von Doro Peyko und mache eine Berufsausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann beim linken Schallplattenverlag Pläne, der damals unter anderem die Musik von Hannes Wader veröffentlicht. Dank sehr guter Leistungen in Firma und Berufsschule und weil ich das Abitur habe, kann ich die Lehre bereits nach eineinhalb Jahren mit Prüfung vor der Industrie und Handelskammer zu Dortmund erfolgreich abschließen. Journalist bin ich deshalb aber immer noch nicht.
Doch dafür habe ich zwei weitere Eisen im Feuer: Die Westfälischen Nachrichten in Münster suchen einen Lokalredakteur, laut Anzeige sind Seiteneinsteiger mit anderer Berufserfahrung ausdrücklich willkommen. Eine elitäre Ausbildung bietet die Hamburger Journalistenschule von Gruner + Jahr und der Zeit (später Henri-Nannen-Schule), die Praxis in Redaktionen wie Spiegel und Stern einschließt. Für beide Wege bewerbe ich mich.
Bei der Journalistenschule muss ich eine Reportage und einen Kommentar einreichen. Die sind offenbar gut, denn ich komme in die engere Auswahl und werde zu Tests nach Hamburg eingeladen: Unter Zeitdruck eine Reportage verfassen, in jenem Jahr zum Thema »Auf dem Arbeitsamt«. Wir fahren gemeinsam dorthin und müssen direkt danach schreiben. Dann folgen ein Bildertest (bekannte Gebäude und Personen der Zeitgeschichte erkennen), ein Wissenstest, eine Redigieraufgabe und ein Vorstellungsgespräch.