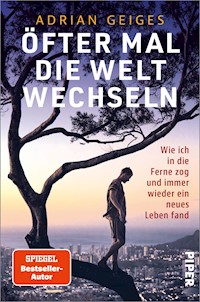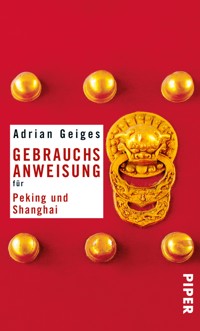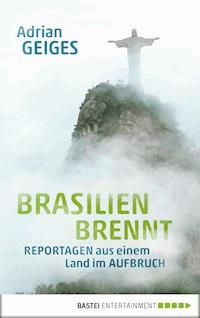
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Lange Jahre berichtete der Journalist Adrian Geiges aus China und Russland. Nun hat er das Land der Fußball-WM als neue Heimstatt gewählt: Brasilien, ein Land im Aufbruch. Geiges recherchiert hautnah. Er übernachtet in Indianerhütten am Amazonas, steht bei VW in São Paulo an der Werkbank, erlebt wilde Partys an der Copacabana und wohnt in einer Favela von Rio de Janeiro, einem Armenviertel, das zwischen Militärpolizisten und Drogengangs umkämpft ist. Doch Brasilien ist längst nicht mehr "Dritte Welt". In wenigen Jahren wird Brasilien einer der neuen Wirtschaftsriesen sein: Ein Gigant erwacht! Erwacht sind auch seine Bürger, die sich gegen korrupte Politiker erheben und ihre Rechte einfordern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Adrian Geiges
BRASILIEN BRENNT
Reportagen aus einem Land im Aufbruch
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2014 Quadriga Verlag, Berlin, in der Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagmotiv: Veer.com/Ocean Photography
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-5620-2
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Inhalt
Deutschland, leb wohl
Hitler Marubo
Krieg für WM und Olympia – wie Brasiliens Militärpolizei die Favelas erobert
Landung in der wunderbaren Stadt
Erica oder Wie ich in einen Carioca verwandelt werde
Portugiesisch mit brasilianischen Besonderheiten
Wohnungssuche im Manhattan des Südens: Ich ende in einer Favela
Rio real
Lula – der Präsident der Armen
»Ich habe gelernt zu töten«
Vom Gefängnis in den Palast: Dilma
Hauptstadt des dritten Jahrtausends
Dschungelcamp – Deutsche bauen ein Stadion am Amazonas
Wem gehört der Regenwald?
Brasilianische Disziplin und ein deutscher Metzger
Überraschendes aus dem Leben einer Strandbekanntschaft
Die rote Kommandantin auf der roten Suzuki
Ein deutsches Patenkind wird bei lebendigem Leib zerstückelt – vor 5000 Zuschauern
Das Slumleben als Seifenoper
Eine einbeinige Sambatänzerin und ihr toter Geliebter
Samba, Sex und Karneval
Beinahe ein Brudermord
Ein Slum wird zur Boomtown
Mein Nachbar, der Drogengangster
Schüsse beim Friedenslauf
Volksaufstand gegen die Fußball-WM – Brasilien in Aufruhr
Die Revolution entlässt ihre Oma
Generalstreik bei VW
Der Papst an der Copacabana
Ein Mann bewegt die Welt – aus dem Regenwald von Rio
Der Zweite Bürgermeister der Hansestadt Hamburg taucht in einer Favela unter
Gisele Bündchens zwanzig Millionen Verwandte
Ist Brasilien das China Amerikas?
Bildteil
Über den Autor
Bildnachweis
Deutschland, leb wohl
Hamburg, Anfang 2013. Zehn Zentimeter Neuschnee bedecken meine Terrasse, der Himmel ergraut. Draußen friert man sogar in langer Unterwäsche, die ich so gemütlich finde wie einen Stahlhelm. Der Umzugswagen kann vor dem Jugendstilbau nicht halten, weil ein Gerüst seit Wochen fünfzehn Parkplätze wegnimmt – gearbeitet wurde darauf noch keine Sekunde. Mein Nachmieter wartet auf seinen Vertrag, da der Zuständige in der Hausverwaltung krank ist und ihn keiner vertreten kann. Manchmal scheint mir, in Deutschland wird nur noch eines »erneuert«: Weniger Leute leisten mehr Arbeit. Zypern bricht das zweite Gebot der modernen europäischen Zivilisation, wonach der Staat die Spareinlagen sichert. Auf der toten Baustelle des Berliner Flughafens brennt Licht, weil niemand den Schalter findet, um es abzustellen. Zeit für mich, Europa zu verlassen und nach Brasilien aufzubrechen, in das Land der Fußballweltmeisterschaft 2014. Die größte Party der Welt wartet. Das Land errang fünf Mal den Weltmeistertitel, so oft wie kein anderes. 2014 feiert der brasilianische Fußballverband seinen 100.Geburtstag – als die WM für dieses Jahr vergeben wurde, bewarben sich andere Länder gar nicht erst, es war klar, wohin sie geht. Und mittlerweile ist Brasilien nicht nur im Fußball ein Riese: Auch in der Weltwirtschaft wächst seine Rolle in Riesenschritten. Kein Wunder, bei diesen Dimensionen: Brasilien ist 24-mal so groß wie Deutschland, erstreckt sich über eine größere Fläche als die Europäische Union. 200 Millionen Menschen leben dort, so viele wie in Russland, Kanada und Australien zusammengenommen. Da will ich hin! Jogi und die Jungs kommen nach, ich gehe schon mal vor.
Die Fußball-WM verteilt sich auf zwölf Städte, kennenlernen will ich sie alle, leben aber in Rio de Janeiro. Nicht nur, weil dort das Finale gespielt wird. Meine Expedition in den Süden soll Spaß bringen, und ich verbinde mit Rio Sonne, Strand und Karneval, wie wohl jeder. Obendrein ist Rio auch noch die Stadt der Olympischen Sommerspiele 2016, und die bewegen mehr in einer Stadt als nur den Sport. Das habe ich 2008 in Peking erlebt.
Erst vor vier Jahren kehrte ich aus China in die Heimat zurück– und staunte, wie viele Standuhren im angeblich so perfekten Deutschland ihrem Namen zur Ehre gereichen. Leider sind nicht nur die Uhren stehen geblieben, sondern auch die Zeit. Den Europäern ist lediglich das Selbstbewusstsein geblieben, am wohlhabendsten, sozialsten und umweltfreundlichsten zu sein – ein Selbstbewusstsein, das immer weniger durch Fakten gestützt wird. Zwar zehren wir noch von Erbschaften aus besseren Zeiten, doch die schmelzen zusammen. Denn die Ehrgeizigen, Mutigen und Schnellen leben anderswo. Zum Beispiel in Peking und Shanghai. Das habe ich zehn Jahre lang als Korrespondent des Stern und als Geschäftsführer von Gruner+Jahr dort erlebt.
Aber gilt das auch für Brasilien? Gemeinsam mit Russland, Indien und China zählt es zu den aufstrebenden BRIC-Staaten, manchmal mit Südafrika erweitert zu BRICS. Vierzig Prozent der Erdbevölkerung leben in diesen fünf Ländern. 2012 hat Brasilien Großbritannien überholt und ist zur sechstgrößten Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen, Frankreich, der Nummer fünf, folgt es dicht auf den Fersen. Goodbye, British Empire, au revoir, Grande Nation! Auf Platz vier liegt Deutschland – noch. Bereits jetzt produziert kein anderes Land so viele Lebensmittel wie Brasilien. Es baut den meisten Kaffee und das meiste Zuckerrohr an und ist weltweit der größte Exporteur von Rindfleisch. Während uns Brasilien mit Essen versorgt, ist China die Werkbank der Welt – und zunehmend auch die Bank der Welt, besonders für die Amerikaner, denn der Volksrepublik gehört ein Großteil ihrer Staatsanleihen. Aber auch bei Brasilien, einst selbst stark verschuldet, stehen die USA bereits mit 335 Milliarden Dollar in der Kreide. Gas, Gold, Öl und Eisen bereichern Russland, auch dort arbeitete ich sechs Jahre, unter anderem als Korrespondent von Spiegel TV. Indien spielt bei Computern vorne mit, doch wer wie ich dort mit stundenlangen Wartezeiten an Flughäfen eincheckte, der wünscht sich, die Software wäre nicht nur für den Export bestimmt.
»Vierzig Millionen Brasilianer sind in den letzten acht Jahren der Armut entwachsen und in den Mittelstand aufgestiegen«, sagt mir in einem Vorgespräch Paulo Gustavo de Santana, Pressesprecher der brasilianischen Botschaft in Berlin. Doch spricht ein Diplomat nicht von Amts wegen gut über sein Land? Der Geo-Fotograf Michael Ende ist ein Weltenbummler wie ich, lebt seit fast dreißig Jahren in Brasilien und unterrichtet jetzt auch in China, geht also den umgekehrten Weg. Wir treffen uns in Bielefeld, weil das irgendwie auf halber Strecke liegt. Er spottet: »Brasilien war das Land der Zukunft, ist das Land der Zukunft und wird das Land der Zukunft bleiben.« Michael spielt an auf das 1941 erschienene Buch Brasilien. Ein Land der Zukunft des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig. Er war vor den Nazis nach Brasilien geflohen und sah dort das Modell für ein friedliches Zusammenleben der Rassen. Erst nachdem das Buch erschienen war, merkte er: Auch dort bestand der Rassismus unterschwellig weiter, der damalige brasilianische Diktator Getúlio Vargas hatte seine Naivität ausgenutzt. Im Februar 1942 nahm sich Zweig in Petrópolis bei Rio de Janeiro das Leben. Michael möchte mit diesem Vergleich sagen, auch heute sei es mit den Veränderungen nicht so weit her. Doch verliert man vielleicht manchmal den Blick auf das Neue, wenn man lange in einem Land lebt und von diesem oder jenem im Alltag genervt ist? Ich will mir in Brasilien ein eigenes Urteil bilden.
Freunde und Kollegen reagieren begeistert, manche aber auch verwundert: Wie, von heute auf morgen Wohnung und Versicherungen auflösen und von den Colonnaden, wo ich in Hamburg gewohnt habe, an die Copacabana umziehen? Noch sind wir mehr darauf dressiert, nur dann woanders hinzugehen, wenn uns eine Firma entsendet und im Zweifel noch ein Coaching bei einem Sozialklempner bezahlt. So lange wollte ich nie warten, auch in Moskau und Peking fing ich an, indem ich mir selbst einen Sprachkurs buchte und dann langsam eine Existenz aufbaute – für mich die beste Art, ein anderes Land kennenzulernen.
Im Internet vergleiche ich verschiedene Portugiesisch-Sprachschulen in Rio. Im Preis-Leistungs-Verhältnis am besten erscheint mir Casa do Caminho, wörtlich »Haus am Weg«, nahe dem Strand von Ipanema, mit einer Kursgebühr von umgerechnet etwas mehr als 300 Euro pro Monat. Was meine Sympathie weckt: Betrieben wird die Schule von Freiwilligen, die 42 Kilometer von Rio entfernt ein Waisenhaus für vierzig Kinder unterhalten, die Opfer von Gewalt, Missbrauch und Armut wurden. Der Reinerlös fließt dorthin.
Als Unterkunft bietet die Schule – natürlich gegen Extrakosten– einen Homestay an, also Leben bei einer Gastfamilie. Ich bin begeistert, so kann ich das brasilianische Portugiesisch praktizieren und Menschen kennenlernen. Das wird mir auch erleichtern, in Rio eine Wohnung zu finden, wenn ich vor Ort bin. Denn von Deutschland aus habe ich nur Angebote bekommen, die auf ihre Art von Brasiliens Boom zeugen. Der Andrang von Geschäftsleuten, Fußballfans und Karnevalisten hat zu einem eigenen Business geführt: Apartments für Ausländer einrichten und zu einem astronomischen Preis vermieten. Den Fotos nach zu urteilen, die ich per E-Mail bekomme, bieten sie eine gute Aussicht, sind geschmackvoll bis kitschig eingerichtet, und die Betten sind sogar schon bezogen. Doch kann ich das nicht günstiger selbst tun?
Die Sprachschule schlägt mir zur Auswahl zwei »Familien« vor, die eigentlich Einzelpersonen sind: Davi, einen 21-jährigen Studenten, und Erica, eine 39-jährige Assistentin, wie es heißt. Ich entscheide mich für Erica. Wahrscheinlich beeinflusst mich auch, dass sie, wie ihr Bild zeigt, eine gut aussehende Frau ist – sie zeigt sich darauf allerdings mit einem Mann, der ihr den Arm um die Schultern legt. Ihr Freund oder ein ehemaliger Student? Wichtiger ist ohnehin: Davi erweckt in seinem Vorstellungstext den Eindruck, es gehe ihm vor allem darum, Fremdsprachen kennenzulernen. Ich aber will mein Portugiesisch praktizieren. Erica erwähnt ihr Interesse für Rios Geschichte und ihre Kontakte zur Kunstszene. Das passt gut. Überhaupt kann sie als erwachsene Frau, die mitten im Leben steht, wohl besser vom Wandel in Brasilien erzählen, über den ich mehr wissen will.
Wir chatten auf Skype.
»Ich bin in Rio geboren und aufgewachsen, aber ich bin kein typisches Rio-Girl«, schreibt Erica. »Als ich 14, 15 war, verbrachte ich etwas Zeit in der Schweiz und lernte dort Französisch. Das hat meine Persönlichkeit beeinflusst.«
Ich antworte: »Interessant. In welcher Hinsicht entsprichst du nicht den Stereotypen von Rio?«
»Die Leute denken, wir sind große Fußballfans, tanzen im Karneval und liegen im knappen Bikini am Strand – auf mich trifft nichts davon zu. Auch schütze ich meine Privatsphäre sehr.«
»Kein Problem, ich habe in China gelebt, wo dir Menschen sehr wenig über ihre privaten Gefühle erzählen, wenn sie dich nicht gut kennen. Ich bin sicher, im Vergleich zu denen gehst du richtig aus dir heraus. Erzähle mir etwas über deine Arbeit.«
»Meine? Verglichen mit deiner?! Ich habe den langweiligsten und stumpfsinnigsten Job der Welt.«
»Aha, was machst du genau?«
»Ich arbeite in einem Unternehmen, das fünf Prozent der Einnahmen aller Industriebetriebe von Rio erwirtschaftet, mit Öl und Autos. Mit diesem Geld werden Schulen, Ärzte, Zahnärzte, Sport und andere Angebote für die Bürger von Rio finanziert. Ich arbeite als Assistentin in der technischen Abteilung.«
»Das hört sich doch spannend an! Ich arbeite im Moment in einer TV-Produktionsfirma, deren Anteil am Hamburger Wirtschaftsprodukt kaum zählbar ist und die nichts für gute Zwecke spendet.«
Ärger gehört bei solch einem abrupten Wechsel auf die andere Hälfte der Erdkugel dazu, meist wird er durch Kleines ausgelöst. Der Nachmieter für meine Wohnung, ein niederländischer Geschäftsmann, ist nicht zur Übergabe erschienen. Hat er inzwischen etwas anderes gefunden? Mir drohen zwei Monate doppelte Miete in zwei teuren Metropolen, Hamburg und Rio de Janeiro.
Den aufwendigen interkontinentalen Umzug erspare ich mir, verfrachte Bücher und Möbel in ein Lagerhaus. Im Ergebnis wiegen meine beiden Koffer für den Flug Hamburg-London-Rio zusammen 39 Kilo. Um eine saftige Gebühr für Übergepäck zu vermeiden, besuche ich meinen Nachbarn, einen Chinesen aus Singapur, der am Hamburger Flughafen den Check-in von British Airways leitet. Er lächelt: »Du fliegst nach Rio de Janeiro– weil die Wirtschaft dort boomt und viele Geschäftsleute dort hinreisen, haben die Brasilianer gegenüber den Engländern durchgesetzt: Selbst in der Economy Class darf jeder zwei Koffer aufgeben und hat 32 Kilo Freigepäck – pro Koffer.« In solch ein Land fliege ich gerne.
Während ich dies schreibe, ruft der Makler an: Nachmieter und Hausverwaltung haben doch noch zueinandergefunden. Ohne meine Kaution zu verlieren, wandere ich aus nach Brasilien, in ein Land voller aufregender Geschichten. Ich bin nicht zum ersten Mal dort. Eine Rückblende.
Hitler Marubo
Hitler lebt. Gemeinsam mit seiner Frau, seiner Tochter und seiner Schwester bewohnt er ein nahezu unmöbliertes Zweizimmerapartment in Manaus, Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonas und einer der Spielorte der Fußball-WM 2014. Die Polizei rät wegen der hohen Verbrechensrate von Spaziergängen durch das Viertel ab. Bei den meisten Häusern ist der rote Backstein nicht verputzt. Hitler sitzt in Bermudashorts auf dem Terrassenboden, sein Oberkörper ist nackt. Unten auf der Straße spielen Jungs Fußball, aus einem der Nachbarhäuser klingt das »Nossa Nossa« aus dem brasilianischen Welthit von Michel Teló. Hitler ist jetzt 31 Jahre alt. Er macht eine Ausbildung zum Krankenpfleger und hat eine E-Mail-Adresse von Google.
Heute bringt es keine Vorteile mehr, Hitler zu heißen, auch nicht hier am Amazonas. In der Schule wurde Hitler wegen seines Namens verprügelt. Spanien hat ihm die Einreise verweigert. Besitzer von Kopierläden schicken ihn weg, wenn er seine Zeugnisse vervielfältigen will. Hitler heißt mit vollem Namen Hitler Marubo. Er ist ein Aktivist der UNIVAJA, der Union der eingeborenen Völker im Javari-Tal. Sein Vater hat ihm »Hitler« als Vornamen gegeben, weil er ihn für einen geborenen Führer hielt und nichts über die Naziverbrechen Adolf Hitlers wusste. Der Nachname »Marubo« bezeichnet seinen Indianerstamm. »Marubo« ist in Deutschland deutlich weniger geläufig als »Hitler«. Doch das soll sich jetzt ändern, durch eine Initiative aus Thüringen. Ihre Losung lautet: »Rettet die Marubo, und ihr rettet ein besonderes Stück Natur.«
Heute erhält Hitler Marubo Besuch aus Weimar, wo die Nazis im nahen Konzentrationslager Buchenwald 56000 Menschen ermordeten. Hitler trägt einen militärischen Kurzhaarschnitt, sein Gast Guilherme Werlang hat das lange Haar zu einem Zopf zusammengebunden. Der Brasilianer deutscher Herkunft ist Gastprofessor für Ethnologie an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Werlang vertritt hier die Hilfsorganisation Ourchild e.V. aus dem Kurort Bad Sulza in Thüringen. Die Landschaft wird seit einigen Jahren als »Toskana des Ostens« vermarktet, wegen ihrer Hügel, des Weinbaus und des Tourismus. Dieser Werbegag stammt von Marion Schneider und Klaus Dieter Böhm, einem aus dem Westen zugezogenen Unternehmer-Ehepaar. Ich kenne sie aus der Zeit, als sie noch jung und Kommunisten waren – beides Eigenschaften, die damals auch auf mich zutrafen. Heute verdienen die beiden ihr Geld im Bäder-Business und stecken auch hinter Ourchild e.V. Sie haben mir von diesem Projekt erzählt, ich wollte darüber berichten – deshalb reise ich im August 2012 mit Professor Werlang den Amazonas entlang.
Wie große Käfige wirken die vergitterten Schlafsäle im Casa de Apoio, dem »Haus der Hilfe« von Tabatinga, der brasilianischen Grenzstadt zu Kolumbien. Alle 35 Patienten sind Indianer, alle leiden an Hepatitis B oder D oder der Kombination von beidem, einer sogenannten Superinfektion, die meist tödlich endet. Sie spucken Blut.
Der Regenwald ist kein Neuland für Professor Werlang. Er hat als Kulturanthropologe viele Jahre im Javari-Tal geforscht, erkrankte dabei zweimal an Malaria. Der Javari ist ein Nebenfluss des Amazonas. An seinen Ufern leben etwa 6000 Indianer, neben den Marubo auch die Mayoruna, die Matis, die Kanamari, die Kulina und die Korubo.
Nirgendwo sonst auf der Welt findet man so viele Menschen, die bisher keinen Kontakt zur Zivilisation hatten. Werlangs wissenschaftliche Arbeit konzentriert sich auf Musik und Gesang der Marubo.
Doch selbst Werlang, der schon viel erlebt hat, ist im Casa de Apoio erschüttert: Er sieht dort den ausgemergelten Almir wieder, einen Marubo, den er vor vierzehn Jahren als fröhliches Kind gekannt hat. Jetzt wartet der junge Mann nur noch auf seinen Tod. Werlang hat nicht erwartet, ihn hier zu treffen. Er hat nicht einmal gewusst, dass Almir an Hepatitis B erkrankt ist.
Der Kurort Bad Sulza hat 2926 Einwohner und ist damit deutlich größer als der Stamm der Marubo mit 1688 Angehörigen – nach Angaben des brasilianischen Gesundheitsministeriums. Die Marubo selbst halten diese Zahl sogar für übertrieben, denn sie erleben jeden Monat den Tod von Verwandten. Mehr als fünfzig Prozent von ihnen leiden an Hepatitis B, häufig verbunden mit Hepatitis D. Ihr Volk ist vom Aussterben bedroht – ebenso wie die anderen Indianerstämme im Javari-Tal. Während der vergangenen zehn Jahre erreichte die Sterberate bei ihnen eine Quote von 7 bis 16 Prozent der gesamten Bevölkerung (zum Vergleich: in Deutschland liegt die Sterberate bei etwa einem Prozent). Die Gegend weist prozentual die weltweit meisten Hepatitis-Erkrankungen auf. Seit dem Jahr 2000 tötete die Krankheit 325 Indianer im Javari-Tal. Am häufigsten sterben Säuglinge, die weniger als ein Jahr alt sind. Immer wieder trauern die Familien um ihre kleinen Kinder. Die Zahl der Toten gleicht der in Kriegsgebieten wie Afghanistan.
Per Ferndiagnose hat der Landrat im Kreis Weimarer Land, Hans-Helmut Münchberg, die Ursache erkannt: »… der zunehmende Kontakt dieser Völker mit der Außenwelt und mit der umgebenden nationalen Gesellschaft.« Der Vormarsch der Zivilisation habe »verheerende Auswirkungen auf ihr Wohlergehen und auf ihre physische und kulturelle Unversehrtheit«. Auch sieht er einen Zusammenhang zwischen der Ausbreitung von Hepatitis und der »akuten Bedrohung des regionalen wie auch des globalen ökologischen Systems durch unkontrollierte Abholzung und wirtschaftliche Ausbeutung des Regenwaldes«.
Tatsächlich wird Hepatitis B vor allem beim Sex übertragen. Indianer jobben oder studieren in den Städten, haben dort Liebesbeziehungen oder gehen zu Prostituierten. Dann kehren sie in ihre Großfamilien zurück. Dort schlafen die Frauen auch mit den Brüdern ihres Mannes, ein etwa bei den Marubo verbreitetes Gewohnheitsrecht. Die Mütter vererben die Krankheit dann bei der Geburt an ihre neugeborenen Kinder. Hilfe wie die aus Thüringen ist also dringend notwendig, um beispielsweise Impfungen zu bezahlen und Kondome zu verteilen. Da die Indianer in wenig erschlossenen Teilen am Amazonas nur schwer zu erreichen sind, denken die Unterstützer an ein Sanitätsschiff – sie selbst leben an den Ufern von Saale, Werra und Gera.
Dabei wollen es die kulturell sensiblen Deutschen aber nicht belassen. Um hier nichts Fremdes überzustülpen, sollen auch die Schamanen mit ihren Zauberkräften heilen.
Schamane Robson Dionisio Doles Marubo, mit Indianernamen Venapa Iskonáwavo, liegt auf der Hängematte und klickt in seinem Handy Fotos einer Freundin an. Das Dach aus Schilfrohr reicht bis zum kahlen Erdboden, an Seilen hängen Bananen und Unterhosen. Estêvão Marubo, das 58-jährige Oberhaupt einer dreißigköpfigen Großfamilie, hat den Schamanen in ihr Langhaus eingeladen, um der jüngsten seiner drei Frauen, der 24-jährigen Têpi, das Kopfweh auszutreiben. Die Indianer hocken auf Baumstämmen, empfangen so den »Spirit«, wie es heißt – auch ganz wörtlich in Form von Ayahuasca, dem Gebräu aus der gleichnamigen Dschungelliane. Es löst Halluzinationen aus. Der 31-jährige Schamane singt in Trance: »Jüngere Brüder! Hört mir zu! Öffnet eure Ohren!« Die Männer fangen an zu zittern.
Das ferne Thüringen fördert dieses Ritual der Marubo-Indianer im Regenwald, nahe dem Dreiländereck von Brasilien, Kolumbien und Peru. »Ich bin persönlich bewegt von der dramatischen Gesundheitssituation der indigenen Völker dort«, schreibt Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht in einem Empfehlungsschreiben für die Hilfsorganisation Ourchild e.V. Die CDU-Politikerin gehört zum Beirat des Vereins.
»Die Schlange des Todes ist da!«, ruft Estêvão Marubo. Im echten Leben ist von einer Schlange nichts zu sehen, aber tatsächlich springt ein Frosch zwischen den Beinen der Andächtigen herum. Der Sprechgesang des Familienoberhaupts geht weiter: »Die toten Menschen vom Fluss gehen in ihre Langhäuser.« In seinem Langhaus ist es mittlerweile eine Stunde nach Mitternacht. Schamane Robson liegt weiter in der Hängematte und zuckt heftig. Die Indianer schnupfen Tabak aus meterlangen Rohren. Mit beiden Nasenlöchern dabei ist Guilherme Werlang, der Gastprofessor aus Weimar.
»Marubo und andere Indianer misstrauen der modernen Medizin«, sagt im Casa de Apoio die Krankenschwester Helena Peixoto. An diesem Abend betreut sie die Kranken allein mit einem Sicherheitsmann. Viele Patienten sind vor ihren Augen gestorben. »Nur wenn man die Schamanen einbezieht, glauben einem die Eingeborenen.«
Selbst der Arzt Waldery Nobre de Mesquita, als Leiter der Gesundheitsbehörde von Tabatinga zuständig für diesen Teil des Amazonasgebietes, findet das Ansinnen der Thüringer nicht so absurd, wie es klingt: »Die moderne Medizin kuriert die körperlichen Symptome, die indianische die Seele«, erklärt er. Auch kann sie manchen Krankheiten vorbeugen, genauso wie Naturheilverfahren in anderen Regionen der Welt, ich denke dabei an die Erfolge der traditionellen chinesischen Medizin, über die ich immer wieder berichtet habe.
Nicht überraschend wird Guilherme Werlang auch von Guilherme Werlang unterstützt – einem entfernten Verwandten und Namensvetter, der als katholischer Bischof die sozialen Projekte der Kirche betreut. »Wir müssen die traditionellen Heilmethoden der Indianer einbeziehen«, meint er. »Sie kommen aus der Natur, wie die moderne Medizin auch.«
Deutlich unterscheiden sich aber die Arbeitszeiten. Schulmediziner kurieren lieber tagsüber, während die Stunde der Schamanen erst nach Sonnenuntergang schlägt. Die Thüringer haben das bedacht und sammeln deshalb auch für ein Internat, in dem rund um die Uhr unterrichtet werden soll, Weltliches am Tag, Übersinnliches in der Nacht. »Schamanischer Unterricht kann nur nachts stattfinden«, erklärt Marion Schneider, die Vorsitzende von Ourchild e.V. in Bad Sulza, »weil die Geister, die dabei gerufen werden, nur nachts erscheinen.«
In einem interkulturellen Austausch helfen nicht nur die Thüringer den Indianern, sondern auch die Indianer den Thüringern. So lud Marion 2011 zu einem Workshop über »Heilung aus dem Regenwald« ins Schloss Auerstedt. Weltberühmt ist der Ort mit 457 Einwohnern, inzwischen von Bad Sulza eingemeindet, aufgrund der Schlacht zwischen Napoleons Truppen und den Preußen 1806. Den Workshop leitete kein anderer als Marubo-Schamane Robson– gemeinsam mit Benedito Dionisio da Silva Ferreira.
Benedito sieht ein bisschen so aus wie Anthony Quinn als Quasimodo im Film Der Glöckner von Notre Dame. Der 49-jährige Heiler und Lehrer der Marubo spielt eine Schlüsselrolle bei dem Schulprojekt, das die Thüringer unterstützen. Auch dabei verbindet sich Spirituelles mit ganz praktischen Nöten. »Unsere Familien leben in 13 Dörfern verstreut. Um von einem Schüler zum nächsten zu gelangen, muss ich oft eine Woche durch den Regenwald wandern oder mehrere Tage mit dem Boot fahren«, sagt Benedito. »Ein Internat, in dem die Schüler wohnen, wird ein Glück für ihre Bildung sein.« Deshalb wird das Schulvorhaben auch von der Amazonas-Staats-Universität gefördert, die nicht unter Verdacht steht, Hokuspokus zu unterrichten. Sie wird Lehrer stellen und Schulmaterial liefern.
Wer zu den Marubo will, braucht das Boot. Das Amazonasbecken erstreckt sich über die Hälfte der Fläche Brasiliens. Um auf die Anlegestelle von Tabatinga zu gelangen, muss man über dünne Bretter balancieren. Wer nicht aufpasst, stürzt in den Amazonas, den mit Abstand wasserreichsten Fluss der Erde. Sobald alle zwanzig Plätze besetzt sind, fährt das Motorboot los. Auf beiden Seiten erhebt sich der tropische Regenwald. Dreißig Prozent dieser Lunge der Erde gehören zu Brasilien. Kein Baum gleicht dem anderen, fünfzig Meter hohe Paranussbäume stehen neben Palisanderhölzern mit ihren Hülsenfrüchten. Über 50000 verschiedene Baumarten wachsen im tropischen Regenwald wild durcheinander. Zum Vergleich: In Nordwesteuropa blühen ganze vierzig Baumarten.
Nach einer Stunde Bootsfahrt folgt eine weitere im Auto. An einer Tankstelle, genauer gesagt einer winzigen Hütte, wird Treibstoff aus einer Plastikflasche in den Tank gegossen.
Immer wieder ist von Hitler die Rede in Atalaia do Norte am Javari, dem Nebenfluss des Amazonas. In dem 7000-Einwohner-Ort leben Eingeborene aus dem Umland auf provisorisch zusammengezimmerten Holzstämmen und Brettern im Wasser, direkt vor einem Müllhaufen. Auf der Wäscheleine sitzt ein Papagei. Eine im siebten Monat schwangere Indianerin trägt einen knappen Bikini, wäscht sich mit Wasser aus dem Javari, das sie mit der Seifendose über sich gießt. Sie ist mit ihrer Familie in der Kreisstadt, um sich bei der örtlichen Indianerbehörde Sozialhilfe abzuholen.
Gastprofessor Werlang aus Weimar trifft sich hier mit Aktivisten der Indianerbewegung. Doch Hitler, dem hier alle folgen, sei spurlos verschwunden, heißt es.
Tage später findet ihn der Weimarer Professor in Manaus. Hitler begrüßt das Projekt aus dem Land, mit dem er von Geburt an durch den Namen verbunden ist. Wie der historische Hitler liebt er große Worte und Gesten, auch wenn er sonst nicht mit ihm zu vergleichen ist. »Wenn jetzt nichts passiert, gibt es unser Volk in wenigen Jahrzehnten nicht mehr«, sagt er. »Ich habe schon sechzig meiner Verwandten sterben sehen.« Die Regierung Brasiliens habe die Hepatitis-Gefahr »kriminell vernachlässigt«, wolle die Indianer »ausrotten« und dann den Regenwald abholzen. Dort werde sie dann Zuckerrohr und Getreide anbauen, um noch mehr Geld mit Ethanol-Kraftstoff zu verdienen.
Übrigens ein schönes Beispiel dafür, wie weltweit Aktivisten ihre in sich schlüssigen Überzeugungen auch dann vertreten, wenn sie den Tatsachen widersprechen. Ich erinnere mich daran, wie die westdeutschen Kommunisten Anfang der 1980er-Jahre behaupteten, in der Sowjetunion seien Atomkraftwerke nicht so gefährlich für die Bevölkerung, da sie in menschenleeren Gebieten Sibiriens stünden. Das war natürlich Unsinn, denn auch die Sowjetunion errichtete die AKWs da, wo der Strom gebraucht wurde, also nahe den Großstädten im europäischen Teil des Landes. Entsprechend baut Brasilien das Zuckerrohr, aus dem Ethanol gewonnen wird, zu 85 Prozent in den boomenden Bundesstaaten São Paulo und Paraná an und nicht im Regenwald, in dem es kaum Straßen gibt.
Der Völkermord Adolf Hitlers wird von seinem indianischen Namensvetter verurteilt. Hitler Marubo hat jetzt einen Antrag auf Namensänderung gestellt, aber die sei in Brasilien nicht einfach durchzubekommen. Seine zweijährige Tochter, die nichts außer einer Windel trägt, zupft ihn am Ohr. Er hat ihr den jüdischen Namen Noah gegeben – »als private Wiedergutmachung«, wie er sagt.
Krieg für WM und Olympia – wie Brasiliens Militärpolizei die Favelas erobert
Die Jungs in Flip-Flops und Bermudashorts tragen russische Kalaschnikows und American Rifles. Baumstämme, aus denen spitze Nägel ragen, versperren alle Einfahrtsstraßen – damit die Polizei nicht hineinkommt. Wir sind mitten in Rio de Janeiro, der Stadt von Fußball-WM und Olympischen Spielen. »Wärst du hier alleine, würden sie dich erschießen«, sagt der Niederländer Nanko van Buuren. Mit ihm zusammen nicht, ihn kennt hier jeder, er umarmt viele und küsst sie auf die Wangen, auch Männer, hebt den Daumen, was in Brasilien sowohl »Hallo« als auch »Okay« bedeutet, richtet den Zeigefinger auf sie und imitiert einen Pistolenschuss. Dabei kommt Nanko aus einer anderen Welt, schon rein äußerlich. Man könnte ihn einen »gut aussehenden älteren Herrn« nennen, 64 Jahre alt, weißes Haar, dunkles Jackett, weißes Hemd, helle Hose. Der promovierte Psychiater arbeitete für die Weltgesundheitsorganisation WHO, jetzt führt er seit mehr als zwanzig Jahren als Präsident das (IBISS), das »Brasilianische Institut für Erneuerungen in der sozialen Gesundheit«, eine Hilfsorganisation mit dreihundert Mitarbeitern. Die Leute sind Nanko sehr dankbar, denn er ließ hier die Kanalisation verlegen und eine Schule bauen. Auch für seine Projekte sammelt Ourchild e.V. aus Thüringen Geld. Er führt mich durch die Favelas Vila Nova und Vila Aliança, sie werden von Drogengangs beherrscht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!