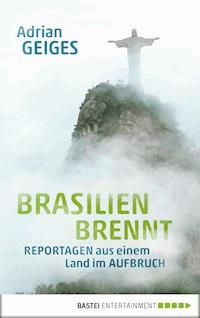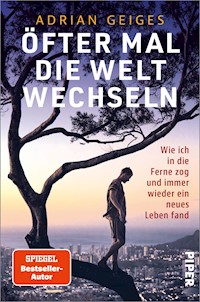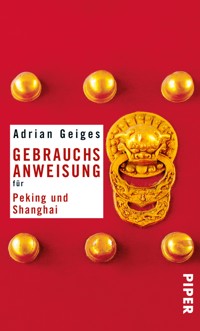21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
China und Russland sind die Speerspitze einer Bewegung gegen die Freiheit, die vom Iran bis nach Nordkorea reicht. Viele glauben nach wie vor, Putin und Xi Jinping seien nicht vergleichbar. Doch sie stehen in einer gemeinsamen Tradition, die mit der Oktoberrevolution von 1917 begann. Der langjährige Peking- und Moskau-Korrespondent Adrian Geiges erzählt die spannende Geschichte der chinesisch-sowjetischen und chinesisch-russischen Beziehungen, die die Welt heute mehr prägen denn je. Und er untersucht, auf welche »nützlichen Idioten« sich diese Allianz im Westen stützen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: picture alliance/ZUMAPRESS.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
Vorgeschichte
»Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht«
Umsturz im Auftrag des deutschen Kaisers
Wie Moskau die chinesische Revolution entfachte (1917–1949)
Lenins Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus – ein Buch mit revolutionärer Sprengkraft
Wie Moskau in Shanghai eine Partei gründete
Chiang Kai-shek – von Moskaus Musterschüler zum Schlächter der Kommunisten
Mao schießt sich an die Macht – mit sowjetischer Hilfe
Die Sowjetunion als großer Bruder Chinas (1949–1960)
Der Mann, der zurückblieb
Maos Treffen mit Stalin
Atomkrieg gegen den Imperialismus
Der Bruderkrieg: Wer führt die Weltrevolution? (1960–1985)
»Unter Maos Führung die ganze Welt befreien«
Weltpolitische Konflikte an einem See in Brandenburg
Killing Fields: Wie China die Revolution nach Kambodscha exportierte
Vietnam zwischen den Fronten
Wie sich Moskau und Peking wieder annäherten (1985–2000)
Gorbi und die Demos auf dem Platz des Himmlischen Friedens
Putsch in Moskau
Atomkrieger Schirinowski – ein geistiger Wegbereiter Putins
China als großer Bruder Russlands (seit 2000)
Die Seelenverwandten: Wladimir Putin und Xi Jinping
Die Restalinisierung Russlands und Chinas
Jagd nach »Spionen« überall: der Fall des Außenministers Qin Gang
Neue Seidenstraße – Weltrevolution mit wirtschaftlichen Mitteln
Was hat Putin gegen Schwule?
Chinesische Lösungen für die Welt: die Corona-Diktatur in Shanghai und anderswo
Das streng geheime Biowaffenlabor von Wuhan
Krieg gegen die Ukraine – und gegen Taiwan?
Nordkorea – vom Paria zum Partner auf Augenhöhe
Nützliche Idioten
Unternehmer/Manager mit kurzfristigen Profitinteressen – und willfährige Politiker
Autoritäre Rechte
»Antikolonialisten« (einst »Antiimperialisten«) und »Antirassisten«
Apokalyptiker
Wie verteidigen wir Frieden und Freiheit?
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
»Im Moment gibt es Veränderungen, wie wir sie seit 100 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und wir sind es, die diesen Wandel gemeinsam vorantreiben.«
Xi Jinping zu Wladimir Putin bei ihrem Treffen am 21. März 2023 in Moskau
»In einem Atomkrieg wird möglicherweise ein Drittel der Weltbevölkerung umkommen, möglicherweise die Hälfte. Doch dann bliebe immer noch die andere Hälfte übrig, der Imperialismus wäre am Boden zerstört, und die ganze Welt würde sozialistisch.«
Mao auf der internationalen Konferenz der kommunistischen Parteien am 18. November 1957 in Moskau
Vorgeschichte
»Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht«
Dieses Buch richtet sich nicht gegen Chinesen oder Russen, ganz im Gegenteil. Mit beiden Völkern bin ich eng verbunden. In Peking studierte ich Mandarin. Russisch lernte ich am Landesspracheninstitut der Ruhr-Universität Bochum, danach wohnte ich sechs Jahre in Moskau. Als ich ankam, war es noch die Sowjetunion, ich wurde dort Zeuge ihres Zusammenbruchs und erlebte den Beginn des neuen Russlands. Es folgten zehn Jahre in China, davon sechs in Peking, drei in Shanghai und eines in Hongkong. In beiden Ländern arbeitete ich als Auslandskorrespondent, für Spiegel TV beziehungsweise den Stern. In China leitete ich außerdem einige Jahre die Tochterfirma des deutschen Verlagshauses Gruner + Jahr, gründete dessen chinesische Zeitschriften, lernte die Volksrepublik also auch von ihrer wirtschaftlichen Seite kennen. Meine erste Frau war Russin, jetzt bin ich mit einer Chinesin verheiratet, unsere beiden Töchter wachsen zweisprachig auf. Ein Großteil meiner Freundinnen und Freunde sind Chinesen und Russen. Ich habe sogar einen chinesischen Namen, wie alle Ausländer, die in China gelebt haben, ich heiße Jia Jiesi (ausgesprochen Dsja Dsjese).
Dieses Buch richtet sich gegen Naivität. Nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb der Schweizer Schriftsteller Max Frisch sein Stück Biedermann und die Brandstifter. Darin nimmt der Haarwasserfabrikant Gottlieb Biedermann aus Gutmütigkeit Hausierer bei sich auf. Sie kündigen ihm nahezu unverblümt an: Wir werden Ihr Haus anzünden. Doch er nimmt sie nicht ernst und denkt, so schlimm werde es schon nicht kommen.
Ähnlich verhielt sich die freie Welt gegenüber den Machthabern in Russland und verhält sich weiter gegenüber den Machthabern in China – unter denen ihre eigenen Völker am meisten zu leiden haben. Dabei machten, wie ich zeigen werde, Lenin, Stalin und Mao, Putin und Xi Jinping nie einen Hehl aus ihrer diktatorischen Politik und ihren weltweiten Ambitionen. Die Herrscher in den Zeiten dazwischen, etwa Breschnew und Deng Xiaoping, äußerten sich etwas zurückhaltender, ohne das große Ziel aus den Augen zu verlieren. Es beruht auf einer Ideologie, die ich hier nicht mehr durchgängig als »Kommunismus« bezeichne, denn das träfe nur noch auf China zu. Ich werde diese Ideologie gelegentlich »Antiimperialismus« nennen, diese Formel vereinigt China und Russland seit Langem. Doch dieser »Antiimperialismus« führt in Wahrheit zu einem neuen Imperialismus, diesen Widerspruch werde ich auflösen.
Was qualifiziert mich zu dieser Analyse, neben der Kenntnis der Länder und Sprachen? Ich habe die gleiche Ausbildung genossen wie Xi Jinping und Wladimir Putin. Als junger Westdeutscher war ich überzeugter und aktiver Kommunist und wurde deshalb von meiner damaligen Partei, der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), für ein Jahr auf eine Kaderschmiede in der DDR entsandt, an die Jugendhochschule Wilhelm Pieck, die höchste Bildungsstätte der Freien Deutschen Jugend. Benannt war sie nach dem ersten Staatsoberhaupt der DDR, Pieck hatte während der Stalinschen Säuberungen in Moskau gelebt. In ihren besten Zeiten waren an der Jugendhochschule 53 Länder vertreten. Dort bildete man mich in unserem damaligen Verständnis zum »Berufsrevolutionär« aus. Mit mir studierten, neben dem politischen Nachwuchs der DDR, Aktivisten von Befreiungsbewegungen aus Afrika wie dem African National Congress (ANC), der in Südafrika gegen die Apartheid kämpfte, Sandinistinnen aus Nicaragua, Widerstandskämpfer gegen die Militärdiktatur in Chile und Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO.
Wir befassten uns mit den Werken von Marx, Engels und Lenin, in denen wir die Grundlage der Wissenschaft von der Gesellschaft sahen. Die Fächer hießen entsprechend »Wissenschaftlicher Kommunismus« (also quasi marxistische Politologie), »Dialektischer und historischer Materialismus« (marxistische Philosophie), »Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus« (marxistische Wirtschaftslehre) und »Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung«. Schon damals war unser Credo »Hört auf die Wissenschaft!«, das gab uns die Gewissheit, unumstößlichen Wahrheiten zu folgen. Natürlich hielten wir die Schlussfolgerungen aus diesen Erkenntnissen für alternativlos – oder wie wir es damals mit einem berühmten Zitat von Friedrich Engels (der sich wiederum auf Hegel berief) lernten: »Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit.«[1] Es war eine Wissenschaft mit Haltung. Ziel war nichts weniger als, mit den Worten von Karl Marx, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«.[2] Das vom deutschen Kommunisten Louis Fürnberg gedichtete Lied »Die Partei hat immer recht« spiegelt den Geist dieser Bewegung:
Denn wer kämpft für das Recht,
der hat immer recht.
Gegen Lüge und Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt,
ist dumm oder schlecht.
Wer die Menschheit verteidigt,
hat immer recht.
Bis dahin könnten die Zeilen auch von der selbst ernannten »Letzten Generation« stammen, die nächsten aber zeigen, wohin das führen kann:
So, aus Leninschem Geist,
wächst, von Stalin geschweißt,
die Partei, die Partei, die Partei.
Stalin war in unserer Zeit aus dem Text gestrichen, mittlerweile wird er von Putin und Xi Jinping wieder verehrt. Auch sie sind aufgewachsen mit der Überzeugung: Auf der richtigen Seite zu stehen rechtfertigt jedes Verbrechen. Bertolt Brecht lieferte in seinem Lehrstück Die Maßnahme die ultimative Entschuldigung: »Welche Niedrigkeit begingest du nicht, um die Niedrigkeit auszutilgen.«[3] Wir sahen uns in einem weltweiten Kampf gegen rassistische und koloniale Unterdrückung, so wie man das auch aus heutigen Debatten kennt. In der Sowjetunion und in China gab es damals ebenfalls solche Schulen für Gleichgesinnte aus anderen Ländern der Erde. Das gemeinsame Ziel hieß: Weltrevolution. Damals wie heute geht es also um die Weltherrschaft der »Guten«, der »Antiimperialisten«. Und da »das Wohl des Menschen« nach marxistisch-leninistischer Lehre nur durch eine Diktatur der Partei zu erreichen ist, lässt sich hier getrost von einer Weltdiktatur als dem Endziel sprechen.
Wie das so ist, wenn man glaubt, die absolute Wahrheit zu verkünden, gab es Streit darüber, wer diese Wahrheit für sich gepachtet hatte. Eines Tages hörten wir an der Jugendhochschule einen Alarm: An der Pforte des gut bewachten Geländes stünden Chinesen. Damals lag China im Streit mit der Sowjetunion, dem Schutzpatron der DDR. Worum es dabei ging, werde ich in einem Kapitel dieses Buches darstellen. Die Panik an der Jugendhochschule aber war umsonst: Bei den Besuchern handelte es sich in Wirklichkeit um Vietnamesen, also enge Verbündete der DDR.
Putin trat während seines Studiums Anfang der 1970er-Jahre der Kommunistischen Partei der Sowjetunion bei und gehörte ihr bis zu ihrer Auflösung 1991 an. Damit hat er an den gleichen Parteischulungen teilgenommen wie ich. Viele Jahre später, 2016, bekannte er: »Ich war nicht Parteimitglied, weil ich es musste. Ich mochte kommunistische und sozialistische Ideen sehr, und ich mag sie noch heute.«[4] Xi Jinping hat ein postgraduales Studium der marxistischen Philosophie und ideologischen Erziehung abgeschlossen. Seine Reden heute gleichen manchmal bis auf den Wortlaut dem, was wir damals gebüffelt haben. Noch immer glauben manche in Europa, China sei ganz anders als Russland oder die Sowjetunion, viel geschäftsorientierter. Jedes Land hat seine Besonderheiten, klar. Doch die Tendenz geht in beiden Ländern in die gleiche Richtung.
Im März 2024 besuche ich wieder einmal meinen früheren Wohnort Shanghai. Ich erkenne die einst so dynamische und weltoffene Stadt nicht wieder. Der internationale Flughafen Pudong ist verwaist, dabei wurde er am 1. Oktober 1999 als Prestigeobjekt zum 50. Gründungstag der Volksrepublik China eingeweiht. Im Vergleich zu früher leer sind auch die Einkaufspromenaden und Shoppingmalls. Xis Rückkehr zur kommunistischen Ideologie hat der Wirtschaft ebenso zugesetzt wie der extreme Lockdowns während Corona, bei dem er die Menschen monatelang in ihren Wohnungen einsperren ließ. Auch auf dem Renmin Guangchang, dem »Platz des Volkes« im Herzen der Stadt, ist kein Volk mehr. In den Fußgängerzonen steht alle hundert Meter ein Polizist, oft auch ein rot-blau blinkender Polizeiwagen oder gleich ein ganzer Mannschaftsbus. Überall sind Überwachungskameras angebracht, manchmal fünf an einer Stelle, damit kein Blickwinkel unbeobachtet bleibt.
Die einst so redseligen Taxifahrer schweigen während der Fahrt oder antworten auf harmlose Fragen zur Politik und Wirtschaft: »Über die Entscheidungen der zentralen Führung dürfen wir nicht sprechen.« Ein Reiseführer ist mir gegenüber gesprächiger. »Polizei, Polizei, überall Polizei«, schimpft er. »Selbst wenn sie gar nichts tun – so wird ein Klima der Angst geschaffen.« Die Partei fürchte jegliche Ansammlung von Menschen. Mittlerweile sei sogar das besonders bei Alten beliebte Schattenboxen an vielen Orten verboten. »Kürzlich ging ich mit einer Reisegruppe auf den Platz des Volkes, da stoppte uns die Polizei. Dies sei eine Demonstration! Und das nur, weil ich ein Fähnchen trug, damit die Touristen mich sehen konnten.«
Wir unterhalten uns über die Zukunft. Wie er meine auch ich: Europa ist übersättigt, die Gewichte der Welt verschieben sich nach Asien, egal unter welchem System. »Ich wünsche mir, dass China das führende Land der Erde wird«, sagt der mutige Mann, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte, um ihn nicht zu gefährden. »Aber wenn das ein China unter Xi Jinping ist, dann wird das für die Welt eine Katastrophe.«
Man hört viele Mythen über das chinesisch-russische Verhältnis. Das heutige Bündnis sei rein taktischer Natur, keine Liebesheirat. Klar, um Liebe geht es in der Politik nie, und schon gar nicht zwischen Ländern, sondern um Macht und Interessen, das ist eine Binsenweisheit. Doch der »neue Ostblock«, wenn man das geografisch einordnen will, hat tiefe ideologische Wurzeln und eine lange gemeinsame Geschichte, die ich hier erzählen möchte.
Umsturz im Auftrag des deutschen Kaisers[5]
Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das dachten sich die US-Amerikaner, als sie in den 1980er-Jahren im Kampf gegen die Sowjets die afghanischen Mudschahedin (abgeleitet von Dschihad, »Heiliger Krieg«!) unterstützten. Aus einigen von ihnen wurde später Al-Qaida. Heutzutage will der Westen immer noch den brutalen syrischen Diktator Assad loswerden – der Kampf gegen ihn trug aber zumindest indirekt dazu bei, dass sich der sogenannte Islamische Staat in Teilen Syriens ausbreiten konnte. Das Bündnis mit dem Feind des Feindes wird also leicht zum Bumerang, wie diese Beispiele zeigen. Noch aber sind sie nur Fußnoten der Geschichte im Vergleich zu dem, was am frühen Nachmittag des 7. Januars 1915 seinen Ausgang nahm, gut fünf Monate nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs.
Ein beleibter Mittvierziger, gut gekleidet, gepflegter Bart, Handschuhe und Zylinder, fährt vor der Kaiserlichen Deutschen Botschaft in Konstantinopel vor. Es handelt sich um den russischen Revolutionär Helphand, der unter seinem Kampfnamen Parvus bekannt ist. Drinnen empfängt ihn Botschafter Konrad Freiherr von Wangenheim. Der in Konstantinopel ansässige deutsche Agent Max Zimmer hat das Treffen eingefädelt. Mit großen Posen und in gewandter Rede unterbreitet Parvus dem Botschafter einen Plan: Die Kaiserliche Regierung müsse sich mit den russischen Revolutionären verbünden, »preußische Bajonette und russische Proletarierfäuste«, wie er sich ausdrückt, sollten sich vereinen. Nur so lasse sich der Zar, Deutschlands Kriegsgegner im Osten, besiegen. Er habe dafür bereits ein Aktionsprogramm entworfen, sagt Parvus: »Die Interessen der deutschen Regierung sind mit denen der russischen Revolutionäre identisch.« Am nächsten Tag kabelt der Botschafter ans Auswärtige Amt, spricht von einer »durchaus deutschfreundlichen Haltung« seines ungewöhnlichen Gastes und endet: »Bitte Dr. Parvus in Berlin empfangen.«
Der Russe war 1891 als Flüchtling nach Deutschland gekommen und hatte als Journalist bei sozialdemokratischen Blättern gearbeitet. Als die sächsische Regierung ihn 1898 aus Dresden ausweist, zieht er nach München. Dort lernt er einen anderen russischen Emigranten kennen, einen gewissen Wladimir Iljitsch Uljanow. Beide wohnen im Stadtteil Schwabing. Sie gründen die Zeitschrift Iskra, russisch für »Der Funke«, die in Deutschland gedruckt und dann ins Zarenreich geschmuggelt wird. Uljanow nutzt in München die Decknamen Iordan K. Iordanov und Mayer. Wie Parvus schreibt er außerdem unter einem Pseudonym, unter dem er später bekannt wird: Lenin.
Zunächst drucken sie die Zeitung in einer Parteidruckerei in Leipzig, dann in Parvus’ Wohnung in der Ungererstraße 80. Die Handpresse verfügt über eine besondere Funktion: Die fertigen Matrizen lassen sich mit einem Knopfdruck zerstören – eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall einer Hausdurchsuchung. Die Schwabinger Wohnung wird zu einem Treffpunkt der Genossen. Dort bringt Parvus Lenin mit Rosa Luxemburg zusammen und nimmt 1904 einen jüngeren russischen Revolutionär auf, Lew Davidowitsch Bronstein. Auch er nutzt einen Kampfnamen: Leo Trotzki.
Bald finden sie Gelegenheit, ihre revolutionären Theorien in die Praxis umzusetzen. Am 22. Januar 1905, einem Sonntag, ziehen 100 000 Arbeiter zum Winterpalais des Zaren in Sankt Petersburg, bitten um eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Sie tragen keine roten Fahnen, sondern Ikonen und Bilder von Zar Nikolaus II. Sie singen nicht die Internationale, sondern religiöse und patriotische Lieder. Trotzdem schießen Kosaken auf sie, den Befehl erteilt Großfürst Wladimir, der Onkel des Zaren. Nach unterschiedlichen Schätzungen sterben 200 bis 1500 Arbeiter. Dieser Tag geht als »Blutsonntag« in die russische Geschichte ein, löst Generalstreik und Revolution aus.
Gespalten in untereinander zerstrittene linke Kleingruppen, sind die russischen Emigranten im Ausland von den Nachrichten überrascht. Spontan entscheiden sich viele von ihnen für die Rückkehr nach Russland, wollen sich an die Spitze des Aufstands stellen. Trotzki erfährt in Genf davon, wählt den Weg über München, um dort mit Parvus zu sprechen, der sich selbst dann mit einem gefälschten Pass nach Sankt Petersburg durchschlägt. Er und Trotzki gehören zu den ersten Emigranten, die zurückkehren. Mit ihrem politischen Geschick und rhetorischen Talent gelangen sie bald an die Spitze der Bewegung. Die Arbeiter bilden Räte, auf Russisch Sowjets – 1905 ist die Generalprobe für die erfolgreiche Revolution 1917. Damals heißt es: »Trotzki spielte im ersten Sowjet der Arbeiterdeputierten die erste Geige – und Parvus schrieb die Noten dazu.«
Doch die Erhebung wird niedergeschlagen, die zaristische Polizei verhaftet zuerst Trotzki, dann auch Parvus. In der Haft treffen sie sich wieder, sie umarmen und küssen sich. Rosa Luxemburg kommt aus Deutschland angereist und besucht die beiden im Gefängnis. Sie dürfen sogar fremdsprachige Zeitungen lesen. Doch dann verbannt der russische Innenminister Parvus für drei Jahre nach Sibirien. In einem Gnadengesuch an den Minister spricht der Revolutionär die Furcht aus, die Verbannung könne zu seinem »vorzeitigen Tod« führen. Nach eigener Diagnose leidet der jetzt 39-Jährige an »chronischer Atonie der Nieren mit Magen-Darmkatarrh«. Statt der Verbannung solle man ihm lieber eine Kur »mit den heilenden Mineralwässern in Karlsbad« gewähren.
Aber Parvus muss den beschwerlichen Gefangenentransport mitmachen, der ihn mehrere Wochen lang in Zügen, Fuhrwerken und Booten nach Sibirien bringt. Einige der Gefangenen haben Flaschen mit 95-prozentigem Alkohol bei sich, um die Qualen leichter zu ertragen. Parvus überzeugt sie, dass es besser ist, die Flaschen den Bewachern zu schenken und, wenn diese betrunken sind, die Flucht zu versuchen. Bald torkeln die Wächter. Beim Besteigen eines Boots nutzt Parvus das Durcheinander aus an Bord drängenden Passagieren, Strafgefangenen, Bauern und Händlern zur Flucht. Er kleidet sich zur Tarnung wie ein Muschik, ein einfacher russischer Bauer, trägt gegürteten Kaftan, Hosen und Stiefel. Im Zug zurück nach Sankt Petersburg nimmt er die letzte Klasse, isst und trinkt mit den mitreisenden Bauern und spielt mit ihnen Karten. Doch die Flöhe führen ihm zu Bewusstsein, dass es leicht ist, einen Muschik zu spielen, aber wesentlich schwerer, mit anderen Muschiks zu leben. In der nächsten Stadt wechselt er die Kleider und sieht jetzt wie ein vornehmer Herr aus.
Er schwört dem armen asketischen Leben ab, die neue Philosophie des Kommunisten Parvus lautet: Nur mit Geld lässt sich die Welt verändern. In Konstantinopel baut er mit großem Erfolg ein Firmenimperium auf, das mit Getreide und Waffen ebenso handelt wie mit Holz und Eisen. Sogar Banken gehören ihm. Rosa Luxemburg und andere seiner Freunde und Genossen sind entsetzt. Trotzki schreibt einen »Nachruf auf einen lebenden Freund«. Einige Genossen spotten, Parvus sei nur in die osmanische Metropole gezogen, um »die Polygamie an bester Quelle zu studieren«.
Doch als 1914 der Erste Weltkrieg beginnt, ist seine Stunde gekommen. Das Treffen mit dem deutschen Botschafter in Konstantinopel macht den Anfang. Im Februar 1915 reist Parvus nach Berlin. Wie vom Botschafter vermittelt, besucht er das Auswärtige Amt in der Wilhelmstraße, wo ihn Staatssekretär Gottlieb von Jagow empfängt. Auch Max Zimmer, der Agent, ist wieder dabei. Parvus erläutert seine Idee von einem Generalstreik in Russland, der den Zaren in die Knie zwingen werde. Um Aufrufe dafür zu verbreiten, benötige er deutsches Geld. Auch solle Deutschland nationale Unabhängigkeitsbewegungen in den russischen Provinzen unterstützen. Der Staatssekretär unterbricht den hitzigen Vortrag: Parvus solle seine Vorstellungen erst einmal zu Papier bringen, dann werde man weitersehen.
Innerhalb weniger Tage entwirft Parvus seinen Plan für die Russische Revolution, ein mit der Maschine geschriebenes Papier von 23 Seiten. Wichtige Punkte sind:
»Ein politischer Massenstreik in Russland unter der Losung: Freiheit und Frieden«
»Dieses Werk kann nur unter der Leitung der russischen Sozialdemokratie zustande kommen. Der radikale Teil der letzteren ist bereits in Aktion getreten.«
»Aufstand der Schwarzmeerflotte«
»Petroleumdepots in Brand setzen«
»Eine besondere Beachtung ist Sibirien zu widmen. Man kennt es in Europa nur als Land der Verbannung. Es lebt aber längs der großen sibirischen Tracen, an der Eisenbahn und den Flüssen ein starker Bauernstand, von stolzem und unabhängigem Sinn.«
»Zugleich müsste man Vorsorge treffen, um die politischen Deportierten (in Sibirien) nach dem europäischen Russland entkommen zu lassen. Dies ist eine reine Geldfrage. Man kann auf diese Weise mehrere Tausend der tüchtigsten Agitatoren, die große Verbindungen besitzen und eine schrankenlose Autorität genießen, nach den oben genannten Agitationszentren und nach Petersburg dirigieren.«
»Broschüren in russischer Sprache können in der Schweiz herausgegeben werden.«
»Es ist der Abfall des Kaukasus möglich … Die Bevölkerung dort würde gewiss eine muselmanische Regierung vorziehen.«
»Sturz der (russischen) Regierung und rascher Friedensschluss«
»Technische Voraussetzungen zu einem Aufstand in Russland: a) Beschaffung genauer Karten russischer Eisenbahnen und Bezeichnung der wichtigsten Brücken, deren Zerstörung notwendig ist, um den Verkehr lahmzulegen … b) Genaue Angabe der Menge von Sprengstoffen, die zur Erreichung des Zieles in jedem einzelnen Fall notwendig ist … c) Klare und populäre Anweisung über die Handhabung der Sprengstoffe bei Brückensprengungen, Sprengung von großen Gebäuden. d) Einfache Rezepte zur Zubereitung von Sprengstoffen.«
»Finanzielle Unterstützung der sozialdemokratischen Majoritätsfraktion, die den Kampf gegen die zaristische Regierung mit allen Mitteln fortführt. Die Führer sind in der Schweiz aufzusuchen.«
Mit der sozialdemokratischen Majoritätsfraktion meint er die Bolschewiki, die spätere Kommunistische Partei der Sowjetunion. Und mit deren Führern vor allem einen: den zu dieser Zeit in der Schweiz lebenden Lenin. Anders als Parvus hat dieser übrigens den Ersten Weltkrieg nicht vorausgesehen. Noch 1913 schrieb er: »Ein Krieg zwischen Österreich und Russland wäre für die Revolution (in ganz Osteuropa) sehr nützlich, aber es ist kaum anzunehmen, dass uns Franz Joseph und unser Freund Nikolaus dieses Vergnügen bereiten.«
Einen guten Monat nach Eingang des Parvus-Plans hat der Staatssekretär dessen Vorschläge geprüft und telegrafiert an das Reichsschatzamt: »Zur Unterstützung der revolutionären Propaganda in Russland werden hier zwei Millionen Mark benötigt.« Alles in allem wird das deutsche Kaiserreich in den kommenden Jahren eine Milliarde Mark in den Sieg der kommunistischen Revolution investieren. Ziel: das Ausscheiden Russlands aus dem Krieg und damit aus der antideutschen Front. Mittelsmann im Auftrag des Kaisers ist Parvus selbst. Seine einstige Mentorin, die linke Ikone Clara Zetkin, nennt ihn einen »Zuhälter des Imperialismus«.
Ein anderer Revolutionär hat da weniger Berührungsängste. Ende Mai 1915 reist Parvus zu seinem alten Kampfgenossen Lenin, der damals in der Berner Länggasse lebt. Seine bescheidene Wohnung besteht nur aus einem Raum mit Küche. Es riecht nach Kohlsuppe. Hier reden sie über eine Revolution in Russland. Nach außen aber wahrt Lenin Distanz zu dem in linken Kreisen mittlerweile umstrittenen Geschäftsmann. Die österreichische Slawistin Elisabeth Heresch schreibt in ihrem Buch Geheimakte Parvus: »Wie Parvus seinen Reichtum zur Schau stellt, wirkt auf seine Landsleute provokant. Alles spricht davon, dass er im Zürcher Nobelhotel Baur au Lac angeblich bereits zum Frühstück eine Flasche Champagner leere und dabei von einem Harem molliger, attraktiver Blondinen umgeben sei.«[6] Das Geld von Parvus nimmt Lenin aber gerne.
Parvus zieht von Konstantinopel nach Kopenhagen, residiert jetzt in einer pompösen dreigeschossigen Villa in der vornehmen Vodroffsvej-Straße. Wegen der Nähe zu Russland betreibt er seine Geschäfte nun von hier, außerdem leitet er ein 18-köpfiges Agentennetz, getarnt als »Institut zur Erforschung der sozialen Folgen des Krieges«. Sein Geschäftssinn ist ebenso gut wie sein Geschick als Agent und Revolutionär. Er handelt mit allen Seiten, ist der Prototyp des Kriegsgewinnlers: Baumwolle aus der Türkei verschiebt er nach Russland, wo sie den nicht mehr enden wollenden Bedarf an Uniformen deckt. Er verkauft kriegswichtige Metalle wie Kupfer, Zinn und Aluminium. Von Kautschuk und Kaviar bis zu Kognak und Kondomen hat er alles im Angebot.
Im Juli 1915 wird Parvus von Graf Ulrich von Brockdorff-Rantzau empfangen, dem deutschen Botschafter in Kopenhagen (in der Weimarer Republik wird er deutscher Außenminister werden). Dieser ist jetzt der Verbindungsmann zwischen Parvus und der deutschen Regierung. Parvus berichtet ihm von seinen Plänen zum Sturz des Zaren. Der Diplomat aus altem Adel, der nie ohne Siegelring erscheint, ist ganz anders als dieser Revolutionär und Lebemann, respektiert ihn aber für seine Klugheit und Verbindungen, hält ihn im Interesse Deutschlands für wichtig. Nach dem Gespräch schreibt der Graf an den deutschen Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg: »Der Sieg und als Preis der erste Platz in der Welt ist unser, wenn es gelingt, Russland rechtzeitig zu revolutionieren und dadurch die Koalition zu sprengen.« Und fügt über Parvus alias Helphand persönlich hinzu: »Dass Dr. Helphand weder ein Heiliger noch ein bequemer Geist ist, steht fest; er glaubt aber an seine Mission und hat eine Probe seiner Befähigung während der Revolution nach dem Russisch-Japanischen Krieg abgelegt.«
Parvus möchte vom Reichskanzler empfangen werden, doch wird dies abgelehnt. »Leute wie Parvus sollten nicht zu den obersten Stellen vorgelassen werden«, heißt es in Berlin. Doch vom 16. bis zum 20. Dezember 1915 besucht er dort erneut das Auswärtige Amt und diesmal zusätzlich das Reichsschatzamt. Staatssekretär Karl Helfferich sagt ihm eine weitere Million zu – diesmal in Rubel. Der ist damals doppelt so viel wert wie der US-Dollar. Wenige Tage später erhält Parvus das Geld in bar und quittiert handschriftlich, »am 29. Dezember 1915 eine Million Rubel in Banknoten zur Förderung der revolutionären Bewegung in Russland von der deutschen Gesandtschaft in Kopenhagen erhalten« zu haben. Lenins Vertrauter und Geldbeschaffer Jakob Fürstenberg, später Leiter der sowjetischen Notenbank, wird kaufmännischer Direktor in der Kopenhagener Import- und Exportfirma von Parvus. Die deutsche Kriegskasse finanziert über ihn den Druck der bolschewistischen Parteizeitung Prawda, um die sich die Revolutionäre scharen. Aus Deutschland werden der Firma Scheinkredite gewährt, die nie zurückzuzahlen sind. Das Geld fließt an die russischen Bolschewiki. Als Lenin sich darum sorgt, das könne bekannt und gegen ihn ausgeschlachtet werden, beruhigt Parvus ihn: »Glauben Sie meiner Erfahrung, Wladimir Iljitsch, bei großen Dingen wird man nie ertappt. Nur kleine Fische gehen ins Netz.«
Wie Moskau die chinesische Revolution entfachte (1917–1949)
Lenins Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus – ein Buch mit revolutionärer Sprengkraft
Man muss nicht wie ich in Basel geboren sein, um zu wissen: Die Schweiz steht für vieles, aber nicht unbedingt für den Kommunismus. Und doch stammt das Konzept einer proletarischen Weltrevolution aus der Spiegelgasse in Zürich. Sie ist nur 160 Meter lang und an manchen Stellen so schmal, dass gerade mal drei Personen nebeneinander über den Pflasterstein gehen können. Gesäumt wird sie von Gebäuden aus dem Mittelalter, wie man es aus europäischen Städten kennt, die von den Kriegen des letzten Jahrhunderts verschont blieben, etwa Stockholm und eben Zürich. Am Haus mit der Nummer 14 hängt eine Gedenktafel: »Hier wohnte vom 21. Februar 1916 bis 2. April 1917 Lenin, der Führer der russischen Revolution.« Allerdings ist Lenin damals noch kein Führer, sondern ein mittelloser Flüchtling aus dem zaristischen Russland, der ständig den Wohnort wechseln muss und jetzt von Bern nach Zürich umgezogen ist. Zusammen mit seiner Ehefrau Nadeschda Krupskaja lebt er im Haus »Zum Jakobsbrunnen« als Untermieter in einem Zimmer, das zur Wohnung des Schuhmachers Titus Kammerer gehört. Oft scheint die Sonne hinein, die Fenster sind nach Süden ausgerichtet. Doch das russische Pärchen öffnet sie nicht, denn es stinkt aus der Wurstfabrik im Hinterhof.
Lenin verbringt deshalb die meiste Zeit in der Wasserkirche, wo die Stadtbibliothek untergebracht ist, die damals gerade mit der Kantonsbibliothek zur Zentralbibliothek zusammengelegt wird. Dort schreibt er an einem Buch, mit dem er »raus aus dem kleinbürgerlichen bürokratischen Käfig« kommen will. Er verspricht sich von seinem neuen Werk, »die revolutionär gesinnte Jugend aus verschiedenen Ländern« zu gewinnen. Der Titel: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Doch zunächst einmal beklagt er sich über die schlechten Arbeitsbedingungen: Literatur aus Frankreich, England und Russland sei in der Schweiz nur schwer zu bekommen.[1]
»Der Kapitalismus ist zu einem Weltsystem kolonialer Unterdrückung und finanzieller Erdrosselung der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung der Erde durch eine Handvoll ›fortgeschrittener‹ Länder geworden«, pinselt er auf sein Blatt. »Und diese ›Beute‹ teilen sich zwei, drei weltbeherrschende, bis an die Zähne bewaffnete Räuber (Amerika, England, Japan), die die ganze Welt in ihren Krieg um die Teilung ihrer Beute mit hineinreißen.«[8]
Wladimir Iljitsch Uljanow alias Lenin hat sich von einem braven Jungen in einen wütenden Mann verwandelt. Einst verehrte er seinen vier Jahre älteren Bruder Alexander, der an der Universität von Sankt Petersburg für Biologie eingeschrieben war. Als herausragender Student gewann er eine Goldmedaille für seine zoologischen Studien über Würmer. Bekannt machten ihn allerdings nicht diese Würmer, sondern die Tatsache, dass er das Gold verpfändete, um sich davon Dynamit zu kaufen. Mit einigen Freunden plante er ein Attentat auf Zar Alexander III. Das flog allerdings auf, der 21-Jährige wurde zum Tod verurteilt und starb am Galgen.
Der Verlust traumatisierte seinen jüngeren Bruder. Beide waren in einem bildungsbürgerlichen, liberalen und weltoffenen Haushalt aufgewachsen. Doch von bürgerlicher Moral wollte Wladimir jetzt nichts mehr wissen: »Wir glauben nicht an eine ewige Moral und entlarven alle Märchen über die Moral als Betrug.« Einst liebte er die »Appassionata«, die Klaviersonate Nr. 23 von Beethoven, vorgetragen auf dem Klavier. Jetzt nörgelte er: »Sie geht einem auf die Nerven und verleitet einen dazu, dumme, freundliche Sachen zu sagen, und Menschen, die etwas so Schönes zu schaffen vermochten, während sie in dieser widerwärtigen Hölle lebten, den Kopf zu streicheln. Man darf nämlich niemandem den Kopf streicheln, es könnte einem dabei die Hand abgebissen werden. Man muss ihnen erbarmungslos auf den Kopf schlagen, obwohl es unser Ideal ist, gegen niemanden Gewalt anzuwenden.«[9]
So wurde Lenin selbst zum Revolutionär. Doch jetzt, als er in Zürich vor sich hinschreibt, geht es längst nicht mehr nur um Russland und den Zaren, sondern um die ganze Welt. China interessiert ihn besonders. Er verweist auf die »außerordentlich hohe Bevölkerungsdichte« und sagt voraus: »China hat man erst zu teilen begonnen, und der Kampf um China zwischen Japan, den Vereinigten Staaten usw. verschärft sich immer mehr.«[10] Deshalb warnt er vor einem »Bündnis aller Mächte zur ›Befriedung‹ Chinas (man denke an die Niederwerfung des Boxeraufstands)«.[11] An anderer Stelle heißt es in seinem Buch: »Man nehme Indien, Indochina und China. Bekanntlich werden diese drei kolonialen und halbkolonialen Länder mit einer Bevölkerung von 600–700 Millionen Menschen vom Finanzkapital einiger imperialistischer Mächte – Englands, Frankreichs, Japans, der Vereinigten Staaten usw. – ausgebeutet.«[12] Er sieht eine ganz neue Etappe in der Geschichte der Menschheit heranreifen: »Monopole, Oligarchie, das Streben nach Herrschaft statt nach Freiheit, die Ausbeutung einer immer größeren Anzahl kleiner oder schwacher Nationen durch ganz wenige reiche oder mächtige Nationen – all das erzeugte jene Merkmale des Imperialismus, die uns veranlassen, ihn als parasitären oder in Fäulnis begriffenen Kapitalismus zu kennzeichnen.«[13] Die gute Nachricht aus Lenins Sicht: Es sei ein »sterbender Kapitalismus«.[14] Und deshalb werde »der Imperialismus der Vorabend der sozialistischen Revolution«.[15]
Etwas Ablenkung findet Lenin abends im Cabaret Voltaire, der Geburtsstätte der künstlerischen Bewegung des Dadaismus. Praktisch: Das Kleintheater liegt nur wenige Haustüren von seinem Zimmer entfernt, ebenfalls in der Spiegelgasse. Die Geheimpolizei beobachtet diese russischen Revolutionäre, nimmt sie aber nicht besonders ernst. Im Nachbarland treffen sie sich in Wien im Café Central, hier etwa Lew Davidowitsch Bronstein, der sich selbst ja Trotzki nennt. »Wer hätte das voraussehen können?«, heute ein geflügelter Satz, galt schon damals. Als später die ersten Nachrichten von der russischen Oktoberrevolution eintreffen, hält ein österreichischer Staatsbeamter das für eine Falschmeldung: »Wer soll denn diese Revolution machen? Vielleicht der Herr Trotzki aus dem Café Central?«[16]
Die Kommunisten im damaligen Europa waren ein bisschen so wie die Christen im alten Rom: eine entschlossene, fanatische Gruppe, aber weit von der Macht entfernt. Den Christen half Kaiser Konstantin der Große: Er war zwar kein Gläubiger, suchte aber nach einer ideologischen Rechtfertigung dafür, warum Rom so viele Gebiete unter seiner Kontrolle hielt. Was konnte es da Besseres geben als eine Religion mit weltweitem Anspruch, die man verbreitete? Deshalb ließ Konstantin auf dem vermuteten Grab des Apostels Petrus den Vorgängerbau des heutigen Petersdoms errichten und machte das Christentum so salonfähig. Den Kommunisten half ein anderer Kaiser: Wilhelm II.
Im Jahr 1917 ist es so weit: Die Unzufriedenheit mit der Not und dem Krieg in Russland wird immer größer. Am 23. Februar (nach dem alten russischen Kalender) streiken 87 000 Arbeiter, am Tag darauf 97 000, bald sind es 240 000. Sie gehen auf die Straße, rufen: »Brot! Frieden! Nieder mit der Regierung!« Ganz wie von Parvus in seinem Plan aufgeschrieben: »Ein politischer Massenstreik in Russland unter der Losung: Freiheit und Frieden«. Eliteeinheiten sollen die Unruhen niederschlagen, doch sie verbrüdern sich mit den Aufständischen. Der Zar, der sich außerhalb der Hauptstadt befindet, schickt ein Telegramm: »Es ist zu spät. Jetzt bleibt nur mehr die Abdankung.« Die Februarrevolution hat gesiegt.
Doch für Deutschland reicht das nicht aus, denn auch die neue Regierung setzt den Krieg fort. Jetzt unterstützt das Kaiserreich erst recht Lenins Bolschewiki, die den Krieg sofort beenden wollen. Am 2. März 1917 erhält die Vertretung der Deutschen Reichsbank in Stockholm Anweisung Nr. 7443 aus ihrer Zentrale: »Hiermit wird Ihnen mitgeteilt, dass Sie aus Finnland Anfragen für Auszahlungen für pazifistische Propaganda in Russland erhalten werden. Die Anfragen werden von einer der folgenden Personen an Sie gestellt: Lenin, Sinowjew, Kamenjew, Trotzki, Sumenson, Koslowski, Kollontai, Sievers oder Merkalin.« Das klingt wie ein Who’s who der russischen kommunistischen Bewegung. Doch das Problem der deutschen Regierung ist das Problem der Revolutionäre: Ihr Anführer Lenin lebt weit von den Ereignissen entfernt, in der Spiegelgasse in Zürich, »eingepfropft wie in einer Flasche«, so Parvus.
Botschafter Brockdorff-Rantzau telegrafiert an das Auswärtige Amt in Berlin, ganz im Sinne seines Gesprächspartners Parvus alias Helphand: »Uns muss allein daran liegen, die Anarchie und das Chaos dort so anwachsen zu lassen, dass Russland für den Krieg nicht mehr in Betracht kommt … Hatte Gelegenheit, den in russische Verhältnisse tief eingeweihten Dr. Helphand ausführlich zu sprechen, der gerade jetzt an der Arbeit ist, uns durch eine zielbewusste Aktion in Russland sehr große Dienste zu leisten.« Die »zielbewusste Aktion«: Parvus schlägt seinen deutschen Gesprächspartnern vor, Lenin in einem Eisenbahnwaggon von der Schweiz nach Russland zu bringen. Dort werde er dann eine bolschewistische Revolution anführen und den Krieg gegen Deutschland stoppen. General Erich Ludendorff, nach Generalfeldmarschall von Hindenburg zweiter Mann der Obersten Heeresleitung, erklärt, eine Durchfahrt Lenins könne Deutschland große Kriegsvorteile bringen. Kaiser Wilhelm II. stimmt zu, wirkt aber etwas naiv. So sagt er, man solle Lenin und seinen Genossen die kaiserliche Osterbotschaft überreichen, »damit sie in ihrer Heimat aufklärend wirken«.
Als Lenin von der Durchfahrtgenehmigung hört, meint er: »Wenn die deutschen Kapitalisten so dumm sind, uns nach Russland zu bringen, schaufeln sie damit ihr eigenes Grab. Ich nehme das Angebot an – ich fahre.« Das Zusammenspiel von Kaiser und Kommunisten soll geheim bleiben, doch die Information sickert durch. Als Lenin und 31 weitere russische Emigranten am 9. April 1917 in Zürich den von Deutschland bereitgestellten Sonderzug besteigen, rufen demonstrierende Russen: »Provokateure, Lumpen, Schweine!« und »Verräter! Wilhelm bezahlt euch die Reise!« Sie blockieren die Gleise, es scheint, als könnten sie die Ausfahrt des Zuges verhindern und den Plan von Parvus vereiteln. Doch dann werden sie von prokommunistischen Demonstranten verdrängt. Diese singen die Internationale, der Zug fährt ab.
Ein Triumphzug. In Deutschland hat Lenin Vorfahrt, sogar gegenüber dem Sonderzug von Friedrich Wilhelm, dem 34-jährigen Kronprinzen des Deutschen Reichs und Preußens, der im Bahnhof Halle zwei Stunden warten muss. Die Reisenden im Zug aus Zürich singen französische Revolutionslieder, was Lenin schließlich verbietet, um Konflikte mit den Deutschen zu vermeiden. Und bereits jetzt führt er die Planwirtschaft ein: Da immer wieder Raucher die Toilette besetzen, schneidet er Bezugskarten zu. Nur mit dieser Karte darf man auf den Abort.
Zunächst geht also alles seinen Gang in diesem Sonderzug in den Sozialismus. Doch dann passiert etwas Ungeplantes: In Berlin bleibt er auf einem Abstellgleis stehen, fast 24 Stunden lang. Sind Parvus und Lenin auf einen Trick der kaiserlichen Geheimpolizei hereingefallen? Werden die Kommunisten jetzt verhaftet? Vertreter der deutschen Reichsregierung betreten den Zug – und erlauben die Weiterfahrt.
Auch russische, englische und französische Geheimagenten beobachten Lenin und Parvus. Die englische Regierung warnt in einem Telegramm Russlands neue Provisorische Regierung vor der Ankunft Lenins, doch diese reagiert gelassen. Der russische Außenminister Pawel Miljukow schreibt in seinem Antworttelegramm: »Wenn bekannt wird, mit wessen Hilfe sie kommen, werden sie so diskreditiert sein, dass sie keine Gefahr mehr darstellen.«