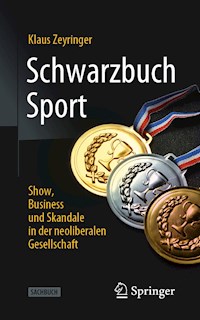14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Kulturgeschichte des größten Sportereignisses aller Zeiten: die Olympischen Spiele Nach dem großen, von der Presse hochgelobten Erfolg ›Fußball. Eine Kulturgeschichte‹ nun das neue Buch von Klaus Zeyringer ›Olympische Spiele. Eine Kulturgeschichte von 1896 bis heute‹. Sackhüpfen, Kanonenschießen, Seilklettern, so begann die Neuauflage der olympischen Spiele Ende des 19. Jahrhunderts. Schon daran zeigt sich, wie sehr die Idee des Barons von Coubertin in der damaligen Kultur verhaftet war; eine Geschichte der Olympischen Spiele muss also als Kulturgeschichte erzählt werden. Genau das macht Klaus Zeyringer: von den idealistischen Anfängen bis zum Massenspektakel von heute. Er rückt die zentralen Etappen der Umsetzung der »Olympischen Idee« in den kulturellen und sozialen Kontext, schreibt über Amateurismums, die Bedeutung des Marathonlaufs, die Verstrickungen mit den politischen Mächten und zeigt uns den ganzen Reichtum und die Skurrilität der olympischen Welt des Sports – durch witzige Details, pointierte Anekdoten und die Einordnung in das große Ganze. Ein Lesevergnügen der besonderen Art.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Prof. Dr. Klaus Zeyringer
Olympische Spiele. Eine Kulturgeschichte von 1896 bis heute
Band 1: Sommer
Über dieses Buch
Die Kulturgeschichte des größten Sportereignisses aller Zeiten
Sackhüpfen, Kanonenschießen, Seilklettern, so begann die Neuauflage der olympischen Spiele Ende des 19. Jahrhunderts. Schon daran zeigt sich, wie sehr die Idee des Barons de Coubertin in der damaligen Kultur verhaftet war; eine Geschichte der olympischen Spiele muss also als Kulturgeschichte erzählt werden. Genau das macht Klaus Zeyringer: von den idealistischen Anfängen bis zum Massenspektakel von heute. Er rückt die zentralen Etappen der Umsetzung der »olympischen Idee« in den kulturellen und sozialen Kontext und zeigt uns den ganzen Reichtum und die Skurrilität der olympischen Welt des Sports – durch witzige Details, pointierte Anekdoten und die Einordnung in das große Ganze. Ein Lesevergnügen der besonderen Art.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Coverabbildung: Ezra Shaw / Getty Images
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hißmann, Hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403193-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Voraussetzungen
Neues Olympia und Kulturgeschichte, Bilder und Erzählungen
Sport und Moderne
Grabungen und Idealisierungen: Altertum im 19. Jahrhundert
Anfänge
Olympische Nachspiele seit Shakespeares Zeit
Coubertin tritt auf
Ein Pariser Kongress: Hellenismus in der Sorbonne
Hellenismus in Hellas: Athen 1896
Mühsame Durchsetzung, bedenkliche Praktiken
Sportliches Durcheinander hinter Großkulisse
»Close to disaster«: St. Louis 1904
Rassismus als ausgestellte Anthropologie
Zwischenspiele: Ein Intermezzo als Rettung
Die US-Flagge in London
Ein kleiner Italiener und Sherlock Holmes beim Marathon
Ideal und Realität
Olympischer Geist und Sieg der Superlative
Zeremonie: Ritual und Symbole
Idealismuskulisse: Amateurismus
Bannsprüche und Ausschlüsse
Völkerverbindung?
Etablierung, Weltkrieg, Etablierung
Ein Fest für Körper und Geist: Stockholm 1912
Nach den letzten Tagen der Menschheit
Stars auf dem Friedensaltar des Sports: Paris 1924
Bilder in Amsterdam
Olympia in Hollywood
Olympischer Friede?
Propaganda siegt über Boykott: Berlin 1936
Diktatur und Inszenierungsmacht
London 1948 und das Ende der Kunstwettbewerbe
Kalter Krieg im Stadion
Blut im Wasser
Zweimal deutsch und andere Teilungskonflikte
Sportkörper und Stadionmasse
Frauensport
Heroen, Heldinnen
»Who are you?«: Überraschungen
Publikum
Heilsgeschichten, Gefühlserzählungen
Welt-Arena
Die andere Hauptstadt der Antike im neuen Schaufenster
Geheimdienste unterm Triumphbogen und die Dramaturgie des Duells
Tokio 1964: Nationale Identitätsförderung
Schwarze Fäuste und ein Sprung ins nächste Jahrtausend
Ein Massaker, ein Kulturprogramm und Sport
München 1972: The show must go on
Sportmoderne, Medienmoderne, Finanzmoderne
Olympische Krise, sportliche Höchstleistungen
Politik bis zum Boykott
Wie nationale Solidarität aussieht: Seoul 1988
Staatsdoping
Medaillen gekauft, Siege erdopt
In welchem Land liegt Barcelona?
Gold und Geld: »Coca-Cola-Spiele« 1996
Olympiade, die lange Zwischenzeit
Gigantismus 2000
Ein politischer Auftrag
Sicherheitsmanie und Miseren im Ursprungsland
Slogans und Emotionen in Peking
Extraterritorial in London
Alles Olympia: Paralympics, Jugendspiele …
Kulturmarke und Marketing
Stadion-Nationalismus
Staat und Geld machen: Die Herrschaften des IOC
Wozu Olympia? Hamburg stimmt ab
Kontrolle und Karnevalisierung
Zweifaches globales Dorf
Anhang
Bibliographie
Archiv
Internet
Zeitungen, Zeitschriften
Bücher
Bildnachweise
Register
Voraussetzungen
Neues Olympia und Kulturgeschichte, Bilder und Erzählungen
Die Sonne, die Straße, der Durst. Shiso Kanaguri läuft. Kein Schatten schützt. Nur sein eigener läuft vor ihm her und bewegt sich klein auf dem Hitzebelag vor den Füßen.
Shiso muss laufen, sie haben ihn hierhergeschickt, zur Ehre Japans. Hinunter darf er nicht blicken, er würde taumeln. Er muss laufen, sie haben für ihn gesammelt. Keiner hat geahnt, dass es in Skandinavien so heiß ist.
Seine Beine machen weiter. Gewinnen wird er nicht, da sind welche vor ihm, wer und wie viele, weiß er nicht. Er muss ins Ziel kommen, für »aufgeben« hat er kein Wort. Er wird ins Stadion einbiegen, vielleicht spenden die Tribünen auf der letzten Gerade Schatten. Man wird ihm kaltes Wasser reichen, er wird sich ins kühle Gras legen, die Beine in die Höhe und ausschütteln. Er wird aufstehen und trinken, man wird ihm zu essen geben, er wird trinken, er wird im kalten Strahl der Dusche stehen.
Er läuft, die Sonne brennt. Der Mund keucht trocken. Die Häuser an den Vorgärtchen stehen schattig, da sitzen Leute, sie heben Gläser. Shisos Beine biegen vom Parcours ab, nur kurz, sagt sein Kopf. Die Leute sehen zu ihm auf, sie reichen ein Getränk. Shiso Kanaguri lässt sich in die Kühle nieder. Er trinkt. Sie geben ihm zu essen. Er trinkt, sein Körper streckt sich in die Liege. Shiso schließt die Augen, kurz nur, sagt sein Kopf. Er schläft ein.
So könnte sich die Szene abgespielt haben. So geht eine Erzählung von der ersten Etappe des längsten Marathonlaufs der olympischen Geschichte, sie setzt Kulturbilder in Bewegung.
Hundert Jahre später stiftet das Japanische Olympische Komitee eine Silbertafel zur Erinnerung, dass die Familie Petre in Sollentuna damals Shiso Kanaguri, der nach dem Start des Marathons sein »Bewusstsein verloren« habe, in der Not beigestanden sei. »Die Geschichte erzählte man sich in unserer Familie von Generation zu Generation«, sagt 2012 eine Urenkelin der hilfreichen Altvorderen.
Man schrieb den 14. Juli 1912, es war ein Sonntag. In Stockholm herrschte eine Hitze, wie man sie hier kaum je zuvor erlebt hatte.
Man zelebrierte das größte Sportereignis, das die Moderne hervorgebracht hat. In der schwedischen Hauptstadt fanden Olympische Spiele statt, die fünften, seit der französische Baron Pierre de Coubertin das antike Athletenerbe erneuert hatte.
Für den Erfolg der Veranstaltungen, ja der gesamten olympischen Bewegung hatte sich ein Wettkampf als wesentlich erwiesen, den man der griechischen Legende abgeschaut hatte: Vierzig Kilometer soll ein gerüsteter Bote von Marathon nach Athen gelaufen sein, dort den Sieg in der Schlacht verkündet haben, darauf tot niedergebrochen sein.
In Stockholm brach der Portugiese Francisco Lázaro auf der Strecke zusammen: heftiger Sonnenstich. Am nächsten Tag starb er. In Schweden organisierte man eine Sammlung zugunsten seiner Familie. Die großen Schlagzeilen der internationalen Presse verbreiteten die Nachricht. Dass der Tod mitläuft, bestätigt die Legende.
Wer hätte denn vorherzusehen vermocht, dass in Skandinavien die Sonne so heiß herniederbrennen könnte. Als man das Programm erstellt hatte, war es draußen kalt gewesen. Den Marathonlauf hatte man zur Mittagszeit um 13 Uhr 45 angesetzt, da war die Zielankunft am Nachmittag zu erwarten, wenn das Stadion voll sein würde.
An diesem Julisonntag maß man über dreißig Grad im Schatten. Zum Start reihten sich die Konkurrenten in weißer Kleidung auf, alle mit weißen Kappen oder weißen Tüchern auf dem Kopf. Die Mühen des längsten Laufes waren ihnen bekannt, nicht jedoch die Strapazen unter diesen Bedingungen. Die Hälfte der achtundsechzig Athleten blieb auf der Strecke, sie wurden mit Autos ins Stadion zurückgebracht.
Lange lief Shiso Kanaguri in einem kleinen Pulk. Dann gaben die einen auf, andere konnten ihr Tempo steigern, oder wurde er langsamer? Zwischen Kilometer 25 und 30, im Vorort Sollentuna, sah sich Shiso allein auf heißer Straße.
Erstmals hatten zwei Teilnehmer aus Asien bei Olympischen Spielen, die man in Europa und den USA als Weltmeisterschaften betrachtete, gemeldet – beide Japaner, Shiso Kanaguri und ein Sprinter. Shiso war über die Marathondistanz schon eine sehr gute Zeit gelaufen, jedoch fehlte das Geld für die lange Reise. Seine Studienkollegen sammelten für ihn, dann war er achtzehn Tage unterwegs, mit dem Schiff nach Wladiwostok, weiter mit der Transsibirischen Eisenbahn. Als er in Stockholm ankam, war er erschöpft. Fast eine Woche brauchte er, um sich zu erholen.
Shiso Kanaguri lief gegen die Kilometer, er lief gegen die Hitze. Von früheren Rennen wusste er um den Durst, den musste man überwinden. Das hier jedoch war anders.
Regelmäßige Verpflegungsposten gab es damals nicht. Hinter einigen Athleten fuhren Begleiter auf dem Rad oder im Auto. Auf manchen Passagen der Strecke war zwischen zwei Kurven niemand zu sehen.
In Sollentuna lief Shiso auf ein Haus zu, im Garten saß die Familie Petre. Zwei Männer hoben volle Gläser. Er hielt an, sie boten ihm zu trinken, er ließ sich nieder und schlief ein.
Im Stadion waren die Letzten, die durchgehalten hatten, eingetroffen. Die wenigen Streckenposten und die Kampfrichter beugten sich über ihre Listen. Die Zeiten waren eingetragen, die Läufer, die aufgegeben hatten, waren vermerkt. Der Portugiese kämpfte im Krankenhaus um sein Leben. Wo aber der Japaner verblieben war, wusste keiner.
Man schickte Polizisten aus. Shiso Kanaguri kam erst am nächsten Tag – so stellt es eine Version der Geschichte dar. Eine andere erklärt, die Schande und die Scham seien dem Athleten so überwältigend erschienen, dass er zunächst nicht nach Japan zurückkehren wollte, sich dann aber auf den Weg machte, ohne sich zuvor bei den Veranstaltern zu zeigen. Auf den Listen stehe er als »vermisst« eingetragen.
In den folgenden Jahren gewann er dreimal die nationale Meisterschaft, bei den Olympischen Spielen von Antwerpen belegte er 1920 den sechzehnten Platz, 1924 stellte er einen neuen Asienrekord auf.
In seiner Heimat Japan verstand man 1912 den Sport anders als in Europa. Um 1870 begannen die Meiji-Reformen die Gesellschaft teils nach europäischem Vorbild zu modernisieren, die Körperertüchtigung blieb allerdings vor allem den traditionellen Kampfformen vorbehalten. Ein Jahr vor den Olympischen Spielen von Stockholm war der Schwertkampf Kendo Pflichtfach an Schulen geworden. Erst zehn, zwanzig Jahre später setzte sich Sport als Element westlicher Lebensart durch und wurde moderat ins Bildungswesen eingeführt.
Beim Langstreckenlauf, meinte man anfangs in Japan, sei Schweiß ein Ausdruck zunehmender Müdigkeit. Also tranken die Athleten vor und während des Wettkampfs nicht. Trotz der Hitze hielt sich Shiso Kanaguri in Stockholm zunächst daran. Am Start hatte er die Konkurrenten mit seinen japanischen Schuhen überrascht, die vorne bei den Zehen zweigeteilt waren – der kulturelle Unterschied war für die Konkurrenten sichtbar. Die sprachordnende Differenz kam 2012 bei der Überreichung der Erinnerungstafel in Sollentuna zum Ausdruck. Deren offizielle Version bedeutete, Kanaguri könne nicht wissentlich vom Weg abgewichen sein, um seinem Durst und seiner Müdigkeit nachzugeben, da er ja »nach dem Start sein Bewusstsein verloren« habe.
Shiso Kanaguri wurde Universitätsprofessor. Als er fünfundsiebzig Jahre alt war, reiste er 1967 erneut nach Stockholm. Dort setzte er seinen Lauf von jenem Haus aus fort, wo er eingeschlafen war, und vollendete der Welt langsamsten Marathon: 54 Jahre, acht Monate, sechs Tage, fünf Stunden, zweiunddreißig Minuten. »Es war ein langer Lauf«, sagte Shiso Kanaguri, »unterwegs heiratete ich, bekam sechs Kinder und zehn Enkel.«
Zwar stehen seit 2000 im Triathlon eineinhalb Kilometer Schwimmen, vierzig Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen auf dem Programm, aber der Marathon ist mit seiner mythischen Dimension seit 1896 der heroischste Weg zu olympischem Ruhm.
Erst 1890 – vier Jahre bevor Baron Coubertin bei einer Tagung in der Pariser Sorbonne die Erneuerung der Spiele von Olympia ausrief – hatte man mit Ausgrabungen in Marathon begonnen. Zu jener Zeit war die Legende vom Soldaten, der mit der Triumphnachricht auf den Lippen gestorben sei, wenig bekannt. Bei Herodot ist von einem Krieger zu lesen, der es in zwei Tagen von Athen nach Sparta geschafft habe, um Hilfe gegen die Perser zu holen. Bei Plutarch findet sich dann die Geschichte, ein Bote sei mit der Nachricht vom Ausgang der Schlacht bei Marathon gegen die Perser nach Athen geeilt, habe dort »nenikekamen« gerufen, »wir haben gesiegt«, und sei tot niedergestürzt.
Im Programm der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit schrieben die Veranstalter eine Distanz von vierzig Kilometern vor: von Marathon auf der Straße, am Meer entlang, nach Athen. Wäre der legendäre Krieger, der Pheidippides geheißen haben soll, tatsächlich gelaufen, hätte er jedoch wohl den kürzesten Weg über die Hügel gewählt und höchstens 34 Kilometer zurückgelegt. Im ganzen Land verstand man 1896 diesen Wettbewerb als den unzweifelhaften – da mythisch heimischen – Höhepunkt aller Kämpfe. Folglich musste ein Grieche gewinnen, das verlangten Volk und Patriotismus. Der Kronprinz nutzte den Symbolwert und geleitete den Sieger Spyridon Louis auf den letzten Metern ins Ziel.
Mit der Distanz nahm man es in den nächsten Jahren bei den Marathon-Wiederholungen, die in vielen Ländern große Popularität erlangten, nicht genau. Etwa vierzig Kilometer sollten es sein.
Die Adaptierung an die Moderne und deren Körperertüchtigung, die im Zusammenhang mit der Industrialisierung in Großbritannien ihre Ausprägung erhalten hatte, war Programm. Ob es historisch stimmte, war nicht von Bedeutung. Baron Coubertin und seine Kompagnons folgten ihrer – idealisierten, aber an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gängigen – Vorstellung von der Antike und verbanden sie mit den Praktiken, die ihnen in ihrer Zeit am fortschrittlichsten galten: Olympia mit English Sports.
Der Baron hatte die Spiele als Erbe der Hochkultur, der es nachzueifern galt, neu belebt und damit ein volkspädagogisches Ziel verfolgt: Man müsse eine gesunde Verbindung von Geist und Körper fördern, »mens sana in corpore sano«, um die jungen Männer besser auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Der Marathonlauf führte dabei am wirksamsten den mythischen Sportausdruck jener Antike vor Augen, für die man sich ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert in Europa und Amerika so begeisterte, dass man sie als höchste Norm von Kultur und Bildung verstand.
Coubertin legte seinem Olympia ein Ideal zugrunde, auf das man sich international in der Theorie einigen konnte: ein Fest der Jugend für den Frieden und zur »Ehre der Menschheit«. Das vermochte Sinn zu stiften und das eigene Verhalten zu erhöhen. Und das bewirkte tatsächlich eine kulturelle Aufwertung der Spiele der Neuzeit, wodurch wiederum das antike Original stark an Bedeutung gewann.
Die Olympischen Spiele griffen in ihren modernen Anfängen auf die Kulturgeschichte zurück. Sie sind selbst Kulturgeschichte und zählen nun zum »Kulturerbe der Menschheit«.
Anfang der dreißiger Jahre berichtete Pierre de Coubertin von einem »hohen japanischen Beamten des Völkerbundes«, der ihm in Genf gesagt habe: »Man kann sich nicht vorstellen, in welchem Maße die Wiedereinsetzung der Olympischen Spiele mein Land umgewandelt hat.«
Das Antreten zweier japanischer Athleten in Stockholm war ein, wenn auch noch recht kleines erstes sportliches Zeichen dafür, dass sich Japan geöffnet hatte und in die Moderne eingetreten war. Nachdem die Einladung des Internationalen Komitees eingetroffen war, gründete Kano Jigoro, der Erfinder des modernen Judo, 1911 den Großjapanischen Sportverband. Allerdings verweigerten die offiziellen Stellen der Entsendung eines heimischen Teams nach Schweden ihre Unterstützung. Das Land hatte in den Jahrzehnten zuvor den Weg zur konstitutionellen Monarchie beschritten und etwa in wesentlichen Zügen das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch übernommen. Die imperialistische Expansion verdeutlichten 1910 die offizielle Annexion des »Protektorats« Korea und der Griff nach der Mandschurei, nachdem Russland 1905 im Krieg besiegt worden war. Die Meiji-Ära, übersetzt »aufgeklärte Herrschaft«, ging am 30. Juli 1912 mit dem Tod des Tenno zu Ende.
Als Shiso Kanaguri aus Stockholm nach Hause zurückkam, herrschte ein anderer Kaiser, folglich nach japanischer Vorstellung eine andere Zeit. In dieser Taisho-Ära begann man, den Sport nach westlicher Art mit eigenen Traditionen zu verknüpfen. 1920 wurde der – darauf jeweils zu Neujahr stattfindende – Hakone Ekiden ausgetragen, ein zwei Tage dauernder Staffellauf von Tokio zum heiligen Berg Hakone und zurück. Die Idee stammte von Kanaguri, der zum wirkungsvollsten Verbreiter des bald populären Langstreckenlaufens wurde. Die Strecke, die vor dem Umkehrpunkt auf dem »Steilen Abstieg vom Himmel« bergan führte, wählten die Organisatoren wegen der historischen Orte am Weg und vor allem wegen des Symbols der mythischen kaiserlichen Herabkunft vom Himmel.
Die Politik griff sichtbar in die Stockholmer Veranstaltung ein. Bei der Eröffnungsfeier sollten die Mannschaften erstmals hinter Schildern mit Ländernamen einmarschieren. Da protestierte Österreich gegen die Teilnahme eines Teams aus Böhmen, damals ein Teil Österreichs, und Russland gegen eines aus Finnland, das zum Zarenreich gehörte. Man fand Kompromisse; die Iren durften jedoch gar nicht unter ihrer eigenen Flagge starten. In seinen Erinnerungen hielt Baron Coubertin fest: »Die Olympischen Spiele wurden Staatsangelegenheit. Die königlichen Familien mischten sich darein und die Regierungen ebenfalls.«
Heute liefert Olympia weltweit verbreitete Signale und Symbole, damit kommt es der Vorstellung von Globalisierung entgegen. Formen und Verhalten sind wiedererkennbar, sie regen zur Nachahmung an.
Bedeutungen sind in symbolisches Gewand gekleidet, Kulturmuster in Bildern und Erzählungen ausgedrückt.
Zu den am meisten verbreiteten Fotos des 20. Jahrhunderts zählen eine Aufnahme von zwei dunkelhäutigen Athleten, die auf dem Siegespodest ihre Hände in schwarzen Handschuhen protestierend gen Himmel strecken, und eine andere von einer vermummten Silhouette auf einem Balkon. Die eine stammt von Olympia 1968 in Mexico City, die andere von den Spielen 1972 in München.
Im Klima der Hochkonjunktur und des enormen Ausbaus der Massenmedien kamen ab den sechziger Jahren Bildbände über Olympia in Mode, die das Ereignis bald nach der Abschlussfeier nacherlebbar präsentierten. Sie gehören zu den frühen intensiven Bucherlebnissen vieler Heranwachsender. Nach der Spannung der Wettkämpfe wartete man gespannt darauf, das im Fernsehen Miterlebte für die Erinnerung fixiert zu finden. Auf Hochglanz wurden Bilder und Geschichten geboten, die das olympische Ideal einer friedlichen Konkurrenz und Völkerverbindung abseits der politischen Welt vermitteln.
Zum Beispiel 1968 nach den Spielen von Mexico City, die im Jahr der weltweiten Protestbewegungen stattfanden. Bei Demonstrationen unweit des Olympiastadions, einige Tage vor der Eröffnung, waren Hunderte junge Menschen von der Polizei getötet worden. Das »Offizielle Standardwerk des Österreichischen Olympischen Komitees« erwähnt die Vorfälle und die Toten mit keinem Wort. Das Buch beginnt mit dem Satz: »Während draußen vor den Toren des Universitätsstadions von Mexiko Tausende Soldaten bereitstehen, um für Ruhe und Frieden zu sorgen« (warum sie bereitstehen müssen, wird nicht erklärt), »erfreut sich auf dem Stadionrasen eine buntgekleidete, singende und tanzende Kinderschar an ihrem monatelang vorbereiteten Auftritt«. Es ist der Kitsch des Harmoniewillens. Und die rhetorische Frage des Einleitungsteils »Alle Probleme gelöst?« kommt wieder aufs Kindliche: »Pedro ist ein Schuhputzerbub. Er besucht keine Schule und weiß gerade noch, wie alt er ist.« Jetzt aber »wurde ihm eine besondere Ehre zuteil: Er durfte ›seinen‹ Stand gleich hinter dem Eingang des olympischen Dorfes errichten.« Das weiß er zu schätzen: »Flink, fleißig und beliebt war Pedro. Er wußte, was er den ›Spielen‹ schuldig war.« Wie er habe die ganze Siebenmillionenstadt »geschuftet«, und alle Anlagen finde man nun »in eine freundliche Waldlandschaft eingebettet«. Ein Problem sei allerdings »zu einer wirklichen Sorge erwachsen«. Nein, von Politik ist nicht die Rede, nicht von den Toten. Das Problem, »vielleicht bleibt es das einzige«, ist der Verkehr in der Großstadt. Und »mit Befriedigung« stellt der offizielle Standardwerk-Autor letztlich fest, dass am Abschlusstag, »nachdem die Rekordläufer Smith und John Carlos aus dem Team ausgeschieden« waren (tatsächlich wurden sie ausgeschlossen), sich »auch jene schwarzen Athleten eines Besseren besannen, die geglaubt hatten, daß ihre phantastischen sportlichen Leistungen sie zu Demonstrationen auch neben der Laufbahn berechtigten«. Demokratie, das geht weder im Stadion noch vor dem Stadion. Man spielt Olympia, »dem olympischen Eid treu, zum Ruhme des Sports und zur Ehre des eigenen Teams«.
Die Bildbände der Kindheit und Jugend erzählen Geschichten, die vieles auslassen. Und oft stimmen sie nicht.
Bilder bleiben am stärksten im Gedächtnis. Das wissen die Planer von Eröffnungsfeiern und Abschlussfesten bei Olympia, die seit der intensiven Mediatisierung meist auf den Kitsch einer symbolträchtigen Choreographie bauen.
Das Besondere an den verbreiteten Sportbildern ist es, dass sie Emotionen sichtbar machen, die keineswegs gekünstelt wirken und die als unzweifelhaft lebensecht verstanden werden. Sie führen Sieg und Niederlage, Triumph und Enttäuschung vor Augen. Sie sind im doppelten Sinn bedeutendes Material des kollektiven Gedächtnisses: Ausdruck einer Medienmoderne, die eine Kultur starker Bilder ist.
Namen, die derart an Ereignisse geknüpft sind, können in einen allgemeinen Sprachgebrauch eingehen. So kommt es, dass man heute eine Veranstaltung des Altertums sowie eine antike Legende, die um 1890 wenig bekannt war, als gängige Bezeichnung verwendet und deren metaphorische Dimension dabei selten bedenkt: eine »olympische Leistung«, eine »Marathon-Rede«, ein »Verhandlungs-Marathon«, ein »Film-Marathon« …
Den Marathonlauf gewann 1936 bei den Spielen von Berlin, die der Nazipropaganda dienten, ein Koreaner. Nur schwer konnte er es verwinden, dass er unter japanischer Flagge starten und bei der Siegerehrung die ihm verhasste Hymne der Okkupationsmacht hören musste.
Titelverteidiger Carlos Zabala aus Argentinien galt als Favorit, vom Startschuss weg lief er an der Spitze. Allerdings teilte er sich offenbar seine Kräfte schlecht ein und gab nach 32 Kilometern auf. Kitei Son erschien als Erster im Stadion, der japanische Reporter rief ins Mikrophon: »Unser Son kommt bald zum Ziel. Japan ist endlich auf dem ersten Platz.« Der schmächtige, drahtige Athlet überquerte die Linie in neuer Weltbestzeit, der Radiojubel überhöhte nationalistisch: »Son ist am Ziel! Unser Japan – der Marathonsieger. Den langersehnten Olympia-Sieg hat unser Japan errungen.« Der Gewinner ist das Land, die Betonung liegt auf der Gemeinschaft unter seinem Namen, das wiederholte »Unser« vereint und vereinnahmt.
»Unser Kitei Son« aber hieß eigentlich Sohn Kee Chung, unterschrieb in Berlin auf Koreanisch und malte gelegentlich eine Karte Koreas daneben. Dritter wurde ebenfalls ein Koreaner, dessen Name Sung Yong Nam die Kolonialmacht zu »Soryu Nan« gezwungen hatte. Bei der Siegerehrung standen beide bekränzt da und schauten betrübt zu Boden, als die Hymne ertönte. Sohn Kee Chung hielt den Topf mit dem Lorbeer so vor die Brust, dass er Japans Flaggensonne verdeckte. Einige Zeitungen in Korea brachten Fotos des Goldmedaillengewinners, bei denen sie die Flagge auf dem Trikot retuschierten. Die japanische Verwaltung ließ die zuständigen Journalisten verhaften und die Blätter sperren. Da sie Kundgebungen für die Unabhängigkeit befürchtete, verbot sie Siegesfeiern. Schon auf der Heimreise bewachte man Sohn und untersagte ihm, jemals wieder einen Marathon zu laufen. Jahrzehnte später sagte er: »Kaum jemand kann sich vorstellen, was ich fühlte, als ich mit der japanischen Flagge auf der Brust laufen musste. Es schmerzt immer noch.«
1970 reiste ein südkoreanischer Abgeordneter (nach anderer Version: ein Diplomat) nach Berlin. Mit Hammer und Meißel begab er sich nachts zum Olympiastadion, ging zur Marmortafel, auf der die Namen der Goldenen von 1936 prangen, und entfernte neben dem Marathonsieger die Bezeichnung »Japan« – die heute, nach dem Entscheid des Internationalen Olympischen Komitees, wieder dort steht. Die Exekutivkommission beschloss am 13. März 1971, die »ursprüngliche Nationalität dieses Konkurrenten darf keine Veränderung erfahren, und dies bedeutet, dass das Land, für das er 1936 teilnahm, Japan war«.
Bei der Eröffnung der Spiele von 1988 trug dann Sohn Kee Chung die Flamme ins Stadion von Seoul.
Die olympische Erzählung bringt Helden und Mythen hervor, Stars und Legenden. Sie zeitigt wirtschaftliche Auswirkungen von enormen Ausmaßen. Die globale Verwertung des Sports erscheint geradezu symptomatisch für den gegenwärtigen Kapitalismus, der Identitäten mittels Konsum konstruiert. Sport zieht Konzerne an, da er ihnen hilft, ihren Reklameruf zu verbreiten und Märkte zu öffnen.
Bei den Spielen, die 2004 wieder nach Athen und ins Ursprungsland ihres Mythos zurückkehrten, lancierte das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit den schönen Worten seiner Idealismuskulisse die Kampagne »Celebrate Humanity«. Präsident Jacques Rogge behauptete, 365 Tage im Jahr sei der wahre Geist der Spiele von »unseren weltweiten Sponsoren« demonstriert. Das klingt ebenso geschäftstüchtig wie realitätsfern – oder aber der wahre Geist ist nunmehr tatsächlich jener der Sponsoren. Das Projekt war von der Marketing-Abteilung im IOC entwickelt worden, um die nichtkommerziellen Ideale hervorzuheben. Im Grunde ging es jedoch darum, Olympia als internationale Marke an Politiker, Konzerne und Konsumenten zu verkaufen.
Das in Lausanne ansässige Internationale Olympische Komitee, ein »gemeinnütziger Verein« nach Schweizer Gesetzeslage, ist der Alleinbesitzer von Rechten, vor allem für Vertrieb und Vermarktung, die ihm regelmäßig hohe Einkünfte und seinen Spielen die Garantie der großen Weltbühne bieten. Es gibt keine andere Veranstaltung dieser Größe, die in periodischen Abständen in den Medien derart eindringlich eine Zeremonie der Globalisierung vorführt.
Die Entwicklung zum Megaevent ist daran ersichtlich, wie viel jeweils für die Fernsehrechte bezahlt wurde. In den USA gingen sie 1964 für 1,5 Millionen Dollar an einen Sender, ein knappes Vierteljahrhundert später war der Preis um das Zweihundertfache auf 300 Millionen gestiegen, 2008 dann auf 894 Millionen.
Die kanadische Soziologin Helen Jefferson Lenskyi meint, dass sich die »Olympic Industry« der Idealismuskulisse bediene. Die Betonung auf olympische »Familie« oder »Bewegung« sowie die Beschwörung des »olympischen Geistes« würden Mystik und Elitismus vermitteln, somit jedoch Macht- und Profitmotive verdecken. Dies bekräftigen in jüngster Zeit zunehmende Kritiken, für Olympia würden Grundrechte aufgegeben, Gesetze umgestoßen, Menschen – vor allem aus ärmeren Schichten – delogiert.
Spätestens mit der starken Mediatisierung sind die Spiele zum wesentlichen Maßstab in der globalen Entwicklung des Sports geworden und haben ein Zwei-Klassen-System geschaffen: die olympischen Disziplinen und die anderen. In den Jahrzehnten nach 1896 bildete das Programm eine Mischung aus Elementen der Antike, der adeligen Ertüchtigung und der englischen Moderne. Reiten, Kricket und Tennis wurden von den Eliten betrieben, das Rudern ebenso, aber seit Ende des 18. Jahrhunderts zog es ein breites populäres Publikum an. Das Dressurreiten blieb lange den Offizieren vorbehalten, für sie richtete man anfangs auch einen eigenen Fechtwettbewerb aus.
Das Fechten ist eine von nur vier Sportarten, die bei keinen Spielen fehlte. Es galt als der aristokratisch-militärische Sport schlechthin; das änderte sich erst, als nach dem Ersten Weltkrieg dieses Milieu auf die alte Art nicht weiterbestand. Andererseits nahmen faschistische Eliten den »Blut-Sport« mit seinem Kriegerkult und dem mittelalterlichen Flair auf. Mussolini, der in seinen jungen Jahren als Journalist mehrmals zum Duell gefordert hatte, unterstützte demonstrativ die italienische Fechtmannschaft; Franco soll enthusiastisch gefochten haben; Heydrich begeisterte sich so sehr, dass er die Archive des internationalen Verbands aus Brüssel in sein Büro nach Berlin transportieren ließ.
Ein wesentliches Ziel der Adepten einer Sportart ist es, »olympisch« zu sein: Das bringt Anerkennung, etwas mehr Publikum, etwas mehr Werbung und viel mehr Geld. In der Geschichte des modernen Olympia wechselten die Programme oft. Anfangs wurden sie von den Veranstaltern bestimmt, erst ab den späten zwanziger Jahren entschied das IOC in Absprache mit den Fachverbänden. Seine Kriterien änderten sich im Lauf der Zeit. Bis zu Beginn der 1980er Jahre war es besonders wichtig, ob ein Sport weit verbreitet und nicht von Profis dominiert war – für Baseball und Kricket gilt beides nicht, deswegen blieben sie bis auf eine kurzfristige Ausnahme draußen. Mit der starken Mediatisierung bekamen Medientauglichkeit und Jugendlichkeitsmode mehr Gewicht, das sprach für Beachvolley, Surfen, Snowboard.
Man kämpft bei den Spielen zwar auf dem Land und im Wasser, nicht aber aeronautisch. 1900 stand in Paris Ballonfahren auf dem Programm, es war das einzige Mal, dass man olympisch in die Luft ging. Da auch die Autorennen gestrichen wurden, liegt die Annahme nahe, dass motorengetriebene Wettfahrten nicht genehm schienen, weil sie zu wenig der Körperertüchtigung dienen würden. Allerdings hätte man ja das Segelfliegen durchführen können, schließlich gibt es auf dem Wasser die Segelregatten, die immerhin die Spiele oft an zwei Veranstaltungsorte zwingen: 1972 mussten die Segler in das siebenhundert Kilometer von München entfernte Kiel. Für Segelkonkurrenzen in der Luft fehlte wohl die Tradition und lange Zeit die Vorstellung, wie man derartige Wettbewerbe medial vermitteln solle. Wenn man die Massen bei Flugshows bedenkt, wäre das Publikumsinteresse zweifellos vorhanden.
Im Fall des Mountainbike, das seit 1996 olympisch ist, gibt es mittlerweile einige Disziplinen. Die nationalen Verbände lagen im Streit, welche man bei den Spielen austragen solle. Schließlich behielten die technisch versierteren Teams die Oberhand, so dass man die schwierigeren Versionen und die gefährlicheren Strecken wählte.
Sogar der Verband der Wettesser erklärt, seine Wettbewerbe seien so anspruchsvoll, dass sie durchaus zu den auserwählten zählen müssten (ein Weltrekord: 69 Hotdogs in zehn Minuten).
Nach den neuesten Reformdebatten haben sich auch so traditionelle Disziplinen wie das immerhin aus der Antike übernommene Ringen Sorgen zu machen, ob sie weiterhin im gleichen Ausmaß präsent sein würden. Das IOC hat nach den Vorwürfen, es bediene einen Gigantismus, deshalb seien die Spiele nicht mehr finanzierbar, die Obergrenze der Athleten und Athletinnen auf 10500 (Winter: 2900) festgelegt und die Entscheidungen auf 310 (Winter: 100) eingeschränkt.
In einer für ein paar Wochen eigenen, abgeschlossenen Welt liefert Olympia Inszenierungen, die mit universell verstandenen Sinnbildern versehen sind.
Spiele sind eine Wurzel der menschlichen Zivilisation, sie vermögen starke kollektive Bindungen zu schaffen. Sie finden außerhalb des Alltags statt, sind räumlich und zeitlich begrenzt, wiederholbar und von Regeln geleitet.
Die Entwicklung der Olympischen Spiele zeigt, dass sich Idee und Praxis seit 1896 stark verändert haben. Sport und Spiele sind Ausdruck, ja Kennzeichen ihrer gesellschaftlichen und kulturellen Umstände.
Sport und Moderne
Im Vorfeld der Sommerspiele, die 2012 in London stattfanden, gab es einige Debatten über Gigantomanie und Kostenexplosion, soziale und ökologische Folgen der Veranstaltung. Dahinter stand oft die Frage nach der Sinnhaftigkeit des gegenwärtigen Spitzensports, der mit seinem intensiven Training nicht wirklich gesund oder gar durch leistungssteigernde Substanzen ein Spritzensport und schädlich sei. Die Organisatoren begaben sich mit ihren Argumenten nicht auf dieses Terrain, sondern sprachen vom Vorbild für die breite Masse. Sie betonten den Wert der olympischen Erziehung, setzten auf den Slogan »save the children« und somit auf eine positive gesellschaftliche Funktion.
Soziologen hielten dagegen, vor allem der Mannschaftssport betreibe auch soziale Kontrolle. In der Geschichte habe er im Sinne der Herrschenden dazu beigetragen, junge Männer zu guten Bürgern oder zu guten Arbeitern zu erziehen. Als Beleg zitierte man gerne Theodor W. Adorno, der erklärt hatte, Sport diene dazu, gesellschaftliche Verhältnisse zu bestätigen. Er sei kein Spiel, sondern ein Ritual: Unterworfene feiern die eigene Unterwerfung, sie »parodieren Freiheit durch die Freiwilligkeit des Dienstes, den das Individuum dem eigenen Körper noch einmal abzwingt«.
Die historischen Grundlagen für diese Einschätzungen sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu finden, vor allem in England. Dort begann eine der wirkungsmächtigen Entwicklungen der Moderne, die den Sport zum populären globalen Phänomen und zum ganz wesentlichen Feld der heutigen Gesellschaft machte.
Den Mythos von Olympia hatte die Renaissance wiederbelebt. Sowohl an den Fürstenhöfen als auch für die Stadtbevölkerungen war eine körperliche Betätigung mit Spiel- und Wettkampfcharakter zunehmend wichtiger geworden. Einiges davon sah Michel de Montaigne 1580/81 auf seiner Reise durch Italien. In den Essais berichtete er vom Ballspiel Jeu de Paume, einem Vorläufer des Tennis, vom Reiten und Fechten, Ringen und Schwimmen, von Wettrennen und Sprungkonkurrenzen.
Einen wesentlichen Aufschwung für den Sport brachte dann die Kommerzialisierung in England. Dort begeisterten sich immer mehr Menschen für das Boxen und das Laufen. In London gründeten Gentlemen 1787 den ersten Kricketclub. Man schrieb ein Regelwerk nieder, und im 19. Jahrhundert war Kricket im ganzen Empire verbreitet. In der britischen Hauptstadt erschien auch 1792 die erste Fachzeitschrift: Dass sich The Sporting Magazine vor allem mit Pferdesport und Jagd beschäftigte, war der Leserschaft aus der obersten Gesellschaftsschicht und ihren Vorlieben geschuldet.
Seine weite Verbreitung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verdankt der Sport der Industrialisierung sowie den sozialen und politischen Zuständen. In Großbritannien hatte sich die Gesellschaft dynamischer entwickelt als in anderen Ländern. Die wesentlichen Gründe dafür waren die Seeherrschaft, auf die sich das Empire stützte, der Parlamentarismus, der frühe Aufbau großer Produktionsstätten und ihre Auswirkungen auf den Handel, den die Kolonialherrschaft entscheidend begünstigte.
Zur Mitte des Jahrhunderts lebte mehr als die Hälfte der Einwohner Großbritanniens in Städten. Das Bürgertum in den ständig wachsenden Zentren sah die Werte des Kapitalismus auf den Sportplätzen spielerisch und dennoch ernsthaft umgesetzt: Wettbewerb, Unternehmergeist, Produktivität.
Die geänderte Vorstellung vom menschlichen Wesen in der Moderne hängt mit einer anderen Einschätzung von Körper und Bewegung zusammen. In Großbritannien bildeten die Elite und die Mittelschichten ein neues Körperverständnis aus. Da sie die Gesundheit der Bevölkerung als öffentliches Gut betrachteten, investierten sie viel in den Fortschritt der Medizin. Um in den Industriezentren die befürchteten Epidemien zu verhindern, legte man großen Wert auf Hygiene, zu deren Mitteln man den Sport zählte. Kurz: Es ging um das »survival of the fittest«, wie es bei Charles Darwin zu lesen war – seine Beobachtungen aus der Natur übertrug der Sozialdarwinismus auf die menschliche Gesellschaft.
1867 belief sich der Anteil der Industriearbeiter an der englischen Gesamtbevölkerung auf siebenundsiebzig Prozent, 1862 bis 1875 stieg der Reallohn um vierzig Prozent. Die veränderte Lebenssituation beeinflusste Normen und Verhalten. Das zunehmende Wettbewerbsdenken der Mittel- und Unterschichten stellte die geregelte Leistung und den messbaren Erfolg über das spielerische Moment: eine Einstellung, die schließlich den Weg zum Berufssport begünstigte.
Neue Regelungen von Arbeit und Arbeitszeit wirkten sich auf die Freizeitgestaltung aus. Wichtige Werte der Eliten und der gehobenen Mittelschicht zielten auf Selbstverbesserung sowie Arbeitsmoral, folglich konnten sie den Sport mit dem Nutzen der Erholung und der Charakterbildung rechtfertigen. Zudem entsprach er den Bedürfnissen einer städtischen Bevölkerung, der es ansonsten an Bewegung mangelte. Seine kultischen Momente ließen Männlichkeit, Führung und Fairplay erhaben erscheinen. Sport vermochte als Therapiemittel für die Gesellschaft zu dienen, Training konnte man als Kapitalisation von Energie verstehen.
Zunehmende Bürokratisierung und Rationalisierung griffen auch in diesem Bereich: Man rief Sportverbände ins Leben. Die Organisation ermöglichte eine Körperertüchtigung nach Gesetzmäßigkeiten im überschaubaren Rahmen. Spontane und kaum geregelte Spiele schienen den meisten Bürgern wenig nutzbringend. Sinn hatte für sie, was Leistung und Disziplin einübte. Im Kulturambiente und auch im Einsatz für die Nation traf man sich mit der Elite. Die renommierten Hochschulen trainierten die Fähigkeiten, die dem Empire dienlich sein sollten: Körperstärke, Willenskraft und Teamgeist. Um einen Posten in der Kolonialverwaltung zu erhalten, war es günstig, ein ausgewiesener Sportler zu sein. Ein Gentleman ging keinem allzu anstrengenden Beruf nach; er hielt seinen Körper fit, um an der Leitung des Empires tätig mitwirken und um seine Langeweile überwinden zu können. Die moderne Neugier auf neue Erfahrungen führte viele dieser Gentlemen dazu, sich auf riskante Unternehmungen einzulassen. Sie begaben sich nicht nur auf abenteuerliche Reisen, sondern zählten auch zu den Begründern des Alpinismus.
Die Oberschicht setzte sportliche Grenzen, indem sie die Wettkämpfe zum gesellschaftlichen Ereignis stilisierte. Beim Kricketmatch zwischen den Teams der Elitehochschulen Eton und Harrow trugen die Damen im Publikum ihre exquisite Garderobe in den Farben der Mannschaften, Hellblau oder Marine, dazu passend die Sonnenschirme, Haarschleifen und Handschuhe. Der Höhepunkt der Frühjahrsveranstaltungen war ab 1856 die Bootsregatta der zwei berühmtesten Universitäten, Cambridge gegen Oxford. Als diese beiden Institutionen 1864 ihre Leichtathletikmeisterschaft auf dem morastigen Kricketplatz des Christ Church College austrugen, stürmten Zuschauer vor Begeisterung nach jedem Wettbewerb das Feld und feierten die Gewinner.
Bald betrieb man einen Kult des Siegers, den die Sportpresse zu verbreiten beitrug. Heldengeschichten machten die Runde. So las man und erzählte sich, wie Edward Colbeck 1868 die englische Meisterschaft im Rennen über eine Viertelmeile in der Landesbestzeit von vierundfünfzig Sekunden für sich entschieden hatte – trotz einer Kollision mit einem Schaf, das sich auf die Bahn verirrt hatte und »voll Verwunderung ob der respektablen Leistung des Läufers dastand«. Colbecks Rekord hielt immerhin dreizehn Jahre.
English Sports ging um die Welt, vor allem der Fußball eroberte spätestens nach dem Ersten Weltkrieg die Stadien der meisten Länder. Das Empire hatte seine Verwalter und Soldaten, Techniker und Geschäftsleute rund um den Erdball stationiert. Zwischen 1850 und 1880 wanderten sieben Millionen Briten aus. Großbritannien galt als mächtigster Staat, die Flotte gewährleistete die »Erschließung« der Kolonien. »Britannia rules the waves«, hieß es stolz und sprichwörtlich. Bis in die fernsten Winkel sollte britische Überlegenheit und Kultur dringen. Beides vermittelten die Hochschulen, überall im Land formte man eine imperialistische Identität und das dazugehörige Selbstbewusstsein. All dies drückte auch der Sport aus, dadurch erhielt er einen ideologischen Anstrich.
Im Deutschen Kaiserreich knüpfte man hingegen an eine andere Entwicklung an. Hier hatte es die englische Art des Sports zunächst schwer, den Fußball verunglimpfte man gar als »Fußlümmelei«. Zur Zeit der Napoleonischen Kriege und der patriotischen Verunsicherung war Friedrich Ludwig Jahn, der dann »Turnvater« genannt wurde, im zersplitterten Deutschland der Kleinstaaterei zum Kampf für das Reich angetreten. Die »Weichlichkeit« des deutschen Volkes gelte es durch trainierte Männlichkeit zu überwinden. Die von ihm propagierte Leibesertüchtigung zielte auf späteren militärischen Einsatz für das Vaterland und auf starke soziale Disziplinierung ab. In strenger Ordnung unterrichtete man das vom aufsteigenden Bürgertum geförderte Turnen ab Mitte des 19. Jahrhunderts in den Gymnasien; die Vereine wuchsen zu Zentren der patriotischen Gesinnung und der Förderung der Wehrhaftigkeit. Der Turnerbund wurde zur größten Sportvereinigung der damaligen Welt. Da er sich aber als Stütze der Herrschaft im Kaiserreich verstand, bildeten die Arbeiterturner ihre eigenen Strukturen.
Der Sport erlebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überall dort einen großen Aufschwung, wo man die Industrialisierung vorantrieb. Mit der Mechanisierung, besonders mit der Eisenbahn, dem Symbol des Fortschritts, veränderte sich die Vorstellung von Raum und Zeit, somit die Wahrnehmung von Bewegung und Geschwindigkeit. In der Literatur und in der Presse jener Zeit gibt es unzählige Beschreibungen von Ängsten, Taumel, Schwindel bei der Zugfahrt.
Im Jahr 1900 veröffentlichte Louis-Octave Uzanne ein Buch über Sport und Transport La locomotion à travers l’histoire et les moeurs, dem er 1911 zwei Kapitel über Automobile und Flugzeuge hinzufügte. Darin beschrieb er begeistert das »Geschwindigkeitsfieber« seiner Zeit, die Zusammenhänge zwischen Fortbewegung, Raum und Moral. Nie mehr werde man auf den Wegen den angenehmen Rhythmus der Pferdehufe vernehmen, sondern nur noch das »Töff-Töff« der Maschinen. Das 19. Jahrhundert sei die Epoche der Initiation gewesen, der technisierte Mensch der Zukunft werde diese Ängste und Zweifel gar nicht mehr verstehen. Die Eisenbahnen, die Schiffe und vor allem die Flugzeuge erklärte der französische Schriftsteller zu den »mächtigsten Agenten der Fusion der Rassen, der Arbeitenden, der Länder und des Denkens«.
Der Geist des modernen Menschen sei eine unendliche Rennstrecke, meinte Octave Mirbeau, der 1907 seine Erzählung La 628-E8 publizierte. Der Titel ist die Nummerntafel seines Autos, das in dieser Prosahymne für die schnelle Bewegung den Helden abgibt.
Im Laufe der Industrialisierung sah man den Körper oft als Maschine, bis 1914 konnte man ihn in seiner Stärke erleben und ausstellen. Nachdem jedoch in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs die Technik über den Körper gesiegt hatte (achtzig Prozent der Gefallenen an der Westfront hatten ihren Feind nie zu Gesicht bekommen), war das Bedürfnis an körperlich errungenen Siegen besonders stark. Diesem Interesse des Massenpublikums folgten die Massenmedien, die Sportberichterstattung nahm enorm zu. Und konkret bewirkte der rasante Ausbau des Bahnnetzes eine viel größere Mobilität, die auch nationale wie internationale Sportveranstaltungen begünstigte. Der Mitropacup im Fußball bewirkte in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre die Einführung der »Mitropazüge«.
Die Körperbetätigung, die man heute als Sport bezeichnet, hatte in früheren Zeiten religiösen Charakter. Traditionelle Gesellschaften gaben ihr kultische Bedeutung. Baron Coubertin machte daraus einen Kult der Moderne, der gut mit der Rekordsucht des 20. Jahrhunderts zusammenspielt.
Die Moderne – die Epoche und ihre Geisteshaltung, aus der Pierre de Coubertin und seine Gefährten kamen – basiert auf Entwicklungen, die sich für die Umsetzung der olympischen Idee als förderlich erwiesen: Urbanisierung, Massengesellschaft, Fortschrittsglaube, Leistungsvergleich, Beschleunigung. Unter diesen Umständen empfanden viele Menschen ein neues Lebensgefühl, das der Leistung des Körpers große Bedeutung zumaß. In diesem Sinne entstanden um die Jahrhundertwende Jugendbewegung und Reformpädagogik, die der zweite Olympische Kongress 1897 in Le Havre als Hauptthema debattierte.
Sogar ausgewiesene Feingeister wollten sich neuen Erfahrungen mit der Geschwindigkeit nicht entziehen. So hatte sich der Wiener Dichter und Diplomat Leopold von Andrian, der sich in der Pose der Empfindsamkeit gefiel, ein Programm der Körperertüchtigung vorgenommen. Der schmächtige Hypochonder bezog im Dezember 1900 seinen Posten als Attaché an der österreichisch-ungarischen Gesandtschaft in Athen, von dort berichtete er seiner Mutter: »Heute bin ich zum ersten Mal ›ohne Hände‹ gefahren. Außerdem hoffe ich mir dreimal in der Woche einen Turnunterricht einzurichten.« Mit seinem Freund Hugo von Hofmannsthal hatte Baron Andrian in der Umgebung Wiens eifrig das »Bicycle«-Fahren geübt, im Gefühl, durch die sausende Bewegung eine sichere Balance zu gewinnen und sich durch Mutproben herauszufordern. Im Rückblick vermerkt er »als charakteristisch für die neue Zeit« seiner frühen »Mannesjahre« den Plan, erstens sich durch »beim klassischen Alterthum beginnende« Studien eine Weltanschauung zu schaffen und zweitens die »Uebung in Selbstachtung (Aufspringen, Bicycle in der Stadt, Schwindel-Bekämpfung usw.)« voranzutreiben. Schließlich vermerkte er, offenbar stolz: »Radfahren ohne Bremse den Hügel hinunter.«
Der Radsport war mit den neuen Möglichkeiten der Technik und dem starken Interesse an schneller Bewegung entstanden. Wesentlich für die Entwicklung war der Pedalantrieb des »Vélocipède«, das die Firma Michaux in Paris baute. Sie hatte mit dem Modell, dessen Namen das Wort für »Geschwindigkeit« aufnimmt, 1869 bei der Weltausstellung internationale Aufmerksamkeit erregt. Im selben Jahr hatte man zwischen Paris und Rouen das erste Radrennen auf einer öffentlichen Straße durchgeführt. Der Sport entwickelte sich rasant, die Sportpresse ebenso: 1893 gab es im Land eine Rad-Tageszeitung und an die dreißig Rad-Wochenblätter. Um 1900 bestanden dann in Frankreich schon dreihundert Velodrome; 1903, im selben Jahr wie der bald wichtigste Literaturpreis des Landes, der Prix Goncourt, wurde die Tour de France begründet. Kein Wunder, dass Franzosen 1896 bei den ersten Olympischen Spielen in Athen die Radkonkurrenz dominierten.
Bestimmte Gesellschaftsformen bringen bestimmte Sportformen hervor. Die Programme der Olympischen Spiele zeigen, wie wandelbar allein die Einstufung ist, was als Sport, insbesondere im Rahmen der renommiertesten Veranstaltung, gilt.
Neben der Neugestaltung antiker Wettbewerbe und den traditionellen Disziplinen der Elite gab es zunächst einige – aus heutiger Sicht – befremdliche: 1896 und dann wieder 1932 das Seilklettern, 1900 in Paris das Kanonenschießen, 1904 in St. Louis das Sackhüpfen und Keulenschwingen. Vier Jahre später galt in London dem Tauziehen ein großes Publikumsinteresse, und zuvor hatte man bei den englischen Wenlock Olympic Games »wheelbarrow freestyle«, also Freistil mit dem Schubkarren, durchgeführt. (Das ist offenbar heute wieder in Mode: Man läuft mit einem Karren durch die Stadt oder übers Gelände und macht dabei mit ihm komplexe Bewegungen, lässt ihn Figuren drehen.)
Trotz der idealistischen Beteuerungen vom »Olympischen Frieden« blieb in einigen Disziplinen der kriegerisch-aggressive Urgrund sportlicher Betätigung ersichtlich. Bei den Spielen, die 1900 in Paris im Rahmen der Weltausstellung ausgetragen wurden, gewann der Belgier Léon de Lunden das Taubenschießen. Das Komitee um Coubertin mochte es schließlich doch nicht als olympische Entscheidung anerkennen – man schoss nicht auf Tonscheiben, sondern auf lebende Vögel, so dass die Arena am Ende voller Blut und Federn war. Etwa dreihundert Tauben erlegte man aus sechs Metern Entfernung im Fluge, de Lunden traf einundzwanzig. Dafür erhielt er den Siegespreis von 20000 Franc, die Summe teilte er – man könnte es »im olympischen Geist« nennen – mit den drei anderen Finalteilnehmern. Als Olympia dann 1924 neuerlich in Paris gastierte, hatten die Veranstalter immerhin für die Vögel eine sinnbildhafte Verwendung. Sie entließen Tauben bei der Eröffnungszeremonie als Friedenssymbole in die Freiheit.
Bis 1912 stand auch ein Kampf aus dem aristokratischen Ehrenkodex auf dem olympischen Programm. Mit Pistolen schossen die Konkurrenten auf Pappfiguren, die so gestaltet waren, als seien sie zum mondänen Duell gekleidet.
Das Militärische und das Mondäne dominierte beim Schießen noch lange. Bis 1936 durften nur Offiziere mit der Pistole antreten. Einem der Besten dieser Zeit, dem Ungarn Károly Takács, verweigerten die sich sonst so volkspädagogisch gebenden Olympier die Zulassung, weil er Unteroffizier war. Durch eine Granate erlitt er 1938 eine schwere Verwundung seiner rechten Hand. Darauf begann er mit der linken zu trainieren, 1948 und 1952 gewann er Gold.
Die auf eine bestimmte Schicht begrenzte Teilnahme zeigt, dass die Ideale, von denen Coubertin schwärmte, bei den Olympischen Spielen lange nicht umgesetzt wurden. Der Baron sah die Phänomene der Moderne im Sport verkörpert. Darunter verstand er die Gleichheit der Chancen, ein gerechtes Ergebnis, eine Steigerung der Leistung; dazu verkündete er die Überhöhung, Olympia sei das Feld »außerordentlicher Heldentaten«. In seinen Reden und Schriften verwies er auch auf das Mittelalter als »Epoche mächtiger sportlicher Aktivitäten«, deren »ritterliche Idee« er adaptieren wollte, um die sozialen Probleme seiner Zeit zu lösen.
In seinen Unternehmungen konnte er sich auf die damals rapide zunehmende Sportbegeisterung stützen: Zwischen 1876 und 1886 zählte man in Paris mehr als 250 Veranstaltungen mit je vier Laufwettbewerben, zwei Jahre später trug man die ersten Landesmeisterschaften aus.
Da ist Pierre Fredy Baron de Coubertin fünfundzwanzig Jahre alt und dichtet seine Ode à la France, in der das lyrische Ich klagt, viele würden das geliebte Vaterland sterben sehen. Um England stehe es wesentlich besser, meint der junge Franzose. Das Rudern Oxford gegen Cambridge begeistert ihn, beeindruckt ist er vom Roman Tom Brown’s Schooldays, weil Thomas Hughes schildert, wie günstig sich die Athletik in der Ausbildung von Rugby auswirkt.
Darauf schreibt Coubertin sein Buch über das englische Erziehungswesen, L’Éducation en Angleterre. Sein Fazit ist: Die englische Jugend sei gesünder, da sie mehr Sport treibe; und die Weltmachtstellung des britischen Empire hänge eng mit der Sporterziehung an den Schulen zusammen.
Im Denken des Barons gesellt sich zu den English Sports der Bildungsenthusiasmus für die Antike. Nach den erfolgreichen Grabungen des deutsche Archäologen Ernst Curtius meint Coubertin: »Wenn Deutschland die Ruinen von Olympia freigelegt hatte, warum sollte es Frankreich dann nicht in seiner ganzen Pracht wiedererstehen lassen?«
Grabungen und Idealisierungen: Altertum im 19. Jahrhundert
Im antiken Olympia verneigte man sich vor den Göttern und feierte nur die Gewinner. Ab 776 vor unserer Zeitrechnung sind Siegerlisten bekannt, zweite oder gar dritte Plätze blieben kaum je in Erinnerung.
Seit dem zweiten Jahrtausend veranstaltete man die Spiele, in fünf Tagen hielt man Läufe, Zweikämpfe, Wettreiten, Wagenrennen und den Fünfkampf ab. Gegen Ende des vierten Jahrhunderts n. Chr. untersagte der römische Kaiser Theodosius I. sämtliche »heidnischen« Kulte. Das bedeutete auch das Ende Olympias, obwohl man die Spiele insgeheim noch eine Zeitlang durchgeführt haben dürfte.
Die Kult- und Sportstätte mit den Heiligtümern, dem Hain, der Arena und den Gebäuden für die Athleten wurde 551 bei einem Erdbeben verschüttet, dann überschwemmt. Lange Zeit wusste man nicht, wo sie lag. Nachdem ein französischer Forscher sie lokalisiert hatte, beschrieb sie der englische Archäologe Richard Chandler 1776 in seinem Buch Travels in Greece. Mehr als fünfzig Jahre später legten Franzosen den Tempel des Zeus frei. 1875 begann Ernst Curtius, der Autor der damals am meisten gelesenen Griechischen Geschichte, in Olympia mit den Grabungen, die das gesamte Areal zum Vorschein brachten.
Das antike Olympia.
Die Begeisterung für Griechenland führte im 19. Jahrhundert zahlreiche europäische Geistesmenschen ins Land. 1809 kam erstmals der Sehnsuchtsdichter Lord Byron, der im spleenigen englischen Sportsgeist später den ganzen Canal Grande in Venedig hinuntergeschwommen sein soll; 1824 starb er als Kommandant einer griechischen Freiheitsarmee in Mesolongi. Der Deutsche Heinrich Schliemann war mit seinen Geschäften reich geworden, studierte an der Pariser Sorbonne Altertumskunde und begann dann in Kleinasien Troja auszugraben; 1877 brachte er den »Schatz des Priamos« nach London. Die Taten und Texte dieser beiden Philhellenen wurden jeweils ausführlich von der Presse ihrer Zeit verbreitet.
Auch über die Grabungen von Curtius erschienen oftmals Berichte in den Zeitungen. Für seine Arbeit in Olympia, die von Deutschland als Prestigeprojekt des neuen Kaiserreiches gefördert wurde, warb Curtius mit den Worten: »Was dort in dunkler Tiefe liegt, ist Leben von unserm Leben«. 1856 hatte er im Essay Der Wettkampf, der heftige Debatten hervorrief, die Griechen von den »Orientalen«, vor allem den Juden, zu unterscheiden gesucht. Pathetisch wies er dem Sport eine gewichtige kulturelle Rolle zu: Den Siegerkranz sah er als »das Symbol des Griechentums«. Derartige Volkstypisierungen vereinfachen es, gewünschte Verbindungen zu präsentieren: Die Deutschen erklärte Curtius kurzweg zur hehren Kulturnation, indem er sich und seinen Landsleuten ein besonderes Verständnis des »hellenistischen Wesens« zusprach. Tatsächlich schuf damals das humanistische Gymnasium – das allerdings nicht nur in Deutschland Bildungs- und Sozialisierungsanstalt der Elite war – eine starke Voraussetzung, da Latein und Griechisch fast die Hälfte aller Unterrichtsstunden ausmachten.
In der Antike meinte man jene absoluten Normen für Kunst und Kultur zu finden, denen es nachzueifern gelte. Die Altertumswissenschaften hatten nach den Idealbildern, die Johann Joachim Winckelmann in seiner ungemein wirkungsvollen Geschichte der Kunst des Altertums von 1764 publiziert hatte, einen großen Aufschwung erlebt. Seine Formel von »edler Einfalt und stiller Größe«, die das Besondere dieser Referenzkultur ausgemacht hätten, wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein nachgebetet. Dazu vermochten die Erfahrungen, die Goethe und so viele andere Geistesmenschen von ihren Italienreisen berichteten, das tiefe Erlebnis der Antike zu vermitteln. Zur praktischen Anschauung verfügte man damals allerdings über wenige Originalwerke. Umso mehr Aufmerksamkeit erregten die Grabungen.
Als am Fuße des Vesuvs eine verschüttete Stadt entdeckt wurde, begeisterte die Nachricht das gebildete Europa. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts brachten Grabungen allmählich Pompeji und Herculaneum zum Vorschein, als hätte die alte Kultur nur geschlafen und sei nun wieder zum Leben erweckt worden. Die genauere Erforschung setzte in den 1860er Jahren ein, Ausgrabung wurde zum Sinnbild für historische Arbeit schlechthin. Mit Schliemanns Selbstinszenierung und vor allem mit seiner 1881 publizierten Selbstbiographie erschien der Archäologe in der Öffentlichkeit wie die moderne Form des Eroberers.
Die Antike wurde zur Mode, die Archäologie zur Attraktion. Der Bildungstourismus führte nunmehr obligatorisch zu ihren Stätten. Die übliche große Europareise der Oberschicht, die man als soziale Unterscheidung zelebrierte, steuerte Athen, Troja, Pompeji an. Kritischen Geistern aber blieb die Konstruktion einer Kulturidentität mittels romantischer Pose nicht verborgen. 1869 schrieb Mark Twain in The Innocents Abroad, unpoetisch und befremdlich sei die »idea of a railroad train actually running to old dead Pompeii«. Für ihn passte die Eisenbahn, das Geschwindigkeitssymbol der Moderne, nicht mit der Antike zusammen.
Die Begeisterung für den Hellenismus schuf einen Markt, und wenn der Boden zu wenige Objekte der Begierde freigab, machte man sie eben nach. So kam Arthur Evans, der reiche Sohn eines englischen Papierfabrikanten, 1894 nach Kreta, fand in Knossos Teile antiker Bauten und erklärte sie zu Palast und Labyrinth des Königs Minos. Vor dem Grabungsfeld hisste er den Union Jack. Die Lücken half ihm Emile Gilliéron zu füllen, der in Athen ansässige Schweizer Kunstrestaurator zog einen einträglichen Handel mit Kopien und angeblichen Originalen auf. Einiges geriet dann doch zu modern, so dass der britische Schriftsteller Evelyn Waugh meinte, ein Urteil über die minoische Kunst könne er nicht abgeben, denn die ausgestellten Fresken seien höchstens zu einem Zehntel älter als zwanzig Jahre.
Der Engländer Arthur Evans erbaute sich seine erträumte minoische Kultur neu, auch mit Stahlbeton. Der französische Baron Coubertin bemühte sich seinerseits um ethische Korrektheit. Er ließ ein neues Olympia erstehen, das – anders als die Konstruktion in Knossos – nicht behauptete, das alte zu sein, sondern das Renommee aufnahm und mit Formen der Moderne versah.
Dabei wurde auch Emile Gilliéron tätig: Er entwarf die Gedenkbriefmarken zu den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit und für die »Zwischenspiele«, die 1906 in Athen stattfanden. Seine Reproduktionen von Knossos, bei denen Gilliéron und sein Sohn sich die Freiheit wesentlicher Veränderungen genommen hatten, gingen um die Welt und inspirierten viele Bewunderer, darunter Sigmund Freud. In seiner Traumdeutung – und insgesamt in der Moderne – ist das Souterrain eines der wesentlichen Sinnbilder.
Wie die erste Intensivierung des Sports geht der Philhellenismus, die Begeisterung für das alte Griechenland, auf die Renaissance zurück. Durch diese Geistesströmung kamen Mythen und Epen, antike Tragödie und Philosophie wieder in den Blick und beeinflussten entscheidend nicht nur die französische und später die deutsche Klassik. Im 18. Jahrhundert nahmen die Aufklärer und die Gründungsväter der USA die attische Demokratie zum Vorbild. Die französischen Revolutionäre förderten den Neoklassizismus, um ihn gegen die christlichen Formen zu setzen, die ihnen als Symbole der Monarchie galten – Zeichen einer Zivilreligion, wie sie die Architektur der Macht noch heute vorstellt: Viele Parlamente erinnern mit ihren Säulen teilweise an griechische Tempel, vor manchen stehen Statuen wie Pallas Athene, die Göttin der Weisheit.
Am Anfang des 19. Jahrhunderts trug ideell die Romantik, dann konkret die Unterstützung des Freiheitskampfes der Griechen gegen das Osmanische Reich zum stärkeren Enthusiasmus für das Hellenentum bei. In ganz Europa nahmen die gebildeten Schichten das Land als Symbol für eine gemeinsame europäische Vergangenheit in mythischer Kulturzeit.
1821 brach der Aufstand gegen die türkische Herrschaft aus. Schnell begannen zahlreiche Vereinigungen in Europa und in den USA Finanzen und Hilfsmittel zu sammeln. Lord Byron brachte auf dem Schiff nicht nur Soldaten, sondern auch Geld und Medikamente mit.
In einem seiner Gedichte heißt es über Marathon: »The mountains look on Marathon / and Marathon looks on the sea; / and musing there an hour alone / I dream’d that Greece might still be free.« Der Kampf um die Freiheit nimmt Anleihe in der Vorzeit, am Mythos hält man sich an. Die zwei Versionen über den laufenden Boten verbindet Robert Browning 1879 in seiner langen lyrischen Hommage: »Run, Pheidippides, run and race, reach Sparta for aid!«. Und dann, am »Marathon day«: »Run, Pheidippides, one race more.« Dieses Gedicht war eine der Anregungen für Baron Coubertin, den langen Lauf vom Schlachtfeld nach Athen zum Vorbild für die Olympischen Spiele zu nehmen.
Im Oktober 1827 besiegten britische Schiffe mit französischer und russischer Unterstützung die türkisch-ägyptische Flotte in der Seeschlacht von Navarino. Der Krieg endete im folgenden Jahr, 1832 war Griechenland ein unabhängiger Staat.
Nach der Befreiung stärkte man das Gemeinschaftsgefühl mit dem ständigen Blick auf die glorreiche Vergangenheit, die immerhin ein kulturelles Feld für den Kontinent, wenn nicht für die ganze Welt bestellt hatte. Die Bedeutung ließ sich umso deutlicher vermitteln, je besser man sie vor Augen zu führen vermochte. Mithin leisteten die Ausgrabungen einen Beitrag zur Stärkung des griechischen Selbstbildes und des europäischen Kulturverständnisses.
Das Werk des Dichters Panagiotis Soutsos spiegelt diese Entwicklung gut wider. Seine Lyrik feierte die Geburt der neuen griechischen Nation, in einem Gedicht von 1833 lässt er Platon aus der Unterwelt in die Gegenwart aufsteigen und fragen: Wo sind all eure großen Theater und Marmorstatuen? Wo sind eure Olympischen Spiele? Entsprechend legt ein anderes Gedicht Leonidas – Spartas Kriegshelden, mit dem die Schulbücher des 19. Jahrhunderts einen kriegerischen Patriotismus zum Ideal setzten – die Worte in den Mund, die Olympischen Spiele müsse man wiederbeleben. Diesen Gedanken goss Panagiotis Soutsos 1842 in ein Memorandum, drei Jahre später rief er die Athener in einer enthusiastischen Rede zum neuen Olympia auf. Ein Veteran des Unabhängigkeitskriegs sollte ihn erhören.
Zwischen 1890 und 1897 veröffentlichte Ernst Curtius zahlreiche Publikationen über die Funde in Olympia. Pierre de Coubertin las die meisten.
Er hatte an der Sorbonne Kunst, Philologie sowie Jura studiert und dort die Begeisterung für die Antike erlebt, die sich in Paris auch in der (nach dem mythischen Musenberg benannten) Poesie der Parnassiens äußerte. Die griechische Kultur war ihm wie zahlreichen seiner Kollegen eine sublime Erhöhung, um einen Ausweg aus den ungünstigen Zeitumständen in Betracht ziehen zu können. Indem er ein Ideal beschwor, setzte er sein geheiligtes Bild über die historische Realität, deren Siegerkult er nicht sehen wollte. Die Devise »Dabeisein ist alles« übernahm Coubertin später vom englischen Sport.
Dem Hellenismus, dem der Baron nachhing, ging es weniger um geschichtliche Genauigkeit, sondern eher um seine Anwendung in der Gegenwart. Als Idee sollte er die Moderne bereichern und zur Besserung beitragen: In der »gegenwärtigen moralischen Unordnung«, erklärte Coubertin, vermöge Olympia eine Hilfe zu bieten, wie dies schon der Sport im 16. Jahrhundert in einer »physischen Renaissance« geschafft habe. Das idealisierte Menschenbild fand er von den antiken Skulpturen dargestellt, insbesondere vom Diskuswerfer des Myron.
Im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung hatte Euripides geschrieben: Griechenland kenne viele Übel, am schlimmsten aber sei das Volk der Athleten. Darauf ging der Baron nicht ein.
Coubertins Text »So war Olympia« brachte nicht die angekündigten Fakten, sondern die Wunschvorstellung: »Die Schönheit der umgebenden Landschaft, der Reichtum der Kunstgegenstände, die überraschende Fülle der Gebäude, die hohe Bedeutung der Institution, die Noblesse und Harmonie der Spektakel, die Intensität der patriotischen Rivalitäten – all das trug dazu bei, aus Olympia eines der bewegendsten und grandiosesten Zentren der antiken Zivilisation zu machen.« Der mythische Ort diente als Projektionsfläche. Und Coubertin drückte dies aus, indem er ihn als »cité de rêve«, als eine traumhafte Stätte, der Realität enthob.
Die Ideologie der olympischen Bewegung ist ohne Mythos nicht denkbar. Er gibt nämlich vor, dass eine überirdisch angelegte Fortdauer einer kulturellen Idee über die Zeiten hinweg bestehe, als sei es das unwiderstehliche Werk der Zivilisation.
Deren Ursachen und Wirkungen setzte Pierre de Coubertin in seinen Zusammenhang. Wenn ein englischer General erklären konnte, der Sieg von Waterloo sei auf den Kricketfeldern des Colleges von Eton vorbereitet worden, so stimme es auch, dass der Triumph von Marathon in den griechischen Sportstätten geschmiedet worden sei. Diese, die »Gymnasien«, könnten am besten die Größe der alten Zeiten erklären, da sie einer »höheren Zivilisation« gedient hätten.
Anfänge
Olympische Nachspiele seit Shakespeares Zeit
Zwanzig Jahre nach dem Tod von William Shakespeare erschien 1636 in London ein Buch mit dem Titel Annalia Dubrensia. Der Band rühmte eine Bereicherung der Kultur, die man jährlich in den Cotswold Hills erleben konnte. Wettkämpfe seien dort zu sehen, man tanze, und zwischendurch schlage ein Musiker die Harfe, der als alter Grieche wie Homer gekleidet sei.
Die Renaissance hatte das antike Denken wieder in das Bewusstsein der Gebildeten gerufen und zugleich die Sportausübung belebt. Nicht allzu weit von Shakespeares Stratford-upon-Avon entstanden in den Jahren vor 1612 »Mr Robert Dovers Olimpick Games«, die zunächst jeweils am Donnerstag und Freitag vor Pfingsten stattfanden. Die Puritaner hatten jedwede Unterhaltung am Sonntag untersagt, 1618 aber erlaubte die Declaration of Sports von König James I. in ganz England Tanz sowie Körperertüchtigung am Wochenende, und die königliche Familie unterstützte Dovers Olimpicks.
Robert Dover hatte in Cambridge studiert, war kurz Priester, dann Jurist. Die Vorgaben des Puritanismus empfand er als hinderliche Einschränkungen. Am Spiel sah er nichts Schlimmes, und körperliches Training sei zur Verteidigung des Reiches nötig. Folglich organisierte er, vage nach dem antiken Vorbild, in einer Naturarena Wettkämpfe um Silbertrophäen: Laufen, Werfen, Ringen, Fechten, Pferderennen. Dabei sollten Arm und Reich in spielerischer Stimmung vereint sein. Tatsächlich kam das Publikum aus allen Ständen von weit her, die lokalen Adeligen machten mit, gelegentlich zogen sie sich zur Abgrenzung in ihre Zelte zurück. Offenbar herrschten angenehme Bedingungen, denn Nicholas Wellington dichtete in seinem Beitrag der Annalia Dubrensia: »None ever hungry from these games come home.«
In dem Band stimmten dreiunddreißig Schriftsteller, darunter Ben Jonson, das Loblied auf diese Games an und wandten sich damit gegen die Puritaner, die das Unternehmen als »moralisch degenerierend« bezeichneten. Es wurde 1642 vom englischen Bürgerkrieg unterbrochen, nach Wiederherstellung der Monarchie wiederaufgenommen und bis Mitte des 19. Jahrhunderts durchgeführt.
Manche Interpreten meinen, auch Shakespeare dürfte einmal Dovers Olimpicks erlebt haben. Der Hinweis, der aus den Lustigen Weibern von Windsor herauszulesen sei, erscheint anderen aber doch zu vage: Es handle sich nur um einen Hügel, den Bolingbroke nennt, der aber nicht klar als die Stätte der Sportwettkämpfe zu identifizieren sei. 2009 vermutete der Historiker Francis Burns, der Sekretär von Robert Dover’s Games Society, der Ringkampf in Wie es Euch gefällt könnte dem Wrestling bei den Spielen geschuldet sein.
In den USA schlug kurz nach der Unabhängigkeitserklärung von 1776 ein Mitglied des Kontinentalkongresses der dreizehn Kolonien vor, man möge Olympische Spiele abhalten. Im Krieg könne es zum Vorteil gereichen, wenn die Männer durch Sport größere Robustheit erlangten. Außerdem gelte es zu bedenken, dass ja die alten Griechen die Spiele zur Geburt der Nation benützt hätten. Daraufhin hatte ein anderer Abgeordneter gegen diese »funny declamation« einzuwenden, gerade diese Art »Narretei« habe die Griechen »in ihre trostlose Lage« gebracht.
Auf dem nordamerikanischen Kontinent organisierte man dann Ende August 1844 unter dem Ehrenschutz des Generalgouverneurs von Kanada und dem Vorsitz des Bürgermeisters die »Montreal Olympic Games«.
Im 18. und 19. Jahrhundert wurden kurzzeitig an einigen Orten in Europa Wettkämpfe veranstaltet, die sich am griechischen Vorbild orientierten, und sei es nur namentlich. Das revolutionäre Frankreich trug 1796 bis 1798 die »Olympiades de la République« aus; »Olympische Spiele« fanden 1834 und 1836 auch im schwedischen Ramlösa, einem Vorort von Helsingborg, statt.
Nachdem Schweden ein Vierteljahrhundert zuvor Finnland an das Zarenreich verloren hatte, war eine starke nationale Bewegung entstanden. In ihr wirkten romantische Dichter des Landes und auch der Initiator der Spiele von Ramlösa. Sie waren sich einig, dass mangelndes vaterländisches Gefühl am territorialen Verlust schuld sei und man zudem die körperliche Ausbildung verbessern müsse. Ähnliche Voraussetzungen und vor allem die gleichen Argumente finden wir oft, hier wie in den USA, in Griechenland, Deutschland, Frankreich, England.
Trotz des patriotischen Interesses konnte sich das schwedische Olympia nicht lange halten. Die Oberschicht schätzte Ramlösa als renommierten Sommerkurort, die dortigen Pferderennen waren offenbar eine zu starke mondäne Konkurrenz gegen Gymnastik, Springen, Rennen, Ringen und Klettern.
Im sportbegeisterten England zur Zeit der Industrialisierung lief es anders. In Liverpool gab es von 1862 bis 1867 »Grand Olympic Festivals«, Ähnliches in Leicester und Morpeth; und im Londoner Crystal Palace organisierte man 1866 nationale Olympische Spiele, die bis 1883 insgesamt siebenmal stattfanden.