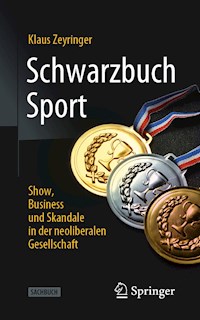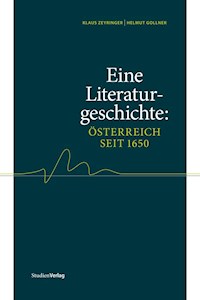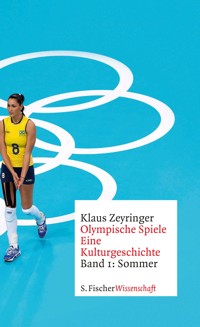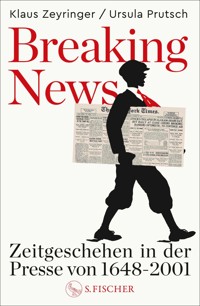
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was sagen uns Schlagzeilen über gesellschaftliche Debatten? Schlagzeilen in den Zeitungen bestimmen, was wichtig ist – aus Perspektive der Zeitgenossen. Klaus Zeyringer liest ausgewählte Nachrichtenim Original in der damaligen Zeitung und analysiert, ob und wie sie etwas aufnahmen, das heute als welthistorisch gilt. Er stellt fest, welche Vorfälle und Themen sie zugleich beschäftigten – und welche aus heutiger Perspektive nicht. Somit erhalten wir Einsichten über Formen, Möglichkeiten und Wertigkeiten der Kommunikation sowie des sozialen Lebens. Die Historikerin Ursula Prutsch ordnet die Berichte in den Kontext der Geschichte ein. Dadurch sehen wir, wie ein Ereignis von den Zeitgenossen bewertet worden ist und als was es sich im Laufe der Geschichte herausgestellt hat. An einer Fülle von Beispielen erfahren wir u.a., wie schnell die Presse 1688/89 vor Ort in der »Glorious Revolution« mit den Siegern einen Paradigmenwechsel vollzog; dass die Blätter in Europa und den USA (bis auf extrem wenige Ausnahmen) Not und Elend indigener Bevölkerungen nicht als Auswirkungen des Kolonialismus vermittelten, etwa die Millionen Hungertoten der 1770er Jahre in Bengalen; wie intensiv 1848 der Ruf der Revolutionen hallte; welch fatale Rolle Zeitungen beim Börsenkrach 1873 und in der folgenden langen Wirtschaftskrise spielten; welchen Anteil Propagandalügen an der Entwicklung zum Weltkrieg und dann verstärkt von 1914 bis 1918 hatten; was beim Aufstieg der Nazis gesehen, übersehen wurde oder wie Fotos die Einschätzung des Spanischen Bürgerkriegs prägten. Eine packende Zeitreise in die Aktualität der Vergangenheit voller überraschender Geschichten, und ein Denkanstoß über die Schlagzeilen von heute.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ursula Prutsch | Klaus Zeyringer
Breaking News
Zeitgeschehen in der Presse von 1648–2001
Über dieses Buch
Schlagzeilen in den Zeitungen bestimmen, was wichtig ist – aus Perspektive der Zeitgenossen. Dem historischen Blick zeigt sich ein ganz anderes Bild. Klaus Zeyringer erzählt fulminant von mehr als fünfzig historischen Ereignissen, wie sie damals in der Presse wahrgenommen wurden, und die Historikerin Ursula Prutsch präzisiert deren Bedeutung und Auswirkungen aus heutiger wissenschaftlicher Sicht.
Eine packende Zeitreise in die Aktualität der Vergangenheit voller überraschender Geschichten, und ein Denkanstoß über die Schlagzeilen von heute.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Klaus Zeyringer lehrte Germanistik in Frankreich und ist heute als Autor und Moderator tätig. Im S. Fischer Verlag sind zuletzt erschienen »Fans. Von den Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft« (gem. mit Ilija Trojanow), »Die Würze der Kürze. Eine kleine Geschichte der Presse anhand der Vermischten Meldungen« sowie mehrere Bände zur Kulturgeschichte des Sports.
Ursula Prutsch ist Professorin für Amerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat zahlreiche Publikationen u.a. zur Kulturgeschichte Brasiliens, Eva Peron, Populismus und zum »Patronenkönig« Fritz Mandl vorgelegt.
Inhalt
[Widmung]
1 »Eine ansteckende Krankheit«: 1720
2 Die Aktualität der Vergangenheit
3 Wie lang der Friede von Westfalen bis Prag brauchte: 1648
4 Das Abendland fürchtet sich: 1683
5 Krönung des Parlamentarismus: 1688/89
6 In den Anfängen des Pressewesens
7 »Indian War«, Indien und Tee in Boston: 1754 bis 1773
8 Kolonialmacht und Hungersnot: 1770
9 »All men«?: 1776 und danach
10 »Gran Rebelión«: 1780
11 Revolution und Symbol: 1789
12 Sklavenrevolution: 1791 – und zwölf Jahre Ungewissheit
13 Der Kongress tanzt die Presse aus: 1814/15
14 Weltende und andere Miseren
15 Peripherie zum Zentrum erhoben: 1807–1826
16 Revolutionen, Schlagzeilen
17 Der verbarrikadierte Kaiser: 1848
18 Beginn moderner Kriegsberichterstattung: 1854–56
19 Die Presse auf dem Weg in die Moderne
20 Vereinigungen: 1860, 1863, 1864
21 »Der Kronprinz lässt Ihnen sagen, Sie sollen zur Schlacht kommen«: 1866–1871
22 Blitzlichter
1870: Dogma und Debatte
1871: Blutwoche
1872: »Mrs. Satan« und »uma triste noticia«
23 Krach und Krisen: 1873–1896
24 Kolonialismus als Menschenzoo und Nachrichten von anderswo
25 Der »Meister der Pest«: 1894
26 Das afrikanische Herz der belgischen Finsternis: 1885, 1904, 1908
27 Was James Joyce im Kino und aus Zeitungen erfuhr: 1904/1905
28 Marktplatz der Moderne
29 »Menschheitsdämmerung«: 1914–1918
Eines schönen Tages Ende Juni
Einschläge und Schlagzeilen
Revolutionen, Bilanzen
30 Weltumwälzungen in Vororten und eine globale Epidemie: 1918–20
31 »Mordende Wirtschaftskrise«: 1929…
32 »Golden Age« der Presse?
33 Was heraufzog und was man kommen sah: 1933
34 Und was eintrat: Holocaust, Massenvernichtung
35 Bilderkrieg: 1936–39
36 Weltkrieg bis zur Atombombe: 1939–1945
Lügenüberfall
Pearl Harbor
Barbarossa eingekesselt
D-Day: Geheimnisse der »Operation Overlord«
Ende mit Schrecken
37 Bogotazo: 9. April 1948
38 Gründungen mit Langzeitwirkung: 1947–1949
39 Tod des Tyrannen: 1953
40 Mau Mau – Wer sind die Barbaren?: 1952–1960
41 Freiheit, Gleichheit/Mord und Tränengas: 1968
42 Mann im Mond: 1969
43 Bilder und Gegenbilder: München 1972
44 Warum es in Teheran eine Nofel-Loshato-Straße gibt: 1979
45 »The wall comes tumbling down«: 1989
46 Schlagzeilen zum Gegenschlag: 2001
Bibliographie
Internet
Unser herzlicher Dank gilt Michael Hochgeschwender und Ilija Trojanow
1»Eine ansteckende Krankheit«: 1720
Die Pest, und alles ist anders.
Am Kai stehen Grüppchen in anscheinend lockerem Gespräch, daneben sind Männer geschäftig bei der Arbeit. Auch wenn das Bild starr ist, es wirkt bewegt.
Es gibt Neuigkeiten, ein Dreimaster hat angelegt, mächtig nimmt er die Mitte des Gemäldes ein. Nun vertäuen ihn die Seeleute. Andere rufen vom Deck herab und bringen eine breite Holzrutsche an, um die Waren an Land gleiten zu lassen. Damen in wallendem Gewand, eine mit einem Schirmchen und eine andere mit einem Körbchen, sehen aus sicherem Abstand auf das Treiben. Herren unter Dreispitzhüten und roten Gehröcken treten näher, veranschlagen den Wert der Ladung. Sie fragen einen Matrosen, barfuß und in blau verschlissener Kniehose, wie viele Monate er unterwegs war. Ein Mann balanciert das weiße Bündel einer Last auf dem Kopf, zu einem Stapel weißer Säcke. Kinder laufen, sie rufen und lachen. Zwei blau Livrierte kommen mit einer Sänfte, hinter ihrem blauen Vorhang ist der Insasse dem Blick entzogen, ein dunkelbrauner Hund trottet hinterdrein. Daneben hält ein gebeugter Alter einen großen Fisch unter den Arm geklemmt, als wäre es eine Geschäftsmappe. Am Rande des Bildes rollen drei Kräftige ein Fass.
Man vermeint Gerede, Geschnatter, Getrappel, Geklopfe zu hören, Bewegung und Kommen und Gehen wahrzunehmen.
Im Hintergrund des Hafenbeckens rudern Männer in Barken heran. Auf dem Kai liegen Kisten, Fässer und Ballen. Über allem erhebt sich in hellem Braungrau das Mauerwerk der Bastei und ihrer Türme und oben auf dem Hügel die Basilika Notre Dame de la Garde, »la Bonne Mère«, die gute Mutter.
So bringt ein Gemälde des Claude Joseph Vernet das Treiben im Hafen von Marseille nahe.
Ein paar Jahre zuvor lastete hier eine Todesstimmung, wie sie ein anderes Bild, gemalt von Michel Serre, vermittelt.
Niemand rudert, keine Ladung wird gelöscht, niemand plaudert. An Sammelplätzen liegen Kadaver an Kadaver, auf Tragen und in Karren bringen Dunkelgekleidete die nächsten Leichen. Feuerstellen glosen, an Hausecken wachen Soldaten. In einem Winkel und vorne an der Kaimauer sind Körper auf dem Boden hingestreckt, von denen gerade noch der eine oder andere Arm zur Hilfe gereckt ist. Geschunden wirken sie; könnte man sie aus der Nähe sehen, würde man Beulen und dunkle Male an ihnen erkennen. Rauch liegt über der Trostlosigkeit, ein Mönch hält ein langes Holzkreuz in die Höhe.
Es herrscht der Eindruck drückender Stille, unterbrochen von Seufzen, Klagen, Weinen, Jammern und Schreien.
Marseille, um 1720.
Mit den Schiffen kommen nicht nur Seeleute und Passagiere, Waren und Nachrichten.
»Un mal contagieux«, nennt es die halboffizielle französische Zeitung. Die genaue Bezeichnung meidet sie konsequent, als vermöchte sie mit dem Namen das Schlimmste aus ihrer Welt fernzuhalten. Eine ansteckende Krankheit, »un mal contagieux« (»le mal« heißt auch »das Böse«), sei in Marseille aufgetreten, »qui avoit fait mourir quelques persones«, die einige Personen – notabene nicht viele – zu Tode gebracht habe. So steht es am 24. August 1720 in der Pariser Gazette. Sie teilt es ihrem Publikum nicht durch eine Meldung aus dem eigenen Land mit, sondern durch eine Nachricht von Hamburg her, wo Schiffe aus Marseille wegen der Seuche nicht anlegen dürfen. Aus Neapel berichtete das Blatt eine Woche zuvor, die dortige Behörde habe den Handel mit der Provence ausgesetzt und siebenundzwanzig bewaffnete Boote vor der Küste kreuzen lassen, um die Zufahrt zu kontrollieren.
Die Gazette bringt keine direkte Information von der Lage im Süden des Landes, nichts aus erster Hand von Korrespondenten in Marseille, Toulon oder Arles. Den Ausbruch der Krankheit meldet sie nur über Umwege, nach Mitteilungen aus der Fremde, so dass der Name des Übels in ausländischen Blättern bleibt, in medialer Quarantäne.
Aus Frankreich selbst bietet die Pariser Zeitung kaum mehr als Hofnachrichten. Sie schwelgt in Audienzen, Ernennungen, Festlichkeiten, Kirchenbesuchen und Jagden. Am 13. September 1721: »Der König tötete mehrere Stück Wild. Seine Majestät fuhr sodann in der Kutsche in den erleuchteten Gärten spazieren.« Es folgten Konzert und Feuerwerk, die Majestät ist unterhalten und »sehr zufrieden«.
Zu dieser Zeit stirbt halb Marseille an der Pest.
Man schreibt den 25. Mai des Jahres 1720, es ist ein Samstag. Ein Dreimaster steuert segelgebauscht auf Marseille zu. Er hat teure Stoffe geladen, die Fracht ist hunderttausend Ecus wert, dafür müsste ein Arbeiter hunderttausend Monate schuften. Die Grand Saint Antoine kehrt aus der Levante zurück, dort grassiert die Pest.
Einer der Eigentümer ist der erste Ratsherr von Marseille, vor zehn, fünfzehn Jahren hat er als Konsul im osmanischen Sidon, im heutigen Libanon, die Pest erlebt. Auch in seiner Heimatstadt, dem wichtigsten Mittelmeerhafen der Zeit, vor allem für den Handel mit dem Orient, kennt man den »Schwarzen Tod« aus eigener Erfahrung. Im vergangenen Jahrhundert ist die Seuche hier vier Mal ausgebrochen. Deswegen belässt man Schiffe in Quarantäne – vierzig (quarante) Tage abgeschottet, auf Sicherheitsabstand –, wenn die sanitäre Lage in ihrem Abfahrtshafen und an Bord ungewiss ist.
Die Grand Saint Antoine hat sieben Tote zu beklagen, als sie auf Marseille zusegelt. Die Männer an Bord sind erschöpft und höchst besorgt. Der Kapitän erklärt die Sterbefälle mit dem schlechten Essen.
Nach einigem Hin und Her verhängt die Behörde nicht die übliche strikte Abgeschiedenheit auf einer fünfzehn Kilometer entfernten Insel. Das Schiff darf in Stadtnähe ankern, es ist der Besatzung schließlich erlaubt, einen Teil der Ware an Land zu bringen. In den Stoffen nisten Flöhe, sie tragen – wie man heute weiß – den Bazillus Yersinia pestis.
Einige Wochen später notiert ein Pater: »Gott hat seinem Volk den Krieg erklärt.« Bis August 1722 sterben vierzigtausend Menschen in Marseille, das zuvor doppelt so viele Einwohner gezählt hat, und ungefähr hunderttausend in der Provence.
Es ist die letzte große Pestepidemie in Europa.
Der halbe Kontinent hat Angst.
Die Presse zeugt davon, besonders wenn sie die Seuche nicht beim Namen nennt wie die Pariser Gazette im Dienste des Hofes. Weitreichende Befürchtungen stehen am 6. November 1720 in der Wiener Zeitung:
Aus der Schweitz/von dem 28. October. Daß man alldorten dermalen mit Unmuth vernehmen müsse / wie daß nunmehro die Pest nicht allein in ganz Provence sich ausgebreitet: sondern auch bereits die Gränzen vom Delphinat und Piemont angestecket: und also diese Pest nicht allein ganz Frankreich und die Schweitz / sondern auch ganz Deutschland / Italien / Spannien / Portugall / und die sammentliche Niederlanden in grosse Unruhe gesetzet: sodan bewogen habe / mögliche Fürsorg zubrauchen.
In München weiß die Mercurii Relation am 19. Oktober von Briefen, die aus Marseille in Genua eingetroffen sind: »weil die Leichen 15. biß 20. Tage auf denen Gassen unbegraben ligen / so wäre auch die Luft davon inficiret worden«.
Der Stamford Mercury in Lincolnshire übernimmt am folgenden Tag einen Beitrag, der eine Woche zuvor in der Londoner Evening Post erschien und wiederum einen Brief aus Marseille vom 20. September zitierte. Im Gegensatz zur Pariser Presse finden sich hier die Zustände deutlich geschildert: »This City looks like a Desert, we see nothing in our Streets but either dead Bodies or dying Persons, ten Carts not being sufficient to carry them off.« Alle Friedhöfe sind seit vierzehn Tagen voll, neue mussten eingeweiht werden, auch sie bald überfüllt. Eine Woche später legt das Blatt mit der in Katastrophenfällen medial üblichen Übertreibung nach: »Marseille is entirely ruin’d, above 80000 Persons have died there.« So tödlich und hartnäckig habe noch keine Pest gewirkt.
Eine Beschreibung der schrecklichen Zustände gibt die Wiener Zeitung am 16. August 1721, indem sie einen Brief aus Arles auszugsweise abdruckt. Niemals sei in einer Stadt ein »solcher Jammer gewesen / als hier / seitdem sich die Pest bey uns eingefunden«. Die Berichte vor Ort nennen die Seuche beim Namen; Paris hingegen zensiert.
Es mangelt an allem, es gibt weder Wundärzte noch Totengräber. Die Kadaver liegen aufeinander, in den Beulen sitzen Würmer, geht das Wiener Blatt ins Detail. Es stinken die Leichen, »die davon wümmeln / wie ein fauler Käß«. Der üble Geruch liegt in der Luft, dringt in alle Gebäude. Die dramatische Lage verursacht Aufstände, dem Erzbischof wurde von einem Schuss der Hut durchlöchert, zwei Rädelsführer hat man hingerichtet. Die befallenen Dörfer sind mit Pestmauern und Palisaden abgeriegelt, davor wachen Regimenter. Die Generalität ordnet an, Ortschaften mit dem Feuer zu reinigen. Die Überlebenden müssen ihre Dörfer selbst anzünden, ihre Kleidung in die Flammen werfen, sich in Baracken zur Quarantäne zurückziehen.
In der folgenden Rubrik teilt ein Brief aus Vigan in der Languedoc dem Wiener Lesepublikum mit, man fürchte in der Region ein Übergreifen der Seuche. Um das zu verhindern, haben Soldaten einen verirrten Widder »erwürget«. Daraufhin befahl der Kommandant ohne weitere Worte den Wildtötern, eine Grube auszuheben und sich dort aufzustellen. Sie wurden füsiliert und samt dem Widder verscharrt.
Am selben Tag will die Pariser Gazette von schauerlichen Zuständen nichts wissen. Sie teilt hochgemut mit, der König erfreue sich bester Gesundheit. Vor lauter Glückseligkeit darüber hat nicht nur der Große Rat ein Te Deum singen lassen, reihum loben die Kirchen den Herrn für das Wohlbefinden der Majestät. Seine Jagderfolge, die das Blatt in braver Regelmäßigkeit mitteilt, halten sich mit einem Widder nicht auf: Bei diesem »divertissement«, seinem Vergnügen, töte der König immer eine erkleckliche Anzahl Wild.
Einen Monat später meldet die Wiener Zeitung, dass in Toulon die Pest zwar zurückgehe, aber auf dem Land »dauret das Sterben noch sehr«. In einem Dorf sind fast alle dreihundert Bewohner hingerafft, in einem anderen bleibt nur ein Viertel der Bevölkerung übrig. Aus der Stadt wurden sechzig Rudersklaven abkommandiert, um die Toten zu begraben – die sechzig sind der Geißel Gottes erlegen.
An diesem 13. September erfährt die Leserschaft der Gazette, der Herzog von Bourbon habe dem König ein prunkvolles Fest ausgerichtet.
In England kündigt der Caledonian Mercury am 23. November 1721 an, es gebe »An approved Preservative against the Plague«, und der Stamford Mercury weiß »Avignon is in a Miserable Condition«.
Wie schlimm die Lage in Avignon auch sein mag – in Paris hält sich die Gazette weiterhin an den Pomp höfischer Abgehobenheit: Bei der Aufführung des Balletts Elemente habe der König graziös getanzt.
Die Meldungen der Zeitungen gingen seit Beginn des Pressewesens im frühen 17. Jahrhundert kaum je über Höfisches und Schlachten, Katastrophen und Skurriles hinaus. Vom Kulturleben war äußerst selten zu lesen. Den Wahrheitsgehalt der Blätter (die mitunter von Blutregen, Babys mit drei Köpfen und Untoten schrieben) bezweifelten Gelehrte, oder sie prangerten gar die »Unsittlichkeit des Zeitungslesens« an.
Die Schilderungen von der Pest jedoch nahm das Publikum mit Schrecken für wahr, so dass die Distanz zu den Orten der Verheerung zu schrumpfen schien.
Die Angst blieb lange, die Erinnerung in Form von Pestsäulen und Redewendungen bis heute.
Es schien niemanden zu verwundern, dass 1720 die Seuche mit dem Dreimaster Grand Saint Antoine ausgerechnet aus dem Orient nach Marseille gekommen war.
2016 wiesen jedoch Forscher des Max-Planck-Instituts mittels der DNA aus Zähnen die Herkunft des Erregers nach: Er stammte nicht aus Asien, sondern von der großen Pest, die Europa fast vierhundert Jahr zuvor verheert und mindestens ein Drittel der Bevölkerung des Kontinents getötet hatte. Am 14. Januar 2016 titelte die Süddeutsche Zeitung: »Pest-Erreger schlummerte jahrhundertelang in Europa«.
Die asiatische Herkunft passte in die seinerzeitige Vorstellungswelt. Von dieser weiten Ferne wusste man wenig, erfuhr man kaum etwas, hatte man schreckliche Ahnungen. Hartnäckig hielten sich Erzählungen von den Einfällen der Hunnen, Mongolen, Tataren und Türken. »Die Geißel Gottes«, das galt sowohl für Attila als auch für die Pest.
In Südfrankreich ging sie im Sommer 1722 zu Ende.
Im Dezember desselben Jahres starb der chinesische Kaiser Kangxi. Seinem Sohn und Nachfolger passte der Vertrag mit Russland nicht, er ließ die Grenzen schließen. Nur in wenigen europäischen Zeitungen war von den Vorgängen in China zu lesen.
2Die Aktualität der Vergangenheit
Aus einer gegenwärtigen Sicht sind oft Gründe und Hintergründe aktueller Entwicklungen nicht zu durchschauen. Allenthalben macht es später eine historische Recherche möglich, kann man dadurch Zusammenhänge und Auswirkungen verstehen. Die Pest in Marseille betrachten wir heute beruhigt, in Kenntnis der Tatsache, dass es die letzte große Welle des Schwarzen Todes in Europa war und Alexandre Yersin 1894 den Erreger, somit ein Gegenmittel fand.
Die Presse von früher vermittelt einen gewichtigen Teil des öffentlichen Diskurses ihrer Zeit. Die täglichen Nachrichten und Kommentare bringen – für immer festgehalten – das zum Ausdruck, was damals als Mitteilung über Ereignisse und als Einschätzung ihrer Wirkungen zirkulierte. Sie bildeten ein Reservoir für den Gesprächsstoff, aber die meisten Inhalte gelangten nicht in ein weiterreichendes kollektives Gedächtnis.
Die nachträgliche Lektüre ist eine Zeitreise. Sie schafft eine Tiefenbohrung, legt Schichten früherer Zustände frei. Der heutige Wissensstand nimmt zwar die damalige Spannung, wie sich eine Lage weiterentwickeln werde, vermag jedoch mit Einsichten versehen zu sein, die den Zeitgenossen noch nicht bekannt waren. Was auf die »Türkenbelagerung« von Wien folgte, wissen wir; 1683 fieberte ganz Europa dem Ausgang entgegen. Oder: Die Zusammenhänge zwischen der enormen Explosion des Vulkans Tambora, die sich in Indonesien 1815 ereignete, und den globalen Klimaveränderungen wurden erst fast hundert Jahre später von Forschern verstanden. Seinerzeit berichtete die Presse jeweils von beiden Phänomenen unabhängig voneinander – allerdings vom Ausbruch nur am Rande, da ihr die weitreichende Bedeutung nicht bewusst sein konnte.
Aus früheren Zeitungen ist nicht nur zu erfahren, ob und wie sie etwas aufnahmen, das heute als welthistorisch gilt. Es lässt sich feststellen, welche Vorfälle und Themen sie zugleich beschäftigten, sogar mitunter mehr als das Großereignis, wie wir es nunmehr verstehen. Aus unserer jetzigen Sicht kann auch auffallen, was in der damaligen Presse keine Spuren hinterließ, wie Informationen präsentiert waren, an welcher Stelle und in welcher Nachbarschaft im Blatt.
Derart erhalten wir Einsichten über Formen, Möglichkeiten und Wertigkeiten der Kommunikation sowie des sozialen Lebens. Zudem vermögen wir den Zeitungen zu entnehmen, wie sie (und ihr Lesepublikum) im Lichte und Interesse der jeweiligen Aktualität Historisches präsentierten: So gestaltete man Narrativ und Einordnung der »Türkenbelagerung« gemäß Situation und Machtinteresse 1783, 1883 und 1933 je anders.
Wertigkeiten wurden im Lauf der Zeit verschoben, Deutungen geändert. Der Geschichtsunterricht unserer Bildungsstätten bespricht wohl das Ende des Dreißigjährigen Krieges, jedoch nicht die Belagerung Prags, bei der die Schweden vom Westfälischen Frieden zunächst nichts wissen wollten, während sich die Zeitungen dauernd fragten, wie es um die »Goldene Stadt« stehe.
Bei der Lektüre der Blätter von früher werden Positionen und Ansichten, damalige Vorgangsweisen und Einschätzungen, Narrative und (oft eingeschränkte) Möglichkeiten der Information ersichtlich:
Wie schnell 1688/89 die Newspapers vor Ort in der Glorious Revolution mit den Siegern einen Paradigmenwechsel vollzogen;
wie Zeitungen 1720 den französischen Autoritäten zur Verschleierung der Pest dienten;
wie die Presse hingegen 1814/15 den Mangel an Nachrichten über Fortschritte des Wiener Kongresses mit der Beobachtung von Tanzschritten und mit Spekulationen über deren eventuelle diplomatische Bedeutung überdeckte;
wie wenig die europäischen Blätter in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (und in den folgenden zumindest hundertfünfzig Jahren) über die ferne Fremde wussten, wie selten sie – außer im kolonialen Kontext – über andere Kontinente berichteten, wie ungewiss meist die Informationen waren und wie sehr sie Stereotypen folgten;
wie ab 1754 Zeitungen der feindlichen Lager aus ihrer jeweils konträren Erzählung eines Scharmützels propagandistisch den Beginn des ersten globalen Kriegs legitimierten;
dass die Blätter in Europa und den USA (bis auf ganz wenige Ausnahmen) Not und Elend indigener Bevölkerungen nicht als Auswirkungen des Kolonialismus vermittelten, etwa die Millionen Hungertoten der 1770er Jahre in Bengalen;
wie man für die heimische Öffentlichkeit eine Rebellion in den Kolonien (im Vizekönigreich Peru) herunterspielte,
wie man hingegen die Französische Revolution sofort stark symbolisch überhöhte oder – je nach Standpunkt – verteufelte, was den Zeitungs- und Devotionalienmarkt belebte;
zugleich brachten europäische Zeitungen über die Sklavenrevolution in Saint-Domingue wenige und widersprüchliche Nachrichten, in Schwarz-Weiß-Malerei;
wie nicht wenige Blätter des »Alten Kontinents« die begeisterte Diktion der Lateinamerikaner zitierten, die sich von Spanien und Portugal unabhängig kämpften;
wie intensiv 1848 der Ruf der Revolutionen hallte;
wie die Presse im ersten »modernen« Krieg mitspielte und in der Folge meist nah am militärischen Geschehen war, ab 1914 von den Autoritäten weitgehend eingeschränkt;
dass das Rote Kreuz in den Tagen seiner Gründung gleich zu seinem ersten Einsatz direkt vor Ort kommen hätte können;
welch fatale Rolle Zeitungen beim Börsenkrach 1873 und in der folgenden langen Wirtschaftskrise spielten, und wie seither diese Finanzkatastrophen den gleichen Mustern folgen;
dass Presseberichte das Interesse des belgischen Königs Leopold für den Kongo erweckten und dass dann die Affäre um die dortigen Gräuel und um millionenfachen Mord in heftigen Medienkämpfen ausgetragen wurde;
welchen Anteil Propagandalügen an der Entwicklung zum Weltkrieg und dann verstärkt von 1914 bis 1918 hatten;
wie konträr die Pariser Vorortverträge kommentiert wurden, so dass sie weniger friedens- als kriegsstiftend zu wirken schienen, während man auch mit der ungemein tödlichen Grippeepidemie Politik betrieb;
wie ab 1929 das große Elend zunächst herabgespielt, dann in Schlagzeilen gesetzt wurde, während das millionenfache Elend im Kleinen unter »Vermischtes« zu finden war;
was beim Aufstieg der Nazis gesehen, was übersehen wurde;
wie Fotos die Einschätzung des Spanischen Bürgerkriegs prägten;
wie sehr die europäische Sichtweise den Mau-Mau-Aufstand in Kenia dämonisierte und die britischen Grausamkeiten bagatellisierte, wenn nicht verschwieg;
welche Bilder allgemeine Vorstellungen von den Auseinandersetzungen 1968, von der Mondlandung 1969, vom Terroranschlag bei Olympia 1972, vom Mauerfall 1989 bestimmten;
welche Rolle ein französisches Dorf in der Iranischen Revolution spielte;
wie 2001 Schlagzeilen einen Gegenschlag vorbereiteten.
Diese historischen Tiefenbohrungen mittels der Presse von damals gehen gezwungenermaßen von unserer eigenen Sozialisation und von praktischen, vor allem sprachlichen Möglichkeiten aus. Fast alle für uns verfügbaren und lesbaren Zeitungen stammen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, aus Frankreich und Großbritannien, aus den USA und Brasilien, manche aus Italien und Spanien, sehr wenige aus einem Land slawischer Sprache. Sie vermitteln eine von Europa geprägte Sichtweise, meist und jedenfalls hinter den Worten einen Eurozentrismus. Deswegen muss, über die Jahrhunderte, eines der Oberthemen unserer Presserückschau der Kolonialismus mit seinen Grundlagen und Auswirkungen sein.
4Das Abendland fürchtet sich: 1683
Von den Mauern Wiens sehen die Verteidiger das ganze Land in Flammen. Die Vorstadt haben sie selbst in Schutt gelegt, um den Angreifern keine Deckung zu gewähren. Nun brennen rundum die Dörfer, überall rot glimmende Nester. Die Tartaren der osmanischen Armee haben zweihundert Ansiedlungen abgefackelt, die Bewohner umgebracht oder in die Sklaverei getrieben. So steht es in der Pariser Gazette am 24. Juli 1683.
Und so entspricht es im christlichen Europa der damaligen Furcht vor den »Türken«, in den Berichten meist »die Ungläubigen« genannt, mit den Beiwörtern »brennend und sengend«. Sogar in Kirchen Schutz suchende Frauen und Kinder haben sie aufs Entsetzlichste hingeschlachtet, liest man in den Zeitungen, die in manchen Berichten diese Heimsuchungen als Strafe Gottes bezeichnen. Alle Schlösser, Klöster und Dörfer im weiten Umkreis der Residenzstadt Wien liegen in Asche, schreibt die im norddeutschen Altona erscheinende Europäische Relation an diesem 24. Juli. Es sei jeder Einheimische »klein und groß / wie das Viehe« weggeführt und wer nicht zu folgen vermochte, »niedergehauen worden«. Zehntausende Männer, Frauen und Kinder aus »Österreich unter der Enns« (dem heutigen Niederösterreich) treiben die Osmanen auf die kleinasiatischen Sklavenmärkte; dort fallen alsbald die Preise.
Der Beitrag in der Gazette ist eine Meldung aus Wien vom 5. Juli. Die Hauptmacht der türkischen Truppen, heißt es, konnte bei Körmend die Raab überqueren. Obwohl sie noch hundertfünfzig Kilometer von der Hauptstadt, dem »Tor zum Abendland«, entfernt ist, erregt dort die Nachricht »allgemeinen Schrecken« (»une épouvante générale«). Kaiser Leopold I., später »Türken-Poldl« genannt, und sein Hof verlassen Wien unter Buhrufen und Pfiffen der Bevölkerung, weichen nach Linz zurück, dann nach Passau.
Die Furcht vor den Türken zieht durchs Land. Sie speist sich aus Erzählungen, Liedern, Flugblättern und der Presse.
Von den Gräueltaten der christlichen Armeen hingegen berichten die Zeitungen kaum, auch nicht davon, dass es sich für ungarische Kleinadelige und die dortige Bevölkerung nicht schlechter unter dem Sultan lebt als unter dem Kaiser.
Die böse grausame Gewalt ist den Feinden aus dem ganz anderen Kulturkreis zugeschrieben, auf beiden Seiten fördert das die Machtpolitik. Sowohl Habsburger als auch Osmanen geben ihren Interessen und damit ihrem Konflikt eine religiöse Fassade; den jeweils Anderen geißeln sie als ungläubig, also furchtbar.
Dem Pariser Blatt kommt die Zuspitzung auf den Glauben entgegen, da Frankreich im Hintergrund den Sultan zum kriegerischen Vorgehen in Westungarn ermuntert hat, führt es doch selbst Krieg gegen den Kaiser. Nach einer Hilfszusage von Ludwig XIV. erhob sich Graf Tököly mit seinen Kuruzzen gegen Habsburg. Die Gazette, vom Hof unterstützt und kontrolliert, kann natürlich des Königs Verständnis für die muslimischen Osmanen nicht deutlich öffentlich machen: Im Sinne des »christlichen Abendlandes« muss sie ihrem Lesepublikum den Kampf gegen die Ungläubigen vorsetzen.
Die Zeitungen sowie die später als »Relationes« publizierten Augenzeugenberichte schildern die militärischen Vorgänge ausführlich, oft aus offen subjektiver Sicht mit den Worten »die Unsrigen«. Das ist nicht nur den Korrespondenten geschuldet, die eben aus ihrer Stadt berichteten, sondern suggeriert in der Häufung während der »Türkenkriege« einen christlich-abendländischen Zusammenhalt.
In der Ausgabe vom 24. Juli ist in der Gazette zu lesen, in Lissabon habe der Erzbischof allen Kirchen um göttliche Hilfe für Wien zu beten befohlen; in Rom sei vom Papst eine Generalabsolution für alle versprochen worden, die im Kampf gegen die »Ungläubigen« fallen. Die Europäische Relation meldet am 7. August aus Rom, dass Innozenz XI. schnell die »Differentien« mit Venedig ausgeräumt sehen wolle, um nichts zu unterlassen, »was zu Defension der Christenheit / wieder den Türckischen Bluth-Hund« [sic] beitrage. Ungläubigen spricht man auf beiden Seiten den Menschenstatus ab, indem man sie mit Tiernamen belegt.
Als in Paris die Gazette am 17. Juli berichtet, die »Türken und Tartaren« hätten sich von Buda und Pest aus in Marsch gesetzt, und dieselbe Nummer aus »Constantinople, le 27 may 1683« weiß, der Sultan (Mehmed IV.) sei in Belgrad eingetroffen, haben die osmanischen Truppen unter Großwesir Kara Mustafa mit ihrem Belagerungsring Wien schon völlig eingeschlossen.
Es folgen zwei Monate heftigster Kämpfe, Sturmangriffe und Gegenattacken, Kanonendonner und Minenexplosionen, Feuer und Seuchen, Leichenberge und furchtbare sanitäre Zustände, Lebensmittelnot und Wucher. Kleine Abschnitte werden erobert und zurückgewonnen. Auf Terrainverluste antworten Ausfälle der Belagerten, auf Rückschläge der Belagerer ihr erneutes Anrennen gegen die Mauern, die in einigen Bereichen bröckeln. Die osmanischen Sappeure graben sich gegen die Bollwerke vor, die Wiener kontern mit Gegensprengungen. Um das Minieren rechtzeitig zu entdecken, steht in jedem Haus nahe der Wälle ein Posten im Keller, horcht und beobachtet ein gefülltes Schaff: Wenn das Wasser sich kräuselt, ist Bewegung in der Erde.
Das Elend in Wien sei »sehr groß / dann umb der Stadt nichts mehr als alte ruinirte Palläste zu sehen«. Es herrsche Uneinigkeit, die Bürger seien gegen »die Pfaffen«, besonders die Jesuiten, »erbittert«, zeichnet die protestantische Europäische Relation am 20. Juli kein Bild einer geeinten Christenheit.
Anfang August schreibt die Gazette: Der Kaiser ruft die Fürsten auf, das Reich gegen die Ungläubigen zu verteidigen; die Kurfürsten verlangen einen schnellen Frieden mit Ludwig XIV.; der französische Gesandte teilt mit, sein König werde wegen des Türkenkriegs den Kaiser nicht angreifen, wenn jener die Bedingungen akzeptiere. Welche das sind, meldet das Pariser Blatt nicht.
Wien verteidige sich mit aller Kraft, weiß es am 21. August, bei einem Ausfall haben die Belagerten hundert Rinder erbeutet. Die Osmanen müssen sich ein Stück zurückziehen, wegen einer Seuche häufen sich die Leichen in ihrem Lager. Bei den Wühlarbeiten zu den Bollwerken hin sind sie auf die Massengräber der letzten Pest gestoßen, ein scheußlicher Gestank liegt in der Luft. Der Großwesir treibt seine Truppen an, er verspricht ihnen die Plünderung Wiens.
Der dritte Sturm wird »mit Gottes Hülffe glücklich abgeschlagen«, wobei sich »die Studenten und Becker=Knechte sehr tapfer« halten. Wenn sich die Stadt nicht bald ergebe, lässt daraufhin der Großwesir verkünden, werde er auch die Kinder im Mutterleib nicht verschonen (Wochentlicher Ordinari Friedens= und Kriegs=Courrier, Nürnberg, 2. und 16. August).
Die Osmanen bemächtigen sich einer Contrescarpe, einer äußeren Mauer des Hauptgrabens. Dagegen setzen die Wiener zwei Minen ein, sprengen »dergestalten alles in die Lufft«. Beim folgenden Ausfall töten sie viele Janitscharen und durch die Explosion die Paschas von Mesopotamien und Albanien: »es wäre sonderlich lustig zu sehn gewesen / wie diese lose Völgel [sic] mit ihren langen Röcken in der Lufft geschwebet und wieder herunter gefallen« (Nordischer Mercurius, Hamburg, 31. August).
Eilboten schaffen es durch den Belagerungsring, einem Fischer gelingt es schwimmend, ein Soldat kommt in Türkenverkleidung durch die osmanischen Linien. Sie überbringen dem Kaiser und seinen Feldherrn Lagemeldungen und die immer dringlicheren Hilferufe: »es seye aber hohe Zeit den Ensatz [sic] vorzunemmen« (Montägliche Wochenzeitung, Zürich, 6. September). Die Unterstützung der Fürsten, betont die Europäische Relation am 7. September, gelte nicht nur gegen die Türken, sondern auch der »Conservation des Münsterischen […] Friedens«.
Aber das Entsatzheer, das Wien aus dem Würgegriff der Osmanen befreien soll, lässt auf sich warten. Die Fürsten streiten um die Rangordnung.
Die Berichte über die Belagerung beruhen in den Blättern deutscher Sprache auf den Briefen, die wagemutige Kuriere durch die feindlichen Linien bringen. Die Gazette weiß mehr, sie hat auch Korrespondenten in Constantinopel. Am 7. August schreibt sie, Großwesir Kara Mustafa habe Mohammeds Banner aus den Händen des Sultans erhalten – ein Signal, das den Krieg zur Glaubensfrage erklärt –, in allen Moscheen werde für den Sieg gebetet.
Eine Woche später dominiert in der Pariser Zeitung die Trauermeldung über den Tod der französischen Königin (Maria Teresa von Spanien aus dem Hause Österreich), deren Begräbnis in aller Ausführlichkeit beschrieben ist. Aus Wien erfährt die Leserschaft: Der Großwesir hat eine Kampfpause angeboten, um die Toten zu bergen und zu bestatten; Graf Starhemberg, der Kommandant der Verteidiger, lehnte ab, denn die Garnison sei in gutem Zustand; wer in der Stadt von Kapitulation spreche, werde gehängt; Lebensmittel seien rationiert, vor allem Brot und Wein, Starhemberg habe die Schlüssel zu allen Weinkellern konfisziert.
Aus Constantinopel bleiben in der Folge weitere Nachrichten aus, Neuigkeiten aus der Hauptstadt der Osmanen gelangen später über Venedig nach Paris. So steht am 16. Oktober in der Gazette, die Mutter des Sultans sei verstorben, am 27. November, wegen der Niederlage vor Wien sei der Großwesir auf höchsten Befehl erdrosselt worden.
Das Nebeneinander unterschiedlicher Sphären und Gemütslagen ist die damalige Leserschaft gewöhnt, insbesondere jene der Gazette, die Kriegs- und Hofberichterstattung stärker mischt als andere Blätter. Im Anschluss an die Belagerungsszenen, die an Wiens Mauern Minen »spielen lassen«, erfährt das französische Publikum, wann eine heimische Prinzessin zur Kommunion geschritten ist.
Am 2. Oktober schreibt das Pariser Blatt, Starhemberg habe das vereinbarte Signal gegeben, dass die Stadt bald am Ende ihrer Kräfte sei.
Das Entsatzheer unter dem Polenkönig Jan Sobieski rückt heran, am 12. September schlägt es die Osmanen in die Flucht. Der habsburgische Heerführer Karl von Lothringen, weiß die Gazette, habe die Nacht nach dem Sieg im Zelt des Großwesirs verbracht. Der Kaiser kommt ein paar Tage später, Wien singt das Te Deum.
Die Europäische Relation berichtet am 21. September, man habe den Feind nicht zu verfolgen vermocht, »weil alles Land verherret« sei; fürchterlich, »wie die Barbaren gehauset«. Von Wien bis Sankt Pölten sei das Elend kaum zu beschreiben, tote »christliche Körper« liegen in den Feldern.
Am 11. Oktober teilt die Züricher Montags-Zeitung mit, der König von Polen habe an Papst Innozenz XI. geschrieben und »seinen Eifer« für die Beschützung der »gemeinen Christenheit bezeuget / welches der Papst mit Thränen und grosser Freud gelesen hat«. Anbei schickte Jan Sobieski das erbeutete Mohammed-Banner und setzte dazu die abgewandelten Caesar-Worte »venimus, vidimus, Deus vincit« – wir kamen, wir sahen, Gott siegte. Womit erneut das ganze Geschehen religiös fundiert ist.
In den Städten des Reiches hält man Dankgottesdienste ab. Am 20. September meldet der Wochentliche Ordinari Friedens= und Kriegs=Courrier, von allen Kanzeln sei um »weitern Sieg der Kays. Majest. gerechten Waffen wider den Erb=Feind christlichen Namens und dessen Barbarischen Anhang« zu beten.
Die religiöse Betonung in den damaligen Flugschriften und Zeitungen entsprach der Verbindung von Staat und Religion sowie den öffentlichen Ritualen und Signalen. Sie heizte – über eine übliche Gegnerschaft hinaus – die Verteufelung der »Türken« an. Die Feinde im Dreißigjährigen Krieg, die ganze Landstriche verheert hatten, waren nicht mit einer derartig intensiven Dämonisierung, die wiederum Furcht und Schrecken verstärkt, versehen worden.
Predigten, Erzählungen und die Presse rechtfertigten das Bild vom »Erbfeind der Christenheit« auf propagandistische Weise mit der einseitigen Betonung der Gräueltaten, obwohl mitunter gar nicht gesichert war, ob eine Ansiedlung von den Osmanen oder den »Unsrigen« in Schutt und Asche gelegt worden war. Es mussten die Muslime gewesen sein, denn man präsentierte sie ja als Gottesplage. Publikumswirksam sind sie so in allegorischen Darstellungen der Triumphalkunst gezeichnet, mit Halbmond, Krummschwert und Turban zu Füßen der Sieger oder zu Füßen der »Gottesmutter Maria«. In das Volksvermögen ging die Dämonisierung ein, indem die verbreiteten »Türkenlieder« den Feinden alles Schlechte, vor allem Hinterhältigkeit, zuwiesen und sie als Tiere, oft als Hunde oder Geier, bezeichneten.
Auch die Erinnerungen an die Belagerung Wiens erfuhren eine propagandistische Funktion. Architektonisch bleibend der ausführliche Dank an »die seligste Jungfrau Maria«: Vielerorts gemahnen bis heute Mariensäulen an die »Türkengefahr« – und auch an die Pest.
Das Nachspiel stark gefühlsbetonter historischer Ereignisse folgt im Zahlenspiel der Jubiläumsjahre. Es schafft die Gelegenheit, die Gegenwart mit einer mythisierten Vergangenheit aufzuladen und damit eigene Vorstellungen zu stützen.
Das »Türkenjahr« 1783 diente in erster Linie der Verherrlichung des Hauses Habsburg und des nunmehrigen Kaisers Joseph II. – dafür war allerdings die Umdeutung der Flucht von Leopold I. aus seiner Residenzstadt nötig: Der Unmut, die Buhrufe und die Pfiffe der Bevölkerung wurden verschwiegen und von Hinweisen ersetzt, dass der Kaiser höchstselbst Entbehrungen zu erleiden hatte. Im Vordergrund stand wohl die Tapferkeit der Verteidiger, vor allem die militärische Leistung Karls von Lothringen, Leopolds Schwager. Die Wiener Zeitung hob am 3. September 1783 das »vaterländische Interesse« der Erinnerungsfeiern hervor, insbesondere die Verdienste des Monarchen und seiner Truppen. Eine Woche später, mit gehörigem Abstand, lobte das Blatt dann »die tapferen Bürger«. In dieser Hinsicht erschien im Wienerblättchen am 13. September eine bezeichnende Annonce, die die Gegenwart sichtbar mit der Vergangenheit zu verbinden versprach: Zu kaufen sei ein Kupferstich, der aktuelle Wiener Bürger in der Kleidung von 1683 zeige.
Entsprechend dem zunehmenden politischen Einfluss des Bürgertums strich die Presse dann 1883 dessen wichtigen Anteil an der Abwehr der moslemischen Armee hervor. Und nach wie vor trennte sie scharf zwischen Christentum und »Heidentum«, zwischen dem europäischen Westen und dem »barbarischen Osten«. Am 11. September widmete die Neue Freie Presse ihre ganze Titelseite der »200jährigen Gedenkfeier« der Befreiung von der »Türkennoth«. In den Händen der Wiener Bevölkerung, hieß es, sei das Schicksal Europas und der Christenheit gelegen, gegen die Türken, »wilde Asiaten«, die »zum Himmel schreiende Grausamkeiten« verübt hätten. In der Entsatzschlacht sei erkennbar gewesen, »daß hier Welt gegen Welt stand«.
Bei den »Türkenfeiern« 1933 erklärten die beiden autoritären Lager – die zum Austrofaschismus tendierende Dollfuß-Regierung und die Nationalsozialisten – auf je ihre Art die Erinnerung als Aufruf gegen die Gefahr aus dem Osten, gegen Gottlosigkeit und Kommunismus.
Wenig von einer Verklärung hielt die sozialdemokratische Arbeiterzeitung. Sie schilderte, was zuvor in der Presse kaum je zu lesen gewesen war, da der heldenhafte Widerstand hehr zu erscheinen hatte. In seiner Sonntagsausgabe beschrieb das Wiener Blatt am 10. September 1933 ohne Quellenangabe über zwei Seiten in dem Artikel »Die Türken vor Wien« sowohl die fürstlichen Eitelkeiten und Streitigkeiten im Entsatzheer als auch die Versäumnisse Kara Mustafas und die Zustände während der Belagerung:
Senkgruben, verstopfte Kanäle, Misthaufen auf den Straßen. Man hatte anfangs alle Abfälle über die Mauer in den Donaukanal geworfen, aber das Wasser war gefallen und wahre »Mistgstättn« am Fuße der Befestigungen gegenüber der Leopoldstadt entstanden. Man schlachtete auf der Gasse, ließ Blut und Innereien in der Sonne verfaulen. Kranke lagen zu Dutzenden auf den Gassen herum, viele starben auf dem Pflaster, das vom Schmutz der blutigen Stühle weithin besudelt war.
Kein Brunnen führte gutes Wasser, die meisten waren von den Massengräbern verunreinigt. Ein scheußlicher Gestank lastete auf der ganzen Gegend. In der Stadt und im osmanischen Lager, in dem die sanitäre Situation ebenso schlecht war, wütete die Ruhr.
Kurz, fasste die Arbeiterzeitung mit vergleichendem Blick auf die zuletzt erlittene Weltkatastrophe zusammen: »das Leben in Wien während der Türkenbelagerung« sei die gleiche »qualvolle Heldentragödie« gewesen wie »das Schützengrabendasein im Weltkrieg«.
Im Jahr 1683 starb der Barockdichter Daniel Caspar von Lohenstein. Der Tiroler Geigenbauer Jakobus Stainer, der für berühmte italienische Musiker und für das Orchester von Johann Sebastian Bach Instrumente gebaut hatte, kam auch ins Grab. Und in Westafrika einigte – nach europäischer Einschätzung: vermutlich um diese Zeit – Osei Tutu, der Herrscher von Kumasi (heute in Ghana), die Fürstentümer der Aschanti.
Die Zeitungen nahmen damals keine Notiz davon.
Die Propaganda wirkte. Die »Türkenkriege« förderten eine Solidarität, die im Inneren des Reiches zur Stabilisierung beitrug. Zugleich konnte man sich angesichts des Gegenbildes der wilden Feinde nach außen abgrenzen, und die Furcht steigerte das Gemeinschaftsgefühl. Dies geschah umso effektiver, als sich die beiden aufeinandertreffenden Großreiche mittels des Glaubens legitimierten und sich zur Führungsmacht – einerseits der Christenheit, andererseits des Islams – ausriefen. Die passende Rhetorik (bei den Habsburgern der Verweis auf die Kreuzzüge) verdeckte die machtpolitischen Interessen.
Der Ausgang der Schlacht um Wien setzte eine Dynamik in Gang, die den Polen Selbstvertrauen bescherte (jedoch die Teilung des Landes 1772 nicht verhinderte), die Habsburger in ihrer Gegenoffensive immer mehr in Richtung Balkan zog und für das Osmanische Reich den Beginn seines langsamen Niedergangs brachte.
5Krönung des Parlamentarismus: 1688/89
In ihrer Nummer 2444 berichtet die London Gazette über die Krönung Willems von Oranien und seiner Gemahlin zu King William III. und Queen Mary II. von England. Der holländische Prinz ist fünf Monate zuvor mit seiner Flotte übers Meer gekommen, er war buchstäblich zur Invasion eingeladen worden. Nachdem die Declaration of Rights einen starken Parlamentarismus in der Monarchie garantiert hat, segnet nun, am 11. April 1689, die Feierlichkeit den Abschluss einer langen, vielschichtigen Entwicklung. Die Vorgangsweise des Machtwechsels erscheint, insbesondere angesichts des rundum herrschenden Absolutismus, revolutionär. Sie verlief in der letzten Phase immerhin ohne großes Blutvergießen, so dass man die Charakterisierung »glorious« als angebracht erachtet, auch wegen der Glorie einer erstmaligen Doppelkrönung.
Die London Gazette hat Gewicht. Sie findet weite Verbreitung, auch die ersten Newspapers in der Überseekolonie New England waren ab 1685 Reprints der Gazette. Sie ist die amtliche Zeitung, unter ihrem Titel steht groß »Published by Authority«. Entsprechend nüchtern klingen ihre Schilderungen. Nach den Trommeln und Trompeten beim Einzug in die Westminster Abbey listet das Blatt die bedeutendsten Persönlichkeiten auf, zugegen sind die hohe Geistlichkeit und die adeligen Würdenträger. Und diesmal, wie es bei einer Krönung noch nie geschah, die Mitglieder des Unterhauses: Sie befinden sich auf oberen Plätzen, als würden sie das Geschehen beaufsichtigen. Man habe die ganze Feierlichkeit mit großer Pracht und Herrlichkeit abgehalten, lautet der Bescheid der Gazette.
Genaueres erfährt die Leserschaft anderswo, recht detailliert in einem fünfzehnseitigen Hamburger Sonderdruck. In protestantischen Gefilden Deutschlands ist offenbar das Interesse an dieser Zeremonie groß. Ein Übergewicht des Katholizismus in Westeuropa zu verhindern war ja ein Beweggrund für den brieflichen Hilferuf von sieben einflussreichen Parlamentariern an Willem und für dessen Aufbruch über den Ärmelkanal,
Auch die Extraausgabe Ausführliche Relation der königl. Kröhnung in Engeland vom 22. April schildert die Feierlichkeiten eingehend: Morgens um sieben wurden die Majestäten in einer geschmückten Barke vom Whitehall-Palast bis an die Treppe des Parlaments gerudert; im Oberhaus kleidete man sie mit den karmesinroten, hermelingefütterten Gewändern; um zehn Uhr erfolgte die Prozession zur Westminister Abbey, den Himmel über den zu krönenden Häuptern trugen sechzehn Barone und fünf Grafen. Der Erzbischof von Canterbury habe die sakralen Rituale vorgenommen, erzählt der deutsche Sonderdruck. Tatsächlich war es der Bischof von London, der William und Mary zu rechtmäßig erwählten Monarchen, King und Queen, ausrief. Sie legten vor dem Altar den Eid ab, wurden gesalbt und mit den Insignien der Macht versehen. Bemerkenswerter ist, was sie schworen. Das Parlament hatte ihnen den Wortlaut anempfohlen: »to govern the people of this kingdom of England […] according to the statutes in parliament agreed on, and the laws and customs of the same«. Das Hamburger Extrablatt zitiert: »nach denen von dem Parlament gemachten Statuten und Gesetzen«.
Die katholische Pariser Gazette weiß in ihrer Nummer vom 23. April Hintergründe zu berichten: Der Erzbischof von Canterbury habe dem Präsidenten des Oberhauses mitgeteilt, er könne keinen Eid eines anderen Königs abnehmen und auch nicht bei der Krönung zugegen sein, da er doch den verjagten James II. inthronisiert habe und ihm folglich nach wie vor verpflichtet sei. Daraufhin hätten einige Lords gedrängt, den Erzbischof in den Tower zu sperren, die Mehrheit habe dies jedoch verhindert.
Zur gleichen Zeit geschieht anderswo ein Ereignis, das die Leserschaft an den Dreißigjährigen Krieg erinnert. Vom selben 23. April meldet die Nummer 82 der Ordinari Mittwochliche Reichs-Post-Zeitungen aus Rom die Begräbniszeremonie für die abgedankte schwedische Königin Christina, die 1648 den Prager Kunstschatz als Beute nach Stockholm bringen ließ. Gedruckt ist das Blatt in – Prag.
In diesen Tagen feiert London das neue Königspaar. Der Parlamentarismus hat über den Absolutismus gesiegt, ein langer Kampf, in dem es auch um die konfessionelle Autorität ging. Religion ist seit dem Beginn gesellschaftlicher Organisation ein wesentliches Mittel der Machtstrategie, im Europa der Kirchenspaltungen und des Westfälischen Friedens umso mehr.
Gegen die Herrschaft der anglikanischen Kirche, deren »Supreme Governor« der König ist, gab es mehrmals katholische Vorstöße wie den Gunpowder Plot von 1605. Der Konflikt zwischen Monarch, Armee und Parlament führte 1642 zum Bürgerkrieg, 1649 zur Hinrichtung von Charles I. und zur Republik unter Oliver Cromwell bis 1658, dann zur Restauration des Königtums. 1685 kam James II. aus dem Hause Stuart auf den Thron, er war im französischen Exil zum Katholizismus konvertiert. Seine Auseinandersetzung mit dem Parlament entzündete sich am Gottesgnadentum: Der Souverän sah sich über dem Gesetz, da er aus göttlichem Recht herrsche. Demgegenüber ist es von entscheidender Bedeutung, dass William und Mary am 11. April 1689 als »rechtmäßig Erwählte« inthronisiert werden, die Souveränität also nicht nur auf gekrönte Häupter, sondern auch auf das Parlament übergeht.
Mary ist die Tochter von James II., der Prinz von Oranien sein Schwiegersohn und Neffe. Beide stehen fest auf protestantischer Seite, Willem als Statthalter der Niederlande und Mary als englische Thronfolgerin. Die Zeitungen aber berichten nicht, dass die Parlamentarier eine Reihe von Männern aus der königlichen Nachfolgereihe gestrichen haben, da sie katholisch waren, bevor sie die protestantische Mary an die erste Stelle rücken konnten.
Nachdem der eng mit James verbundene französische König Ludwig XIV. 1685 das Toleranzedikt von Nantes widerrufen und damit den Protestantismus verboten hatte, steigerte sich in Englands Öffentlichkeit die Abneigung gegen den Katholizismus.
Das auslösende Moment für die Eskalation war dann eine Geburt: Die als unfruchtbar geltende Gemahlin von James brachte einen Sohn zur Welt, der Mary in der Thronfolge verdrängte. Allerdings war bei der Entbindung kein Abgeordneter zugegen, so dass das Gerücht lief, es sei ein – aus dynastischem, katholischem Interesse – untergeschobenes Kind. Nun sei eine langfristige Herrschaft der feindlichen Konfession zu befürchten, verständigten sich die beiden Gruppierungen des Parlaments, die liberalen Whigs und die konservativen Tories. Daraufhin sandten sieben Abgeordnete die Bitte einzugreifen an Willem – praktisch eine Einladung zur Invasion –, und die niederländischen Generalstände genehmigten ihm Finanzen sowie Truppen.
Von diesen Hintergründen erfährt die zeitgenössische Leserschaft bestenfalls Einzelheiten. Die damalige Presse vermag keinen kontinuierlichen Fluss von Nachrichten zu liefern. Die Zeitungen sind auf ihre Korrespondenten angewiesen und jene wiederum auf Briefe, Augenzeugen und Gerüchte, jedenfalls auf die mitunter ungewissen Postwege. Die Vorgänge in England und das Vorgehen der holländischen Streitmacht erscheinen in den Blättern als Episoden, nicht selten in chronologischem Durcheinander.
Der in Nürnberg publizierte Wochentliche Ordinari Friedens- und KriegsCourrier meldet am 15. November 1688 aus Amsterdam ein Malheur beim Auslaufen der Flotte. Ein Sturm habe die kleineren Schiffe in den Hafen zurückgezwungen. Da die Luken geschlossen bleiben mussten, seien Pferde im Rumpf der Boote erstickt. Die Nachrichten von der Insel hingegen sind günstig. Aus Schottland sollen zwanzigtausend Mann herbeimarschieren, für James wollen sie nicht in die Schlacht ziehen, heißt es. Vier Tage später steht im Hamburger Relations-Courier, in Amsterdam würden »sehr viel ungewisse Zeitungen divulgiret / daß das Volck auff der Englischen Flotte nicht fechten will«.
Am 23. November weiß das Blatt aus London von Vorbereitungen zur Verteidigung, aber auch von »stetem Streit« zwischen englischen und irischen Soldaten. Es zitiert in ganzer Länge die Rede, die James II. vor dem Rat hielt, um gegen die »bösartigen Gerüchte« anzugehen, dass »der Sohn, von welchem Gott mich gesegnet«, ein »supponirtes Kind« sei.
Inzwischen ist Willem von Oranien am 5. November mit seinen Truppen gelandet. An diesem Tag bringt die London Gazette eine Proklamation des Königs, es werde niemand seiner Strafe entkommen, der den »Prince of Orange and his Adherents« unterstütze. Drei Tage darauf klingt die in der Zeitung veröffentlichte »Declaration« von James dringender und leicht verzweifelt:
As We cannot consider the Invasion of Our Kingdoms by the Prince of Orange without Horror, for so Unchristian and Unnatural an Undertaking in a Person so nearly Related to Us; So it is a Matter of the greatest Trouble and Concern to Us to reflect upon the many Mischiefs and Calamities which an Army of Foreigners and Rebels must unavoidably bring upon Our People.
Eindrücke vom Vormarsch der holländischen Armee kann die deutsche, vor allem die protestantische Leserschaft in ihren Zeitungen verfolgen. Der Hamburger Relations-Courier schildert sie am 17. Dezember in einem langen Beitrag. Frauen standen bis zu den Knien im Meerwasser, um die Oranier willkommen zu heißen. Dragoner und Fußvolk stiegen unter Trommeln und Trompeten von der Küste hinauf, obwohl die Klippen »erschrecklich hoch« sind. Das nächstgelegene Dorf verfügte über so schlechte Unterkünfte, dass der Prinz in einem »elenden Fischer-Häußlein« übernachten musste; erst im Bischofssitz von Exeter hatte er es bequem.
Bereits »37 Pairs und 60 Ritter/Baronen u.d.gl. nebenst den Lords von anderen Provintzien« stellten sich unter seinen Befehl, sieben Schiffe der englischen Flotte sind zu ihm »übergegangen«, auch einige befestigte Städte. Der größte Teil Nordenglands erklärt sich für den Oranier, während sich der König weigert, das Parlament einzuberufen. Das meldet der Relations-Courier