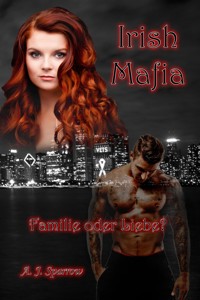4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine unter einer Million zu sein, ist nicht so schön, wie man vielleicht denkt. Liara ist so jemand. Sie hat Fähigkeiten, die die Menschen fürchten. Ihresgleichen wird gejagt und getötet, ganz egal ob sie böse sind oder nicht. Das Einzige, was sie will, ist, in Frieden zu leben, was ihr leider nicht vergönnt ist, stattdessen führ sie ein Leben auf der Flucht und im Schatten. Damit sie nicht gefunden wird. Alec ist in einer Spezialeinheit und hat den Auftrag, diejenigen mit besonderen Fähigkeiten zu jagen und zu töten. Für ihn ist es eine Notwendigkeit, weil für ihn diese Freaks nicht leben sollten. Von ihnen geht nichts Gutes aus, weil sie alle nur ihre Gaben einsetzen, um den normalen Menschen Schaden zuzufügen. Dann lautet sein Auftrag, Liara lebend zu fangen, und plötzlich gerät seine Meinung ins Wanken. Werden Liara und Alec einen Weg finden, um die jeweiligen Vorurteile aus dem Weg zu räumen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
A. J. Sparrow
One in a
Million
Impressum
Copyright © 2021
A. J. Sparrow
Covergestaltung: Copyright © 2021
Seleni Black
Coverbilder: Pixabay
Korrektur:
Textwerkstatt 2021
Stand: November 2021
Deutsche Erstauflage
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne Zustimmung der Autorin nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden.
Die Ereignisse in diesem Buch sind frei erfunden. Die Namen, Charaktere, Orte und Ereignisse entsprechend der Fantasie der Autorin, oder wurden in einem fiktiven Kontext gesetzt und bilden nicht die Wirklichkeit ab. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen, tatsächliche Ereignisse, Orte oder Organisationen sind rein zufällig.
1
Liara
Man hatte viele Namen für mich. Freak, Missgeburt, Begabte … Ich konnte die Liste noch weiter führen, aber das waren die gängigsten. Ganz selten wurde ich auch als etwas Besonderes betitelt. Ja, klar, so besonders, dass man mich am liebsten als Laborratte in einen Käfig sperren wollte.
Ich hatte einen sehr seltenen Gendefekt, der mich von normalen Menschen unterschied. Rein Äußerlich sah man fast keinen Unterschied, bis auf meine auffällige Augenfarbe. Sie waren violett. Zum Glück hielten es alle immer für Kontaktlinsen, wenn mal jemand meine Augen sah. Na ja, fast alle, denn es gab auch Menschen, die von meiner Existenz wussten und mich deshalb jagten.
Ich war schneller, stärker und meine Verletzungen heilten in kürzester Zeit. Das war bei jedem mit diesem Defekt so. Dazu kam dann noch das eine oder andere Feature, das bei jedem anders war.
Das Ganze war so selten, dass es von einer Million Menschen, nur einen mit diesem Defekt gab. Womit ich vermutlich den Jackpot erwischt hatte. Wenn ich könnte, würde ich es gern an den Absender zurückgeben. Ging nur leider nicht!
Meine Eltern hatten mich im Alter von zehn Jahren alleine gelassen. Das war der Zeitpunkt, zu dem sich meine Kräfte zeigten. Ich nahm ihnen das nicht übel, sie hatten einfach nur Angst vor mir. Und das konnte Menschen dazu bringen, falsche Entscheidungen zu treffen.
Nur meinen Fähigkeiten war es zu verdanken, dass ich noch am Leben war und dass mich niemand in ein Heim gesteckt hatte. Als ich noch klein war, hatte ich mir Essen, Klamotten und alles, was ich sonst noch brauchte, gestohlen. Jetzt, da ich alt genug war, arbeitete ich, um das bezahlen zu können, was ich wollte.
Ich hatte das Glück, dass ich mich unsichtbar machen und auch Dinge mit meinen Gedanken bewegen konnte. So überlebte ich all die Jahre. Ob meine Eltern noch lebten, wusste ich nicht, aber falls sie es taten, hoffte ich, dass sie glücklich waren. Das einzige Andenken, das ich an sie hatte, war ein Rosenkranz aus schwarzen Perlen. Er hatte meiner Mutter gehört und bevor sie mich verlassen hatte, legte sie ihn mir um den Hals. Er war das Wertvollste was ich besaß.
Im Moment befand ich mich in San Francisco. Ich fand die Stadt einfach toll. In einem Restaurant arbeitete ich als Spülhilfe. Der Chef stellte keine Fragen, worüber ich sehr dankbar war. Ich verdiente nicht viel, aber für mich reichte es. Er hatte mir sogar einen Schlafplatz besorgt, bei einer netten alten Dame, die ebenfalls keine Fragen stellte.
Beide hatten anscheinend ein Herz für Streuner und hatten schon öfters Fremden ihre Hilfe angeboten. Das war leider sehr selten, daher genoss ich es in vollen Zügen. Dennoch würde ich nicht allzu lange bei ihnen bleiben, denn ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Es gab einige, die so waren wie ich, die ihre Fähigkeiten für Grausamkeiten verwendeten. Dass man sie jagte, verstand ich, da sie Menschen verletzten oder gar töteten. Warum man jedoch auf einmal hinter mir her war, wusste ich nicht, immerhin hatte ich noch nie ein anderes Lebewesen verletzt.
Ich war erst einige Tage in der Stadt und in der letzten hatten sie mich spätestens nach einer Woche aufgespürt, daher würde ich wahrscheinlich in ein paar Tagen einfach verschwinden. Und wie immer würde ich keine Spuren hinterlassen. Sie würden mich niemals in ihre Finger bekommen. Sollten die sich doch eine andere Laborratte suchen.
An diesem Abend arbeitete ich länger. Da viel los war, hatte ich es angeboten. Weil mein Chef so nett zu mir war, machte ich das gern. Als ich endlich um halb eins die Küche durch den Hinterausgang verließ, hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden.
Ich schaute nach rechts und links die kleine Gasse entlang, konnte aber niemanden erkennen. Wie immer trug ich meinen Mantel mit der weiten Kapuze, die ich mir über den Kopf zog. Sie war so weit, dass sie mein Gesicht verdeckte und ich unscheinbar wirkte. Zudem trug ich auch noch farbige Kontaktlinsen, wodurch meine Augen dunkelbraun waren. Ich hasste diese Dinger zwar, aber es war besser als gefragt zu werden, warum ich lilafarbene trug.
Ich machte mich auf den Weg zu meiner momentanen Bleibe. Sie war nur ein paar Straßen vom Restaurant entfernt. Immer wieder drehte ich mich um, konnte aber immer noch niemanden entdecken. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Ich bog in eine weitere kleine Gasse ein und verschmolz mit dem Schatten. Erst als ich mir sicher sein konnte, dass mich niemand sah, machte ich mich unsichtbar, blieb dennoch im Schatten stehen.
Es dauerte auch nicht lange bis zwei Kerle in dunklen Anzügen auftauchten und sich suchend umsahen. „Sie kann doch nicht einfach verschwunden sein?“, fragte der eine und schaute sich suchend um, wobei er sich immer wieder um die eigene Achse drehte.
„Wer weiß, was diese Missgeburt alles kann. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir sie nicht umlegen dürfen wie die anderen“, knurrte der andere. Auch er schaute sich suchend um. Als er kurz in meine Richtung sah, hielt ich den Atem an, obwohl ich wusste, dass er mich nicht sehen konnte.
Der andere drückte sich einen Finger aufs Ohr, wahrscheinlich hatte er so einen Knopf darin, mit dem er seine Befehle erteilt bekam. Beide tauschten einen kurzen Blick miteinander und liefen dann in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Erst als ich ihre Schritte nicht mehr hören konnte, atmete ich aus. Ich blieb noch einen Moment, wo ich war und machte mich dann auf den Heimweg. Sichtbar machte ich mich nicht mehr, denn ich hatte keine Lust, diesen Kerlen doch noch in die Arme zu laufen.
Ich würde meinen Kram zusammenpacken und so schnell es ging von hier verschwinden. Schade, eigentlich hatte ich gehofft, hier mal etwas länger bleiben zu können.
Zehn Minuten später betrat ich das kleine Haus, das die letzten Tage mein Zuhause war. Die alte Dame schlief wie immer in ihrem Sessel vor dem Fernseher. Ich wollte sie nicht wecken, daher war ich so leise ich konnte. In meinem Zimmer holte ich meinen großen Seesack aus dem Schrank und stopfte meine Sachen einfach hinein. Jetzt kam es mir zugute, dass ich nicht so viel Zeug besaß.
Zum Schluss schrieb ich noch eine kurze Nachricht für sie, bedankte mich für alles und verließ die Wohnung. Draußen schaute ich noch einmal wehmütig zum Haus, bevor ich in die Dunkelheit der Nacht verschwand.
2
Alec
Diese verfluchten Freaks! Ich hasste es, ihnen hinterherjagen zu müssen. Leider war genau das mein Job. Ich gehörte zu einer Spezialeinheit der NSA, die sich um diese „Besonderen Menschen“ kümmerte. Ihre Existenz war geheim und nur eine Handvoll Menschen wusste von ihnen.
Man erkannte sie immer an ihrer ungewöhnlichen Augenfarbe. Ansonsten unterschieden sie sich rein äußerlich nicht von allen anderen. Jeder von ihnen verfügte über Fähigkeiten, die sie gefährlich machten.
Vor zwei Wochen waren mein Team und ich erst in Rom, um einen von ihnen zur Strecke zu bringen. Dabei hatte ich zwei meiner Männer verloren. Jetzt waren wir in San Francisco und verfolgten die Spur einer jungen Frau. Ich hatte ein Foto von ihr, das allerdings schon ein paar Jahre alt war. Am auffälligsten waren ihre Augen. Sie waren violett, was ich auch bei keinem anderen dieser Freaks je gesehen hatte.
Bis jetzt war sie noch nie negativ aufgefallen oder es wurde nur nicht registriert. Mein Auftrag lautete, sie gefangen zu nehmen. Normalerweise eliminierten wir diese Mistgeburten einfach. Aber aus irgendeinem Grund sollte sie erst einmal am Leben bleiben. Warum das so war, interessierte mich nicht. Diese Monster waren mir scheißegal. Wenn es nach mir ginge, könnte man ihnen allen eine Kugel in den Kopf jagen.
Wir hatten einen Tipp erhalten, dass sich unsere Zielperson in einem kleinen Restaurant aufhalten würde. Anscheinend arbeitete sie dort, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte. Diese Leute nahmen sich für gewöhnlich einfach, was sie wollten, sie dachten noch nicht einmal daran, sich anzupassen und für das, was sie brauchten, arbeiten zu gehen. Daher konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie anders war.
Ich hatte mich an die Bar gesetzt, wartete und behielt die Umgebung im Auge. „Was hältst du von der neuen Spülhilfe?“, fragte die Kellnerin die Bardame.
„Ich finde sie eigenartig. Sie redet nie mit jemanden, kommt und geht, ohne ein Geräusch zu machen und vor zwei Tagen habe ich sie mit lila Kontaktlinsen gesehen. Sie wusste, glaube ich nicht, dass ich sie dabei gesehen hatte, wie sie die Dinger rausgenommen hat“, erwiderte darauf die Angesprochene.
Das reichte mir. Ich warf zehn Dollar für mein Wasser auf die Theke und verließ das Restaurant. Draußen warteten meine Männer auf Anweisungen. „Sie ist hier und arbeitet als Spülhilfe. Vermutlich wird sie daher den Hinterausgang benutzen. Wir bringen uns in Stellung und warten darauf, dass wir zugreifen können“, wies ich sie an und ging auf die Ecke zu.
Hier führte eine kleine Gasse hinter das Restaurant.
Es reichte, dass ich meinen Männern Zeichen gab. Sie wussten genau, was ich von ihnen wollte. Die Kleine würde uns sicher nicht durch die Lappen gehen. Neben mir führte eine Feuertreppe nach oben. Ich würde mich auf dem Dach positionieren, während meine Männer sich am Eingang bereithielten. Jetzt hieß es warten und ich hasste warten!
Gegen halb eins tat sich endlich etwas. Die Hintertür zu dem kleinen Restaurant wurde geöffnet und eine kleine Gestalt trat heraus. Sie hatte lange dunkle Haare, ob sie schwarz oder braun waren konnte ich nicht sagen. Sie schien angespannt zu sein, denn sie sah sich zu beiden Seiten der kleinen Gasse um. Natürlich konnte sie meine Männer nicht sehen, denn sie hielten sich noch verborgen. Genauso wie ich es ihnen aufgetragen hatte.
Die Kleine zog sich die Kapuze ihres Umhanges über den Kopf und setzte sich in Bewegung. „Los!“, gab ich den Befehl und meine Männer setzten sich ebenfalls in Bewegung.
Durch unsere kleinen Stöpsel im Ohr, konnten wir uns ohne Probleme verständigen. Es war immer wieder faszinierend, mit welchen Spielzeugen unsere Nerds in den Laboren ankamen. Aber auf der anderen Seite konnte wir das auch alles gebrauchen, denn im Gegensatz zu diesen Freaks, hatten wir keine ungewöhnlichen Fähigkeiten.
Sie schien zu merken, dass wir ihr auf den Fersen waren. Das verriet ihre ganze Körperhaltung. Sie bog in eine andere Gasse ein, in der ich sie aus dem Blick verlor. Aber zwei meiner Männer hatten es ebenfalls gesehen und bogen in dieselbe Gasse ein.
Ich lief auf dem Dach, soweit ich konnte und hatte meine Männer wieder im Blick. Sie standen am Anfang und schauten sich suchend um. Anscheinend war es ihr gelungen, den beiden zu entkommen. Ich fragte mich, wie sie das geschafft hatte. Auf jeden Fall hatten wir sie verloren und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie jetzt noch einmal hier auftauchen würde. Ich an ihrer Stelle würde es nicht tun. „Okay, zieht euch zurück. Wir haben sie verloren“, gab ich den Befehl und machte mich zurück auf den Weg zur Feuerleiter.
Ich stieg hinab und unten warteten auch schon meine Männer auf mich. Verdammte Scheiße und ich hatte gehofft, dass dies eine einfache Jagd wird!
„Wir fahren zurück ins Büro und besprechen die Lage. Da sie jetzt weiß, dass wir ihr auf den Fersen sind, versucht sie wahrscheinlich so schnell wie möglich aus der Stadt zu verschwinden“, knurrte ich.
Die anderen stimmten mir zu und stiegen in die Autos. Gerade als ich mich ebenfalls hineinsetzten wollte, brachte mich irgendetwas dazu, noch einmal in die Gasse zu schauen.
Es war niemand zu sehen und doch hatte ich das Gefühl, dass dort jemand war. „Fahrt vor, ich komme nach.“
Nach kurzem Zögern ließen sie die Motoren der beiden Wagen an und fuhren los.
Mir fiel die Brille wieder ein, die mir Kaleb heute Morgen gegeben hatte. Er war ein Erfinder. Er gab sie mir zum Testen, denn sie war sein Prototyp. Für mich sah sie aus wie eine ganz gewöhnliche Sonnenbrille, aber was solls, es konnte ja nicht schaden, sie einmal aufzusetzen.
Erst geschah überhaupt nichts und ich wollte sie schon wieder absetzten, denn im Dunkeln mit einer Sonnenbrille herumzulaufen, erregte zu viel Aufsehen. Doch auf einmal veränderte sich meine Sicht. Ein heller, leicht violetter Umriss tauchte am Ende der Gasse auf. Sie lief schnellen Schrittes und schaute sich immer wieder um. Da war sie also wieder und so wie es aussah, konnte dieses Biest sich unsichtbar machen. Mann, diese Brille war genial.
Ich folgte ihr mit etwas Abstand, da ich nicht wollte, dass sie schon wieder verschwand, obwohl sie sich jetzt vor mir nicht mehr verstecken konnte.
Die Kleine steuerte ein Haus an, verschwand darin und kurz darauf ging in einem der oberen Zimmer das Licht an. Ich vermutete, dass sie ihre Sachen zusammenpackte, um von hier zu verschwinden. Zehn Minuten später kam die Kleine wieder heraus und hatte einen Seesack über der Schulter. Ich würde ihr so lange folgen, bis es ungefährlich war, sie zu ergreifen. Die Gegend hier war dafür einfach zu bewohnt, da ich nicht wusste, was dieser Freak sonst noch alles konnte.
Am Rande der Stadt steuerte sie eine verlassene Lagerhalle an, wahrscheinlich wollte sie sich hier etwas ausruhen. Der Ort war perfekt, um sie zu schnappen. Hier würde keinem Zivilisten etwas passieren, falls sie ausrasten sollte. Wovon ich ausging, denn bis jetzt gab keiner von diesen Missgeburten kampflos auf. Wenn sie in die Enge getrieben wurden, setzten sie ihre Kräfte frei, ohne Rücksicht auf Verluste.
Ich drückte auf den kleinen Knopf von meinem Stöpsel im Ohr, damit ich mich mit den anderen in Verbindung setzten konnte. „Ich hab unsere Zielperson gefunden. Sie ist in einer verlassenen Lagerhalle. Ich werde euch die Adresse schicken und warte hier auf euch. Macht aber keinen Krach, wenn ihr kommt.“
Ich erwartete keine Antwort, sondern nur, dass sie so schnell wie möglich hier auftauchten. Ich zog mein Handy heraus und schrieb Cooper eine Nachricht mit der genauen Adresse.
Zehn Minuten später hielten zwei schwarze SUVs neben mir. Gut, dann konnten wir uns die Kleine jetzt schnappen und ich hatte dann hoffentlich mal ein paar Tage frei. Diesen Freaks hinterherzujagen war anstrengend, vor allem weil man ja nie wusste, was einen erwartete.
„Die Kleine kann sich unsichtbar machen. Mit dieser Brille kann ich sie jedoch sehen“, sagte ich und hob die Brille hoch. „Jedoch haben wir davon erst einmal nur die eine. Ich gehe davon aus, dass sie sich da drin in irgendeiner Ecke zum Schlafen hingelegt hat“, fügte ich noch hinzu und deutete auf die Halle.
„Ich geh vor und ihr folgt mir. Ab jetzt sagt keiner mehr ein Ton und passt auf, wo ihr hintretet.“
Mit diesen Worten setzte ich mich dicht gefolgt von den anderen in Bewegung.
Auf mein Zeichen hin verteilten sich meine Männer und schauten nach anderen Eingängen, über die sie in die Halle gelangen konnten. So hatten wir die Halle zwar umstellt, aber falls die Kleine abhauen würde, hätten meine Leute keine Chance sie zu sehen. Daher hoffte ich, dass sie tief und fest schlief.
Während ich durch den Vordereingang ging, machten sich meine Männer daran, durch die Seiteneingängen zu gehen. Drinnen setzte ich wieder die Brille auf. Zum Glück gab es hier nur ein Stockwerk und am Ende der Halle schienen Büroräume zu sein. Auch wenn meine Leute sie nicht sehen konnten, so positionierten sie sich dennoch vor den Ausgängen. Die Kleine würde auf jeden Fall nicht unbemerkt von ihnen verschwinden können.
Langsam ging ich vorwärts und schaute dabei immer wieder in jede Richtung. Ich vermutete, dass sie sich in einem der Büros versteckt hielt. So würde ich es jedenfalls machen. Schritt für Schritt ging ich weiter auf das mittlere Büro zu, mein Gefühl sagte mir, dass ich sie dort finden würden.
Kurz bevor ich in das Büro trat, gab ich meinen Männern ein Zeichen, schrieb ich Coop eine Nachricht, dass ich sie wahrscheinlich gefunden hatte. Er würde es an die anderen weiter geben. Die anderen konnten die Kleine nicht sehen und so mussten sie nicht mehr so vor den Ausgängen stehen, dass die Kleine in sie hineinlaufen würde, wenn sie fliehen wollte. Auch wollte ich nicht noch mal einen von ihnen wegen so einem Freak verlieren.
Leise ging ich in den Raum hinein, schaute mich um und entdeckte sie in der hintersten Ecke. Ich hatte mich also nicht geirrt. Ich zog meine Waffe aus dem Schulterholster, entsicherte sie und schlich leise auf das schlafende Bündel zu. Sie hatte ihren Umhang eng um sich gezogen, die Kapuze verdeckte noch immer ihr Gesicht und ihr Seesack diente als Kopfkissen.
Ich kniete mich neben sie und hielt ihr meine Waffe an die Schläfe, zumindest vermutete ich sie dort. Durch das ungewohnte Gefühl schreckte sich hoch, sodass ich meinen anderen Arm um ihre Mitte schlingen konnte. „Wir werden jetzt zusammen aufstehen, du wirst dich sichtbar machen und nichts Dummes versuchen. Ich will dir nicht unbedingt eine Kugel in den Kopf jagen, aber wenn du versuchst, mich oder einen meiner Männer zu verletzten, werde ich es tun“, flüsterte ich ihr zu.
Sofort fing sie an zu zittern und wurde sichtbar. Ich stand mit ihr gemeinsam auf, wobei ich meinen Griff um sie festigte, drehte mich zur Tür, wo Cooper stand, der Mal wieder nicht auf meine Befehl gehört hatte und vermutlich als Rückendeckung zu mir kam. Ich deutete mit meinem Kinn auf ihren Seesack. Cooper verstand, was ich damit sagen wollte und schnappte sich ihre Sachen.
Als ich mit ihr das Büro verließ, hatten meine Leute ebenfalls ihre Waffen gezogen und richteten sie auf die Kleine. Alle waren angespannt, was ich nach unserer letzten Begegnung mit einem von ihnen sehr gut verstehen konnte. Aber so wie es aussah, hatte die Kleine viel zu viel Angst, als dass sie irgendetwas tun könnte. „Wollen wir doch mal sehen, was sich unter dieser Kapuze verbirgt“, sagte ich und Cooper zog sie ihr vom Kopf, damit ich sie nicht loslassen musste.
Das Einzige, was ich von ihr sah, waren eine Masse an dunklen, langen Haaren. Aber an den Gesichtern meiner Männer konnte ich erkennen, dass sie erstaunt waren. „Legt ihr Handschellen an“, befahl ich.
Kyle kam meinem Befehl sofort nach und legte ihr auf dem Rücken Handschellen an. Jetzt ließ ich ihre Mitte los und packte sie am Oberarm. Ohne sie weiter zu beachten, führte ich sie nach draußen. Meine Waffe hatte ich wieder weggesteckt, immerhin waren noch genug andere auf sie gerichtet.
An den Autos angekommen öffnete Cooper die Tür und ich setzte sie hinein. Erst jetzt schaute ich mir ihr Gesicht an und ich musste sagen, dass sie wunderschön war. Als ich ihr in ihre violetten Augen schaute, erkannte ich darin nichts Böses, sondern nur Angst und Verzweiflung. Es war anders als bei den anderen Freaks, die wir bis jetzt erwischt hatten, auch wenn ich es nicht benennen konnte, was es war. Nach einigen Sekunden löste ich meinen Blick von ihr und schlug die Wagentür zu. Wir stiegen ein und fuhren los.
3
Liara
So ein verdammter Mist! Ich war unvorsichtig und nun saß ich in diesem scheiß Wagen und wusste nicht, wohin diese Kerle mich brachten. Wobei ich es mir schon denken konnte. Wahrscheinlich in irgendein Labor, in dem sie mich wie eine Ratte in einen Käfig sperren und Versuche mit mir machen würden.
Dieser Kerl, der mir seine Waffe an den Kopf gehalten hatte, saß jetzt neben mir auf der Rückbank. Ich hatte meinen Kopf gegen die Scheibe gelehnt und ergab mich einfach meinem Schicksal. Was hätte ich auch sonst machen sollen? Die gesamte Fahrt über konnte ich seine Blicke auf mir spüren und ich wusste, dass er seine Waffe auch immer noch schussbereit in der Hand hielt.
Wo wir hinfuhren bekam ich nicht mit. Ich schloss meine Augen und versuchte meine Gedanken zu sortieren. Leider konnte ich mich nicht richtig konzentrieren, denn aus einem Grund, den ich nicht wusste, machte mich dieser Kerl neben mir nervös. Und das hatte rein gar nichts mit der Waffe zu tun, die er auf mich richtete.
Erst als der Wagen stand, öffnete ich meine Augen. Wir hielten vor einem Hochhaus, das sehr modern aussah. Es fiel zwischen all den anderen nicht wirklich auf. Es war auch kein Firmenschild an der Fassade, woran man erkennen konnte, was für ein Unternehmen hier war Wahrscheinlich würde es sich nicht sonderlich gut machen, den Namen eines Versuchslabors groß an eine Hausfassade zu befestigen.
Der Kerl und auch die anderen beiden stiegen aus dem Wagen, kurz darauf wurde meine Tür aufgemacht und er half mir beim Aussteigen. Einer seiner Männer trug wie vorhin meinen Seesack über der Schulter. Wieder wurde ich am Arm gepackt und die Stufen zum Eingang hochgeführt. Durch eine Drehtür betraten wir den riesigen Eingangsbereich.
Vor dem Empfangstresen stand ein Mann mit Anzug, zusammen mit bewaffneten Wachmännern. Was dachten die eigentlich, wen sie hier gefangen hatten? Einen Massenmörder? Je näher wir meinem Empfangskomitee kamen, desto bekannter kam mir der Mann im Anzug vor. Ich wusste nur nicht genau, wie ich ihn einordnen sollte.
„Hallo Liara, wir haben uns lange nicht mehr gesehen“, sagte der Mann, als wir vor ihm zum Stehen kamen.
Es traf mich, als hätte man mir eine Ohrfeige gegeben. Jetzt wusste ich auch wieder, wer er war. Mein Onkel Damon, der Bruder meiner Mutter. Automatisch wich ich einige Schritte vor ihm zurück. Da der Kerl mich nicht mehr festhielt, war es kein Problem dies zu tun. „Ich sehe, du weißt, wer ich bin“, stellte er anhand meiner Reaktion fest.
„Onkel Damon!“, flüsterte ich und konnte es immer noch nicht glauben, dass ein Teil meiner Vergangenheit vor mir stand.
„Ich bin schon sehr lange auf der Suche nach dir und dann tauchst du einfach so in meiner Stadt auf. Deine Eltern wussten genau, was ich mit dir machen würde, wenn ich dich in meine Finger bekommen würde. Daher haben sie dich sofort, nachdem sie gemerkt hatten, was für ein Monster du bist weggeschafft. Egal wie oft ich sie gefragt habe, sie haben mir nie verraten, wo sie dich hingebracht hatten. Aus Liebe zu ihrem Kind, das nichts anderes als eine Laune der Natur ist“, klärte er mich auf.
Seine Worte brachten mich dazu, dass ich anfing zu zittern und noch etwas wurde mir in diesem Moment schlagartig klar. Meine Eltern haben mich nicht allein gelassen, weil sie Angst vor mir hatten, sondern weil sie mich vor meinem Onkel beschützen wollten.
„Onkel Damon? Sie ist Ihre Nichte?“, meldete sich jetzt der Kerl neben mir zu Wort.
„Das geht Sie nichts an Agent Ryan!“, fuhr mein Onkel den Kerl an. „Sie können jetzt gehen, ab hier übernehmen meine Leute“, fügte er noch hinzu.
Der Agent schien recht unschlüssig zu sein, was er jetzt tun sollte, aber mein Onkel hatte recht, sein Auftrag war erledigt. Warum sollte es ihn auch kümmern, was aus mir wurde. Weil ich auf den Agenten achtete, bemerkte ich zu spät, dass mein Onkel ganz nah vor mich getreten war. Er schaute mich eindringlich an und entdeckte dann den Rosenkranz, den ich um den Hals trug.
„Der wird dir hier auch nichts nützen“, brummte er und riss ihn mir vom Hals.
„Nein, gib ihn mir wieder. Bitte!“, flehte ich ihn an und merkte wie mir eine Träne über die Wange rollte.
Achtlos ließ er ihn auf den Boden fallen und grinste mich dabei abfällig an. Er nickte den Agents noch einmal zu, gab seinen Männern ein Zeichen und setzte sich in Bewegung. Ich wurde schmerzhaft am Arm gepackt und hinter ihm her gezerrt.
Wir steuerten die Aufzüge an, stiegen hinein und fuhren bis nach oben. Ich achtete nicht darauf, wie viele Etagen es waren, da es mich schlicht und einfach nicht interessierte. Das Ping des Aufzuges, als wir unser Ziel erreicht hatten, ließ mich zusammenzucken. Damon verließ ihn als Erstes und ich wurde wieder hinter ihm her gezerrt.
In einem großen Büro setzte er sich hinter einen Schreibtisch, der vor der Fensterfront stand. Wenn ich nicht gewusst hätte, in welcher Gefahr ich mich befand, würde ich die Aussicht von hier oben sogar genießen. Aber so schien sie mich einfach nur zu verhöhnen.
Ich wurde unsanft auf einen der Sessel vor dem Schreibtisch geschubst und die Wachleute positionierten sich hinter mir, ihre Waffen immer noch schussbereit. Wieder fragte ich mich, für was die mich eigentlich hielten. Mein Onkel musterte mich eine ganze Weile, ohne auch nur ein Muskel in seinem Gesicht zu bewegen. Ich konnte seine Mimik einfach nicht deuten, aber eins war mir klar, ich würde hier wahrscheinlich nicht wieder lebend herauskommen.
„Wir haben hier eine schöne Zelle für dich vorbereitet. Du gewöhnst dich lieber schnell daran, denn das ist ab jetzt dein Zuhause. Du wirst tun, was ich dir sage, egal was ich von dir verlange, DU WIRST ES TUN. Was ich mit dir anstelle, wenn du dich mir widersetzt, willst du nicht wissen, also fordere mich nicht heraus“, knurrte Damon mich an.
Gänsehaut überzog meinen Körper und ich zitterte. Ich wusste, dass er mir wehtun würde, wenn ich nicht machte, was er verlangte. Da es nichts Gutes sein konnte, würde das schwierig werden, daher musste ich mich wahrscheinlich auf unsagbare Schmerzen vorbereiten.
Im nächsten Moment wurde ich nach oben gezogen und zu einer Tür geführt. Es war nicht die, durch die wir das Büro betreten hatten, sondern lag dieser schräg gegenüber. Dahinter befand sich ein riesiges Labor und am Ende davon lag meine Zelle - durch eine Scheibe vom restlichen Raum getrennt. „Dies ist mein Privatlabor. Die anderen liegen in den Stockwerken unter uns“, sagte Damon, der auf einmal hinter mir stand.
Ich zuckte zusammen, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass er ebenfalls aufstehen würde. Eine Frau in einem weißen Laborkittel kam auf uns zu und lächelte erfreut. Ich ging davon aus, dass sie sehr zufrieden war, endlich ihr Versuchskaninchen zu haben. „Ich übernehme sie ab jetzt. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich mit den Tests anfange“, lächelte sie meinen Onkel an und ergriff meinen Arm.
Sie führte mich in meine künftige Bleibe und sagte kein Wort, aber sie strahlte eine gewisse Vorfreude aus, die ich absolut nicht teilen konnte. Sie bediente ein Tastenfeld, das in der Wand eingelassen war und eine Tür in der Scheibe öffnete sich geräuschlos. Sie führte mich hinein und ging auf eine Wand zu, dahinter verbarg sich ein kleines Badezimmer mit Dusche, einem kleinen Waschbecken und einer Toilette.
Hier drinnen war schon alles für mich vorbereite, denn es stand alles da, was man in einem Badezimmer brauchte. „Hier sind saubere Klamotten für dich. Dusch dich und zieh sie an, damit wir anfangen können. Ich rate dir keine Dummheiten zu machen, denn die Konsequenzen wären sehr schmerzhaft für dich“, sagte sie, deutete auf den WC-Deckel und ließ mich allein.
Ich schaute mich um und entdeckte oben in jeder Ecke eine Kamera, wahrscheinlich waren es Wärmebildkameras. Eins war für mich klar, ich würde immer nur unsichtbar auf die Toilette gehen oder mich unter die Dusche stellen. So konnten sie wenigstens nicht alles detailgetreu sehen.
Ich machte mich unsichtbar, entkleidete mich und stellte mich unter die Dusche. Als ich damit fertig war, mich zu waschen, stellte ich das Wasser wieder ab, nahm ein Handtuch und trocknete mich ab. Die Klamotten, die für mich bereit lagen, erinnerten mich an OP-Klamotten, nur dass sie nicht blau oder grün waren, sondern weiß.
Meine eigenen sammelte ich vom Boden auf. Solange ich die Sachen am Körper trug, waren sie mit mir gemeinsam unsichtbar. Ließ ich sie los oder zog mich aus, wurden sie sofort wieder sichtbar. Auch ich war jetzt wieder für jeden zu sehen, und als ich das Bad verließ, wartete diese Frau schon mit einer Tüte auf mich.