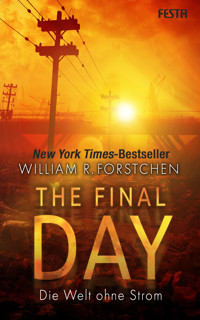4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der US-Bestseller. Was wäre, wenn jemand vorhätte, die USA anzugreifen? Wäre es da nicht strategisch klug, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten zunächst den Schutz durch die überlegene Technologie zu rauben? Was wäre, wenn es eine Waffe gäbe, die alles Elektronische ausschalten könnte? Diese Waffe könnte bereits in den Händen der Feinde sein … John Matherson, Geschichtsprofessor und Ex-Colonel, lebt mit seiner Familie in einer friedlichen Kleinstadt in den Bergen North Carolinas. Doch die Idylle findet ein jähes Ende, als ein EMP die kompletten Vereinigten Staaten lahmlegt. Alle elektronischen Geräte – Autos, Computer, Radios, Flugzeuge – funktionieren von einer Sekunde auf die andere nicht mehr. Die Gesellschaft bricht erschreckend schnell zusammen, und John muss sich eine entscheidende Frage stellen: Wie weit würdest du gehen, um deine Familie und deine Heimat zu schützen? Dieser Roman ist eine Warnung. Eine Warnung vor einer Gefahr, die schon morgen Realität sein könnte: ein Angriff mit einer EMP-Waffe. Der elektromagnetische Impuls kann in einer Sekunde jede Form von Elektronik außer Gefecht setzen – und die Zivilisation, wie wir sie kennen, komplett ausradieren … ONE SECOND AFTER wird fortgesetzt mit ONE YEAR AFTER und THE FINAL DAY. William B. Scott: 'Ein Weckruf, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Chaos und Tod sind nur einen Stromausfall entfernt … Hortet sofort Essen, Wasser, Medikamente und Batterien. Dieser Horror könnte schon morgen Wirklichkeit werden!' Harry Turtledove: 'Forstchen ist einer der faszinierendsten Autoren auf dem Gebiet der historischen Romane und der Military-SF.' Booklist: 'Ein fesselndes, warnendes Beispiel.'
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Vincenzo Benestante und Sabina Trooger
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe One Second After
erschien 2009 im Verlag Forge (Tom Doherty Associates LLC).
Copyright © 2009 by William R. Forstchen
Copyright Vorwort © 2009 by Newt Gingrich
Copyright Nachwort © 2009 by William D. Sanders
Copyright © dieser Ausgabe 2019 by Festa Verlag, Leipzig
Literarische Agentur: Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Titelbild: Arndt Drechsler
Lektorat: Elisabeth Bösl
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-720-2
www.Festa-Verlag.de
www.Festa-Action.de
Meiner Tochter Meghan Marie Forstchen gewidmet … und all denjenigen, die sie beschützen, damit sie in Frieden aufwachsen kann. Und meinem Vater John Joseph Forstchen, der mich lehrte, was im Leben wirklich Wertschätzung verdient.
Danksagung
In gewisser Weise ist jedes Buch das Werk anderer ‒ all jener, die mich als Kind inspirierten und mich lehrten, Lehrer, Schriftsteller und Vater zu werden. Diejenigen unter Ihnen, die in den Jahren des Kalten Krieges mit Science-Fiction aufgewachsen sind, werden sich an Alas, Babylon erinnern, und auch an die Filme Testament und Das letzte Ufer. Die Albträume dieser Zeit verwirklichten sich in meiner Kindheit nicht, und heute fragt man sich, ob die in diesen Werken zum Ausdruck gebrachten Warnungen womöglich mit dazu beigetragen haben, dass dies nicht geschah. Ihr Einfluss auf mich wird im vorliegenden Buch deutlich, und ihre Warnungen bezogen sich damals auf unmittelbar gegenwärtige Gefahren, genau wie die in diesem Buch ausgesprochene Warnung hier und jetzt eine potenzielle Wirklichkeit darstellt.
Ein besonderer Dank gilt meinem Freund Newt Gingrich, der freundlicherweise das Vorwort zu diesem Buch schrieb und mich während des kreativen Prozesses ermutigte, beriet und mit entscheidenden Kontaktpersonen bekannt machte. Bill Sanders, Captain der U. S. Marine, gehört zu den weltweit führenden Experten für die in diesem Buch angesprochene Thematik, und es war Newt, der mich ihm vorstellte. Während meiner Arbeit an diesem Projekt waren sowohl sein Fachwissen als auch seine Freundschaft von unschätzbarem Wert. Ich muss betonen, dass Captain Sanders sich stets äußerst professionell verhielt und manchmal auf meine Fragen strikt entgegnete: »Das darf ich nicht beantworten – Ende der Diskussion«. Alle Fakten, mit denen er mich unterstützte und dieses Buch bereicherte, sind öffentlich zugänglich und nicht als Staatsgeheimnisse klassifiziert. Auch der Abgeordnete Roscoe Bartlett, ein wahrer Diener seines Staates und Vorsitzender einer Regierungskommission zur Einschätzung der Gefahr durch elektromagnetische Impulse, war mir eine große Inspiration.
Ein alter Freund, der vielleicht nicht in diese Danksagung zu passen scheint, ist der Schriftsteller Jean Shepherd. Nur wenige Menschen erinnern sich heute noch an seinen Namen, aber fast jeder kennt seinen berühmten Film über ein weihnachtliches Familientreffen während der Weltwirtschaftskrise. Seine Schriften und seine Rundfunksendung inspirierten mich, als ich unweit der Stadt New York aufwuchs, und durch eine glückliche Fügung des Schicksals wurde er später in Maine mein Nachbar. Als Schriftstellerneuling erlebte ich mit Jean einige unglaublich kostbare Momente und werde nie vergessen, wie er mir damals sagte: »Schreib über das, was du kennst, mein Junge.« Nach so vielen Büchern, die in der Vergangenheit oder in der Zukunft spielen, begann ich nun zum ersten Mal mit dem Schreiben eines Romans, der in der Gegenwart spielt; und es war Jeans Ratschlag, der mir den Weg zu dieser Geschichte wies, die in meiner Heimat spielt. Black Mountain, Asheville und das Montreat College, wo ich Geschichte unterrichte, sind reale Orte. Da dieses Buch eine fiktive Geschichte erzählt, sind die handelnden Personen natürlich ebenfalls fiktiv, aber dennoch erkennen sich meine Freunde und Nachbarn vielleicht ein wenig in den Figuren wieder. Ihnen allen gilt meine tiefste Dankbarkeit für ihre langjährige Freundschaft. Besonders danke ich dem Polizeipräsidenten Jack Staggs für seine Einsichten sowie meinem Hausarzt und unserem Apotheker ‒ jedes Mal, wenn wir uns über diese Geschichte unterhielten, lief es uns kalt den Rücken hinunter. Und wie immer danke ich auch Bill Butterworth (W. E. B. Griffin Jr.), einem der besten Lektoren und Freunde, die man sich nur wünschen kann.
Wie immer gilt mein Dank auch dem Montreat College und den Tausenden von Studenten, die ich dort über die Jahre unterrichtet habe, die ich innig liebe und die mir ebenfalls eine Inspiration gewesen sind; ebenso wie einigen meiner Kollegen, dem Präsidenten unseres Colleges sowie dem Kuratorium; insbesondere meinem langjährigen, engen Freund und Omaha-Beach-Kriegsveteranen Andy Andrews. Ich danke auch dem Personal eines nahe gelegenen Pflegeheims, das meinen Vater und mich liebevoll durch das letzte Jahr seines Lebens begleitet hat. Jeder, der dort arbeitet, ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Schutzengel.
Ohne gute Lektoren, Verleger und Agenten kann ein Schriftsteller nicht wirken. Tom Doherty wird meiner Ansicht nach immer zu den Besten seines Faches gehören. Bob Gleason half mir trotz gelegentlicher kleiner Unstimmigkeiten, dieses Buch immer weiter voranzutreiben, und ich bin ihm dankbar. Und was die Agenten angeht, die an dieses Buch geglaubt haben: Eleanor Wood, Josh Morris und Kevin Cleary – euch allen kann ich nur »Danke« sagen. Dann gibt es noch jemand ganz Besonderen: Dianne St. Clair, die immer an mich geglaubt hat und immer im richtigen Moment für mich da war. Auch Brian Thomsen sage ich »Danke für alles«.
Ein Wort zum Abschluss: Ich hoffe, dass dieses Buch sich niemals bewahrheiten möge. Die Bedrohung ist real, erschreckend real, und je mehr Zeit man sich nimmt, sich mit ihr auseinanderzusetzen, Experten zu befragen und vor allem, einen Sinn für die Weltgeschichte zu entwickeln, desto erschreckender wird sie. Oft kommt der Moment des Absturzes vom Gipfel gerade dann, wenn ein Volk oder eine Nation sich am sichersten fühlt. Der entsetzte Aufschrei »Die Barbaren stehen vor den Toren!« erschallt allzu oft völlig überraschend wie aus dem Nichts, und er ist häufig der letzte Ausruf, der jemals gehört wird. Es gibt heute Menschen auf der Welt, die uns dies wünschen und sich dafür einsetzen, es wahr werden zu lassen. Wie Thomas Jefferson sagte: »Der Preis für die Freiheit ist unaufhörliche Wachsamkeit.«
Ich bete dafür, dass die Kritiker späterer Jahre, wenn meine Zeit sich dem Ende zuneigt, dieses Buch als ein Werk närrischer Fantasie bezeichnen mögen. Das würde mich tief befriedigen, denn es würde bedeuten, dass die Wachsamkeit aufrechterhalten wurde und dass meine Tochter und alle, die ich liebe, die Welt, über die ich schreibe, niemals kennenlernen werden.
William R. Forstchen
Black Mountain, North Carolina
Juli 2008
Vorwort
von Newt Gingrich
1995–1999 Sprecher des Repräsentantenhauses
Obwohl dieses Buch ein Roman ist – eine erfundene Geschichte – basiert es doch auf Fakten; es ist vielleicht eine »Future History«. Es soll jeden von uns zum Denken anregen und uns nach Möglichkeit sogar aufrütteln. Das sage ich aufgrund meiner eigenen, jahrzehntelangen Beschäftigung mit der äußerst realen Bedrohung der amerikanischen Sicherheit durch die spezifische Waffe, über die Bill Forstchen in One Second After schreibt.
Seit dem 11. September 2001 widmen wir einer breiten Palette eventueller Bedrohungen unserer Nation große Aufmerksamkeit; etwa weiteren Entführungen von Passagierflugzeugen, biologischen und chemischen Angriffen, sogar der Gefahr einer »schmutzigen Bombe« bis hin zur stets gegenwärtigen Möglichkeit einer Atomexplosion im Zentrum einer unserer Hauptstädte.
Aber nur wenige Menschen sprechen von der schrecklichen, überwältigenden Bedrohung durch einen EMP, die Abkürzung für electromagnetic pulse weapon – einer elektromagnetischen Impulswaffe. Tatsächlich haben die meisten noch nie davon gehört.
Mein Freund William Sanders, Captain der US-Kriegsmarine, ist einer der führenden Experten in den USA für diese spezifische Waffe und schrieb das Nachwort zu diesem Buch. Unter Verwendung von Dokumenten, die nicht als Staatsgeheimnisse eingestuft sind, wird er in allen Einzelheiten erklären, wie eine solche Waffe funktioniert. An dieser Stelle sei nur kurz erwähnt, dass eine Atombombe, wenn sie über der Erdatmosphäre gezündet wird, eine »Impulswelle« erzeugen kann, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet und in jedem elektronischen Gerät auf der Erdoberfläche, das sie berührt, einen Kurzschluss verursacht. Das wäre, als würde ein Superblitz neben Ihrem Haus einschlagen und Ihren Computer vernichten; nur unendlich viel schlimmer, denn er würde unsere ganze Nation treffen, höchstwahrscheinlich ohne Vorwarnung, und könnte unser komplexes Stromnetz und alles, was daran angeschlossen ist, komplett vernichten. Dies ist eine reale Bedrohung, eine sehr reale, die mir und vielen anderen seit Jahren große Sorgen bereitet.
Über die Jahre haben mein Freund Bill Forstchen und ich gemeinsam sechs historische Romane geschrieben. Inzwischen kenne ich ihn sehr gut. Er erhielt seinen Doktorgrad für Geschichte an der Purdue Universität, sein Spezialgebiet ist die Geschichte der Militärtechnologie, und das hier beschriebene Szenario ist keine bloße Ausgeburt seiner Fantasie. Tatsächlich wurde dieses Buch in einem Gespräch zwischen Bill und mir geboren, das vor einigen Jahren stattfand und in dem er zum Schluss erklärte, er habe das Gefühl, einen Roman über diese Bedrohung schreiben zu müssen, um die Öffentlichkeit aufzurütteln.
Wie bereits gesagt, sehe ich dieses Buch als eine erschreckende »Future History«, die durchaus wahr werden könnte. Bücher dieses Genres haben ihre eigene, bedeutende Tradition. H. G. Wells schrieb erschreckend präzise Prophezeiungen über die Ereignisse, die als Erster und Zweiter Weltkrieg in die Weltgeschichte eingegangen sind. Zwei der großen Klassiker über den Kalten Krieg, Alas, Babylon und der Film Testament, gaben uns einen tief bewegenden Einblick in das, was mit normalen Bürgern geschehen würde, wenn zwischen uns und der Sowjetunion jemals Krieg ausgebrochen wäre. Bill gibt gern zu, dass ihm die beiden oben erwähnten Klassiker als Modelle für dieses Buch dienten. Ich aber vergleiche es gern mit der vielleicht berühmtesten »Geschichte der Zukunft« unserer modernen Zeit: 1984 von George Orwell. Wenn man zugelassen hätte, dass das Böse in Form von totalitären Reichen nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Trümmern Europas aufgeblüht wäre, dann hätte sich jene Zukunftshistorie womöglich als wahr erwiesen. Durch sein Buch sorgte Orwell für eine Bewusstwerdung dieser Gefahr, die uns vielleicht vor dem »großen Bruder« und der Gedankenpolizei bewahrt hat.
Ich hoffe und glaube, dass Bills Roman Ähnliches bewirken kann. Bisher haben sich nur wenige Regierungsmitglieder und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens offen mit der Bedrohung auseinandergesetzt, die schon eine einzige Atomwaffe in den Händen eines zu allem entschlossenen Feindes bedeutet, wenn dieser sie dazu benutzt, einen massiven elektromagnetischen Impuls auszulösen. Ein solches Ereignis würde unsere komplizierte, empfindliche Hightech-Gesellschaft innerhalb eines einzigen Augenblicks vernichten und uns in eine Existenz zurückschleudern, die der des Mittelalters ähnelt. Millionen würden bereits innerhalb der ersten Woche sterben – vielleicht auch Sie, der Sie dies gerade lesen, falls Sie von bestimmten Medikamenten abhängig sind; ganz zu schweigen von den Grundbedürfnissen unseres Lebens, etwa nach Nahrung und sauberem Wasser.
Der Ort, über den Bill schreibt, existiert wirklich, denn er hat diese Geschichte in seiner Heimatstadt und in dem College, an dem er unterrichtet, angesiedelt. Ich erinnere mich an die Gespräche, die wir führten, während er diesen Roman schrieb. Mehr als einmal war er über das, was er erforscht und entdeckt hatte und jetzt in Romanform für jedermann lesbar aufschrieb, zutiefst verstört. Am meisten erschütterte ihn, wie er mir sagte, die immer wiederkehrende Vorstellung von seiner halbwüchsigen Tochter inmitten dieser albtraumhaften Realität; und ich glaube, Sie werden beim Lesen dieses Buches diesen sehr persönlichen Aspekt deutlich erkennen. Auch ich war tief betroffen, denn ich habe zwei Enkelkinder. Genau wie er sich wünscht, seine Tochter vor diesem Schicksal zu bewahren, wünsche ich mir, meine Enkel zu beschützen und ihnen ein Amerika zu hinterlassen, das vor solchen Bedrohungen sicher ist.
Die Bedrohung ist real, und wir als Amerikaner müssen dieser Bedrohung die Stirn bieten, uns auf sie vorbereiten und sie zu verhindern wissen. Denn wenn wir das nicht tun, wird das Amerika, das wir kennen, wertschätzen und lieben, »eine Sekunde danach« für immer verschwunden sein.
Denn ich bin der Tod geworden,
der Zerstörer der Welten.
Kapitel Eins
Black Mountain, North Carolina, 14:30 Uhr
John Matherson nahm die Plastiktüte von der Ladentheke.
»Bist du sicher, dass ich die Richtigen habe?«
Nancy, die Besitzerin des Ivy Corner, lächelte. »Keine Sorge, John. Sie hat sie schon vor Wochen ausgesucht. Gib ihr eine Umarmung und einen dicken Kuss von mir. Kaum zu glauben, dass sie heute schon zwölf wird.«
John nickte seufzend, während er die mit zwölf Beanie Babys gefüllte Tüte betrachtete – eine Puppe für jedes Lebensjahr seiner Tochter Jennifer, die heute vor zwölf Jahren zur Welt gekommen war.
»Ich hoffe, dass sie die mit 13 immer noch haben will«, sagte er. »Gott steh mir bei, wenn der erste Junge vor der Tür steht und mit ihr ausgehen will.«
Die beiden lachten und Nancy nickte zustimmend. John durchlitt diese Situation bereits mit seiner 16-jährigen Tochter Elizabeth, und deshalb – aber auch aus vielen anderen Gründen – wünschte er, die kostbare Zeit, in der sie noch sein »kleines Mädchen« sein würde und an die sich jeder Vater später liebevoll erinnert, noch um ein paar Tage, Wochen oder Monate verlängern und festhalten zu können.
Es war ein wunderschöner Frühlingstag. Die Kirschbäume, die die Straße säumten, standen in voller Blüte, und eine sanfte Brise wirbelte die rosafarbenen Blütenblätter durch die Luft, während er die Straße hinaufging, vorbei an Doktor Kellors Praxis, den Antiquitätenläden, der neuen, etwas düster anmutenden Kunstgalerie, die im letzten Monat eröffnet hatte, den üblichen Schnickschnack- und Andenkenläden und auch dem nostalgisch eingerichteten Eiscafé – der Preis von anderthalb Dollar pro Kugel war jedoch durchaus zeitgemäß. Danach kam Bensons Laden für gebrauchte und seltene Bücher, und John zögerte. Er hätte gern ein paar Minuten hineingeschaut und zog sein Handy hervor, um auf die Uhr zu sehen.
14:30 Uhr. Ihr Bus würde um drei ankommen, also hatte er heute keine Zeit, hier bei einer Tasse Kaffee über Bücher und Geschichte zu plaudern. Walt Benson erspähte ihn und hielt einladend eine Tasse hoch, aber John schüttelte verneinend den Kopf und deutete auf sein Handgelenk, obwohl er nie eine Armbanduhr trug. Er setzte seinen Weg zu seinem Talon-Geländewagen fort, den er vor Taylors Eisen- und Gemischtwarenhandlung an der Ecke geparkt hatte.
John hielt inne und blickte einen Moment auf die Straße zurück.
Ich lebe in einem verdammt idyllischen Gemälde von Norman Rockwell, dachte er zum tausendsten Mal.
Hier zu landen … das hätte er sich früher niemals vorstellen können; er hatte es nie geplant und nicht einmal gewollt. Vor acht Jahren hatte er an der Militärakademie in Carlisle, Pennsylvania Militärgeschichte unterrichtet und Vorlesungen über asymmetrische Kriegsführung gehalten. Damals war er sehr darauf erpicht gewesen, endlich in den Rang eines Brigadier Generals aufzusteigen.
Doch dann hatten sich zwei Dinge ereignet. Seine Beförderung war mit einer Berufung zum Verbindungsoffizier bei der NATO in Brüssel bestätigt worden – eine ziemlich gute Position und höchstwahrscheinlich die Abrundung seiner Karriere. Und dann war Mary einige Tage nach seiner Beförderung mit bleichem Gesicht und fest zusammengepressten Lippen von einem Arztbesuch zurückgekehrt und hatte drei Worte gesagt: »Ich habe Brustkrebs.«
Der Kommandant in Carlisle war Bob Scales gewesen, ein alter Freund und der Patenonkel von Johns Tochter Jennifer, und er hatte die Bitte verstanden, die John an ihn richtete. John hätte die Beförderung gern angenommen, aber könnte er nicht im Pentagon stationiert werden? Dann wären sie in der Nähe der Johns Hopkins Klinik und obendrein nicht weit von Marys Familie entfernt gewesen.
Das ging jedoch nicht. Es gab ohnehin viele Budgetkürzungen. O ja, im obersten Kommandostab brachte man ihm viel Verständnis und Mitgefühl entgegen, aber er musste den Posten in Brüssel annehmen, wenn er seinen Generalsstern haben wollte. Vielleicht würden sie in einem Jahr eine Position in den Staaten für ihn finden.
Nachdem er mit Marys Arzt gesprochen hatte, reichte John seinen Rücktritt ein. Er wollte Mary in ihre Heimat bringen, wie sie es sich wünschte – nach Black Mountain in North Carolina. Das Chapel Hill Krebstherapiezentrum lag ganz in der Nähe.
Als John Black Mountain erwähnte, erwiesen sich Bobs Verbindungen als gut, sogar als erstaunlich gut. Ein einziger Telefonanruf genügte – die »alten Seilschaften« wurden zwar als politisch unkorrekt verachtet, aber sie existierten und halfen, wenn Not am Mann war. Der Präsident des Montreat College in Marys Heimat in North Carolina brauchte tatsächlich »plötzlich« einen Vizedirektor für das Ressort »Akademische Entwicklung«. John hasste zwar diese bürokratische Tätigkeit, bei der es um Studentenimmatrikulation ging, aber es gelang ihm, sie zu überleben, bis schließlich vor vier Jahren eine Professur mit Aussicht auf Unkündbarkeit in der Geschichtsfakultät frei wurde, die man ihm übertrug.
Die Tatsache, dass der Collegepräsident Don Hunt sein Leben Bob Scales verdankte, der ihn 1970 aus einem Minenfeld herausgeholt hatte, war ein starker Pluspunkt für John, der unter Freunden nicht übersehen werden konnte. Don hatte ein Bein verloren, Bob bekam für die Rettung Dons einen weiteren Bronze Star, und beide Männer waren seitdem enge Freunde, die sich stets auch um diejenigen kümmerten, die dem anderen wichtig waren.
Mary durfte also endlich nach Hause, nachdem sie John 20 Jahre lang überallhin begleitet hatte: vom Hauptquartier in Benning nach Deutschland, nach Okinawa, nach der nervenaufreibenden Operation Desert Storm, anschließend ins Pentagon. Dann ein Jahr – ein wunderbares Jahr – an der Akademie in West Point und schließlich drei weitere Jahre in Carlisle, wo er Dozent gewesen war. Im Grunde seines Herzens war John Geschichtslehrer, und vielleicht hatte der unbekannte Paragrafenreiter im Personalbüro des Pentagons ihm sogar einen Gefallen getan, als er sein Versetzungsgesuch in die Vereinigten Staaten abwies.
Und so waren sie in Marys Heimat, nach Black Mountain in North Carolina, zurückgekehrt. John hatte keine Sekunde gezögert, Mary ihren Wunsch zu erfüllen; er nahm seinen Abschied vom Militär, verzichtete auf seine Beförderung und zog mit ihr in dieses idyllische Fleckchen in den Bergen North Carolinas.
Als er nun über die Hauptstraße blickte, verlor er sich einen Moment lang in seinen Erinnerungen. Nächste Woche jährte sich Marys Tod zum vierten Mal – vier Jahre waren seit ihrem letzten, langsamen, erschöpfenden Spaziergang auf dieser Straße vergangen, auf der sie als Kind ausgelassen herumgerannt war.
Es war wirklich ein Städtchen wie von Norman Rockwell gemalt. Während dieses letzten Spaziergangs waren sie alle aus ihren Läden gekommen, denn jeder kannte Mary, jeder wusste, was los war, und wollte sie begrüßen, sie umarmen, sie küssen, und alle wussten, dass dies der Abschied war, aber niemand sprach es aus. John würde die liebevollen Gesten niemals vergessen.
Er verdrängte diese Gedanken. Sie gingen ihm immer noch zu nah, und Jennifers Schulbus würde in 20 Minuten ankommen.
Er stieg in seinen Talon, ließ den Motor an, bog in die State Street und fuhr in Richtung Osten. Er liebte den Anblick der State Street, die sich, gesäumt von weiteren Läden, in Kurven durch die Stadt wand. Fast alle Gebäude bestanden aus rotem Backstein und stammten aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende.
Das Städtchen war einst aufgrund des Booms der Tuberkulose-Sanatorien eine blühende Gemeinde gewesen. Als sich in den frühen 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts endlich die Eisenbahn ihren Weg durch die Berge im Westen North Carolinas gebahnt hatte, waren die Tuberkulosekranken die Ersten gewesen, die hierher geströmt waren. Zu Tausenden kamen sie in die Sanatorien, die auf jedem sonnenbeschienenen Berghang wie Pilze aus dem Boden schossen. In den frühen 1920er-Jahren gab es bereits ein Dutzend solcher Kliniken im Umland von Asheville, der großen Kreisstadt 18 Kilometer westlich von Black Mountain.
Dann kam die Wirtschaftskrise. In Black Mountain schien die Zeit stehen zu bleiben, und als nach dem Krieg die Antibiotika aufkamen, leerten sich die Sanatorien. Dadurch blieben in Black Mountain all die schönen Gebäude unverändert erhalten, die in anderen Städten längst Einkaufszentren gewichen waren. Der Fortschritt war an Black Mountain vorbeigegangen.
Nun gab es dort, wo die Sanatorien gewesen waren, Konferenzzentren diverser Kirchen und Ferienlager für Kinder. Auch Johns College war auf einem solchen hoch gelegenen Gelände errichtet worden, das die Einheimischen »Cove« nannten. Es war ein kleines College mit höchstens 600 Studenten, und die meisten stammten aus kleinen Dörfern in North oder South Carolina; nur einige wenige kamen aus Atlanta, Georgia oder Florida. Manchen Jugendlichen machte die relative Abgeschiedenheit schwer zu schaffen, aber die Mehrzahl gab widerstrebend zu, dass sie die Gegend liebten. Es war eine wunderschöne Hochschulanlage, nirgends lauerten Gefahren und rings um das Grundstück wand sich ein alter Holzfällerweg, der direkt auf den Gipfel des Mount Mitchell führte. Reißende Bäche in der Nähe waren ideal zum Kajakfahren, und die dichten Wälder hießen alle willkommen, die unter Umgehung der relativ strengen Collegeregeln Partys feiern wollten.
In den 1980er-Jahren war auch das Städtchen schließlich wieder zum Leben erwacht, aber glücklicherweise waren die Architektur und das Ambiente des ausgehenden 19. Jahrhunderts erhalten geblieben. Im Sommer und Herbst drängten sich nun auf den Straßen Touristen und Tagesausflügler, die aus Charlotte oder Winston-Salem heraufkamen, um der sengenden Hitze der Täler zu entfliehen. Außerdem bewohnten dann Hunderte von Sommer-Mietern die sogenannten Cottages im Cove, die teilweise von alteingesessenen, wohlhabenden Südstaatler-Familien erbaut worden waren und eher Herrenhäusern als Sommerhäuschen glichen.
Genau das waren die Mitglieder von Marys Familie gewesen: traditionelle Südstaatler mit Geld. »Me-ma« Jennie, Marys Mutter, nach der Jennifer benannt war, hielt immer noch stur an ihrem Haus oben im Cove fest, obwohl »Papa« Tyler nun mit Krebs im Endstadium in einem nahen Pflegeheim lag.
John fuhr weiter in Richtung Osten und der Verkehr der Autobahn I-45, der aus dem Bergeinschnitt bei Swannanoa kam, dröhnte zu seiner Linken an ihm vorbei. Die alteingesessenen Bewohner des Städtchens schäumten immer noch vor Wut über diese »verdammte Straße«. Vor dem Bau der I-45 war Black Mountain ein verschlafenes Südstaaten-Fleckchen gewesen. Mit der Autobahn kamen die Erschließung, der Verkehr und die Fluten der Wochenend-Touristen; geliebt von der Handelskammer, mühsam toleriert von allen Ansässigen.
John blieb noch anderthalb Kilometer nach der Stadtgrenze auf der alten Landstraße, die parallel zur I-45 verlief, bis er rechts in einen ungepflasterten Feldweg einbog. Dieser wand sich in Serpentinen einen Hügel hinauf, von dem man auf die ganze Stadt hinunterblickte. Ein alter Witz der Gegend lautete: »Du weißt, dass du einen echten Bergbewohner besuchst, wenn er dir sagt: ›Bieg in den Feldweg ein‹.«
Obwohl er in New Jersey aufgewachsen war, freute sich John immer noch darüber, dass er nun im Süden auf einem Berghang wohnte, zu dem nur ein Feldweg führte; mit einem Ausblick, der mehr wert war als alles Geld der Welt.
Das Haus, das Mary und er gekauft hatten, war Teil einer der ersten Neubausiedlungen der Gegend. Hier gab es noch keine gesetzlichen Baubestimmungen, und deshalb standen am Fuß des Hügels mehrere Wohnwagen sowie eine alte Hütte, in der Connie Yarborough lebte, eine wunderbare, urwüchsige Nachbarin, die immer noch keinen Anschluss an das städtische Strom- und Wassernetz wollte. Neben ihr betrieb der exzentrische Jim Bartlett, ein Relikt aus den 60er-Jahren, eine VW-Reparaturwerkstatt. Auf seinem Grundstück drängten sich Dutzende verrosteter Käfer, Lieferwagen und sogar einige nostalgisch-kostbare VW-Busse und Karmann-Ghias.
Das Haus selbst, das John und Mary aufgrund ihrer gemeinsamen Liebe zu Tolkien »Bruchtal« getauft hatten, bot einen weiten Blick auf das Tal unter ihnen. In der Ferne sah man die Skyline von Asheville, umrahmt von der Gebirgskette der Great Smoky Mountains. Der Blick ging nach Westen, sodass Mary ihre geliebten Sonnenuntergänge genießen konnte.
Wenn John versuchte, Freunden den Ausblick zu beschreiben, sagte er immer: »Seht euch einfach den Film Der letzte Mohikaner an. Eine halbe Stunde von ihm wurde hier gedreht.«
Es war ein relativ modernes Haus mit einem hohen Dach, und die Westwand, die sich über die ganze Breite des Hauses vom Schlafzimmer über das Wohnzimmer bis zum Esszimmer erstreckte, war ganz aus Glas. Das Ehebett stand noch immer so, dass man hinaussehen konnte, denn Mary hatte die Welt draußen beobachten wollen, während ihr das Leben entglitt.
Er bog in die Auffahrt ein. Die beiden »Narren« Ginger und Zach, zwei Golden Retriever, wunderschöne Tiere – und beide so dumm wie Brot –, die sich auf der Veranda vor dem Schlafzimmer gesonnt hatten, sprangen auf und bellten wie wahnsinnig, als sei er ein Eindringling. Wäre John jedoch wirklich ein Eindringling gewesen, hätten sie voller Angst die Schwänze eingezogen und auf den Teppich in Jennifers Zimmer gepinkelt, in das sie sich geflüchtet hätten.
Die zwei Narren rannten durch das Schlafzimmer und dann durch das Fliegengitter der vorderen Verandatür, deren untere Hälfte ein Witz war, denn das Drahtgeflecht war längst zerfetzt. Hätte John das Gitter ersetzt, hätte es höchstens ein paar Tage gehalten, bevor die Narren abermals hindurchgerannt wären und es wieder zerstört hätten. John hatte diesen Kampf schon vor Jahren aufgegeben.
Auf die Idee, die Tür abzuschließen, kam John schon längst nicht mehr. Dies war Black Mountain. So merkwürdig es sich anhören mochte, aber die Leute hier sperrten selten irgendetwas ab. Sie ließen ihre Autoschlüssel stecken, die Kinder spielten am Abend auf der Straße, und es gab immer noch Paraden am Unabhängigkeitstag und zu Weihnachten sowie das alljährliche, absolut lächerliche Tannenzapfen-Festival, inklusive der Krönung einer Miss Tannenzapfen. Papa Tyler hatte seine Tochter Mary in einem Frühstadium von Johns Umwerben schrecklich blamiert, indem er John voller Stolz ein Foto von ihr als Miss Tannenzapfen 1977 zeigte. In Black Mountain gab es auch immer noch einen Eiscremewagen, der an den Sommerabenden bimmelnd durch die Stadt fuhr … Der Alltag hier unterschied sich gewaltig von Johns Kindheit in den Außenbezirken von Newark in New Jersey.
Ein Auto parkte am Ende der Auffahrt. Es gehörte Me-ma Jennie, Marys Mutter.
Me-ma Jennie selbst saß hinter dem Steuer ihres wunderbaren und höchst extravaganten 1959er Ford Edsel. Ford hatte den Grundstein zum Vermögen der Familie gelegt, denn die Tylers besaßen eine Kette Autohäuser in North und South Carolina, die schon seit der Zeit Henry Fords existierte. Im Haus oben im Cove hing sogar ein gerahmtes Foto, das aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stammte und Marys Urgroßvater zusammen mit Henry Ford bei der Eröffnung einer Autohandlung in Charlotte zeigte.
In der Gesellschaftsschicht ihrer Familie galt es zwar als unschicklich, sich allzu geschäftsmäßig zu geben, und Jennie zog ohnehin die Rolle der hochkultivierten Südstaatler-Lady vor, aber John wusste, dass sie in jüngeren Jahren das Geschäft ebenso versiert geführt hatte wie ihr Mann.
John parkte neben dem Edsel. Jennie legte das Buch weg, das sie gelesen hatte, und stieg aus.
»Hallo, Jen.«
Sie hasste es, wenn ihr Nordstaatler-Schwiegersohn, der ohnehin nicht ihre erste Wahl als Ehemann ihrer einzigen Tochter gewesen war, Ausdrücke wie »Mutti«, »Mutter«, »Mama«, »Me-Ma« oder gar »Oma«, den schlimmsten aller Kosenamen, gebrauchte. Dies hatte sich jedoch mit der Zeit gemildert; besonders, nachdem John ihr Mädchen wieder zu ihr nach Hause gebracht hatte.
John stieg ebenfalls aus und Jennie reckte ihre Wange zum Begrüßungskuss empor, denn mit ihrer Größe von 1,57 Meter wurde sie von dem bulligen, 1,93 Meter großen John weit überragt. Sie berührte sanft seinen Arm und drückte ihn liebevoll.
»Ich dachte, du würdest es nicht schaffen, rechtzeitig hier zu sein. Sie kann jeden Moment kommen.«
Jens Stimme hatte immer noch nicht den rauen oder quiekenden Klang einer alten Frau. John fragte sich, ob sie sich jede Nacht vor einen Spiegel stellte und rezitierte, um sich die wunderbare, sehr weibliche Sprachmelodie einer jungen Südstaatlerin zu bewahren. Dieser Akzent verfolgte ihn immer noch. Marys Stimme hatte genauso geklungen, als sie sich vor 28 Jahren auf der Duke University kennengelernt hatten. Manchmal schossen ihm heute noch Tränen in die Augen, wenn Jen im Zimmer nebenan war und nach den Mädchen rief.
»Wir haben noch Zeit. Warum hast du nicht im Haus gewartet?«
»Mit den beiden Kötern? So wie die an einem hochspringen, hätten sie meine Strümpfe ruiniert.«
Ginger und Zach sprangen John in der Tat bellend an und tanzten aufgeregt um ihn herum, wobei sie Jen instinktiv ignorierten. Obwohl sie so dumm waren, spürten die Hunde immer, wenn man sie nicht mochte, auch wenn derjenige sich noch so charmant gab.
John beugte sich ins Auto, nahm die Tüte mit den Beanie Babys heraus und ging zu der Steinmauer, die den Pfad zum Haus an beiden Seiten säumte. Dort fing er an, die Puppen Seite an Seite aufzustellen.
»Also wirklich, John, ist sie nicht allmählich ein bisschen zu groß für so was?«
»Noch nicht, nicht mein kleines Mädchen.«
Jen lachte leise.
»Du kannst die Zeit nicht ewig aufhalten.«
»Ich kann’s aber versuchen, oder?«, versetzte er mit einem Grinsen.
Sie lächelte traurig.
»Was glaubst du, was Tyler und ich über dich dachten, als du zum ersten Mal in unser Haus gekommen bist?«
Er streckte seine Hand aus und berührte liebevoll ihre Wange.
»Ihr habt mich sofort ins Herz geschlossen.«
»Dich? Einen Nordstaatler? Dass ich nicht lache! Tyler hat sogar mit dem Gedanken gespielt, dich mit seiner Schrotflinte zu verjagen. Und als du das erste Mal über Nacht geblieben bist …«
Selbst nach all den Jahren wurde er bei dieser Erinnerung immer noch rot. Jen hatte ihn und Mary um zwei Uhr morgens in einer »unangemessenen« Situation auf dem Wohnzimmersofa überrascht. Zwar hatte sich die Unangemessenheit in Grenzen gehalten, aber es war trotzdem ein peinlicher Moment, den Jen ihn niemals vergessen ließ.
Er rückte die Puppen zurecht und trat zurück, um sie prüfend zu mustern, wie ein Armeeausbilder eine Reihe neuer Rekruten. Der rot-weiß-blaue »Patriotenbär« auf der rechten Seite hätte eigentlich auf dem Platz des Fahnenträgers in der Mitte stehen müssen.
Er hörte das ratternde Geräusch des Schulbusmotors, als der Fahrer den Gang wechselte und die alte Route 70 verließ, um den Hügel hinaufzufahren.
»Da kommt sie«, rief Jen aufgeregt.
Sie ging zum Edsel zurück, beugte sich durch das offene Autofenster und nahm eine flache, elegant verpackte und mit einer roten Schleife verzierte Schachtel heraus.
»Schmuck?«, fragte John.
»Natürlich, sie ist ja jetzt zwölf. Eine standesgemäße junge Dame sollte mit zwölf Jahren eine goldene Halskette besitzen. Genau wie ihre Mutter in dem Alter.«
»Ja, ich kann mich an die Kette erinnern«, sagte er mit einem Grinsen. »Sie trug sie in der Nacht, die du mich nie vergessen lässt. Und damals war sie 20.«
»Du Scheusal«, sagte Jen leise und schlug ihn leicht auf die Schulter. Er tat so, als sei es ein überaus schmerzhafter Hieb gewesen.
Ginger und Zach hatten aufgehört, um John herumzuspringen, und spitzten die Ohren. Sie hatten den herannahenden Schulbus gehört, dessen Bremsen am Fuß der Auffahrt quietschten. Seine gelbe Farbe war durch das Frühlingslaub der Bäume gerade noch sichtbar.
Wie zwei Blitze rannten die Hunde los, jagten in halsbrecherischer Geschwindigkeit die Auffahrt hinunter und bellten wie verrückt. Sekunden später hörte John das Gelächter von Jennifer und Patricia, der ein Jahr älteren Nachbarstochter, und von Patricias großem Bruder Seth, der in die elfte Klasse ging.
Die Mädchen rannten die Auffahrt hinauf und Seth warf einen Stock, wodurch die Hunde kurz abgelenkt wurden. Sie setzten an, das Stöckchen zu jagen, aber dann drehten sie sich gleichzeitig um und hetzten hinter den Mädchen her. Seth winkte und ging auf die andere Straßenseite zu seinem Haus.
John spürte, wie Jens Hand sich in seine schob.
»Genau wie ihre Mutter«, flüsterte sie mit erstickter Stimme.
Ja, er konnte Mary in Jennifer deutlich erkennen. Schlank wie eine Gerte, fast schon mager, mit schulterlangen, blonden Haaren; immer noch ein etwas schlaksiges kleines Mädchen. Sie verlangsamte ihren Lauf etwas und streckte eine Hand nach einem Baum aus, als wollte sie sich abstützen. Patricia drehte sich um und wartete auf sie. John spürte das Aufflackern der Sorge und wollte zu ihr gehen, obwohl er es besser wusste. Jen hielt ihn zurück.
»Du bist überfürsorglich«, flüsterte sie. »Sie muss selbst damit fertig werden.«
Die kleine Jennifer kam wieder zu Atem und spähte, etwas blass geworden, den Hang hinauf. Als sie sah, dass ihr Vater und ihre Großmutter auf sie warteten, breitete sich ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht aus.
»Me-Ma! Und du bist auch noch mit dem Edsel gekommen! Können wir eine Spazierfahrt machen?«
Jen ließ Johns Hand los und beugte sich vor, als Jennifer auf ihre Großmutter zurannte. Sie umarmten einander.
»Wie geht’s meinem Geburtstagsmädchen?«
Sie umarmten sich erneut und Jen bedeckte Jennifers Gesicht mit Küssen: genau zwölf Stück, die sie einzeln abzählte. Pat erblickte die aufgereihten Beanie Babys, lächelte und sah John an.
»Guten Tag, Mr. Matherson.«
»Wie geht’s dir, Pat?«
»Ich glaube, sie muss sich testen«, flüsterte Pat.
»Das hat noch Zeit.«
»Daddy!«
Jennifer stürzte sich in seine Arme. Er hob sie hoch und umarmte sie so heftig, dass sie lachen musste. Dann stöhnte sie: »Du brichst mir ja den Rücken!«
Er ließ sie los und sah ihre Augen, als sie an ihm vorbeiblickte und die aufgereihten Beanie Babys entdeckte … und tatsächlich: Das Funkeln, das darin aufblitzte, war immer noch kindlich.
»Der Patriotenbär! Und Ollie Ostrich!«
Als sie anfangen wollte, die Puppen einzusammeln, warf John Jen ein triumphierendes Lächeln zu, als wollte er sagen: »Siehst du, sie ist immer noch mein kleines Mädchen.«
Jen nahm die Herausforderung an, trat neben Jennifer und hielt ihr die flache Schachtel hin.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Liebes.«
Jennifer riss das Papier ab. Ginger meinte, das Papier sei ein Geschenk für sie, schnappte es sich und verschluckte es halb. Sie rannte los und Zach jagte hinter ihr her.
Als Jennifer die Schachtel öffnete, wurden ihre Augen groß.
»Oh, Me-ma.«
»Es ist Zeit, dass mein Mädchen eine Halskette aus echtem Gold bekommt. Vielleicht kann deine Freundin dir helfen, sie anzulegen.«
John betrachtete das Geschenk. Mein Gott, die muss ein Vermögen gekostet haben! Schwer, fast so dick wie ein Bleistift. Jen sah ihn aus dem Augenwinkel an, bereit, jede Kampfansage anzunehmen.
»Du bist jetzt eine junge Dame«, verkündete Jen, als Pat Jennifer half, die Halskette anzulegen und den Verschluss zu schließen. Dann nahm sie einen kleinen Spiegel aus ihrer Handtasche und hielt ihn hoch.
»Oh, Oma … sie ist wunderschön.«
»Ein wunderschönes Geschenk für eine wunderschöne junge Dame.«
John stand einen Moment lang schweigend daneben. Er wusste nicht, was er sagen sollte, als sein kleines Mädchen in den Spiegel sah und den Kopf leicht anhob wie eine erwachsene Frau, um das Gold zu bewundern.
»Süße, ich glaube, du solltest deinen Blutzucker kontrollieren. Du schienst mir etwas kurzatmig, als du den Hügel heraufkamst«, sagte John schließlich. Seine Worte klangen gewichtig und zerstörten die Stimmung.
»Ja, Daddy.«
Jennifer lehnte sich an die Wand, legte den Rucksack ab und nahm ihr Zuckermessgerät heraus. Es war eines der neuen, digitalen Modelle, bei denen es nicht nötig ist, sich in die Fingerkuppe zu piksen. Nur ein sanfter Stich in den Arm. Mit ihrer freien Hand spielte sie abwesend mit der Kette, während sie auf die Anzeige wartete.
142 … relativ hoch.
»Ich glaube, du solltest etwas Insulin nehmen«, sagte John.
Sie nickte.
Jennifer lebte nun schon seit zehn Jahren mit ihrer Zuckerkrankheit. John wusste, dass dies der Hauptgrund für seinen übertriebenen Beschützerdrang war. Als sie noch ein Kleinkind gewesen war, hatte es ihm jedes Mal, wenn er ihr in den Finger piksen musste, fast das Herz zerrissen. Der bloße Anblick von ihm oder Mary mit dem Testgerät in der Hand hatte tränenreiches Protestgeheul ausgelöst.
Alle Ärzte hatten gesagt, dass Jennifer so bald wie möglich lernen musste, sich selbst zu kontrollieren, und dass John und Mary sich zurückhalten sollten – schon als sie erst sieben, acht Jahre alt war. Sie sollte selbst die Anzeichen erkennen, sich selbst testen und ihr Medikament von sich aus einnehmen. Mary war wesentlich besser damit fertig geworden als John; vielleicht aufgrund ihrer eigenen Krankheit. Jen, mit ihrer starken Persönlichkeit, hatte die gleiche Einstellung.
Eigenartig. Ich bin 20 Jahre lang Soldat gewesen, habe auch aktiv Kämpfe erlebt, aber die einzigen Verluste waren Iraker, nie meine eigenen Männer. Ich wurde darauf trainiert, mit allem fertig zu werden, aber wenn es um den Diabetes meiner eigenen Tochter geht, ein verdammt aggressiver Typ 1, haben mich meine Nerven immer im Stich gelassen. Ich war zäh, verdammt gut in meinem Job, von meinen Männern respektiert, aber wenn es um mein eigenes Mädchen geht, bin ich weich wie ein Wackelpudding.
»Drinnen gibt es noch mehr Geschenke«, sagte John. »Geht ruhig schon hinein. Sobald deine Schwester nach Hause kommt und deine Freunde auftauchen, können wir unsere Party feiern.«
»Ach, Paps, hast du Elizabeths Nachricht nicht bekommen?«
»Welche Nachricht?«
»Hier, Dummerchen.«
Sie reckte sich hoch und zog sein Handy heraus, das hinter einem Päckchen Zigaretten in seiner Hemdtasche steckte. Sie war drauf und dran, die Zigaretten aus der Packung zu zerren, um sie zu zertrampeln oder zu zerbrechen, aber ein warnender Blick ihres Vaters hielt sie davon ab.
»Eines Tages, Daddy«, seufzte sie. Dann drückte sie einige Tasten seines Handys und reichte es ihm zurück.
»Komme später heim. Bin mit Ben unterwegs«, zeigte der Bildschirm an.
»Sie hat dir und mir in der Mittagspause gesimst.«
»Gesimst?«
»Ja, Daddy, eine SMS. Alle machen das jetzt.«
»Was ist gegen einen Anruf einzuwenden?«
Sie sah ihn an, als käme er aus vorsintflutlichen Zeiten, und ging ins Haus.
»Gesimst?«, fragte Jen.
John hielt das Handy so, dass sie die Anzeige sehen konnte.
Jen lächelte.
»Du solltest anfangen, Elizabeth gründlicher zu beaufsichtigen«, sagte sie. »Nur für den Fall, dass dieser Ben Johnson nach seinem Großvater kommt.«
Sie gluckste, als sei eine alte Erinnerung hochgekommen.
»Das brauchst du mir nicht zu sagen.«
»Selbstverständlich nicht, Colonel.«
»Eigentlich ziehe ich ›Herr Doktor‹ oder ›Herr Professor‹ vor.«
»Ein Doktor ist jemand, der irgendwelche Dinge in einen hineinsteckt. Ein Professor … tja, die kamen mir immer etwas merkwürdig vor. Entweder waren sie Lüstlinge, die den Mädchen nachjagten, oder sie waren langweilige, verstaubte Typen. Hier im Süden hört sich ›Colonel‹ am besten an. Es klingt irgendwie männlicher.«
»Wie auch immer, ich bin nicht mehr im aktiven Dienst. Ich bin Professor, also einigen wir uns auf John.«
Jen sah einen Moment lang zu ihm auf. Dann trat sie neben ihn, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn sanft auf die Wange.
»Ich kann verstehen, wieso mein kleines Mädchen sich damals in dich verliebt hat, John. Und du wirst deine beiden noch früh genug an irgendwelche pickligen Jungen verlieren, also halte die Kleine ruhig fest, solange du kannst.«
»Du hast mir dabei nicht gerade geholfen, als du ihr diese Halskette umgehängt hast. Wie viel hat sie gekostet? 1000? 1500?«
»So ungefähr, aber eine Dame sagt nie die Wahrheit über ihre Schmuckkäufe.«
»Bis die Rechnung kommt und der Ehemann sie bezahlen muss.«
Eine peinliche Stille entstand. Er wusste, dass er etwas Geschmackloses gesagt hatte. Hätte er so etwas in Marys Gegenwart ausgesprochen, hätte sie ihm gehörig den Kopf gewaschen und ihm klargemacht, dass Frauen unabhängig seien, und zum Teufel mit Männern und Rechnungen … Tatsächlich hatte Mary die Finanzen der Familie bis in die letzten Wochen vor ihrem Tod verwaltet.
Und was Tyler anging – der wusste nicht einmal mehr, was eine Rechnung überhaupt war, und das tat weh – egal, wie selbstständig sich Jen gab.
»Ich gehe wohl besser«, sagte Jen.
»Es tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint.«
»Schon in Ordnung, John. Lass mich zum Pflegeheim fahren und ein bisschen Zeit mit Tyler verbringen. Zur Party bin ich wieder da.«
»Jennifer hat sich auf eine Fahrt in deinem Monster-Auto gefreut.«
»Der Edsel, mein lieber junger Mann, war seiner Zeit um eine Generation voraus.«
»Und die größte Blamage in der Geschichte der Ford Autowerke. Mein Gott, sieh dir nur den Kühlergrill an. Er ist potthässlich.«
Das Geplänkel entspannte sie ein wenig. In ihrer enormen Garage standen sechs Autos. Einige waren neueren Datums, aber es gab auch einen originalen Ford Model A, der auf Blöcken ruhte. Die Krönung war jedoch ein taubenblaues 1965er Mustang Cabrio. An diesem hingen jedoch unangenehme Erinnerungen. Als John und Mary noch miteinander ausgingen, hatte sie ihre Eltern dazu überredet, ihnen das Auto für eine Spritztour auf dem Blue Ridge Parkway nach Mount Mitchell zu leihen – und John war damit auf den Winnebago-Campingbus eines älteren Ehepaars aufgefahren.
Niemand war verletzt worden, aber das Auto hatte einen Totalschaden und Tyler musste Tausende hineinstecken, um es restaurieren zu lassen. Er hatte geschworen, dass niemand außer ihm und Jen es jemals wieder fahren würde, und Jen hielt sich immer noch an diese Regel.
»Dieser Edsel wird immer und ewig laufen, Schätzchen. Informiere dich einmal bei eBay, wie viel er wert ist. Bestimmt unendlich viel mehr als dieses Geländeding, das du fährst.«
Er lehnte an der Steinmauer, während Jen »das Monster« wendete und mit halsbrecherischer Geschwindigkeit die Auffahrt hinunterbrauste. Die Mauer war warm von der Nachmittagssonne. Die Beanie Babys standen immer noch aufgereiht da, und das tat John ein bisschen weh. Sie hätte zumindest den Patriotenbär oder Ollie Ostrich mit hineinnehmen können.
Tatsächlich hörte er Jennifer und Pat drinnen über die Halskette reden, bis die Stereoanlage eingeschaltet wurde. Irgendwelche seltsamen weiblichen Heullaute ertönten. Britney Spears? Nein, die war ja jetzt nicht mehr in, Gott sei Dank. Er konnte nicht feststellen, was es war, außer, dass es ihm nicht gefiel. Pink Floyd oder manche der alten Sachen, die seine Eltern gehört hatten, wie Frank Sinatra oder Glenn Miller, oder, noch besser: die Chieftains – das war mehr sein Stil. Er nahm eines der Beanie Babys. Den Patriotenbären.
»Tja, mein Freund, ich schätze, wir beide werden bald ausgemustert«, sagte John.
Wieder an die Mauer gelehnt, genoss er den Ausblick und die Ruhe des Augenblicks, die nur durch das entfernte Dröhnen des Verkehrs auf der I-40 und den Lärm aus dem Haus gestört wurde.
Ginger und Zach kehrten vom Herumtollen auf dem Feld hinter dem Haus zurück und plumpsten hechelnd vor seine Füße.
Der Duft des Flieders hing schwer in der Luft. Wer den Frühling wirklich erleben wollte, musste in diesen Bergen leben. Unten im Tal standen die Kirschbäume in voller Blüte; aber hier, nur einige Hundert Meter höher, platzten die Knospen gerade erst auf, während der Flieder bereits blühte. Rechter Hand, etwa 16 Kilometer entfernt, trug der Gipfel vom Mount Mitchell noch eine Schneekrone. Dort oben hockte immer noch der Winter.
»›Als der Flieder noch im Vorhof blühte …‹«
Der Duft ließ John immer an Walt Whitmans Totenklage für Abraham Lincoln denken. Und dies erinnerte ihn daran, dass heute der zweite Dienstag des Monats war, der Abend, an dem die Bürgerkriegstafelrunde im Keller der Methodistenkirche stattfand. Es würde eine weitere ausgelassene Zusammenkunft mit den üblichen lärmenden Debatten werden, und wie immer würden die anderen Mitglieder ihn, ihren einzigen Nordstaatler, »Yankee« nennen und es genießen, ihn aufzuziehen.
Dann läutete das Handy. Er zog es aus der Tasche und erwartete, dass es Elizabeth war. Die durfte sich auf etwas gefasst machen, weil sie sich jetzt erst meldete! Wie konnte sie es wagen, ihre kleine Schwester an ihrem Geburtstag im Stich zu lassen, um sich mit diesem pickligen, ständig geilen Johnson-Jungen wegzuschleichen, der nur aus grapschenden Händen bestand …
Doch die Ortsvorwahl des Anrufers war 703 … und John erkannte die folgenden drei Zahlen: das Pentagon.
Er klappte das Handy auf und nahm das Gespräch an.
»Hallo, Bob.«
»John, wie geht’s dir? Wo ist meine Patentochter?« Letzteres mit einer recht annehmbaren Imitation von Marlon Brando als »Der Pate«.
Bob Scales, inzwischen zum Lieutenant General befördert, war Johns ehemaliger Vorgesetzter in Carlisle und ein verdammt guter Freund. Er war Jennifers Patenonkel, und obwohl er nicht italienischer Abstammung war wie »Der Pate«, sondern irisch-katholischer, nahm er die Verantwortung sehr ernst. Er und seine Frau Barbara kamen meist drei- bis viermal im Jahr zu Besuch. Als Mary starb, hatten sich beide Urlaub genommen und einige Wochen hier verbracht, um John zur Seite zu stehen. Sie hatten keine eigenen Kinder und betrachteten Jennifer und Elizabeth gern als Ersatz.
»Sie wird erwachsen«, sagte John traurig. »Ihre Großmutter hat ihr eine goldene Halskette geschenkt, die bestimmt mindestens einen Tausender gekostet hat, und die war ihr viel wichtiger als die Beanie Babys und die Pokémon-Karten, die im Haus noch auf sie warten. Ich habe für die Schulferien sogar Eintrittskarten für Disney World gekauft und will sie ihr beim Abendessen geben, aber jetzt frage ich mich, ob ihr das noch dasselbe bedeutet.«
»Du meinst dasselbe wie damals, als du mit ihr das letzte Mal dort warst? Als sie sechs war und Elizabeth zehn? Mann, natürlich wird es diesmal anders sein, aber du wirst trotzdem erleben, dass das kleine Mädchen wieder zum Vorschein kommt, sogar bei Elizabeth. Wie geht es ihr übrigens?«
»Ich spiele mit dem Gedanken, nachher ihren Freund zu erschießen.«
Bob brüllte vor Lachen.
»Vielleicht ist es besser, dass ich keine Töchter habe«, antwortete er schließlich. »Söhne dagegen …«
Seine Stimme erstarb einen Moment lang.
»Hey, lass mich kurz mit Jennifer sprechen, ja?«
»Klar.«
John ging ins Haus und rief nach Jennifer, die aus ihrem Schlafzimmer stürzte und nach dem Handy griff. Sie trug immer noch die verdammte Goldkette.
»Hallo, Onkel Bob!«
John tippte ihr auf die Schulter. »Hast du dein Insulin genommen?«
Sie nickte und wanderte munter plaudernd durch das Haus. John sah aus dem Fenster auf die Berge jenseits des Tals. Es war ein wunderschöner, makelloser Frühlingstag. Seine Stimmung hob sich. Einige Freunde von Jennifer würden bald zu einer kleinen Party eintreffen. John plante, auf der Terrasse Hamburger zu grillen, und dann würden die Kinder in Jennifers Zimmer spielen. Am Wochenende hatte er den Pool gereinigt. Obwohl die Wassertemperatur nur knapp 20 Grad betrug, könnte es ja sein, dass einige Kinder hineinspringen wollten.
Wenn es dunkel wurde, würde er sie nach Hause scheuchen und zu seinem Tafelrundentreffen gehen, und vielleicht konnte er sich dann später am Abend wieder in den Artikel über die Unterschiede zwischen General Robert E. Lee und General Ulysses S. Grant als Gegner und strategische Befehlshaber vertiefen, den er für die Zeitschrift Civil War Journal schreiben musste … nicht gerade eine intellektuelle Herausforderung, aber das Honorar betrug immerhin 500 Dollar; und überdies gab der Artikel einen guten Eintrag in seiner Vita ab, wenn er nächstes Jahr sein Unkündbarkeitsgesuch einreichte. Er konnte heute lange aufbleiben, denn seine erste Vorlesung morgen war erst um elf Uhr.
»Daddy, Onkel Bob will dich sprechen.«
Jennifer kam aus ihrem Zimmer und hielt ihm das Handy entgegen. John nahm es und gab ihr einen schnellen Kuss auf den Kopf und einen spielerischen Klaps, als sie weglief. Sekunden später verdoppelte sich die Lautstärke der verdammten Stereoanlage in ihrem Zimmer.
»Ja, Bob?«
»John, ich muss auflegen.«
Bobs Stimme klang angespannt. Im Hintergrund glaubte John Stimmen zu hören, die aufgeregt schrien. Er war sich allerdings nicht sicher, da Jennifers Musik so laut war.
»In Ordnung, Bob. Kommst du nächsten Monat runter?«
»Hör zu, John, es ist etwas passiert. Es gibt ein Problem. Ich muss …«
Die Verbindung brach ab.
Im selben Augenblick hörte der Deckenventilator allmählich auf, sich zu drehen, und Jennifers Stereoanlage verstummte. In seinem Büro ging sein Computer aus, und auch das grüne Licht seines 19-Zoll-Monitors erlosch. Ein lautes Zirpen ertönte: das Signal dafür, dass die Alarm- und Feuermeldeanlagen des Hauses ausgefallen waren. Dann verstummte auch dieses Warnsignal.
»Bob?«
Nur Stille. John klappte das Handy zu.
Verdammt. Stromausfall.
»Daddy?« Das war Jennifer.
»Mein CD-Player ist ausgegangen.«
»Ja, Liebes.« Gott sei Dank, dachte er bei sich. »Stromausfall.«
Sie sah ihn etwas enttäuscht an, als sei er irgendwie dafür verantwortlich oder als bräuchte er nur mit den Fingern zu schnipsen, um ihren CD-Spieler wieder zum Leben zu erwecken. Dabei wäre er schwer versucht gewesen, den verdammten CD-Player für immer ins Jenseits zu befördern, wenn es in seiner Macht gestanden hätte.
»Und meine Geburtstagsfeier? Pat hat mir eine CD geschenkt und ich wollte sie anhören.«
»Keine Sorge, meine Süße. Ich rufe die Stromgesellschaft an. Wahrscheinlich hat ein Transformator den Geist aufgegeben.«
Er nahm das Festnetztelefon zur Hand … Stille. Kein Freizeichen.
Als das letzte Mal so etwas passiert war, hatte ein Betrunkener am Fuß des Hügels mit seinem Auto einen Telefonmasten umgefahren und dadurch den Strom gekappt. Natürlich war der Besoffene einfach unverletzt davongetorkelt.
Das Handy. John klappte es wieder auf und begann, Nummerntasten zu drücken … nichts.
Verdammt.
Das Handy war auch tot. Er legte es auf den Küchentisch.
Rätselhaft. Der Akku war anscheinend genau in dem Moment leer gewesen, als Bob aufgelegt hatte. Mist, und ohne Strom konnte John ihn nicht wieder aufladen, um die Stromgesellschaft anzurufen.
Er sah zu Jennifer hinüber, die ihn erwartungsvoll anstarrte, als würde er jetzt sofort alles wieder in Ordnung bringen.
»Kein Problem, Süße. Sie sind bestimmt schon dabei, den Schaden zu beheben, und außerdem ist es ein wunderschöner Tag; du musst dir diesen Müll sowieso nicht anhören. Warum kannst du nicht Mozart oder Debussy mögen, so wie Pat?«
Pat sah ihn unbehaglich an und ihm wurde bewusst, dass er soeben eine erzieherische Todsünde begangen hatte: Vergleiche niemals deine Tochter mit einer ihrer Freundinnen.
»Na los, geht nach draußen und jagt die Hunde herum. Bis zum Abendessen ist der Strom bestimmt wieder da.«
Kapitel Zwei
Tag 1, 18:00 Uhr
Während er die vier Hackfleischsteaks auf dem Grill umdrehte – zwei für sich und je eins für Jennifer und Pat –, sah John über seine Schulter den Mädchen zu, die auf dem Feld oberhalb des Hauses mit den Hunden Fangen spielten. Es war ein schöner Anblick: die Spätnachmittagssonne, die acht Apfelbäume in voller Blüte, die Mädchen, die über die ihnen entwischenden Hunde lachten. Ginger, der jüngere und verrücktere der beiden Golden Retriever, stieß Jennifer durch den Schwung ihres Sprunges zu Boden, als Jennifer versuchte, die Frisbee-Scheibe so hoch zu halten, dass die Hündin sie nicht erreichen konnte. Vergnügtes Kreischen erklang, als die zwei Hunde und die zwei Mädchen zu einem balgenden Knäuel verschmolzen.
Schon seit Monaten trug er keine Armbanduhr mehr; das Handy war nun seine Uhr. Er sah durch das Küchenfenster auf die Standuhr: Es war fast 18 Uhr. Die anderen Kinder hätten längst eintreffen müssen. Es war ausgemacht, dass sie nur für eine kurze Feier vorbeikommen würden, denn morgen war Schule, also würde die Party um 19:30 Uhr zu Ende sein. Bis jetzt war niemand gekommen. Außerdem hatte er Jen längst zurück erwartet.
Er zündete sich eine Zigarette an und rauchte sie schnell, denn eine Zwölfjährige konnte einem mit ihrer »Hör endlich auf zu rauchen, Daddy«-Kampagne erstaunlich auf die Nerven gehen. Rasch warf er die nur halb gerauchte Camel über das Terrassengeländer.
Die Hamburger waren fertig und er stellte sie auf dem Terrassentisch bereit, bevor er in die Küche ging, den Kühlschrank aufmachte, den Kuchen herausnahm und zwölf Kerzen daraufsteckte.
Zurück auf die Terrasse.
»Essen!«
Die Hunde reagierten schneller als die Mädchen. Sie rasten über das Feld zurück, umkreisten den Tisch und setzten sich in ihrer üblichen Bettelpose daneben. Pat und Jennifer kamen kurz nach ihnen zurück.
»He, Daddy, da ist was Eigenartiges.«
»Was denn?«
»Horch mal.«
Er lauschte einen Moment lang. Es war ein ruhiger Frühlingsabend; alles war still, bis auf das Zirpen einiger Vögel und das entfernte Bellen eines Hundes … ganz nett eigentlich.
»Ich höre nichts.«
»Genau das meine ich. Man hört keinen Verkehr von der Autobahn.«
Er wandte sich zur Straße um. Sie war zwar wegen der Bäume nicht zu sehen, aber seine Tochter hatte recht: Da war alles absolut still. Als er das Haus gekauft hatte, war dies die einzige Enttäuschung gewesen. Er hatte bei der Hausbesichtigung nicht daran gedacht, aber schon in der ersten Nacht war das ständige Grollen von der nur einen Kilometer entfernten Autobahn nicht zu überhören gewesen. Nur im Winter, während eines Schneesturms, oder nach einem Unfall war es so still.
»Die Straße muss wegen eines Unfalls gesperrt sein.«
Das war wegen der langen Serpentinensteigung von Old Fort hinauf keine Seltenheit. Alle ein bis zwei Monate versagten die Bremsen eines Lastwagens, der dann hinabrollte; oder ältere Leute in einem 14 Meter langen Wohnmobil verloren die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wenn sie über das kurvenreiche Gefälle von den Bergen nach Piemont hinunterfuhren. Einmal war die Straße wegen eines Unfalls mehr als einen Tag lang in beide Richtungen gesperrt gewesen, als ein Lastwagen umgekippt war und giftige Chemikalien ausgelaufen waren.
»Das haben wir zuerst auch gedacht, Mr. Matherson, aber es ist ganz komisch da unten. Es gibt keinen Stau, nur lauter liegen gebliebene Autos überall. Man kann es von oben auf dem Hügel sehen.«
»Was meinst du?«
»Genau so ist es, Daddy. Ein Haufen Autos, manche am Straßenrand, manche in der Mitte, aber kein Stau – als ob sie alle einfach angehalten hätten.«
Er hörte nur halb zu, während er die Hamburger auf Brötchen legte und sie den Mädchen servierte.
»Wahrscheinlich war der Unfall weiter weg und man hat den Leuten gesagt, sie sollen anhalten und warten.«
Die Mädchen nickten und fielen über ihre Hamburger her. Er aß seinen ersten schweigend und lauschte. Es war fast unheimlich. Man müsste doch irgendetwas hören – eine Polizeisirene, falls ein Unfall geschehen war. Außerdem müssten die Autos auf der alten Route 70 noch fahren. Normalerweise benutzten die Notfahrzeuge die alte Route 70, wenn die Autobahn gesperrt war, um zum Unfallort zu gelangen; und diese war dann erst recht verstopft, weil die Leute versuchten, die Autobahn zu umfahren. Auf jeden Fall dröhnten sonst um diese Zeit unfehlbar die verflixten Jefferson-Jungen, die oben auf dem Hügel wohnten, mit ihren verfluchten Geländewagen lärmend durch die Wälder.
Und dann blickte er auf und fröstelte plötzlich.
Um diese Zeit hätte der Himmel voller Kondensstreifen der hoch fliegenden Passagierflugzeuge sein müssen, denn über ihnen befand sich für die meisten Flüge, die aus dem Nordosten kamen, die Einflugschneise nach Atlanta. Normalerweise sah man zu jeder Tages- und Nachtzeit mindestens zwei bis drei Flugzeuge. Doch jetzt war der Himmel makellos blau, ohne auch nur die Spur eines Kondensstreifens.
Dieses Frösteln … es erinnerte ihn an den 11. September 2001. Wie ruhig es an dem Nachmittag gewesen war – alle Leute zu Hause vor dem Fernseher, und am Himmel kein einziges Flugzeug.
Er stand auf, ging an die Ecke des Geländers und hielt eine Hand schützend über die Augen, damit ihn die Spätnachmittagssonne nicht blendete. In Richtung Craggy Dome brannte es. Der Rauch stieg senkrecht auf und es sah aus, als brannten mindestens zweieinhalb Hektar. Ein weiterer Brand wütete viel weiter weg, auf dem entfernten Kamm der Smokies.
Im Dorf Black Mountain schien sich nichts zu rühren. Normalerweise konnte er, bevor das Laub im Sommer zu dicht wurde, die roten und grünen Lichter der Verkehrsampel an der Ecke State Street und Hauptstraße sehen. Sie war aus, nicht einmal das Warnblinklicht funktionierte.
Er sah wieder auf die Standuhr im Haus. Um diese Uhrzeit kam sonst der »Millionen-Dollar-Zug« vorbei. Er wurde so genannt, weil er Steinkohle im Wert von einer Million Dollar aus Kentucky zu den Kraftwerken bei Charlotte beförderte. Als die Mädchen noch klein waren, war es ein ständiges Ritual gewesen, zu den Gleisen hinunterzufahren und dem Lokführer zuzuwinken, während die fünf schweren Diesellokomotiven, donnernd vor Kraft, ihre Fracht im Kriechtempo zum Tunnel des Swannanoa Gaps zogen.
Die Stille wurde durch ein heiseres Grollen unterbrochen, als Jen in ihrem Monster-Edsel die Auffahrt hinauffuhr.
Sie parkte neben seinem Talon, stieg aus und kam auf ihn zu.
»Total verrückt«, sagte sie. »Der Strom im Pflegeheim ist ausgefallen. Und ihr solltet mal die Autobahn sehen. Die Autos stehen einfach still. Nichts bewegt sich.«
»Stromausfall im Pflegeheim? Was ist mit dem Notaggregat?«, fragte John. »Das müsste sich doch automatisch einschalten.«
»Tja, die Lichter im Heim sind ausgegangen. Und zwar alle.«
»Sie müssen aber einen Notgenerator haben, das ist eine gesetzliche Bestimmung«, sagte John.
»Er ist jedenfalls nicht angesprungen. Irgendjemand meinte, es sei vielleicht ein Relais kaputt und sie würden einen Elektriker rufen. Es ist trotzdem besorgniserregend. Sie mussten den Patienten, die auf Sauerstoffzufuhrgeräte angewiesen sind, stattdessen Sauerstoffflaschen geben, weil die Pumpen in allen Zimmern versagten. Tylers elektrische Nahrungspumpe versagte ebenfalls.«
»Geht es ihm gut?«
»Er war mit der Nahrungsaufnahme sowieso fast fertig, also war es nicht so schlimm. Das Personal sagte, das wäre schon in Ordnung. Dann ging ich auf den Parkplatz, und da war immer noch die ganze Tagschicht; alle Krankenschwestern und das Verwaltungspersonal, und alle drehten verzweifelt ihre Zündschlüssel in den Anlassern. Nichts sprang an … nur mein alter Freund, den du ›Monster‹ nennst, schnurrte ins Leben. Ich musste doch zu meinem kleinen Mädchen, und das Monster war zuverlässig wie immer.«
Sie nickte stolz zu ihrem Edsel hinüber.
»Können wir eine Spazierfahrt machen und alles ansehen, Oma?«, fragte Jennifer.
»Was ist mit deiner Party?«
»Sonst ist keiner gekommen«, sagte sie traurig.
Oma Jen bückte sich und küsste das Mädchen auf den Kopf.
»Du liebe Güte, Kind, du bist ja ganz dreckig.«
»Sie haben oben auf dem Feld gespielt.«
»Und dabei hast du deine Halskette getragen?«, rief Jen entsetzt.
John schnitt eine Grimasse. Eigentlich hätte er dafür sorgen müssen, dass Jennifer die Kette ablegte, bevor sie mit den Hunden herumtobte. Wäre die Kette kaputtgegangen oder hätte sie sie gar beim Balgen mit den Hunden verloren – es wäre eine Riesenkatastrophe gewesen.
»Möchtest du einen Hamburger, Jen?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich habe keinen Hunger.«
»Nimm zumindest ein Stück Kuchen.«
»Okay.«
Er ging zurück in die Küche, zündete die zwölf Kerzen auf der Torte an, natürlich eine Diabetikertorte ohne Zucker, und trug sie nach draußen, während er »Happy Birthday« sang. Pat und Jen stimmten ein.
Nun wurden die anderen Geschenke aufgemacht: Eine Geburtstagskarte von Bob und Barbara Scales mit einem Gutschein für Amazon im Wert von 100 Dollar; und auch die Beanie Babys, die John auf dem Tisch aufgestellt hatte, kamen zu Ehren. Jennifer nahm den Patriotenbären unter den Arm und öffnete das immense Kuvert – halb so groß wie sie selbst –, das John in der vergangenen Nacht gebastelt hatte. Es enthielt eine Kollage aus Fotos von Disney World und eine gemalte Eintrittskarte. »Ticket für Jennifer, Daddy – ach ja, und auch für Elizabeth« stand in der Mitte.
Das kam in der Tat gut an und jetzt war es an ihm zu sagen: »He, drück nicht so fest, du brichst mir ja das Genick!«
Schließlich ging die kleine Feier zu Ende. Es war nach sieben und Pat machte sich auf den Weg ins Tal. Jennifer und die Hunde begleiteten sie nach Hause.
»Ich schätze, heute Abend fällt das Tafelrundentreffen aus«, sagte John und spähte zum Städtchen hinüber. Jen half ihm, die Geschirrspülmaschine zu beladen, obwohl sie beide wussten, dass sie sie nicht einschalten konnten.
»Was, glaubst du, ist da los?«, fragte Jen, und er konnte eine Spur Nervosität in ihrer Stimme heraushören.
»Wie meinst du das?«
»John, es erinnert mich irgendwie an den 11. September. Diese Stille. Aber damals hatten wir Strom; wir konnten die Nachrichten sehen. Die vielen Autos im Stau …«
John erwiderte nichts. Er hatte einen Verdacht, aber der war im Moment zu beunruhigend, um näher darauf einzugehen. Er wollte glauben, dass es nur eine skurrile Kombination von Zufällen war; ein Stromausfall, der vielleicht nur ortsgebunden war. Genug, um die meisten Flüge wegen fehlender Radarkontrolle zu stornieren. Vielleicht hatte es heftige Sonnenaktivitäten gegeben, stark genug, um einen weitflächigen Kurzschluss zu verursachen. So etwas war ja vor einigen Jahren in Kanada geschehen.
Ihm kam ein Gedanke.
»Lass uns dein Monster anwerfen.«
»Warum?«
»Das wirst du schon sehen.«
Sie gingen zum Auto und John setzte sich auf den Beifahrersitz. Jen drehte den Zündschlüssel, der Motor sprang sofort an. Schon nach den wenigen Stunden der Stille war das Geräusch ermutigend.
Er schaltete das Radio ein. Es war ebenfalls ein altes Modell und hatte Drehregler statt Knöpfen zum Drücken. Das leicht vergilbte Sichtfenster zeigte sogar die zwei kleinen Dreiecke, die die Einstellung der alten Zivilschutzfrequenz markierten.
Störgeräusche, nichts als Störgeräusche, von einem Ende der Skala zum anderen. Die Abenddämmerung brach allmählich herein – die Zeit, in der die meisten Mittelwellen-Sender sich verabschiedeten; aber die großen Sender, die genügend Geld für die erhöhten Lizenzgebühren der FCC hatten, müssten jetzt eigentlich auf 50.000 Watt schalten. Das war die Intensität des Signals, das bei stabilen atmosphärischen Verhältnissen mindestens die Hälfte des nationalen Sendegebiets erreichte.
Er erinnerte sich, wie er damals als Teenager in seinem 1969er VW Käfer die lange Fahrt von New Jersey nach Durham in North Carolina zur Duke Universität gemacht hatte. Er hatte die Zeit totgeschlagen, indem er an den Radiodrehreglern spielte, und in Chicago war er auf WGN gestoßen, jenen seltsamen »Country and Western«-Sender aus Wheeling in Indiana, dessen Klagelieder über Frauen und Kleinlaster ihm so fremdartig erschienen waren. Und die ganze Nacht hindurch hatte er, wenn die atmosphärischen Bedingungen günstig waren, WOR aus New York empfangen können, und mitten in der Nacht sogar seine Lieblingssendung mit Jean Shepherd.
Jetzt gab es nur Stille.
»Du siehst besorgt aus, Colonel.«
Er sah sie an, überrascht von dem Ton, in dem sie »Colonel« gesagt hatte.
»Bestimmt ist es nichts Ernstes. Nur besonders starke Sonnenaktivität, weiter nichts.«
Das schien sie zu erschrecken und sie sah zum westlichen Horizont hinüber, wo die Sonne nun tief über den Gipfeln der Smokies hing.
»Sie explodiert doch nicht etwa, oder?«
Er lachte.
»Meine liebe Schwiegermutter, wenn sie explodiert wäre, würden wir sie dann immer noch sehen?«
Etwas verlegen schüttelte sie den Kopf.
»Ein mächtiger Sturm auf der Sonnenoberfläche erzeugt starke, gebündelte Stöße unterschiedlich starker Radioaktivität. Treffen sie auf die Atmosphäre, werden zum Beispiel die Nordlichter ausgelöst.«
»Die habe ich noch nie gesehen.«
»Weil du keine Yankee bist. Manchmal ist ein Sonnensturm so intensiv, dass er elektrische Ladungen in die Erdatmosphäre entlädt, die dann Kurzschlüsse in elektronischen Geräten verursachen.«
»Aber die Autos?«