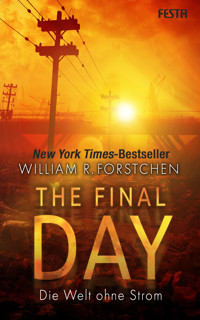4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die spektakuläre Fortsetzung des US-Bestsellers Ein Jahr nach den turbulenten Ereignissen von ONE SECOND AFTER: Ein EMP-Angriff hat sämtliche elektronischen Geräte unbrauchbar gemacht. Der Geschichtsprofessor und Ex-Colonel John Matherson treibt in einer friedlichen Kleinstadt in North Carolina den Neuaufbau mit primitiven Mitteln voran. Die Ankunft eines Regierungsvertreters weckt die Hoffnung, dass eine starke Hand landesweit geordnete Verhältnisse schafft. Stattdessen werden junge Männer und Frauen mit übertriebener Härte für eine ominöse ›Armee des Nationalen Wiederaufbaus‹ abgezogen. Diese Truppen sollen in weit entfernte Unruhegebiete geschickt werden. Matherson wird klar, dass mit dieser aufkeimenden Regierung nicht alles so ist, wie es sein sollte und dass er etwas unternehmen muss … Die fiktive Geschichte einer überaus realen Bedrohung Stephen Coonts: »Forstchen ist der Prophet eines neuen dunklen Zeitalters. Kluge Köpfe würden ihm zuhören.« Kirkus Review: »Ein aufwühlender, unterhaltsamer Roman über ein Amerika, das aus den Fugen gerät.« David Hagberg: »Die Figuren wirken so echt, dass ich schon nach den ersten Seiten das Gefühl hatte, sie seit Ewigkeiten zu kennen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Alexander Amberg
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe One Year After
erschien 2015 im Verlag Forge Books.
Copyright © 2015 William R. Forstchen
Copyright © dieser Ausgabe 2019 by Festa Verlag, Leipzig
Literarische Agentur: Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Lektorat: Alexander Rösch
Titelbild: Arndt Drechsler
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-764-6
www.Festa-Verlag.de
www.Festa-Action.de
Für den Kongressabgeordneten Roscoe Bartlett
und Dr. Richard Pry,
die als Erste vor einem EMP-Angriff warnten.
Und für den echten ›Franklin-Clan‹,
der sich in meinem Leben als wahrer Segen erwies.
VORWORT UND DANKSAGUNGEN
Als Anfang 2009 One Second After erschien, hätte ich nie damit gerechnet, was damit in Gang gesetzt wird. Tatsächlich beschäftigte mich der Gedanke an ein Buch über die Bedrohung durch einen EMP-Angriff schon 2004. Damals veröffentlichte ein Kongressausschuss unter dem Vorsitz von Roscoe Bartlett einen Bericht über elektromagnetische Impulse, der eigentlich jeden hätte wachrütteln müssen. Einen Bericht, den die Medien und somit auch die breite Bevölkerung ignorierten.
Bartlett, ein bemerkenswerter, brillanter Gentleman, beklagte sich in einem Gespräch mit mir, das Hauptproblem bestehe darin, dass das Thema eines katastrophalen Erstschlags gegen den US-amerikanischen Kontinent mithilfe eines elektromagnetischen Impulses, ausgeführt von Ländern wie dem Iran, Nordkorea oder einer von diesen unterstützten terroristischen Gruppierungen, zu sehr nach Science-Fiction klinge und daher in der Öffentlichkeit kaum Gehör finde. Deshalb gebe es keine Stimmen, die sich für eine härtere Gangart in der Außenpolitik und eine bessere Katastrophenvorsorge einsetzten. Bartlett und auch andere traten an mich heran und fragten, ob ich nicht einen auf Fakten basierenden Roman schreiben könne, um die Öffentlichkeit für eine derartige Gefahr zu sensibilisieren.
Es sollte ein Jahr dauern, bis die Idee überhaupt Konturen annahm. Eine ganze Weile kreisten meine Gedanken um das klassische – bitte nicht übel nehmen, Herr Kollege – Clancy-Schema eines Helden, der auf eine Hetzjagd geschickt wird, um die drohende Katastrophe abzuwenden. Am Ende lieferten mir die Studenten an meinem College sowie meine Tochter die Inspiration.
Ich habe das Glück, am Montreat College zu unterrichten (ja, diese Lehranstalt gibt es wirklich). Bei nur 500 Studierenden schließt man als Professor im Verlauf von vier Jahren seine Studenten ins Herz. Der Tag der Abschlussfeier ist daher ein ganz besonderer Moment, der einen mit Stolz, aber auch Wehmut erfüllt. Immerhin verlassen die Kids, die für einen beinahe zu eigenen Kindern geworden sind, das College.
Es war bei einer solchen Abschlussfeier, jemand hielt eine langatmige Rede … da glitt mein Blick über meine Schützlinge, wie sie höflich dem Redner lauschten, aber offenkundig mit den Gedanken ganz woanders waren. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen – was wäre mit ihnen, würde Amerika in diesem Augenblick von einem EMP-Schlag getroffen? Was würde aus meinem College, meiner geliebten Kleinstadt Black Mountain, aus meiner Tochter, aus uns allen? Zwei Stunden später saß ich an der Tastatur und fing an, die Geschichte zu schreiben, die sich zu One Second After entwickelte.
Erst 2009 wurde das Buch veröffentlicht. Es ist schon beinahe amüsant, dass es von einer Reihe größerer Verlage abgelehnt wurde, sehr zur Freude meines Verlegers und Lektors, der es in sein Programm aufnahm, um zu erleben, wie es sich zu einem New York Times-Bestseller entwickelte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte ich nicht die geringste Ahnung, was alles noch kommen sollte. Tatsächlich besuchte ich mit meinem guten Freund Captain Bill Sanders, der das Nachwort aus Expertensicht verfasst hat, gerade eine Tagung zum Thema EMP drüben in Albuquerque, als mein Agent anrief, um mir mitzuteilen, wir seien auf der Bestsellerliste gelandet. Ich war völlig von den Socken, eine bessere Formulierung fällt mir nicht ein.
Das ganze Ausmaß begriff ich erst Monate später. Zum Zeitpunkt, als ich das Buch schrieb, war mir nicht mal bewusst, dass es eine wachsende Bewegung von Menschen gibt, die sich ›Prepper‹ nennen. In einem Ort in der Nähe hatte ein Ehepaar ein Geschäft eröffnet – Carolina Readiness Supply. Die beiden baten mich, bei einem von ihnen organisierten Treffen einen Vortrag zu halten. »Mit wie vielen Leuten rechnen Sie denn?«, fragte ich, und sie meinten: »So an die 100.« Als ich an besagtem Tag eintraf, stand dieses wunderbare Paar auf einem proppenvollen Parkplatz, um mich zu empfangen. Ich fand mich unversehens vor einem Publikum von über 500 Leuten, manche waren eigens aus Atlanta und Charlotte angereist. Ja, das entwickelte sich eindeutig zu einer großen Sache.
Ähnlich verhielt es sich auch in den Jahren danach. Manch einer bezeichnet mich als Triebfeder für die Entstehung der Prepper-Bewegung, doch da bitte ich, genauer zu differenzieren. Womöglich leistete mein Buch einen Beitrag dazu, die Bewegung selbst war längst im Entstehen begriffen. Zig Millionen Menschen dachten wieder wie Amerikaner, nämlich dass es am klügsten ist, sich vor dem Eintreten einer Katastrophe auf ein autarkes Leben vorzubereiten.
All jenen, denen das Konzept des ›Prepping‹ neu ist, muss ich mit Nachdruck versichern: Geben Sie nichts darauf, wie Mainstream-Medien solche Leute in absurden Reportagen oftmals darstellen. Ich konnte feststellen, dass Prepper fast ausnahmslos anständige, rechtschaffene Leute sind, die eben nicht ausschließlich an sich selbst, sondern auch an ihre Nachbarn, ihre Gemeinde, an ihr ganzes Land denken. Sollte es je zum Äußersten kommen, beten Sie darum, dass Ihre Nachbarn Prepper sind. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Tausende von Preppern, denen ich begegnet bin. Alles, was ich sagen kann, ist: Vielen Dank für eure Freundschaft.
Wenn dieses Buch in Druck geht, liegt das Erscheinen von One Second After schon über sechs Jahre zurück. Vieles hat sich geändert, aber es ist frustrierend zu erleben, dass auch vieles beim Alten geblieben ist. Ich hatte gehofft, die Regierung würde etwas zum besseren Schutz unseres Stromnetzes unternehmen, und zwar auf Bundesebene. Ich war davon ausgegangen, sie würde Pläne entwickeln, und zwar nicht nur zur Abwehr, sondern auch für den Katastrophenschutz, und ich hatte auf eine härtere Gangart in der Außenpolitik spekuliert, die unmissverständlich verdeutlicht, dass wir es NIEMALS tolerieren werden, sollten Schurkenstaaten sich eine Waffe aneignen, die einen EMP erzeugen könnte.
Nichts von alledem ist eingetreten. Der Historiker in mir muss unweigerlich an die 30er-Jahre denken. Wir sahen tatenlos zu, wie die Bedrohungen anwuchsen, bis sie schließlich am 7. Dezember 1941 mit einem Paukenschlag unseren Staat und unser gesamtes Leben erschütterten. Wir befinden uns erneut im Tiefschlaf, während Nordkorea Atomwaffen und ballistische Raketen testet, der Iran hinkt nicht weit hinterher, und mit dem IS erhebt sich eine Gruppierung, die in Brutalität und Irrsinn dem Nationalsozialismus in nichts nachsteht.
Ich hatte nie im Sinn, One Second After eine Fortsetzung folgen zu lassen. Aber wann immer ich einen Vortrag hielt, stellte man mir die Frage: Was passiert als Nächstes? Fünf Jahre lang blieb ich standhaft. Dabei hatten mein Verleger Tom Doherty und der zuständige Lektor Bob Gleason längst mit dem Zaunpfahl gewinkt, dass sie mehr wollten. In diesen Jahren lieferte ich ihnen ein Buch, das ich wirklich sehr gern geschrieben habe und das zur Abwechslung eine positive Vision unserer Zukunft im Weltraum bietet (im Festa-Verlag unter dem deutschen Titel DER STERNENTURM erschienen, Anm. des Übersetzers), außerdem ein paar Bücher über den Bürgerkrieg und die amerikanische Revolution, gemeinsam mit meinem guten Freund Newt Gingrich, und schließlich ein im Eigenverlag erschienenes Buch über die Bedrohung durch den IS (TAG DES ZORNS).
Zu guter Letzt konnte ich nicht länger Nein sagen und beschloss, den Erzählfaden um John Matherson, seine Familie, seine kleine Stadt und sein College wiederaufzunehmen. So entstanden dieses Buch und ein drittes, das einige Monate nach dieser Veröffentlichung folgen soll, um die Handlung abzurunden.
Eigentlich sollte dies hier ja Vorwort und Danksagung zugleich sein, also wird es Zeit, dass ich zu Letzterem komme. Ich fühle mich gerade wie jemand, den man bei einer Preisverleihung ermahnt, seine Rede auf eine Minute oder weniger zu beschränken, dessen Liste aber locker für zehn Minuten reicht. Na, dann mal los:
Mein besonderer Dank gilt Newt Gingrich, Roscoe Bartlett und anderen, die sich seit Jahrzehnten politisch in dieser Angelegenheit starkmachen. Würden in einer Zeit so erbitterter parteipolitischer Grabenkämpfe beide Lager, beide Kammern des Parlaments sowie die Regierung doch nur erkennen, dass es sich hier um eine Bedrohung handelt, der das ganze Land ausgesetzt ist. Stellen wir uns dieser Bedrohung nicht, wird es darauf hinauslaufen, dass wir eines Tages eine Exilregierung haben, die, weit entfernt von den Ruinen Washingtons, in einem unterirdischen Bunker sitzt und sich abmüht, alles wieder aufzubauen, und dabei womöglich versagt. Wer vermag schon die Scherben zusammenzusetzen, wenn etwas endgültig zu Bruch gegangen ist?
Wie stets danke ich Tom Doherty, Bob Gleason und dem großartigen Team von Tor/Forge. Als ich vor 30 Jahren als angehender Schriftsteller Tom Doherty zum ersten Mal begegnet bin, hoffte ich, eines Tages zu seinem ›Team‹ zu gehören. Seitdem haben wir gemeinsam an einem halben Dutzend Büchern gearbeitet, und es gibt niemanden in dieser Branche, den ich mehr schätze. Was das Geschäftliche angeht, bin ich meiner Agentin Eleanor Wood unendlich dankbar; meinem Filmagenten Josh Morris; dem Publicity Team von ASCOT Media und meiner dortigen Ansprechpartnerin Monica Foster, mit der ich nahezu täglich in Kontakt stehe. Eine Buchveröffentlichung ist nun mal das Ergebnis von Teamarbeit.
Als ich dem Präsidenten meines Colleges Dan Struble, den ersten Entwurf meines Buchs vorlegte, fragte er mich, warum ich nicht einfach Ross und Reiter nenne, statt mir für meine Stadt und das College fiktive Namen auszudenken. Vielen Dank für diesen Vorschlag, Dan. Dies verleiht den Büchern eine Authentizität, die ihnen andernfalls fehlen würde. Ich habe das Glück, in Black Mountain, North Carolina, zu wohnen (ja, den Ort gibt es wirklich, ebenso wie das Montreat College). Die Erlaubnis, Klarnamen zu verwenden, half mir beim Schreiben und anscheinend auch so manchem Leser, eine persönliche Bindung zur Geschichte zu entwickeln. Die meisten Namen in den Büchern sind frei erfunden, manche jedoch sind echt, und diese ›realen‹ Charaktere schildere ich so, wie ich sie als Freund wahrnehme. Ich hoffe, sie haben Spaß daran und nehmen es mir nicht übel.
Und zuletzt eine sehr persönliche Danksagung: Vor ein paar Jahren hielt ich einen Vortrag bei einem Prepper-Treffen, anschließend signierte ich meine Bücher. Robin Shoemaker trat vor an den Tisch, unsere Blicke begegneten sich … und, na ja … so was passiert nur einmal im Leben. Ich glaube, es entspricht dem, was Mario Puzo in Der Pate als ›sizilianischen Blitzschlag‹ bezeichnet. Der höchste Lohn dafür, ein Buch zu schreiben.
Es wird Zeit, mit den Danksagungen zum Ende zu kommen und mit der eigentlichen Erzählung fortzufahren. Vielleicht geht es Ihnen ja wie mir, dann lesen Sie die Danksagungen sowieso nicht. Üblicherweise ist es ja bloß die Auflistung einer Menge Namen, mit denen man nichts anzufangen weiß. Außerdem sind Danksagungen ganz bestimmt nicht der Grund, dass man das Buch gekauft hat! Aber da mein Verleger Papier und Tinte bezahlt, zumindest für die traditionelle Druckfassung, sehe ich mich doch zu einem abschließenden Gedanken genötigt: Bei diesen Büchern handelt es sich zwar um Fiktion, das Szenario jedoch basiert auf der Realität. Es könnte sehr real werden.
Unsere Eltern und Großeltern, die noch der ›Greatest Generation‹ angehörten, der Generation, die im Zweiten Weltkrieg am Ende das Richtige tat, ließen ihre politische Führung einfach gewähren, als diese vor den wachsenden Bedrohungen auf der Welt die Augen verschloss. Es hieß: »Das betrifft uns hier doch gar nicht«, und dafür wurde ein furchtbarer Preis bezahlt. Die Geschichte kennt Hunderte solcher Beispiele. Lesen wir dieses Buch als Roman oder als Warnung? Falls es eine Warnung ist, wie reagieren wir darauf? Handeln wir oder ziehen wir uns auf den Standpunkt zurück »Es wird schon jemand dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt«? Ich hoffe, dass diese Bücher in 30 Jahren vergessen sind, als düstere Mahnung abgetan werden, die niemals Wirklichkeit wurde. Falls ja, werde ich mich für meine Tochter und meine Enkelkinder freuen und erleichtert sein. Ich hoffe, dass niemand eines Tages zu mir sagen wird: »Bill, du hattest recht.«
Aber dies, meine Freunde, liegt zweifelsohne an euch. Wir haben es in der Hand, wie Abraham Lincoln einst sagte, »unsere letzte, beste Hoffnung auf Erden durch Großmut zu bewahren – oder durch Kleinmut zu verlieren«.
William R. Forstchen
Black Mountain, North Carolina
September 2015
PROLOG
Hier ist BBC News. Es ist drei Uhr morgens, Greenwich War Time, und hier sind die aktuellen Meldungen.
Heute begehen wir den zweiten Jahrestag des Kriegsausbruchs, bei dem drei EMP-Waffen über dem US-amerikanischen Festland gezündet wurden, eine weitere vor der Küste Japans sowie eine fünfte, von der man annimmt, dass sie vom ursprünglichen Kurs abgekommen und über Osteuropa detoniert ist.
Die Auswirkungen dieses Angriffs – mutmaßlich von aus dem Iran unterstützten Terroristen und Nordkorea verübt, auch wenn dies nie abschließend bestätigt wurde – sind nach wie vor weltweit zu spüren. Schätzungen zufolge verloren dabei über 80 Prozent aller Amerikaner ihr Leben, dazu mehr als die Hälfte der Bevölkerung Japans, Osteuropas, des früheren Westrusslands sowie der Ukraine. Im Nachgang des Angriffs wird China als neue Supermacht betrachtet, eine große Zahl chinesischer Streitkräfte, deren Mission als humanitär bezeichnet wird, hält die Westküste der Vereinigten Staaten sowie Japan besetzt. Zwar blieben Westeuropa und unserVereinigtes Königreich von den direkten Folgen des Anschlags verschont, dennoch leiden sie nach wie vor unter den enormen wirtschaftlichen Auswirkungen, während die Welt bemüht ist, zu einem ökonomischen und politischen Gleichgewicht zu finden. In Südasien dauern die schweren, von einem örtlich begrenzten Nuklearkrieg zwischen Pakistan und Indien ausgelösten Kampfhandlungen an.
Den zweiten Jahrestag dessen, was die meisten mittlerweile als ›Tag eins‹ bezeichnen, beging der König mit einem Gedenkgottesdienst in Westminster Abbey. Im Anschluss an den Gottesdienst erneuerte der Premierminister sein Versprechen, unseren europäischen Nachbarn in ihren Bemühungen um den Wiederaufbau beizustehen und auch den Vereinigten Staaten weiterhin Hilfe zu leisten.
Im weiteren Programm erfahren Sie mehr über den Gedenkgottesdienst und die andauernden Auswirkungen von Tag eins, doch zunächst eine Meldung der Interimsregierung der Vereinigten Staaten aus dem Parlamentsgebäude in Bluemont, Virginia: Die vor zwei Wochen von der Administration angekündigte Mobilisierung einer Million Männer und Frauen für die amerikanische Army of National Recovery, kurz ANR, die den Wiederaufbau federführend vorantreiben soll, ist in vollem Gang. In einem seit dem Zweiten Weltkrieg beispiellosen Schritt wurden Einberufungsbescheide versandt. Der überwiegende Teil der am Tag des Angriffs in Übersee stationierten amerikanischen Streitkräfte wird nun an die westliche und südliche Landesgrenze verlegt, um ein weiteres Vordringen ausländischer Mächte einzudämmen.
Aus diesem Grund bekräftigte die Regierung heute noch einmal: Der Zweck dieser Army of National Recovery besteht darin, in jenen Regionen der Vereinigten Staaten, in denen noch immer Gesetzlosigkeit herrscht, für Sicherheit zu sorgen, die innere Ordnung wiederherzustellen, Hilfe beim Wiederaufbau zu leisten und – sofern notwendig – die militärische Präsenz entlang der, wie es heißt, umstrittenen Grenzen zu verstärken.
Unsere Expertenrunde wird im Anschluss die Auswirkungen der Aufstellung dieser neuen militärischen Streitmacht in den Vereinigten Staaten analysieren.
Und hier noch eine Nachricht an unsere Freunde in Montreal: ›Der Stuhl lehnt an der Tür.‹ Ich wiederhole: ›Der Stuhl lehnt an der Tür.‹
Damit zu weiteren Nachrichten aus aller Welt …
KAPITEL EINS
Tag 730
»Daddy, ich habe einen Einberufungsbescheid bekommen.«
John Matherson, der im Leben schon einiges mitgemacht hatte, seufzte. Müde lehnte er sich im Bürosessel zurück und blickte zu seiner Tochter Elizabeth auf. Elizabeths Augen zeugten von einer Reife, die man bei einer 18-Jährigen nicht vermutet hätte, wie bei so vielen ihres Jahrgangs. Als kleiner Junge hatte John gern Bildbände über den Zweiten Weltkrieg durchgeblättert. Schwer zu glauben, dass die »alten Männer« auf den Fotos in Wirklichkeit erst 18 oder 19 waren … An ihren Augen – dem gehetzten, in die Ferne gerichteten Blick – erkannte man, was sie durchgemacht hatten. Keine Kinder mehr, die in die High School gehörten oder als Erstsemester an die Uni … sie waren um Jahre gealtert, oft innerhalb weniger Tage, oder, wie ein Autor es umschrieb: »Der Krieg hatte sie für alle Zeiten um ihre kostbare Jugend gebracht.«
»Setz dich, Kleines.« Seufzend deutete er auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch im Rathaus von Black Mountain, North Carolina, in den Vereinigten Staaten von Amerika – zumindest hoffte er, dass es Letztere noch gab. Auf dem Tisch stapelte sich der ganze Papierkram, um den er sich als Stadtdirektor kümmern musste, alles handschriftlich verfasst beziehungsweise auf einer alten Underwood-Schreibmaschine getippt.
In den schrecklichen Monaten, die auf Tag eins folgten, hatte er im Rahmen der Notstandsgesetze zuletzt eine fast diktatorische Stellung eingenommen. Als im Verlauf des vergangenen Jahres endlich wieder so etwas wie Stabilität einkehrte, hatte er diese Macht bereitwillig wieder in die Hände des Stadtrats gelegt. Mochten Stromversorgung und nationale Infrastruktur auch zerstört sein, eines blieb offenbar bestehen: der Papierkram. Und als Stadtdirektor blieb der größtenteils an ihm hängen. Oft wanderte sein Blick sehnsüchtig zum unbrauchbaren Computer in der Ecke – einem Relikt aus längst vergangener Zeit, das nun nur noch Staub ansetzte, ähnlich wie zuvor die Underwood-Schreibmaschine, die halb vergessen die Jahre in einem Schrank überdauert hatte, bevor das ganze Leben von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt wurde.
Die auf Sauberkeit und Hygiene fixierte Welt von früher, in der man täglich duschte, an heißen Sommertagen auch zweimal, die Welt der gestärkten weißen Hemden mit sauberem Kragen und guten, zum Anzug passenden Schuhen anstelle ausgelatschter Boots gehörte der Vergangenheit an. Jetzt gab es einmal die Woche samstagabends ein Bad im Spülbecken in der Küche, dazu zur Vorbereitung auf den sonntäglichen Kirchgang eine nicht ganz unblutige Rasur mit einem Rasiermesser, das er in einem Antiquitätenladen ergattert hatte. Kleidung wurde von Hand im Bach gewaschen, der hinter dem Haus hinabrieselte. Seine kompletten Hemdkragen fransten allmählich aus und hatten permanent speckige Schweißränder.
Das Ärgerliche an Johns schöner neuer Welt bestand darin, dass alles schmuddelig und lädiert wirkte. Als Historiker hatte er sich früher immer gefragt, wie das Leben vor 150 Jahren wohl ausgesehen, wie es gerochen und sich angefühlt hatte. Jetzt lebte er selber unter solchen Bedingungen. Drängten sich an einem warmen Frühlingsabend die Menschen bei einer Versammlung in einem überfüllten Saal, umgab sie ein unverkennbarer Mief. Leute, die früher in Anzug und Krawatte oder in fein säuberlich gebügelter Kleidung herumliefen, tauchten nun in abgetragenen Jeans und zerknitterten, verblichenen Hemden auf.
Sonntag war der Tag der Woche, an dem man versuchte, sich herauszuputzen; allerdings waren den meisten ihre Anzüge beziehungsweise Kleider mehrere Nummern zu groß, es sei denn, jemand im Haushalt konnte mit so altmodischen Utensilien wie Nadel und Faden umgehen. Bei ihrem Aussehen fühlte er sich an die Daguerreotypien einer vergangenen Epoche erinnert. Auf diesen alten Fotografien sah man selten jemanden mit Übergewicht. Die meisten Abgelichteten wirkten eher hager und sehnig. Schaute man genauer hin, wirkte ihr Aufzug – außer bei Wohlhabenden – ungeheuer schäbig.
Seinem Büro im Rathaus haftete die gleiche heruntergekommene Atmosphäre an. Vorbei waren Zeiten, in denen ständig frisch gebohnert wurde und es nach Desinfektionsmittel roch, bei Tag und Nacht alles in hellem Neonlicht erstrahlte, der Kaffeeautomat Ein-Dollar-Noten akzeptierte, im Sommer die Klimaanlage und im Winter die Heizung lief. Seit Tag eins alles Schnee von gestern.
Mit einem halbwegs sauberen College-T-Shirt, Jeans und einer roten Schleife im dunklen, fast schwarzen Pferdeschwanz bemühte Elizabeth sich, wenigstens einen Anschein von Frische zu bewahren. Sie war schlank und drahtig, der in diesen Tagen charakteristische Körperbau, trug den Gürtel eng um die schmalen Hüften geschnallt. Das bisschen Volumen, das sie vor einem Jahr in der Schwangerschaft mit Ben zugelegt hatte, war längst verschwunden.
Sie legte ein zerknittertes Blatt Papier auf den Schreibtisch und schob es zu ihm. Er faltete den Zettel auseinander und strich ihn glatt, während er sich mit der Hand ruhig übers Kinn fuhr.
Wie alle anderen hatte auch er Gerüchte vernommen, dass eine ferne Zentralregierung, die sich aus Washington, D. C. in Sicherheit gebracht hatte, um sich in einer alten, noch aus dem Kalten Krieg stammenden Bunkeranlage in Nord-Virginia anzusiedeln, und sonst kaum etwas von sich hören ließ, Einberufungsbescheide verschickte. Mit diesem Dokument, das seine einzige verbliebene Tochter ihm hinlegte, wurden die diffusen Gerüchte Wirklichkeit.
Erneut sah er zu ihr auf. Sie war 18, hatte Krieg und Hunger erlebt und hatte bereits ein Kind, dessen Vater im Kampf gegen die angreifende Posse gefallen war, die ihre Stadt vor anderthalb Jahren überfallen hatte. In mancherlei Hinsicht glich sie den Veteranen auf den alten Aufnahmen aus der Normandie oder Iwo Jima, viel zu früh erwachsen geworden, um ihre Jugend gebracht. Aber dies hier war seine Tochter, sein Kind. Er sah sie als Neugeborenes vor sich – sie hatte die Augen ihrer vor langer Zeit verstorbenen Mutter –, sah, wie ihr die Tränen kamen, wenn sie Trost bei ihm suchte, weil sie sich das Knie aufgeschürft hatte, sah die strahlenden Augen einer lachenden Zwölfjährigen, den vielsagenden Blick der 16-Jährigen, die genau wusste, wie sie Daddy mit einem einzigen Lächeln um den Finger wickeln konnte. Wie alle Eltern, denen die Regierung eröffnete, ihr Nachwuchs sei nun alt genug zum Kämpfen und Sterben, empfand er nichts als Angst. Sie wollten ihm sein Kind wegnehmen, wahrscheinlich kehrte sie niemals zurück.
Er starrte auf den Bogen, während er seiner Tochter mit einer Handbewegung erneut zu verstehen gab, dass sie sich setzen solle.
Als sie sich auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch niederließ, machte sie etwas, das sie als Erwachsene noch nie getan hatte. Sie griff nach seiner Hand, während er den Brief las.
›Sehr geehrter Mitbürger, sehr geehrte Mitbürgerin! Auf Anordnung der Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika …‹
Der Präsidentin?
Die Präsidentin der Vereinigten Staaten. Manchmal dachte John noch an den Mann, der das Amt damals, an Tag eins, bekleidet hatte. Es hieß, das Weiße Haus habe vor dem Angriff eine Warnung erhalten und man habe den Präsidenten in letzter Minute an Bord der Air Force One aus Washington ausgeflogen … erstaunlicherweise war die Maschine nicht ausreichend gegen einen heftigen EMP-Schlag geschützt gewesen und irgendwo über West Virginia abgestürzt.
Die jetzige Präsidentin? Tatsächlich kursierten widersprüchliche Informationen. Ein Junior-Senator aus dem Westen behauptete, er sei der legitime Nachfolger, die meisten hingegen, insbesondere Überlebende aus dem Osten, verwiesen auf eine weibliche Hinterbänklerin des Kabinetts aus Bluemont, Virginia.
Es handelte sich um ein Standardschreiben, ähnlich den Einberufungsbescheiden bei früheren Konflikten, das mit der nachdrücklichen Aufforderung schloss, sich innerhalb von drei Tagen im zentralen Gerichtsgebäude von Buncombe County bei der Dienststelle des Bundesbeauftragten zu melden, um in die Army of National Recovery einzutreten. Andernfalls sei mit der vollen Härte des Gesetzes zu rechnen.
Er las das Schreiben zu Ende, überflog es rasch erneut. Nachdem er eine Nacht lang Wachdienst geschoben hatte, war er müde und rieb sich die Augen, während er Elizabeth anblickte, die ihm gegenübersaß. Sie hatte keine Tränen im Gesicht, reagierte nicht hysterisch, ließ sich im Prinzip gar keine Regung anmerken.
Der Bundesbeauftragte in Asheville. Das musste dieser neue Beamte sein, Dale Fredericks, der vor ungefähr einem Monat im Verwaltungssitz von Buncombe County aufgetaucht war, um das komplette reguläre Army-Bataillon abzulösen, das sich über den vergangenen Winter dort einquartiert hatte, dann jedoch abgezogen und nach Texas beordert wurde.
Für John hatte sich die Einheit der Armee als wertvolle Unterstützung bei seinen Bemühungen erwiesen, die Region neu zu organisieren, indem sie mithilfe von Funkausrüstung, die von Auslandseinsätzen zurückgebracht worden war, neue Kommunikationskanäle erschlossen. Die Techniker der U. S. Army unterstützten hiesige Amateurfunker sogar dabei, ihre Geräte wieder funktionsfähig zu machen und ein primitives Funknetz aufzubauen. Außerdem trugen die Soldaten dazu bei, die Plündererbanden zumindest vorübergehend in Schach zu halten, die allgemein als Reivers bekannt waren – eine historische Bezeichnung für Gesetzlose aus Irland und Schottland.
Nach dem Abzug der Armee wurden als Ersatz per Hubschrauber Verwaltungsleute aus Charleston in South Carolina eingeflogen. Per Kurier erhielt John eine schriftliche Mitteilung aus Asheville, die ihr Eintreffen ankündigte, ebenso wurde er informiert, dass man ihn in naher Zukunft gemeinsam mit weiteren kommunalen Entscheidungsträgern kontaktieren und zu einem Meeting einladen werde, um die Neustrukturierung der Kommunen im westlichen North Carolina zu erörtern. Angesichts der ständigen Überfälle, die Banditen von nördlich der Mount-Mitchell-Kette im Grenzgebiet verübten, hielt er das für eine gute Nachricht. Seit dieser Ankündigung hatte er nichts mehr aus Asheville gehört … bis heute.
Und nun kam die erste Mitteilung über den Wiederaufbau des Gemeinwesens, von dem alle nur voller Stolz und Wehmut sprachen – der Vereinigten Staaten von Amerika –, in Form eines Einberufungsbescheids von einer Behörde, die ihm Elizabeth wegnehmen wollte. Seine Elizabeth. Ich habe schon ein Kind verloren, dachte er. Lieber Gott, nicht auch noch sie.
Seine Gedanken wanderten zu Jennifer, Elizabeths kleiner Schwester. Als nach dem Zusammenbruch des als so selbstverständlich empfundenen Gesundheitssystems der USA das Insulin knapp wurde, war sie gestorben. Nur weil ein paar Ampullen Insulin fehlten, hatte sein Baby in seinen Armen sterben müssen. Diesen Teil seines Lebens verdrängte er, um nicht durchzudrehen. Eltern sollten nicht in den Sarg ihrer eigenen Kinder schauen müssen, und doch hatte er sich gezwungen gesehen, seine Tochter zu begraben. Er hielt den Blick weiterhin auf Elizabeth gerichtet, verbarg seine Gedanken vor ihr, darum bemüht, ein ruhiges, gelassenes Äußeres zu wahren.
Er versuchte, seine Gedanken zu sortieren. Ich bin ihr Vater. Das ist meine 18-jährige Tochter. Eigentlich ist sie selbst noch ein Kind, stattdessen erhält sie als junge Mutter ihre Einberufung. Er schüttelte den Kopf, zwang sich zu einem aufmunternden Lächeln und reichte ihr den Zettel.
»Lächerlich. Du hast einen 14 Monate alten Säugling aufzuziehen. Das war schon immer ein Zurückstellungsgrund.«
»Nicht mehr, Daddy. Du hast nicht alles gelesen«, erwiderte sie, während sie ihm das Schreiben aus der Hand nahm und es umdrehte. Im gegenwärtigen Zeitalter der Papierknappheit bedruckte man Dokumente in der Regel beidseitig. Er hatte tatsächlich versäumt, den Bogen umzudrehen und den Nachtrag zu lesen.
»Auf Anordnung der Präsidentin«, las sie mit ausdrucksloser, emotionsloser Stimme, »sind für die Dauer des nationalen Notstandes mit dem heutigen Datum alle bisherigen Freistellungsgründe aufgehoben, ausgenommen der Nachweis einer schweren Körperbehinderung. Wehrpflichtige mit unterhaltsberechtigten Kindern sind gehalten, für eine angemessene Unterbringung der Unterhaltsberechtigten zu sorgen. Ein Versäumnis, dem Folge zu leisten, wird gemäß Notstandsverordnung 303 geahndet.«
Er las die Zeile noch einmal und es lief ihm kalt über den Rücken. Er hatte schon von Verordnung 303 gehört. Sie verlieh einer Regierung offiziell das Recht, die Todesstrafe zu verhängen. Er hatte selbst Menschen hinrichten müssen, in den Monaten nach Tag eins, angefangen mit den beiden Medikamentendieben, ohne Rechtsgrundlage, allein auf Grundlage des städtischen Beschlusses, in einer Phase, in der das Überleben der ganzen Stadt davon abhängig war, derart drakonische Maßnahmen zu tolerieren. Die Entscheidungen hatten ihm damals schwer zu schaffen gemacht, sie suchten ihn immer noch in Albträumen heim. Als er zu seiner Tochter aufsah, wurde er sich der bitteren Ironie bewusst, dass ihr nun das Gleiche drohte.
»Kam das heute Morgen mit der Post aus Asheville?«, wollte er wissen.
»Genau, und ich bin nicht die Einzige. Mabel von der Poststelle meint, es trafen 113 solcher Bescheide per Overnight-Kurier aus Asheville ein.«
»Bist du sicher? 113?«
»Ja, Daddy.« Nun schwang in ihrer Stimme die Verängstigung eines kleinen Mädchens mit. »Ich bin gleich hergerannt, um es dir zu zeigen. Vor der Post bildet sich bereits ein Pulk. Die Menschen sind definitiv nicht glücklich darüber.«
Das musste er erst mal verdauen. Er stand auf und ging durch die Tür nach nebenan, wo die städtische Telefonvermittlung ihren Dienst tat.
»Jim, könntest du mich zu Mabel durchstellen?« Damit kehrte er in sein Büro zurück, um den Hörer des altmodischen Telefons abzunehmen.
Sie hatten einen Schaltschrank aus den 1930er-Jahren aus dem Heimatmuseum in der State Street geholt und im Rathaus aufgestellt. »Ein Ferngespräch«, wie man es früher genannt hatte, entsprach heute einem Anruf in Asheville im Westen oder Old Fort im Osten, wenngleich es Gerüchte gab, in Morganton, knapp 65 Kilometer entfernt, hätten sie es geschafft, genügend Kupferdraht aufzutreiben, um eine Leitung zu ihnen zu legen. Sein Apparat gab ein misstönendes Klingeln von sich, das er aus seiner Kindheit kannte. John hob ab.
»U. S. Post Office. Mabel Parsons am Apparat.«
Er lächelte. Sie hielt an den alten Ritualen fest, obwohl sie die Einzige war, die auf der Post arbeitete, die sich mittlerweile über die übliche Dienstleistung hinaus zum städtischen Umschlagpunkt für Klatsch und Neuigkeiten entwickelt hatte.
»John Matherson. Wie läuft’s, Mabel? Geht es deinem Mann besser?«
»Seit gestern Nachmittag hat sich sein Zustand stabilisiert, John. Danke, dass du den Antrag für die Antibiotika durchgeboxt hast. Wir schulden dir was.«
»Klar, Mabel. So langsam produzieren die College-Kids im Chemielabor Überschüsse, also war’s kein Problem.«
»Weshalb rufst du dann an, John? Doch nicht um mich zu fragen, wie es George geht?«
John hörte die Ablehnung in ihrer Stimme. Mabel war keine Frau, die ein Blatt vor den Mund nahm.
»Okay, Mabel. Meine Tochter Elizabeth kommt gerade von dir mit diesem komischen Einberufungsbescheid. Sie meinte, ein ganzer Haufen davon wurde aus Asheville rübergeschickt. Was zum Teufel ist da los?«
»Ich hab insgesamt 113 Stück gezählt, John. Du weißt, dass ich nicht über die Post anderer Leute sprechen darf. Die alte Dienstehre, Briefgeheimnis und so. Aber, ja, ich sortiere sie gerade in die Postfächer ein. Ich denke, es ist okay, wenn ich dir verrate, dass die Hälfte der Bescheide an Kids geht, die noch oben im College wohnen; der Rest an Jugendliche aus der Stadt, sie werden alle in diese komische ANR einberufen.«
»Ich komm sofort rüber.« Ohne ihre Antwort abzuwarten, legte John auf. Von ihm wurde erwartet, dass er als Anführer und Schlichter für das gesamte Gemeinwesen eintrat; doch ungeachtet der Verantwortung, die er trug, ungeachtet seiner langen Jahre im Militärdienst, lag ihm in diesem Moment einzig das Schicksal seiner Tochter am Herzen, die selbst bereits Mutter war. Es ging um sein Kind, sein Fleisch und Blut, jeder Vater hätte so reagiert.
Er fuhr sich mit der Hand über die Stoppeln am Kinn. Es war Samstagmorgen. Heute Abend würde ihn seine Frau Makala mit einem altmodischen Rasiermesser rasieren. Eine Kunst, die er noch nie beherrscht hatte. Vielleicht lag es an ihrer langjährigen Berufserfahrung als Oberschwester in der Kardiologie, dass sie so gut mit einem Messer umgehen konnte. Ja, Mehrklingen-Einwegrasierer gehörten der Vergangenheit an.
Nachdem er die ganze Nacht lang Wache geschoben hatte, kam er sich schmuddelig und ungepflegt vor. Außerdem tat ihm der verfluchte Zahn weh, der ihm seit letztem Monat Ärger bereitete. Irgendwann war es Makala gelungen, ihn zu überreden, den gefürchteten Zahnarztbesuch über sich ergehen zu lassen. Gleich nachher wollte er hingehen, danach ein Bad im Bach nehmen und sich hinterher eine ordentliche Rasur gönnen, um abends etwas auszuspannen. Doch als er Elizabeth so ansah wusste er: All dies musste warten.
»Komm schon, Kleines, gehen wir!«
»Darf ich fahren, Daddy?«, fragte Elizabeth, als sie das Büro verließen. Sie streckte ihm die Hand hin und bedachte ihn mit einem Lächeln, bei dem ihm das Herz aufging. So wie früher, wenn sie als Halbwüchsige ihren Vater um den Finger wickelte und ihm die Schlüssel für das Familienauto abschwatzte.
Der 1958er Edsel, einst stolzer Besitz seiner Schwiegermutter, diente nun als John Mathersons weithin bekannter Dienstwagen und galt als Quell zunehmender Gewissensbisse. Bei der Schlacht mit der Posse war sein Haus zerstört worden. Darum hatte er sich in Montreat eine neue Wohnung gesucht, rund vier Kilometer vom Rathaus entfernt. Manchmal, besonders an schönen Frühlings- und Herbsttagen, genoss er den Spaziergang zur Arbeit. Bis zur Erfindung des Automobils hatten die Leute schließlich auch fast jede Strecke unter 20 Kilometern zu Fuß zurücklegen müssen. Doch während er gemächlich zum Rathaus schlenderte, was immerhin rund eine Stunde dauerte, ereigneten sich immer häufiger ernste Vorkommnisse, denen er sich umgehend widmen musste. Deshalb hatte ihn der Stadtrat nach einigem offiziellen Hin und Her und heftigen Diskussionen dazu bewegt, eine wöchentliche Ration von gut 20 Litern Benzin zu akzeptieren, was beim hohen Verbrauch des Oldtimers für eine Strecke von knapp 120 Kilometern reichte.
In den Erdtanks der Stadtverwaltung lagerte immer noch eine Reserve von einigen Tausend Litern für den städtischen Fuhrpark, die sparsam verteilt wurde. Was den Sprit betraf, den sie aus verlassenen Fahrzeugen abzapften, wurde dieser in wachsendem Maß unbrauchbar, da er sich mit der Zeit zersetzte, auch wenn der Besitzer der städtischen Volkswagen-Vertretung, Jim Bartlett, behauptete, er sei in der Lage, eine Formel zu entwickeln, um diesen Treibstoff wieder verwendbar zu machen.
Dass John rein dienstlich der Edsel zur Verfügung stand, war ein Luxus, der bei ihm nach wie vor Schuldgefühle weckte. Wann immer er jemanden sah, der zu Fuß in die Stadt oder hinaus wollte, fuhr er rechts ran, um den Betreffenden mitzunehmen und damit sein Gewissen zu beruhigen.
»Wir gehen zu Fuß, Elizabeth. Von hier aus ist es gerade mal einen halben Block bis zur Post.« Mit weit ausgreifenden Schritten, die zu seiner Körpergröße von 1,95 Meter passten, marschierte er los, froh, nach der durchwachten Nacht im Rathaus die frische Morgenluft einzuatmen. Im Hinausgehen informierte er Jim, wo er zu finden sei, und bat ihn, Reverend Black Bescheid zu geben, der bald seinen Dienst antrat, dass die Nacht ausnahmsweise ruhig verlaufen war.
Gerüchten zufolge trieben sich die Reivers vom Mount Mitchell wieder im nördlichen Grenzgebiet der Stadt herum. Die Stepps, mehrere Familien, die in den Ausläufern des hoch aufragenden Gebirgszugs lebten, jammerten, dass ihnen ständig Hühner und Schweine abhandenkamen … über den Schwarzgebrannten, den sie unter der Hand an ebenjene Reivers verhökerten, schwiegen sie hingegen tunlichst. Manchmal wusste John nicht mehr, ob er die Schuld nicht eher bei den Stepps suchen sollte, die zu gelegentlichen Gewaltaktionen neigten, als bei den Kerlen von außerhalb. Aber zumindest diese Nacht war ohne Zwischenfälle oder Rachefeldzüge verstrichen.
John und Elizabeth ließen den Parkplatz des Rathauskomplexes hinter sich, in dem die Büros der Verwaltung sowie Feuerwehr und Polizeiwache einquartiert waren, und überquerten die State Street, früher mal eine Hauptverkehrsstraße. Der Eissturm des vergangenen Winters hatte der Ampel, die schon lange außer Betrieb war, endgültig den Rest gegeben. Die seit Langem aufgegebene Sparkasse auf der anderen Straßenseite war letztes Jahr ausgebrannt, das einst so imposante Gebäude nur noch eine triste Ruine. Ironischerweise waren die Handelskammer und die Touristeninformation an der gegenüberliegenden Straßenecke nach wie vor intakt, obwohl Tausende von Broschüren, welche die örtlichen Sehenswürdigkeiten anpriesen, selbstverständlich längst geplündert waren, um einer deutlich primitiveren Verwendung zugeführt zu werden. Eine Rolle des Originalmaterials, das die Broschüren nun ersetzten, war mittlerweile ihr Gewicht in Silber wert oder eben in der aktuellen Standard-Tauschwährung – Munition. Noch so etwas, woran niemand gedacht hatte, bevor alles den Bach runterging. Kaum jemand hatte Toilettenpapier in ausreichenden Mengen bevorratet.
Sobald sie sich daranmachten, die Straße zu überqueren, bereute er seine Entscheidung herzukommen. Vor gut 150 Jahren war das Postamt der Treffpunkt der ganzen Stadt gewesen, mit einem Kanonenofen, wie einem Gemälde von Norman Rockwell entsprungen, um den sich die örtlichen Dorfphilosophen und Hinterwäldler versammelten, um beim Damespiel Klatsch und Tratsch auszutauschen und auf die Morgenpost und Nachrichten aus der großen weiten Welt zu warten.
Mabel hatte ihren Job stets ernst genommen und es zur stellvertretenden Leiterin des Postamts gebracht. Ein ganzes Jahr lang gab es für sie, wenn überhaupt, nur wenig zu tun. Doch nachdem die Army, wenigstens für kurze Zeit, ihr Hauptquartier in Asheville bezogen hatte, waren tatsächlich gelegentlich Briefe eingetroffen, dann nach und nach immer mehr, bis schließlich dreimal die Woche ein waschechter Kurier aus der ›großen Stadt‹ kam.
Hocherfreut, endlich wieder arbeiten zu können, hatte Mabel – mithilfe ihres Ehemanns George – im Foyer einen Holzofen aufgestellt, dazu ein paar Damebretter und ein Schachspiel, und betrieb mit ihrem frisch gebackenen Maisbrot, das sie jeden Morgen mitbrachte, ein florierendes Nebengeschäft, ebenso mit ihren aus diversen Wurzeln und Blättern hergestellten Tees. Trotz der Tatsache, dass ihre speziellen Präparate für Kunden, die Schmerzmittel benötigten, vor Tag eins in den meisten Bundesstaaten außer Colorado illegal gewesen wären, drückte John beide Augen zu.
Und so war die Post erneut zum Treffpunkt für hiesige Hinterwäldler und Philosophen geworden, genau wie für nicht gerade wenige Witzbolde, vor allem an kalten Winter- und verregneten Frühlingstagen, wenn es auf den Feldern nur wenig Arbeit und sonst nichts zu lachen gab.
Noch bevor John die State Street vollständig überquert hatte, entdeckte ihn die stetig wachsende, offenkundig wütende Versammlung, die vor der Post herumlungerte. Wie jede Menschenmenge in einer Demokratie hielt sie nach jemandem Ausschau, an dem sie ihren Ärger auslassen konnte. Dieser Jemand war natürlich John. Er atmete tief durch und ging zügig weiter.
Mehrere versuchten, ihn anzusprechen, und er setzte sein entwaffnendstes Lächeln auf.
»Hey, egal, was los ist, meine Tochter hängt auch mit drin«, verkündete er, bemüht, sich durchzuzwängen. »Lasst mich erst mit Mabel sprechen, dann komme ich gleich zu euch.«
Noch bevor er ausgesprochen hatte, sah er Ernie vom berüchtigten Franklin-Clan in seinem ramponierten Geländewagen heranrumpeln. Die Nachricht von den Einberufungsbescheiden verbreitete sich wie ein Lauffeuer. John wünschte, Mabel hätte ihn direkt nach Eintreffen der Morgenpost aus Asheville angerufen, dann hätte er sich in Ruhe passende Antworten zurechtlegen können. Er entdeckte seinen alten Nachbarn und Freund Lee Robinson im Pulk und kämpfte sich zu ihm durch.
»Lee«, flehte er ihn an, »könntest du die Leute bitten, draußen zu warten?«
Vor über 200 Jahren hatten Lees Vorfahren sich in diesem Tal niedergelassen, vier von ihnen hatten im ›Unabhängigkeitskrieg des Südens‹ gekämpft, wie Lee sich ausdrückte. Für John war Lee die Verkörperung von allem, was in diesem Tal kostbar war. Er vereinte die besten Aspekte von dessen traditioneller, bodenständiger Prägung, war ein Mann mit Charakter und galt als geschätzter Nachbar. Sein Sohn Seth, ein paar Jahre älter als Elizabeth, hatte stets ein wachsames Auge auf sie gehabt, fast wie ein älterer Bruder. Er hatte sein Okay für Ben gegeben, den Jungen, in den Elizabeth sich verliebt und von dem sie einen Sohn bekommen hatte. Lees jüngste Tochter war Jennifers beste Freundin gewesen. Sowohl John als auch Lee hegten die Hoffnung, dass Seth und Elizabeth einander eines Tages vielleicht mit anderen Augen betrachteten.
Lee nickte. John bedeutete Elizabeth, bei seinem Freund zu bleiben, während er nach hinten ins Postamt ging.
Mabel schmiss den Laden allein. Natürlich gab es keine Zustellung mehr bis an die Haustür; die Leute mussten schon selbst in die Stadt kommen, um die Briefe beziehungsweise Bescheide abzuholen, die hin und wieder aus der Außenwelt eintrudelten. Vor einem Monat hatte es auf der Post sogar eine Art Feier gegeben, als ein Schreiben aus Indiana eintraf. Es war ein Rätsel, wie es auf der langen Strecke überhaupt durchgekommen war, adressiert an Abe und Myra Cohen von ihrer Tochter, die oben in Purdue studierte. Sie hatte Tag eins überlebt und geheiratet. Abe und Myra waren nun die Großeltern eines Zwillingspärchens.
An Tag eins brach der Kontakt vieler Familien zu ihren Kindern ab, die in weit entfernten Bundesstaaten das College besuchten, Frauen wurden von Männern auf Geschäftsreise getrennt oder umgekehrt, betagte Eltern, die Urlaub machten, vom Rest ihrer Angehörigen. In den Tagen und Wochen danach hatte es nur eine Handvoll sicher nach Hause geschafft. Viele, die sich am Nachmittag des Angriffs unten in Raleigh oder in Atlanta aufhielten, waren von der Außenwelt abgeschnitten, man hörte schlicht nichts mehr von ihnen. Darum füllte sich an Tagen, an denen sich herumsprach, dass eine Zustellung aus Asheville eingetroffen sei, die Post mit all jenen, die noch Hoffnung auf Nachricht aus der weiten Welt da draußen hegten.
Doch Mabel leitete nicht nur das Postamt, aufgrund ihrer Erfahrung hatte sie sich zur Beraterin in allen Lebenslagen entwickelt und bot eine Schulter zum Ausweinen, wenn der Briefkasten mal wieder leer blieb. Botschaften von fernen Angehörigen, Neuigkeiten aus der Welt, ein Treffpunkt, an dem man sich über alles, was im Ort passierte, und über die jüngsten Gerüchte austauschen konnte – das war Mabels Domäne. Sie freute sich zusammen mit ihren Kunden, lieferte Trost und Zuspruch, wenn man sich sorgte, und hielt zumindest einige der alten Traditionen aufrecht. Sie liebte ihre Arbeit. Allerdings nicht heute.
Ehe er den Mund aufmachen konnte, hob sie gebieterisch die Hand. »Ja, John, ich weiß – vielleicht war es ein Fehler, all diese Briefe herauszugeben, ohne dich vorzuwarnen. Vermutlich hätte ich dich besser erst informiert, bevor ich sie alle sortiert und in die Postfächer gesteckt habe. Aber ich wusste ja gar nicht, was drinstand. Erst als deine Tochter ihren Bescheid vor meinen Augen öffnete, erfuhr ich es. Da war es schon zu spät und hatte sich bereits herumgesprochen.«
Seufzend betrachtete John die Hunderte kleiner Schlitze im Sortierraum, während die Morgensonne durch die winzigen Glasfenster der Postfächer fiel, um das darin herrschende Dunkel zu erhellen. In über 100 Fächern lagen diese bläulichen Kuverts.
»Hol sie wieder raus«, sagte John. »Ich brauche Zeit, um die Sache zu klären.«
Entschlossen schüttelte Mabel den Kopf, ein vernichtender Blick verriet ihm, dass er eine Grenze überschritt, wenn es um ihren hehren Dienstherrn ging, den USPS, die Post der Vereinigten Staaten.
»John, mag sein, dass du in dieser Stadt das Sagen hast, auch wenn der Ausnahmezustand aufgehoben wurde, und normalerweise sind die Leute mit allem, was du tust, einverstanden. Aber hier drin gelten meine Regeln.« Sie richtete sich zu ihrer vollen Größe von 1,58 Meter auf und schaute zu ihm hoch. »Ich stand früher offiziell im Dienst des United States Postal Service, und, bei Gott, ich war stolz darauf. Erinnerst du dich noch an das Buch, das vor ein paar Jahren erschien, und den miserablen Film, den sie hinterher daraus gemacht haben? Es ging darum, wie der Postdienst Amerika nach einer Katastrophe wieder vereint, wie wir sie jetzt in Wirklichkeit erleben mussten. Dieser dämliche Streifen genoss Kultstatus bei uns Beschäftigten … Die Leute zogen uns mit Witzen über unseren Job auf – ›Na, Postman‹, hieß es und so ähnlich. Aber wir hielten den Betrieb tatsächlich aufrecht, und, verflucht noch mal, John, stell dich nicht zwischen mich und meine Arbeit, sonst wirst du dich vor dem United States Postal Service verantworten müssen!«
Die letzten Worte brüllte sie fast.
»Okay, Mabel, ich gebe mich geschlagen.«
»Und merk dir noch was: Laut dem Gesetz, das wir mal hatten, bin ich verpflichtet, die ordentliche Postzustellung zu gewährleisten, und zwar frei von Zensur. Versuch bitte nicht, mich davon abzuhalten.«
John starrte sie aus großen Augen an, ihm lag bereits eine frustrierte Erwiderung auf der Zunge, als sie diesen letzten Punkt vorbrachte. Doch sie entschärfte die Situation, indem sie hörbar den Atem ausstieß und ihn mit dem Anflug eines freundlichen Lächelns streifte.
»Tut mir leid, John. Jetzt, wo ich weiß, was in diesen Umschlägen steckt, rege ich mich genauso darüber auf wie alle anderen. Einer davon ist an meinen Schwiegersohn adressiert. Mir geht es nicht anders als dir, manchmal hasse ich den Job, den ich erledigen muss, aber ich erledige ihn trotzdem, genau wie du.«
John beugte sich runter und drückte ihr einen freundschaftlichen Kuss auf die Stirn, während sie ihn umarmte.
Noch wie er so dastand, bekam er mit, wie eine der Glastüren aufschwang. Es war Ernie Franklin, der sich mit den Ellbogen an Lee vorbeischob. Unmittelbar darauf erscholl aus der Eingangshalle eine Tirade von Kraftausdrücken.
»Jetzt muss ich mich sofort darum kümmern«, erwiderte John schließlich. Müde schüttelte er den Kopf und sah auf Mabel hinab.
Seufzend streckte sie den Arm aus und ergriff seine Hand. »Hey, ich bin bloß der Überbringer der schlechten Nachricht, wie man früher zu sagen pflegte. Erschieß mich nicht gleich.« Sie verstummte, sichtlich angespannt, denn in seiner bisherigen Rolle, die im Wesentlichen der eines Diktators entsprach, hatte er tatsächlich mehr als einen Menschen erschießen müssen. »Sorry«, stammelte sie ungeschickt und wurde rot.
»Kein Problem!« Er lächelte. »Ich weiß ja, wie du es meinst, Mabel. Das war mal ein gängiges Schicksal für Boten, die unerfreuliche Neuigkeiten abliefern mussten – und die gibt es heute Morgen weiß Gott.«
»Mein Gott, John, ich stehe tief in deiner Schuld für alles, was du für George getan hast. Vor allem weil du dich dafür eingesetzt hast, bei seiner letzten Lungenentzündung Antibiotika freizugeben. Aber wenn eines Tages alles wieder so wie früher werden soll, tut mir leid, muss ich meinen Job machen, genau wie du.« Sie zögerte, schluckte und trat einen Schritt zurück. »Ich kann dich nicht daran hindern, die Umschläge aus den Postfächern zu holen, John. Aber wenn du es tust, verlierst du jeden Respekt, den ich vor dir habe.«
Wie sollte er darauf reagieren? Zumal nun mehr und mehr Postfächer aufgezogen wurden. Ernie führte seine Schimpftirade fort, peitschte die Leute so auf, dass sich ihre Wut womöglich noch in der Eingangshalle des Postamts entlud.
»Na ja, das Kind ist eh in den Brunnen gefallen, Mabel«, erwiderte er und zeigte auf die aufgebrachte Kundschaft.
Sie trat wieder näher und drückte seine Hand. »John, du bist der Anführer in dieser Stadt. Du kriegst das schon hin. Du schaffst es doch sonst auch.«
»Ja, natürlich«, meinte er mit einem Kopfschütteln. Er blickte auf die Postfächer und seine Freunde und Nachbarn, die sich auf der anderen Seite zusammenscharten. »Verflucht, Mabel!« Er zwang sich zu einem freundlichen Lächeln. »Ruf mich beim nächsten Mal wenigstens vorher an, damit ich mir entweder überlegen kann, was ich tun soll, oder …« Er verstummte. Oder wo ich mich verkriechen kann. Aber das sagte er nicht laut.
Wie oft hatte er sich schon gewünscht, und zwar von Anfang an, er könnte genau das tun, einfach irgendwo untertauchen. Daran musste er denken, als er die Tür öffnete und in die Vorhalle trat.
Selbstverständlich ging Ernie Franklin ihm sofort auf die Nerven. Selbst mit Mitte 70 brachte sein Auftreten klar zum Ausdruck: ›Leg dich bloß nicht mit mir an!‹ Er war das Oberhaupt des Franklin-Clans, wie alle die Familie nannten, die jenseits von Ridgecrest lebte. Schon vor Tag eins hatte manch einer sie als Prepper und Überlebenskünstler bezeichnet. Ernie und seine Frau waren, lange vor dem Krieg, Computerexperten gewesen – Programmierer. Damals in den 1960ern hatten sie damit angefangen. Voller Stolz hatte Ernie jedem erzählt, dass er und seine Frau Linda Teile der Software für das Apollo-Programm und die Shuttle-Programme geschrieben hatten. Er hatte kommen sehen, was schließlich eintrat. Darum hatte er 40 Hektar Bergland aufgekauft und am Dorfrand seinen festungsähnlichen Alterssitz errichtet und darin reichlich Nahrungsmittel gebunkert, die den ›Clan‹ offensichtlich immer noch ernährten. Mittlerweile umfasste die Sippe mehrere Söhne, deren Familien, eine Tochter sowie einen einsiedlerischen Schriftsteller, der bereits vor Tag eins in ihr Leben getreten war.
Vom ersten Tag an hatten die Franklins völlig auf sich allein gestellt überlebt, nie um Rationen oder Hilfe aus der Stadt gebeten. Am Tag der verheerenden Schlacht mit der marodierenden Posse hatte der Flankenangriff des Feindes an Ernies Grundstücksgrenze entlanggeführt, wurde jedoch von plötzlich einsetzendem Feuer aus automatischen Waffen zurückgetrieben. Indirekt hatten die Anstrengungen von Ernies Clan zum Sieg der Stadt beigetragen, indem sie den Feind abdrängten und so durch ein Nadelöhr zwangen.
Ihre Gegner mussten schließlich über einen schmalen Weg vorrücken, den eigentlich nur Bergwanderer und Mountainbiker kannten, anstatt über die alte Forststraße, von der aus sie Johns Stellung auf dem Bergrücken am Tagungshaus der Baptisten hätten in die Flanke fallen können. Infolgedessen tobte die Schlacht überwiegend entlang der Interstate 40, doch bei jeder sich bietenden Gelegenheit band Ernie allen auf die Nase, dass sein Clan, ob nun Teil der organisierten Streitmacht oder nicht, bei der Schlacht eine entscheidende Rolle übernommen hatte und dementsprechend Anerkennung verdiente.
Und nun stand er im Begriff, seine Wut an John auszulassen, und zwar in unzweideutigen, absolut unflätigen Worten. Schon vor langer Zeit hatte John die Erfahrung gemacht, dass man ihn am besten einfach lospoltern ließ, bis er irgendwann Luft schnappen musste.
Schließlich verstummte Ernie schwer atmend. John hob die Hand.
Die Eingangshalle der Post war brechend voll. In Anbetracht der allgemein üblichen sanitären Standards roch es ziemlich streng. John war seit jeher recht empfindlich gewesen, was Gerüche anging. In der Grundausbildung hatte sein Drill Sergeant sich das zunutze gemacht und John jeden Morgen gleich nach der ersten Benutzung die Kasernentoiletten schrubben lassen, wobei John regelmäßig das Frühstück wieder hochkam. Nach zwei Jahren, in denen sich jeder nur unregelmäßig wusch, war es quasi zur Norm geworden, dass die Ausdünstungen der Nachbarn die Luft erfüllten, doch manchmal setzte es ihm arg zu.
»Wie wär’s, wenn wir alle nach draußen gehen?«, schlug John vor. »Wir setzen uns hin, atmen einmal tief durch und reden drüber. Ernie, könntest du mir dabei zur Hand gehen?«
Es war Johns Standardmanöver, jemanden um Hilfe zu bitten, insbesondere in kritischen Situationen. Meist reagierte der Betreffende überrascht, ließ sich jedoch darauf ein.
So auch diesmal. Eine Zustimmung murmelnd, wies Ernie mit einer Handbewegung zur Tür, als hätte er hier das Sagen. Die Menge folgte ihm nach draußen.
Im Freien entdeckte John Ed, den Polizeichef. Wahrscheinlich hatte Jim von der Telefonzentrale ihn verständigt und er war ebenfalls aus dem Rathauskomplex hergekommen, um die Lage im Auge zu behalten. John stellte Blickkontakt zu ihm her und gab ihm mit einer kaum merklichen Handbewegung zu verstehen, dass er locker bleiben und einfach weitergehen solle, als wäre alles in Ordnung. In dieser neuen Welt, in der sie lebten, ging niemand ohne Waffe aus dem Haus. John trug stets eine kleine Ruger verdeckt in der Tasche mit sich herum; die meisten versammelten Nachbarn hatten entweder lässig ein Gewehr umgehängt oder eine Schrotflinte unter den Arm geklemmt. Ed hingegen war die bewaffnete Ordnungsinstanz der Stadt. John wollte nicht auch nur den leisesten Eindruck erwecken, dass er angesichts des weiter wachsenden aufgebrachten Menschenauflaufs bewaffnete Unterstützung benötigte.
Mittlerweile hatten sich über 100 Leute eingefunden, viele schwenkten einen Einberufungsbescheid, sei es für sich selbst, für Kinder oder Verwandte. John achtete darauf, dass auch ja jeder mitbekam, dass er ebenfalls einen solchen Bescheid in der Hand hielt. Die Leute ließen sich entlang des Bordsteins nieder oder lehnten sich an die merkwürdige Ansammlung antiquierter Gefährte, die sie umgerüstet hatten, um sie wieder zum Laufen zu bringen, nachdem der EMP-Schlag sämtliche elektronischen Geräte lahmgelegt hatte. Auf die Dächer mehrerer Wagen waren riesige Leinensäcke geschnallt, um den Brennstoff für die Holzvergaser zu speichern. Mabels Ehemann hatte ausgetüftelt, dass sich damit tatsächlich ein Wagen antreiben ließ … zwar gerade so, aber es reichte, um damit durch die Stadt und raus auf die Felder zu fahren, die sie inzwischen als Ackerland nutzten.
John räusperte sich und gebot mit der Hand Schweigen. Es war schon Tradition, eine Bürgerversammlung, sei sie nun offiziell oder formlos, mit einer Schweigeminute zu beginnen. Wäre Reverend Black anwesend gewesen, hätte er ein überkonfessionelles Gebet gesprochen, eine Bitte, Gott möge ihnen den rechten Weg weisen und Besonnenheit schenken. Da er nicht anwesend war, schwiegen alle bloß einen Moment.
Ein weiteres Räuspern von ihm. »Ich habe keine Antworten für euch.«
»Na, das ist ja mal ein verdammt guter Anfang!«, warf Ernie sarkastisch ein.
John sah zu ihm und hob beschwichtigend die Hand. »Lass mich einfach ausreden, danach hat jeder die Chance, etwas zu sagen«, bot John an und merkte, dass er vom Rest der Menge Rückhalt bekam. Widerwillig nickte Ernie und nahm auf dem Fahrersitz seines Polaris, eines Quads, Platz.
»Meine Tochter Elizabeth hat das gleiche Schreiben erhalten wie der Rest von euch, sie soll sich in drei Tagen bei dieser Army of National Recovery melden, von der wir alle schon Gerüchte aufgeschnappt haben. Wir wussten doch, dass uns diese Einberufung früher oder später blüht – und heute ist es so weit. Ich verlange doch nur, dass ihr euch erst mal wieder einkriegt. Ich werde nach Asheville fahren und mit diesem neuen Bundesbeauftragten sprechen, der letzten Monat eingetroffen ist, Dale Fredericks, um zu sehen, was er zu sagen hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommen diese Bescheide von seiner Behörde. Ich werde ihn jetzt gleich anrufen und meinen Besuch ankündigen.«
Er blickte rauf zum Himmel, dann zurück auf die Menge. »Das Wetter sieht heute gut aus.« Was er als Nächstes tat, entsprang eindeutig eiskalter Berechnung – manch einer hätte es wohl als zynische Manipulation bezeichnet, andere als grundlegende Strategie der Menschenführung. »Ein paar der Jungs am College ist es vorgestern Nacht gelungen, einen wilden Eber zu erlegen, nachdem sie ihm wochenlang nachgestellt haben. Im Moment zerlegen sie ihn, und unser Freund Pete, der allseits geschätzte Grillmeister, hilft ihnen dabei. Anstatt das Schwein einzusalzen oder zu räuchern, sollten wir uns heute Abend mal etwas gönnen. Ich werd Pete fragen, ob er auf dem Marktplatz eine Steingrube vorbereitet, und zwar gleich. Ernie, vielleicht könnt du und ein paar andere ihm zur Hand gehen. Wie wär’s, wenn wir, sagen wir: um sechs, eine Bürgerversammlung einberufen? Bis dahin weiß ich mehr und wir können auch gleich etwas essen. Es wird nicht Petes bestes Pulled Pork werden, dürfte aber trotzdem ziemlich lecker sein. Außerdem brauchen wir dafür keine Lebensmittelmarken. Nach der Frühlingsaussaat und dem Glück, das wir mit dem Wetter hatten, wird’s Zeit, anständig zu feiern.«
»So was zu garen dauert doch Tage«, warf Ernie ein. Ein flüchtiger Blick von John, wenigstens zu diesem Thema den Mund zu halten, zeigte Wirkung. »Ja, okay, John«, erwiderte Ernie. »Wir werden Pete helfen, das Schwein zumindest halbwegs genießbar zu machen und für das Meeting heute Abend vorzubereiten. Ich bin sicher, wenn du nachher zurückkommst, hast du ein paar verdammt gute Antworten für uns dabei.«
Diejenigen, die mit den ihnen zugeteilten Rationen kaum über die Runden kamen, stießen unverhohlene Freudenschreie aus. Richtiges Fleisch auf dem Teller, ganz gleich wie zäh, war eine verlockende Aussicht.
»Aber bevor du losfährst, John, hab ich noch etwas zu sagen«, verkündete Ernie. John hob die Hand.
»Wie gesagt, Ernie, ich weiß nicht mehr als der Rest von euch. Ich möchte jetzt diesen Anruf erledigen und dann aufbrechen. Ist das okay für euch alle?«
John graute vor solchen formlosen Versammlungen. Jeder meinte, er müsse zu Wort kommen, und sie zogen sich meist stundenlang hin. Von seinem ganzen Naturell her war er so veranlagt, dass er Fakten brauchte, und zwar möglichst schnell. Er wollte sämtliche Details geklärt wissen und anschließend so schnell wie möglich die Hiobsbotschaft überbracht bekommen. Er fragte sich, ob hinter der Mobilmachung der tauglichsten, gesündesten jungen Männer und Frauen seiner Gemeinde mehr steckte als bloß die Einberufung zu einer staatlich geregelten Dienstpflicht, etwa ein Anlass wie damals im Zweiten Weltkrieg.
Daran, wer alles einen blauen Umschlag schwenkte, sah er, dass die körperlich Leistungsfähigsten, die das Rückgrat bei der Verteidigung der Stadt bildeten und am härtesten auf den Feldern arbeiteten, als Erste einberufen wurden.
KAPITEL ZWEI
Tag 730, Mittag
»Macht es dir wirklich nichts aus, mich zu fahren?«, wollte John wissen.
Makala Turner Matherson schüttelte den Kopf und lächelte. Ein Lächeln, das ihn stets aufs Neue in den Bann zog. Sie war zierlich und schlank gebaut, schon bevor das Hungern begonnen hatte, ihr Haar weiterhin erstaunlich blond – und im Gegensatz zu den meisten anderen Frauen trug sie es auch jetzt noch lang. Sie hatten einander buchstäblich an Tag eins kennengelernt.
Sie war aus Charlotte gekommen, unterwegs zu einer Konferenz im Memorial-Mission-Krankenhaus in Asheville über eine neue Prozedur bei Herzrhythmusstörungen, als ihr Wagen den Geist aufgab – wie so ungefähr jeder andere Wagen, der sich an jenem Tag auf der Straße befand … Zum Glück für sie und auch für ihn blieb sie an der Ausfahrt Black Mountain liegen. An jenem ersten Abend hatte er kurz mit ihr am Straßenrand gesprochen. Schon damals waren es ihre Augen gewesen, die ihn am meisten faszinierten – ihre ungewöhnliche Farbe, manchmal nahezu golden, dann wieder eher in einem grünlich schimmernden Braunton. Bei jenem ersten Blickkontakt hatte sich die Abendsonne in ihnen gespiegelt und sie zum Funkeln gebracht. Er hatte sich nichts anmerken lassen; an jenem Abend war er bloß ein besorgter Vater gewesen auf der Suche nach seiner Tochter, der herausfinden wollte, was passiert war.
Einen Tag später liefen sie einander wieder über den Weg, und in den darauffolgenden Wochen wurde sie allmählich zu einem festen Bestandteil seines Lebens, rettete ihm im wahrsten Sinne des Wortes das Leben, als ihn eine Staphylokokkeninfektion erwischte, und drang noch wesentlich tiefer in seine Familie und sein Herz vor, als sie ihm half, Jennifer zu pflegen – seine jüngste Tochter, die aufgrund ihres Diabetes im Sterben lag.
Vor Tag eins hätte er niemals geglaubt, dass je jemand an Marys Stelle treten könnte, seine erste Frau, die ihm der Krebs vor Jahren genommen hatte, doch in den Anfangsmonaten der Krise und dem langen Winter, der sich anschloss, wurde ihm klar, dass er sie nicht nur als Verbündete und Freundin schätzte, sondern dass sie sich ineinander verliebt hatten. Ein Leben ohne sie – ohne ihre emotionale Stärke, Empathie und ihre klaren Wertvorstellungen, auf die er vollkommen vertrauen und sich verlassen konnte – war für ihn gar nicht mehr vorstellbar.
Da sie planten, nach Asheville zu fahren, entschied sie sich für etwas formellere Kleidung und zog einen hellblauen, knielangen Rock an, dazu eine graue Bluse. Kaum jemand trug heute noch Weiß. Was an Bleichmittel vorhanden war, ging für die Wasseraufbereitung oder die Herstellung diverser Medikamente drauf. Als sie von Johns Absichten hörte, war sie sogar ein Stück bachabwärts vom Haus im Wald verschwunden, um ein kurzes, äußerst kühles Bad zu nehmen. Im Zuge dessen strahlte sie eine saubere, beinahe belebende Frische aus, die er an ihr besonders anziehend fand.
Wenn sie die Stadt verließen, war es ihm lieber, dass sie fuhr, denn damit hatte er beide Hände frei zum Schießen, falls es nötig wurde.
»Ich wünschte nur, ich hätte meinen alten BMW und nicht dieses Ungetüm hier«, meinte sie. »Mein Gott, jetzt mit dem BMW auf dem Parkway und dazu ein gutes Radarwarngerät … das war Fahrspaß! Es gehörte mit zu den Gründen, weshalb es mir hier oben so gut gefiel und ich nach meiner Scheidung aus Charlotte herziehen wollte. Und jetzt bin ich hier und muss mich stattdessen mit deinem klapprigen Edsel rumärgern, John Matherson.«
Sie streckte den Arm aus, um nach seiner linken Hand zu greifen. Seine rechte ruhte auf der Glock im Hüftholster.
Hätte ihr Ausflug einen anderen Anlass gehabt und wäre es nicht stets mit einem gewissen Risiko verbunden gewesen, die Grenzen von Black Mountain hinter sich zu lassen, hätte er die Fahrt auf der freien Straße sogar genossen.
Es war das reinste Vergnügen, die Interstate 40 ganz für sich zu haben. Die Reifen des alten Edsel verloren allmählich an Profil – für so einen Oldtimer waren passende Reifen natürlich unmöglich aufzutreiben, darum tuckerten sie aus Sicherheitsgründen mit gemächlichen 50 bis 60 Sachen dahin.
John hatte diese Strecke schon immer gemocht. Ein paar Kilometer westlich der Ausfahrt 64 gewährte eine lange Steigung einen großartigen Ausblick auf die Mount-Mitchell-Kette zur Rechten, mit über 2000 Metern die höchsten Berge östlich der Rockies. Um diese Jahreszeit erstrahlten die niedrigeren Hänge in saftigem Grün, doch selbst Mitte Mai konnte auf den Gipfeln noch eine dünne Schneedecke liegen, was an diesem Morgen tatsächlich der Fall war. Den niedrigeren Gebirgszug zur Rechten des Highways, der nur 1200 Meter hoch aufragte, hatte der Frühling mit hellem, leuchtendem Grün überzogen.
Abgesehen davon, dass Arbeitskommandos Hunderte liegen gebliebener Wagen zur Seite geschoben hatten, waren an der Interstate seit zwei Jahren keine Instandsetzungsarbeiten mehr ausgeführt worden. Allmählich zeigten sich die Auswirkungen der Vernachlässigung. Im ersten Jahr hatte niemand das Gras gemäht, nun, im zweiten Jahr, sprossen erste Triebe junger Schösslinge auf dem Standstreifen.
Die Häuser draußen am Stadtrand hatte man schon vor langer Zeit aufgegeben, aus Sicherheitsgründen waren ihre Bewohner in leer stehende Wohnungen innerhalb des Stadtgebiets gezogen. Bei vielen der verlassenen Häuser waren die Fensterscheiben zerbrochen, Reben rankten an den Außenwänden hoch, krochen über zugewucherte Fußwege und verwaiste Autos mit platten Reifen, die in Einfahrten vor sich hin rosteten. Einerseits war es ein bedrückender Anblick, andererseits sah John darin die üppige Natur, die sich das Land zurückholte, bestrebt, die Spuren menschlicher Eingriffe zu tilgen.
Zu beiden Seiten der Straße erstreckte sich flaches, fruchtbares Ackerland; fast alle Flächen waren bebaut. Die Traktoren minimierten die knappen Benzinvorräte. Eine ständige Sorge, die sowohl John als auch den Stadtrat umtrieb. Der Sprit reichte vielleicht noch ein, zwei Jahre, wenn er klug rationiert und entsprechend präpariert wurde, um seine Zündfähigkeit zu erhalten. Doch was kam danach? John hegte Fantasien, eines Tages dampfgetriebene Traktoren zu bauen, Gerätschaften, die ihn als Historiker stets fasziniert hatten.
Mehrere solcher Traktoren hatten sie sogar in Scheunen entlegener Farmen ausfindig gemacht, eingerostet und vergessen. Die Hoffnung war, bis zur Ernte im Herbst Teile dieser Wracks zu einem funktionsfähigen Traktor zusammenzuschustern, den man tatsächlich mit Holz anstelle von Benzin betreiben konnte. Zum wiederholten Mal wünschte er sich, im Ort gäbe es mehr altmodische Maschinenschlosser und Werkzeugmacher, die so etwas von Grund auf neu fertigen konnten.
Sie fuhren an einigen streng bewachten Weiden vorbei, auf denen die wenigen kostbaren Pferde gehalten wurden, die man nicht gleich im ersten Jahr geschlachtet hatte. John sah ein neugeborenes Fohlen ausgelassen umhertollen. Der Anblick brachte ihn zum Lächeln. Es lag nicht nur an der Anmut des neuen Lebens; wenn es ihnen nicht gelang, die Infrastruktur ihrer Welt – zumindest auf dem Niveau des frühen bis mittleren 20. Jahrhunderts – wiederherzustellen, könnte dies in wenigen Jahren ihre Hauptenergiequelle für die Landwirtschaft sein.