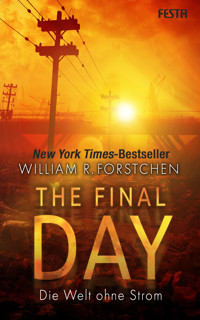
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der mit Spannung erwartete Abschluss der dreiteiligen Bestseller-Serie. Ein EMP-Angriff auf die Vereinigten Staaten hat die gesamte Elektrizität ausgelöscht und das Land in eine dunkle Vorzeit gerissen. John Matherson überlebte Hungersnot und Krieg und möchte endlich wieder Frieden finden. Doch als die neue Regierung die Verfassung außer Kraft setzt und immer mehr Bürger um ihre Freiheit kämpfen, sieht er eine neue Gefahr für die junge Nation: Eine gewaltige Revolution könnte alles in Schutt und Asche enden lassen … Wir sind in völlige Abhängigkeit der Technologie geraten. Essen, Licht, Wärme, Schutz und fließendes Wasser sehen wir als ganz selbstverständlich an. Doch William R. Forstchen warnt uns: Ein EMP-Angriff könnte uns schon morgen all dies nehmen. William B. Scott: »Ein Weckruf, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Chaos und Tod sind nur einen Stromausfall entfernt.« Stephen Coonts: »Forstchen ist der Prophet eines neuen dunklen Zeitalters. Kluge Köpfe würden ihm zuhören.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Alexander Amberg
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The Final Day
erschien 2017 im Verlag Forge Books.
Copyright © 2017 William R. Forstchen
Copyright © dieser Ausgabe 2019 by Festa Verlag, Leipzig
Literarische Agentur: Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Lektorat: Alexander Rösch
Titelbild: Arndt Drechsler
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-724-0
www.Festa-Verlag.de
www.Festa-Action.de
Für Robin
VORWORT UND DANKSAGUNGEN
Seit der Veröffentlichung von One Second After sind über sieben Jahre vergangen. Seither ist eine Menge geschehen, bei jedem von uns. Meine Tochter reifte zu einer hübschen jungen Lady heran und machte ihren College-Abschluss. Vor zweieinhalb Jahren begegnete ich im Anschluss an einen Vortrag bei einer ›Prepper‹-Tagung der Liebe meines Lebens, meiner Seelenverwandten, vor Kurzem haben wir geheiratet. Aufgrund der Themen, über die ich schreibe, sind viele neue Freunde in mein Leben getreten, einige zogen sich zurück.
Neue Menschen bereicherten meine Welt, alte Freunde verließen sie, ganz speziell Andy Andrews, hochgeschätzter Veteran von Omaha Beach. Es gab einige Überraschungen, die größte davon, dass ein anfangs relativ unbekanntes Buch die Bestsellerlisten der New York Times stürmte. Manche behaupten sogar, es habe dazu beigetragen, die Prepper-Bewegung ins Leben zu rufen. Falls dem so sein sollte, sehe ich meine Arbeit lediglich als kleinen Teil eines Phänomens, das mittlerweile Millionen Anhänger umfasst.
Es gab auch Enttäuschungen, die größte davon: Ich schrieb One Second After auf Drängen einiger guter Freunde in der Politik. Sie waren der Meinung, es sei zwar ein Roman, könne der amerikanischen Öffentlichkeit aber die existenzielle Bedrohung für den Fortbestand unserer Nation vor Augen führen. Ich war so blauäugig zu glauben, das Buch könne etwas bewirken, die Politik zum Handeln bewegen, unsere elektrische Infrastruktur zu verbessern und in der Außenpolitik eine härtere Gangart einzulegen, damit derartige Waffen nicht in die Hände derer gelangen, die nur zu gern einen EMP-Angriff auslösen würden. In dieser Hinsicht erwies sich das Buch als völliger Fehlschlag; damit bleibt mir nur noch, eine grundlegende Frage zu stellen. Im Prinzip sollte jeder sie stellen, der diese Worte liest: Warum ignorieren die US-Regierung und die Verwaltungen der Bundesstaaten diese Bedrohung?
Im Rahmen meiner Bemühungen, das öffentliche Bewusstsein zu sensibilisieren und auf eine politische Lösung zu drängen, stieß ich bisweilen auf arrogante Geringschätzung. Es erinnert mich an die Heuchelei jener, die uns übers Waffentragen belehren wollen – und zwar umgeben von professionellen Bodyguards, die in der Tat gut bewaffnet sind, während sie uns ein Loblied darauf singen, wie schön es doch sei, unbewaffnet durchs Leben zu gehen. Zwischen beiden Themen existiert eine klar erkennbare Parallelität, von daher kann sich jeder selber ausrechnen, was ich meine.
Darum glaube ich mittlerweile, dass wir – in den Worten unserer Verfassung ›Wir, das Volk …‹ – nur eine Möglichkeit haben: Jeder muss sich individuell auf solche Fälle vorbereiten, mit Nachbarn und Freunden über das Thema sprechen, bis wir als gesamte Nation auf uns selbst aufpassen können. Ich schreibe dies wenige Tage nach der Tragödie in Orlando, Florida, bei der über 100 Opfer zu verzeichnen waren. Ich fürchte, bald könnten es Tausende, Zehntausende sein, und im Falle eines EMP-Schlags Hunderte von Millionen. Nur indem wir wirklich vorbereitet sind, als Einzelne und als Nation, vermögen wir unser Überleben gegen die Kräfte der Finsternis und des Hasses sicherzustellen.
Nun ja, eigentlich sollte dies eine Danksagung werden, und wenn Sie so weit gelesen haben, wird es langsam Zeit, mit dem wohlverdienten Dank an so viele loszulegen. Ohne die Unterstützung, das Vertrauen und die Anstrengungen meiner Freunde bei Tor/Forge Books könnten Sie diese Worte nicht lesen. Als ich vor 30 Jahren in dieser Branche anfing, begegnete ich bei einer Tagung Tom Doherty. Schon damals hoffte ich, eines Tages mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Er und seine Mannschaft sind das perfekte Verlagsteam, das man sich als Autor erhoffen kann. Danken möchte ich auch meiner Agentin, Eleanor Wood von der Spectrum Literary Agency, sowie ihrem Sohn und ihrer Tochter, die mittlerweile ebenfalls Teil der Firma sind. Seit über 25 Jahren arbeiten wir schon zusammen, stets stand sie mir als Freundin und Ratgeberin zur Seite. Besonderer Dank gilt meinen Freunden bei der Ascot Media Group. Als Public-Relations-Experten sind sie unübertroffen und spielten eine entscheidende Rolle darin, diese Romane über einen EMP-Schlag an die Öffentlichkeit und in die Medien zu bringen.
Wollte ich die Namen aller Freunde aufführen, die mir zur Seite standen, mir Ratschläge gaben und auf meine Arbeit einwirkten, würde es hier weitergehen wie in einer Dankesrede bei der Oscar-Verleihung. Aber wer dies liest, hat den Roman gekauft, um endlich den Abschluss der Geschichte zu lesen. Darum mache ich es, wie Lincoln zu sagen pflegte, ›kurz und bündig‹. Mein Dank geht an meine Freunde, Nachbarn und Kollegen in Black Mountain und am Montreat College. Sie akzeptierten bereitwillig, begrüßten es sogar, dass die Erzählung in unserer Gemeinde spielt. Ob die Krise nun eines Tages eintritt oder nicht, ein schöneres Zuhause gibt es auf der ganzen Welt nicht. Seit fast einem Vierteljahrhundert unterrichte ich inzwischen hier.
Kurz nachdem One Second After erschien, baten mich neu gewonnene Freunde von Carolina Readiness Supply, einen Vortrag bei einem Prepper-Treffen zu halten, das sie sponserten. Ich rechnete mit 50 Zuhörern oder so, stattdessen sah ich mich 600 Leuten in einem überfüllten Saal gegenüber! Das war erst der Anfang. In den sieben Jahren, die seitdem vergingen, bin ich Tausenden von Preppern begegnet … allesamt vernünftige Leute mit konkreten Wertvorstellungen, die an Gott und ihr Land glauben. Ich fühle mich geehrt, weil ich sie alle als Freunde betrachten darf. Abschließend möchte ich all jenen danken, die mich in meinem Leben etwas lehrten, angefangen bei Ida Singer über Russ Beaulieu und Betty Kellor bis hin zu Gunther Rosenberg sowie Männern wie Don King und William Hurt an meinem College. Ich hoffe, ich wurde euren Erwartungen gerecht.
In One Second After schrieb ich, dass ich inbrünstig darum bete, dass meine Bücher in 30 Jahren vergessen sein mögen. Sollte sich jemand daran erinnern, dann nur insofern, als das finstere Zeitalter, das ich heraufbeschwor, niemals anbrach und meine Tochter ihr Leben weiterhin in Frieden führen konnte. Dafür bete ich nach wie vor.
Früher glaubte ich mal, meine Regierung könne unsere Sicherheit gewährleisten, was Bedrohungen durch einen EMP-Schlag oder radikale Gruppierungen überall auf der Welt anbelangt. Heute hege ich da gewisse Zweifel, zumindest auf kurze Sicht. Darum, meine Mitbürger, lege ich meinen Glauben an eine friedliche Zukunft in eure Hände. An uns liegt es, vorausschauend zu handeln, damit diese durch und für das Volk geschaffene Nation nicht vom Erdboden getilgt wird.
William R. Forstchen
Juni 2016
PROLOG
Tag 920 seit Tag eins
Hier ist BBC News. Es ist drei Uhr morgens, Greenwich War Time, an diesem 920. Tag nach Kriegsausbruch. Wir sind auf Sendung für unsere Freunde in der westlichen Hemisphäre.
Im Rahmen der Sendung folgt ein detaillierter Bericht über die tragischen Auswirkungen des groß angelegten nuklearen Schlagabtauschs zwischen Indien und Pakistan, gefolgt von einer Reportage über die Situation im Nahen Osten, wo der Konflikt zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten weitertobt – mit Ausnahme von Jordanien, dessen Führung heute erneut bekräftigte, dass es zu dem Bündnis mit Israel gegen das Kalifat und dessen Verbündete steht.
Doch zunächst die Nachrichten aus den Vereinigten Staaten:
Heute hat die selbst ernannte Bundesregierung mit Sitz in Bluemont erklärt, die früheren Bundesstaaten Virginia und Maryland auf Stufe-eins-Status gehoben zu haben. Nach interner Definition bedeutete das, alle Kräfte im vermeintlichen Konflikt mit der ›Rekonstituierten Obersten Bundesbehörde in Bluemont‹, wie sie sich selbst bezeichnet, wurden befriedet.
Zu Beginn des Jahres gab die Regierung in Bluemont bekannt, ihre Pläne zum Aufbau der Army of National Recovery – der Armee des Nationalen Wiederaufbaus, gemeinhin als ANR bezeichnet – aufgegeben zu haben. Die heutige Mitteilung, wonach in beiden mittelatlantischen Staaten der Status vollständiger Stabilität erreicht wurde, geht den Angaben zufolge auf Einsätze herkömmlicher US-Streitkräfte zurück. Die Regierung in Bluemont erklärte, den Sieg hätten Einheiten errungen, die von der Konfrontation mit der chinesischen Besatzungsmacht im Westen abgezogen wurden, sowie weitere Truppenteile, die am Tag des Kriegsausbruchs in Übersee stationiert waren.
Nach weiteren Meldungen des Tages wird eine Expertenrunde in unserer Sendung die offenbar veränderte Ausgangssituation in Nordamerika analysieren.
Doch zunächst eine Botschaft an unsere Freunde in den chinesisch besetzten Westprovinzen Kanadas: »Der Stuhl lehnt an der Tür.« Ich wiederhole: »Der Stuhl lehnt an der Tür.«
KAPITEL EINS
Tag 920
»Erinnert ihr euch an den Anfang dieses Romans von Charles Dickens: ›Es war die beste aller Zeiten, es war die schlechteste aller Zeiten‹?«
Die Hände um einen warmen Becher Kaffee gelegt – das musste man sich einmal vorstellen, Kaffee, richtiger Kaffee – zitierte John Matherson flüsternd die bekannte Zeile. Er blickte zu seinem Freund Forrest Burnett, der mit dem kostbaren Mitbringsel bei ihm aufgekreuzt war. Aus Erfahrung wusste John, dass man besser nicht fragte, wo er es aufgetrieben hatte.
Forrest verzog das verwachsene Gesicht, entstellt von der in Afghanistan erlittenen Verwundung, zu einem Lächeln. Mit der Augenklappe sah er aus wie ein Pirat. »Stammt das nicht aus dem Film, in dem dieser französische Mob dem Typen zum Schluss den Kopf abhackt?«
»Ja, so ungefähr.« John schmunzelte.
»Der Kerl war verrückt, für seinen Freund einzuspringen und an seiner Stelle auf die Guillotine zu gehen. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, entkommt der andere, der gerettet wird, mit dem Mädchen. Der Streifen hat mir noch nie gefallen. Warum erwähnst du ihn?«
Mit einem Seufzen stand John auf, trat ans Fenster seines Büros und blickte ins Freie.
In diesem Spätherbst hatte es früh geschneit, das College-Gelände von Montreat lag unter einer 15 Zentimeter hohen Schneedecke. Mindestens 15 Zentimeter, eher mehr. Alte Hasen, die anhand der Zahl behaarter Raupen und Nüsse sammelnder Eichhörnchen die Entwicklung des Wetters vorhersagen konnten, prophezeiten einen harten Winter. Anscheinend lieferte dieser frühe Novemberschnee die ersten Anzeichen dafür.
Vor Tag eins war der erste Schnee für John immer eine Zeit der Erholung und glücklicher Erinnerungen gewesen. In der Regel fiel dann auf Basis der Vorwarnungen des Weather Channel im Internet der Unterricht aus. Dann legte er sich ein paar Holzscheite mehr zurecht und machte es sich den ganzen Tag mit einem Buch vor dem Kamin gemütlich, während Jennifer und Elizabeth draußen spielten, um danach klitschnass hereinzukommen und heißen Kakao zu trinken. Später am Abend spielten sie dann Cluedo oder Monopoly. Und falls der Strom ausfiel, na und? Das machte es nur umso gemütlicher, die ersten paar Tage zumindest. Man übernachtete vor dem Kamin und sah zu, wie der Wald immer tiefer zuschneite.
Damals, vor Tag eins …
Jennifer war tot. Seine älteste Tochter Elizabeth, ganze 19 Jahre alt, war bereits Mutter und hatte einen zweijährigen Sohn. Vor Kurzem machte sie den nächsten Schritt und zog aus dem gemeinsamen Haus in Montreat aus. Sie hatte Seth Robinson geheiratet – den Sohn seines alten Nachbarn und guten Freundes Lee – und wohnte nun bei ihrem Ehemann, außerdem erwarteten die beiden ein weiteres Kind.
Auch das hatte sich nach Tag eins verändert. Noch vor wenigen Jahren hieß es, 25 sei das neue 18. Von jungen Leuten erwartete man in der Regel, dass sie aufs College gingen, ihren Abschluss machten, den ersten Job auf der Karriereleiter in Angriff nahmen und nach gelegentlichen Dates den richtigen Partner fanden, sich häuslich niederließen, um im Alter von 28 bis 30 Jahren endlich eine Familie zu gründen. Jetzt war es wieder wie zu Zeiten des Bürgerkrieges – mit 16 oder 17 wurde geheiratet. Ein unverheiratetes Mädchen mit 21 Jahren betrachtete man so langsam als alte Jungfer.
Ja, die Umstände hatten sich verändert, und der Historiker in John sah darin so etwas wie den Rückfall auf Urinstinkte: Verlor ein Stamm, eine Stadt, ein ganzes Land durch einen Krieg so viele Menschenleben, fand ein Paradigmenwechsel statt. Man heiratete jung, um frühzeitig eine Familie zu gründen – etwa im Zuge des sogenannten Babybooms der späten 1940er und 1950er.
Jen, am anderen Ende dieses Altersspektrums angesiedelt – die gute, alte Jen, seine Schwiegermutter aus der ersten Ehe mit Mary –, weilte nicht mehr unter den Lebenden. In einer anderen Zeit wäre sie vielleicht fünf, womöglich sogar zehn bis 15 Jahre älter geworden. Aber es gab eben keine Krankenhäuser und Medikamente mehr, um das Leben zu verlängern, und so geschah mit den Alten etwas, das man von primitiven Völkern kannte. Erlebten sie zu viel Schlimmes, erlosch bei vielen der Lebenswille.
Im August war sie sanft entschlafen. Nach Tag eins hatte John es viel zu oft erlebt – eines Tages verkündeten die alten Leute völlig ruhig, sie hätten genug vom Leben mit all seinen Schicksalsschlägen und es sei für sie an der Zeit zu gehen. Eines Abends fand er sie allein draußen auf der Glasveranda, sie saß da und plauderte vergnügt mit ihrem imaginären Ehemann, der kleinen Jennifer und ihrer Tochter – Johns Ehefrau Mary, die lange vor Tag eins gestorben war. Jen unterhielt sich mit den Geistern der Vergangenheit. John blieb schweigend stehen und lauschte, während sie leise über Antworten lachte, die er nicht hörte.
Lautlos war Makala an seine Seite getreten und hörte ebenfalls zu, während ihr die Tränen übers Gesicht rannen. Schließlich führte sie John ans andere Ende des Hauses, erklärte ihm, er solle Jen in Ruhe lassen, als Krankenschwester habe sie so etwas oft erlebt. Es sei ein deutliches Zeichen dafür, dass ihre Angehörigen, die bereits im Jenseits weilten, sich um sie versammelten, um ihr auf der letzten Reise beizustehen.
An jenem Abend bestand Jen darauf, nicht in ihrem Bett, sondern auf der Veranda zu schlafen, von wo aus man einen Blick auf das Grab der kleinen Jennifer hatte. Am nächsten Morgen fanden sie sie dort. Auf den ersten Blick wirkte es, als schliefe sie lediglich.
Sie begruben sie neben Jennifer. Noch ein Faden gekappt, der John mit seinem früheren Leben verband.
Selbst sein vertrautes Büro gab es nicht mehr, es war im Frühjahr bei der Schlacht mit Fredericks ausgebrannt. Also wurde beschlossen, das, was davon übrig war, ins College-Gelände oben in Montreat zu schaffen und im Untergeschoss von Gaither Hall eine neue Stadtverwaltung einzurichten – eine Entscheidung, die logisch schien, nachdem es bei jener Schlacht bereits als Ausweichhauptquartier gedient hatte. Jemand hatte den Vorschlag gemacht, das mittlerweile leer stehende Büro des College-Präsidenten dafür zu nutzen, doch mit diesem Gedanken konnte John sich nicht anfreunden.
Jene Räumlichkeiten besaßen für ihn eine zutiefst symbolische Bedeutung. Jedes Mal wenn eine Sondersitzung mit Vertretern des stetig wachsenden ›Staates Carolina‹ anstand, schloss er sie auf, damit sie dort tagen konnten. An der Wand gegenüber dem Schreibtisch des College-Präsidenten, genau in der Mitte, hing das bekannte Gemälde mit dem knienden George Washington beim Gebet in Valley Forge. Es erinnerte John an seinen Freund Dan Hunt, der dieses Büro einst genutzt hatte und gleich im ersten Jahr nach Kriegsausbruch gestorben war.
Johns neues Büro unten im Keller von Gaither Hall lag nur einen kurzen Fußmarsch von seinem Zuhause entfernt. Ein Stück den Hügel hinunter fand man die neue ›Fabrik‹, der sie den Namen Dreamworks gegeben hatten. In den Mauern des früheren Anderson Auditoriums lief die Serienfertigung neuer Stromgeneratoren. Ferner gab es eine Drahtfabrik zur Herstellung von Kupferkabeln für die Generatoren und zum Verlegen von Stromleitungen in der Siedlung.
Aufgrund von Spannungsschwankungen flackerte das elektrische Licht in Johns Büro regelmäßig. Immerhin war alles nur notdürftig zusammengeschustert, sie tasteten sich langsam an die ungewohnte Materie heran.
Das Schneetreiben nahm zu, Flocken wirbelten über die kleine Wiese unterhalb von Gaither Hall, starr ragte die reichlich mitgenommene US-Flagge, die sie während der Luftschlacht mit Fredericks’ Apache-Hubschraubern gehisst hatten, in den steifen Nordostwind.
Zuzusehen, wie der erste Herbstschnee fiel, hatte früher tatsächlich zu den ›besten aller Zeiten‹ gehört. John gab sich Mühe, nicht in Wehmut zu versinken. Er saß hier, trank richtigen Kaffee, der Raum wurde von einer richtigen Glühbirne erhellt und der Kaminofen, den die Studenten installiert hatten, verströmte eine angenehme Wärme, wie sie nur ein holzbefeuerter Ofen lieferte.
»Warum so niedergeschlagen, John?«, wollte Forrest wissen.
John hörte, wie ein Streichholz angerissen wurde, und als er über die Schulter blickte, lehnte Forrest sich auf seinem Stuhl zurück und zündete sich eine Zigarette an. Eine Zigarette! Grundgütiger, wie gern hätte er jetzt eine geraucht, doch das Versprechen gegenüber seiner sterbenden Tochter hielt ihn davon ab – ebenso wie der zu erwartende Anfall von Makala, sollte sie je in seinem Atem Zigarettenrauch riechen. Allerdings trat er einen Schritt näher und atmete genüsslich den Tabakqualm ein, der in der Luft hing.
»Ach, nichts, der Schnee bringt heute Vormittag nur so viele Erinnerungen zurück«, erwiderte John, während er wieder auf dem Bürosessel Platz nahm. Er hielt den Blick weiterhin auf die im Wind tanzenden Schneeflocken gerichtet. Lachen schallte heran und er erhaschte ein paar seiner Studenten, die mit einem behelfsmäßigen Schlitten den Hang hinunterrutschten. Junge Leute, abgehärtet vom Krieg und schwerer Knochenarbeit, die von den Kämpfen des Frühjahrs bei Gaither Hall angerichtete Schäden beseitigten. Gerade legten sie eine Pause ein und verhielten sich für ein paar Minuten wie Kinder. Bald würde ihr Kommandeur, Kevin Malady, herauskommen und sie auffordern, sich wieder an die Arbeit zu machen. John genoss es, ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich amüsierten.
»Ja, geht mir auch so«, erwiderte Forrest. Sein Blick verlor sich in weiter Ferne, während er sich mit der verbliebenen Hand gedankenverloren am Stumpf des fehlenden Arms kratzte.
»Spürst du ihn wieder?«, fragte John.
»Phantomglied sagen die dazu.« Forrest lachte in sich hinein. »Ja, es fühlt sich an, als wäre er immer noch da. Juckt wie der Teufel. Das versaut mir jede Erinnerung an Schnee.« Mit der gesunden Hand deutete er auf den fehlenden Arm, anschließend auf die Augenklappe.
»Als junger Kerl bin ich gern auf die Jagd gegangen. Drüben an der Nordseite des Mount Mitchell haben wir immer viel mehr Schnee abgekriegt als ihr hier. Da ließen sich Rotwild, Füchse und Bären leicht aufspüren. Meine Freunde und ich, wir haben im Schnee unser Zelt aufgeschlagen, uns einen Hirsch geschossen und sind dann tagelang in den Wäldern geblieben. Dort haben wir uns vom Wildbret und Mais oder ein paar Kartoffeln ernährt, die wir dabeihatten.« Er lächelte wehmütig. »Und natürlich von reichlich Bier und ein bisschen selbst gezogenem Gras. War viel besser, als in der Schule in einem stinklangweiligen Geschichtsunterricht zu sitzen. Wenn man bedenkt, was aus der Welt geworden ist, hat uns das viel besser auf die Zukunft vorbereitet.«
»Für jemanden, der den Geschichtsunterricht so augenscheinlich hasst, kennst du dich aber verdammt gut aus«, verkündete John mit einem Lächeln.
»Stimmt, du warst ja mal Geschichtsprofessor. Was hat es dir denn gebracht, als es drum ging, in diesem Schlamassel zu überleben?«
»Manchmal können Erfahrungen aus der Vergangenheit durchaus hilfreich sein, Forrest.«
»Okay, ich schätze, es half dabei, den Laden zu schmeißen und eure ›Erklärung‹, wie ihr sie nennt, aufzusetzen. Wird nicht viel dabei rauskommen, falls die ganzen BBC-Berichte stimmen.«
»So bin ich immerhin auch auf die Idee gekommen, wie wir mit der Posse fertigwerden.«
»Willst du damit sagen, du hast Hannibals Plan für die Schlacht von Cannae benutzt?«
Das entlockte John ein Grinsen. »Anscheinend kennst du dich doch besser in Geschichte aus, als du vorgibst, Forrest. Daran erkennt man einen guten Anführer. Das warst du 100-prozentig und bist es immer noch.«
»Genau das hätte mich daran hindern sollen, mich freiwillig für diesen Sondereinsatz in Afghanistan zu melden. So wie die den Krieg führten, als ich dort eintraf, drohte uns ein zweites Vietnam. Errichtet Verteidigungsstellungen, zieht den Kopf ein, bloß nicht schießen, selbst wenn einem die Kugeln um die Ohren fliegen. Den Bösen wurde das restliche Territorium überlassen, während wir herumirrten wie Vollidioten, um ›das Vertrauen der Bevölkerung‹ zu gewinnen.«
Forrests Augen streiften zum Unwetter draußen, während er einen letzten Zug bis zum Filter nahm und die Zigarette verglimmen ließ. Er stand auf, trat ans Fenster, zog den dünnen Vorhang zurück und blickte seufzend hinaus.
»Als ich mir die Scheiße hier in Afghanistan einfing, war es ein Tag wie heute.« Erneut deutete er auf die Augenklappe und den fehlenden Arm. »Es war ein Tag zum Arschabfrieren. Der Gedanke an den rosaroten, gefrorenen Schneematsch verfolgt mich nach wie vor. Mein gesamter Trupp lag dort, in Stücke gerissen. Die Schritte knirschten im Schnee, als die Bastarde, die uns aufgelauert hatten, näher kamen, um sicherzugehen, dass wir auch wirklich alle tot waren. Sie nahmen uns Waffen und Ausrüstung ab. Daran muss ich jetzt immer denken, wenn ich Schnee sehe.«
John schwieg. So detailreich hatte sein Freund – noch vor sechs Monaten ein Feind, der ihn um ein Haar umgebracht hätte – bisher nie von dem Tag gesprochen, an dem es ihn in einem nunmehr fast vergessenen Krieg erwischt hatte.
Mehrere Minuten vergingen, während sie schweigend an ihrem geschmuggelten Kaffee nippten. Hin und wieder kreuzte Forrest mit einem derartigen Geschenk auf, wobei zwischen ihnen eine unmissverständliche Übereinkunft galt: »Keine Fragen stellen, Mund halten!« Forrest steckte sich eine weitere Dunhill an, rauchte sie halb auf. Er erstickte die Glut und verstaute den Stummel in der Brusttasche.
»Was verschafft mir die Ehre deines heutigen Besuchs?«, fragte John schließlich, denn es war ein verdammt langer Weg über die Berge, bei dem Forrests Polaris-Dreiachser einiges an kostbarem Sprit schluckte.
»Hast du es schon in den BBC-Nachrichten gehört? Roanoke wurde von der Regierung oben in Bluemont einkassiert.«
»Ja, ich wollte gerade vorschlagen, dass der Staatsrat an diesem Wochenende zusammentritt, um die Folgen zu erörtern. Wir müssen davon ausgehen, dass wir die Nächsten auf ihrer Liste sind.«
»So wie wir im Frühjahr ihre ANR-Einheit auseinandergenommen haben, hatte ich eigentlich mit einem sofortigen Gegenschlag gerechnet. Und dann – nichts! Aber ich glaube, mittlerweile tut sich was.«
»Deshalb sagte ich ja: ›die beste aller Zeiten, die schlimmste aller Zeiten‹«, erinnerte John, während er beobachtete, wie die letzten Rauchfahnen von Forrests Zigarette zur Decke aufstiegen und sich auflösten.
»›Die beste aller Zeiten, die schlimmste aller Zeiten.‹« Diesmal war Forrest derjenige, der es zitierte. »Nach dem ganzen Mist der letzten Jahre hatte ich auf einen friedlichen Winter gehofft.«
»Meinst du, wir kriegen Ärger?«
»Wenn du damit rechnest, dass die Scheiße eintritt, John, wirst du nie überrascht sein, wenn es so weit ist.«
»Danke für den fundierten Ratschlag.«
»Der Preis für eine gute Tasse Kaffee und dafür, dass ich dir eine Zigarette angeboten habe. Wie auch immer, abgesehen davon, potenziell schlechte Nachrichten zu überbringen, dachte ich mir, ich bleib ein paar Tage hier. Bei dem Sturm wär es ideal, deinen Kids beizubringen, wie man einen harten Winter überlebt.«
»Gute Idee! Was hat dich auf die Idee gebracht?«
»Nun, bevor das alles hier vorbei ist, werden sie eine Schlacht bei Temperaturen unter null kämpfen müssen, mein Freund. Drüben in den Bergen Afghanistans war es kälter als in Valley Forge, kälter als bei der Ardennenoffensive oder bei der Schlacht um den Changjin-Stausee in Korea. Die Afghanen kannten sich damit aus; die meisten von uns, die mit mir da draußen waren, nicht. So etwas möchte ich nie mehr erleben.«
»Meinst du wirklich, es kommt dazu?«
»Du etwa nicht?«
John antwortete nichts darauf. Im Moment hatte er zu viel anderes um die Ohren. Die Ernte reichte kaum, um die rasch wachsende Gemeinschaft über den Winter zu bringen, schon gar nicht bei diesem frühen Wintereinbruch. Ihnen fehlte die Zeit, weitere Vorräte einzulagern. Vor zwei Jahren hatte er sich lediglich um Montreat, Black Mountain und Swannanoa Sorgen machen müssen, doch im Überschwang, der auf ihren Sieg über die Regierungstruppen folgte, schlossen sich ihnen Dutzende weiterer Siedlungen an – im Süden bis nach Flat Rock und Saluda, im Norden bis hin zur Grenze nach Tennessee, im Osten bis zu den Ausläufern von Hickory, alles in allem fast 60.000 Menschen. Eine tragisch geringe Zahl, wenn man bedachte, dass in der Region früher mehr als eine halbe Million Einwohner gelebt hatten.
Selbstverständlich wurden die Leute, die in den kläglichen Resten von Asheville überlebt hatten, mit Freuden aufgenommen, doch brachten sie keine nennenswerten Ressourcen ein, da sie von der Hand in den Mund gelebt und alles geplündert hatten, was in jener vormals exklusiven, am New Age orientierten Stadt zu holen war. Von den Hinterwäldlern aus Kaffs wie Marion, selbst Morganton, konnten sie schon mehr erwarten. Dort existierten ähnliche Gruppierungen wie jene, die Forrest anführte. Sie steuerten den Zugang zu Nahrungsmitteln und Fertigkeiten bei, die wirklich zählten in dem Gebilde, das mittlerweile alle als ›Staat Carolina‹ bezeichneten.
Forrest war nicht unbedingt redselig, darum schwieg John. Dieser Mann hatte noch etwas anderes auf dem Herzen und rückte am ehesten damit raus, wenn man ihm etwas Zeit ließ.
»Gestern kam jemand in mein Camp«, meinte der andere schließlich. »Ich schlage vor, du fährst mit mir zurück und siehst ihn dir mal an.«
»Warum? Was ist das für ein Typ?«
»Ein paar von meinen Leuten fanden ihn, als er auf der Interstate 26 rumirrte. Der arme Kerl wirkt ziemlich mitgenommen – mehrere Rippen gebrochen, schlimme Erfrierungen und jetzt kriegt er auch noch eine Lungenentzündung. Unterwegs wurde er von Marodeuren überfallen und übel zusammengeschlagen. Wahrscheinlich macht er es nicht mehr lange, darum hielten wir’s für besser, dass er bleibt, wo er ist, und du kommst zu ihm.«
John sagte erst einmal nichts. Forrest neigte keineswegs zu Extremreaktionen. Vor einigen Monaten war er nach Black Mountain gekommen, gut 50 seiner Leute im Schlepptau, nachdem Fredericks’ Apaches einen Luftschlag gegen sie geführt hatten. Forrest fing sich damals einen Bauchschuss ein, lehnte aber zunächst jede Behandlung ab und bestand darauf, erst seine Leute versorgen zu lassen. Wenn dieser Mann ihren Flüchtling für nicht transportfähig hielt, stellte John seine Entscheidung nicht infrage.
»Wer ist er?«
»Sagt, er sei Major in der regulären Army. Behauptet, er habe vor Jahren mit dir gedient, heiße Quentin Reynolds und sei Teil der Army-Einheit gewesen, die Roanoke einnahm.«
»Quentin?«, flüsterte John. Der Name sagte ihm etwas, aber wenn sie zusammen gedient hatten, musste es bald 20 Jahre her sein.
»Er sagt, er sei Adjutant von General Bob Scales, der da oben das Sagen hat.«
»Bob Scales?« Als John das hörte, fuhr er kerzengerade hoch. Damals, als der EMP-Schlag sie traf, hatte er gerade mit Bob im Pentagon telefoniert. Johns gesamte Army-Laufbahn hindurch war Bob sein Mentor gewesen. Als John den Militärdienst quittierte, um Mary während ihrer letzten Monate in der Stadt zu pflegen, in der sie aufgewachsen war, hatte Bob ihm über seine Beziehungen die Stelle in Montreat besorgt. »Bob lebt?«
»Das hat er nicht gesagt. Bloß dass er unter ihm gedient hat.«
»Trotzdem muss ich mit ihm reden.« John reagierte ganz aufgeregt. Er schielte durchs Fenster. Der Sturm wurde stärker. »Meinst du, wir kommen durch, wenn wir heute noch aufbrechen?«
»Wenn es hier unten schon so aussieht, möchte ich es nicht riskieren, den Craggy und die Mount-Mitchell-Kette zu überqueren. Schon gar nicht, wenn die Nacht vor der Tür steht. Es war ziemlich stürmisch, als ich heute Morgen rüberkam. Besser, wir warten, bis der Wind sich legt.«
»Verdammt!« John seufzte. »Dieser Quentin … meinst du, er kommt durch?«
»Kann ich nicht sagen, um ehrlich zu sein. Hatte nur so ein Bauchgefühl, dass ich besser direkt rüberkomme, um dir Bescheid zu geben. Wie auch immer, wer ist dieser Bob Scales überhaupt?«
»Ich habe vor Jahren mit ihm gedient und dachte, er sei umgekommen, als alles zusammenbrach. Falls er oben in Roanoke das Sagen hat, mein Gott, dann will ich alles darüber wissen.«
Der Anblick von Paul Hawkins riss John aus seinen besorgten Gedanken. Paul kam, den Kopf tief gegen den Sturm gebeugt, über die Wiese gerannt und platzte samt einem kalten Windstoß ins Büro. Forrest raunzte ihn an, er solle die verfluchte Tür zumachen.
»John, du musst mitkommen und dir das ansehen!«, rief Paul, ein breites Grinsen im Gesicht. Der ganze Schnee, der ihm von der breiten Hutkrempe tropfte, ließ ihn ziemlich grotesk wirken.
Paul und seine Frau Becka waren diejenigen gewesen, die im Keller der College-Bibliothek die gesammelten Jahrgänge des Journal of the AIEE aufgetrieben hatten, des American Institute of Electrical Engineers. Das offizielle Mitgliederorgan des amerikanischen Berufsverbands der Elektrotechniker. Angefüllt mit Diskussionen und Debatten über die neue Wissenschaft der Elektrotechnik, dazu detaillierten Patentanmeldungen von Leuten wie Edison, Tesla und Westinghouse, entfachte diese Entdeckung den Plan, die Stromversorgung wieder zum Laufen zu bringen. Sie lieferte quasi eine ›Anleitung‹, wie sich ihre Gemeinschaft wieder ans Netz bringen ließ.
»Was gibt’s denn, Paul? Im Moment bin ich ziemlich beschäftigt mit einer Nachricht, die Forrest mir mitgebracht hat.« Mit einer Kopfbewegung deutete er auf seinen in der Ecke sitzenden Freund.
»Kann ich nicht erklären, das musst du dir selber ansehen. Du auch, Forrest.«
John wandte sich an seinen Besucher von der anderen Seite des Passes.
»Bist du sicher, dass wir heute nicht mehr zurück über den Berg können?«, fragte er ungeduldig.
Forrest schüttelte den Kopf. »Vielleicht morgen früh bei Tagesanbruch.«
John war nicht so dumm, das Urteil anzuzweifeln. Er seufzte. Also musste er warten. Er drehte sich zu Paul um und nickte lächelnd.
»Na gut, dann wollen wir mal sehen, warum du so darauf brennst.«
Wenn Paul der Meinung war, eine Sache wäre es wert, dafür raus in einen Blizzard zu gehen, versprach es zumindest interessant zu sein.
Sie zogen ihre Jacken über und folgten Paul mit eingezogenen Köpfen in den Sturm. Forrest fluchte in einer Tour, während sie den Fußweg zur alten Bibliothek hinaufstiegen. Der Wind blies so heftig, dass John einsah, dass Forrest recht hatte. Es wäre glatter Selbstmord gewesen, bei diesen Witterungsverhältnissen die über 1800 Meter hohe Bergkette zu überqueren.
Die Bibliothek, ein Gebäude, das architektonisch noch nie so recht zu den übrigen auf dem Gelände passen wollte, meist klassisch aus hiesigem Gestein errichtet, hatte ihnen schon länger Sorgen bereitet. Die Decken waren undicht und schon vor Tag eins waren die Sammlungen wegen Feuchtigkeit und Schimmel ein ganzes Semester lang nicht zugänglich gewesen.
Sobald John drinnen war und Hut und Schal abgelegt hatte, holte er tief Luft und wusste, dass seine Allergien ihn bald im Griff haben würden. Der überwiegende Teil des Gebäudes lag im Dunkeln, in der Ferne hallte das Geräusch tropfenden Wassers. Der Schein einer einsamen Lampe fiel durch die Schwingtür, die in den hinteren Bereich führte, in dem Paul mit seiner jungen Frau eingezogen war. Sie wohnten lieber dort als in einem der stattlichen, nun leer stehenden Häuser oder in einer der Blockhütten, von denen es rings um den Campus unzählige gab. Wenigstens herrschte in ihrem Abschnitt des riesigen Gebäudes angenehme Wärme, da ein großer Holzofen brannte. Becka war da, auf jedem Arm einen neugeborenen Zwilling balancierend – ein Anblick, bei dem John lächeln musste. Er hauchte ihr einen Kuss auf die Stirn.
»Wie geht’s, junge Lady?«
»Dank Makalas Hilfe und Fürsorge deutlich besser.« Während sie das sagte, regte sich eines der Neugeborenen und quengelte leise, um sich sofort wieder an seine Mutter zu schmiegen.
Wie so oft bei Zwillingen waren sie einen Monat zu früh gekommen. Unter anderen Umständen wäre das kein großes Problem gewesen, weil fast jede Klinik über eine Intensivstation für Frühchen verfügte. Doch jetzt? Die Babys waren im alten Hotel, dem Assembly Inn auf der anderen Seite des Campus, zur Welt gebracht worden, umfunktioniert zum örtlichen Krankenhaus. Johns Frau, bei der es in zwei Monaten so weit war, hatte alles in die Hand genommen und die drei gar nicht erst in ihre behelfsmäßige Wohnung zurückkehren lassen, sondern gleich bei sich zu Hause behalten und im Wintergarten eine Säuglingsstation eingerichtet, um ihnen in den ersten entscheidenden Wochen nicht von der Seite zu weichen.
Für John war es eine äußerst emotionale Erfahrung, als er spätnachts die Schreie von Neugeborenen durchs Haus schallen hörte und mitbekam, wie Makala, selbst hochschwanger, jede Nacht für sie aufblieb und am Morgen eines der Mädchen im Arm wiegte, während eine erschöpfte Becka das andere stillte.
Als es mit Johns Tochter, Jennifer, zu Ende ging, war der Wintergarten ihr Krankenzimmer gewesen, dort starb sie schließlich. Auch seine Schwiegermutter, Jen, war unweit dieser verglasten Veranda entschlafen. John bemühte sich, in dieser Umgebung einen Ausgleich zwischen Tod und neuem Leben zu finden. Ein klein wenig linderte es seine Trauer und milderte die Erinnerungen ab, die ihm förmlich das Herz zerrissen.
John widerstand der Versuchung zu fragen, ob er eines der Zwillingsmädchen für einen Augenblick halten dürfe. Makala hatte ihm mehrfach verdeutlicht, dass es in dieser stark keimbelasteten Welt am besten war, wenn man Neugeborene in den ersten paar Monaten möglichst wenig Kontakten aussetzte. Paul drückte Becka einen flüchtigen Kuss auf die Stirn und deutete nach einem zärtlichen Blick auf die Mädchen auf die Tür zum Untergeschoss.
John und Forrest folgten ihm in die Düsternis. Am Fuß der Treppe betätigte Paul einen Schalter, und eine einsame Leuchtstoffröhre erwachte flackernd zum Leben. Daran hatten John und Forrest sich immer noch nicht richtig gewöhnt – ein Druck auf den Schalter, und das Licht ging an. Das Stromnetz der Stadt breitete sich erst langsam vom Lake Susan her aus. Quer durch den Staat North Carolina liefen bereits ein halbes Dutzend weiterer Projekte zur Nutzung von Wasserkraft, dennoch beschränkte sich die Stromversorgung strikt auf öffentliche Einrichtungen und auch für sie auf sechs Stunden am Tag. Für das riesige Untergeschoss der Bibliothek hatten Paul und Becka eine Ausnahmeregelung erwirkt. Diese versetzte sie in die Lage, ihren Arbeitsbereich zu beleuchten, indem sie, solange der Strom floss, alte Taschenlampen aufluden und an die Decke hängten, um weiter ›in der Vergangenheit zu wühlen‹, wie sie es nannten. So wie Paul sich aufführte, schien er wieder auf etwas Wichtiges gestoßen zu sein.
Staunend ließ John den Blick durch das Bibliotheksmagazin schweifen. In der Luft lag der strenge, beunruhigende Geruch nach Moder, Schimmel, Mäusedreck und Zigtausenden langsam vor sich hin gammelnder Bücher und Zeitschriften. Er blieb stehen, um sich einen Stapel anzusehen, den Becka, wie sie sagte, ›sichtete‹, einen riesigen Stoß Life-Magazine, die bis in die 1930er zurückreichten. Bei dem Anblick musste er unweigerlich an früher denken – wie er als kleiner Junge mit einer schweren Grippe im Bett gelegen hatte. Alle paar Tage hatte seine Mutter ihm Zeitschriften aus der Bibliothek mitgebracht, über die Ära des Zweiten Weltkrieges und über die Hundertjahr-Feierlichkeiten der frühen 1960er zum Gedenken an den Bürgerkrieg. Damit legte sie die Grundlagen seiner Begeisterung für geschichtliche Ereignisse, die ihn ein Leben lang begleiten sollte.
Life, Look, Saturday Evening Post, Newsweek, Time Magazine, sogar ein Stapel Mad-Hefte. Sie riefen ein wehmütiges Lächeln hervor und ließen ihn voller Schwermut an die verlorene Welt denken – nicht nur an die seiner Kindheit, sondern an die Welt, die sie alle verloren hatten.
»Hier hinten, Leute!«, rief Paul und winkte sie zu sich. John beschloss, irgendwann herzukommen, sollte er bei all seinen Sorgen und Projekten je die Zeit dazu finden, um vielleicht einen ganzen Tag mit den Mad-Comics und den verrückten Illustrationen von Don Martin zu verbringen, den Stapel des Boys’ Life Magazine nach Kurzgeschichten von Ray Bradbury zu durchforsten oder sich anhand der Titelbilder der Saturday Evening Post die verschwundene Welt eines Norman Rockwell in Erinnerung zu rufen. Forrest blätterte gierig durch einen abgegriffenen Playboy. John fragte sich, wie jemand auf die Idee kam, so etwas für den College-Buchbasar zu spenden.
Forrest zuckte mit den Schultern. »Früher habe ich mir den immer gekauft, die Artikel waren gar nicht so schlecht«, lieferte er die altbekannte Rechtfertigung. John musste lachen, die reinste Freude, denn mittlerweile hatte er nicht mehr allzu viel zu lachen. »Wirklich, ich steh auf Jean Shepherd – du weißt schon, der Typ, der diesen Weihnachtsfilm über den Jungen mit der Luftpistole geschrieben hat. In dieser Ausgabe ist ’ne Geschichte von ihm.«
Ungläubig schielte er ihm über die Schulter, um festzustellen, dass er tatsächlich eine Geschichte von ›Shep‹ aufgeschlagen hatte. Als Kind hatte John Shep immer im Radio gehört, einmal hatte er sogar genau die gleiche Ausrede gebraucht, als seine Mutter hinter seinem Schreibtisch einen Stapel des anrüchigen Magazins entdeckte.
»Kommt schon, ihr beiden, legt die Zeitschrift weg.« Paul winkte ungeduldig nach hinten ins Kellerlabyrinth.
John folgte ihm, vorbei an einem Tisch, auf dem sich Hilfsmittel für den Unterricht stapelten, die man schon vor Jahrzehnten ausgemustert hatte: alte Dukane-Geräte. Dabei handelte es sich um an einen Plattenspieler angeschlossene 35-Millimeter-Projektoren. Sobald die Schallplatte ein hohes Piepen von sich gab, wechselte das Dia – aus lauter Übermut versuchten die Studenten im Sozialkundeunterricht dauernd, das Geräusch nachzuahmen, um die Tonsteuerung aus dem Konzept zu bringen. Daneben standen Overheadprojektoren, die man mit der Einführung von PowerPoint aufgegeben hatte, ganze Stapel alter Acht-Spur-Kassetten, klassische Langspielplatten, mit denen man nichts mehr anfangen konnte. Gesucht waren hingegen Schellackscheiben mit 78 Umdrehungen pro Minute, weil manche auf dem Dachboden oder im Keller noch aufziehbare Plattenspieler aufgetrieben hatten. Außerdem gab es Mimeografen, alte Vervielfältigungsapparate, mit denen nach Tag eins auch John herumexperimentiert hatte, aber die benötigte Kopierlösung mit ihrem charakteristischen Alkoholgeruch war nirgends aufzutreiben und es sah sich auch niemand imstande, sie herzustellen. Allein der Anblick dieser alten Apparate rief in John Erinnerungen daran wach, wie es früher gerochen hatte, wenn der Lehrer eine Aufgabe oder ein Arbeitsblatt austeilte, bei dem die blaue Tinte verschmierte, weil sie noch nicht ganz trocken war.
IBM Selectrics standen da, ein gutes Dutzend, wenn nicht mehr, elektrische Kugelkopfschreibmaschinen; auch die hatte John nach Tag eins inspiziert in der Hoffnung, dass er die Farbbänder vielleicht für seine seit Langem verschlissene manuelle Underwood-Schreibmaschine verwenden konnte. Ein paar Singer-Nähmaschinen aus den Tagen, als das College noch eine Bildungseinrichtung ausschließlich für Frauen gewesen war, wahrscheinlich brachten sie den Studentinnen damals vorwiegend Hauswirtschaft bei. Johns Blick fiel auf eine Standuhr, eine richtige Standuhr, aus der ließe sich unter Umständen etwas machen, doch dann stellte er fest, dass Gewichte und Pendel lediglich Attrappen waren und obenauf ein zusammengerolltes Stromkabel lag. Ganz hinten in einer Ecke stand – nicht zu fassen! – ein Flipperautomat, ein klassischer Black Knight. John erinnerte sich, dass er im Aufenthaltsraum gestanden hatte, als er als Lehrkraft ans College kam.
In der hintersten Ecke dieser zerfallenden Goldmine voller verlorener Erinnerungen und entschwundener Technologien blieb Paul vor einem Arbeitstisch stehen. Er lächelte wie ein Fremdenführer in der Tropfsteinhöhle, so voller Stolz auf sein Reich, als hätte er es selbst erschaffen.
Er deutete auf einen hellbraunen Kasten, auf dem das Firmenlogo gleich oberhalb der Tastatur prangte – ein Apple IIe, ein uralter Computer aus der 8-Bit-Ära.
»Du hast einen antiken PC gefunden. Ja, und …?« John verstummte.
»Sieh mal!« Nach wie vor grinsend betätigte Paul mit einer schwungvollen Geste erst die Einschalttaste des 14-Zoll-Monitors, dann die des Computers.
Der Bildschirm leuchtete auf und warf seinen flackernden Schein in den Raum, während er warm lief, um in herrlichen RGB-Farben das Apple-Logo zu präsentieren.
Verblüfft trat John tatsächlich einen Schritt zurück. Fast kam er sich vor wie ein primitiver Stammeskrieger. Eine Erinnerung an die Teddybär-Wesen aus einem der Star Wars-Filme blitzte in ihm auf, wie sie vor Staunen und Ehrfurcht halb ausflippten, als sie C-3PO durch die Luft schweben sahen, nachdem Luke die Macht eingesetzt hatte.
»Mein Gott, er funktioniert?«, stieß Forrest hervor.
»Natürlich funktioniert er. Seht euch das an!«
Er schob eine alte 5,25-Zoll-Diskette in eins der Laufwerke, es fing an zu rotieren und zu klicken, und alle drei standen sie schweigend da, während die Sekunden verstrichen. Schließlich drang blechern und kaum hörbar eine vertraute Melodie aus dem Monitorlautsprecher. Das Pac-Man-Logo erschien auf dem Schirm.
»O mein Gott«, flüsterte John ehrfürchtig. Vor lauter Wehmut kamen ihm fast die Tränen. Als Elizabeth fünf gewesen war und sich von einer längeren Grippe erholte, hatte Mary ihren alten Apple-Computer vom Dachboden geholt, ihn an Elizabeths Bett aufgestellt und sie einen ganzen verregneten Frühlingstag lang mit den Spielen unterhalten, mit denen sie und John sich während ihres Studiums an der Duke University die Zeit vertrieben hatten.
Seine Magisterarbeit war auf einem solchen Modell entstanden. Er brauchte über 20 Disketten, um seine Abhandlung über zur Artilleriesteuerung entworfene Proto-Computer vor dem Ersten Weltkrieg zu speichern. Viele Studenten beneideten ihn darum, sogar manche Professoren, die ihre Arbeiten noch auf elektrischen Schreibmaschinen tippten oder gerade erste zaghafte Schritte auf IBM Micros unternahmen, wie man die ersten Personal Computer damals nannte. Allein die abschließende Rechtschreibprüfung hatte mehrere Tage in Anspruch genommen – ein Wunder der Technik, wo die anderen doch jemand aus dem Studiengang Englisch bezahlen mussten, um ihre Arbeit von Hand korrigieren zu lassen. Danach mussten sie alles noch einmal tippen.
Mithilfe eines brandneuen, teuren 2400-Baud-Modems war es ihm tatsächlich gelungen, über ein System, das man Internet nannte, umfangreiche Zeichenfolgen einzutippen, um an Material der British Library zu gelangen, allerdings ohne Erfolg. Trotzdem empfand er es zu jener Zeit als faszinierendes Abenteuer. Das Ausdrucken auf dem Nadeldrucker mit Endlospapiereinzug hatte einen weiteren halben Tag in Anspruch genommen. John erinnerte sich noch gut daran, wie langsam alles ging, an das Sirren, mit dem die Nadeln über die Seite glitten, die kleine Pause, während der Einzugsmechanismus das Papier eine Zeile weiterschob und der Druckkopf in die Ausgangsposition zurückkehrte.
»Habt ihr drei was dagegen, wenn ich zu euch komme?«
John blickte zurück zur im Dunkeln liegenden Treppe und rang sich ein freundliches Lächeln ab. Ernie Franklin, der Mann, der ihm bei der endgültigen Konfrontation mit Dale Fredericks das Leben gerettet hatte. Selbstverständlich war er ihm dankbar, aber mitunter konnte der Kerl sich ganz schön aufspielen.
»Ich habe Ernie über meinem Fund informiert«, flüsterte Paul.
»Warum?«, wollte Forrest wissen.
»Damals, zur Zeit der Apollo-Raumsonden und Space Shuttles, hat er bei IBM gearbeitet. Ich dachte mir, der alte Mann kennt sich vielleicht damit aus.«
Ernie trat an den Tisch und musterte das Gerät mit einem Anflug von Empörung. »Das musste ja so kommen«, schnaubte er. »Ein verfluchter Apple. Verdammtes Spielzeug.«
»Ich habe meine Magisterarbeit auf so einem Rechner geschrieben«, protestierte John.
»Und dann waren alle gearscht, als Steve Jobs das Betriebssystem aufgab und mit diesen mickrigen kleinen Neun-Zoll-Macs loslegte. Wir haben uns totgelacht über euch Apple-Fanatiker, als ihr dann alle das veraltete IIe-System ohne Updates am Hals hattet.«
»Sekunde mal«, ging Paul dazwischen. »Ich hab dich hergebeten, um uns etwas zu erklären, Ernie. Wir können später darüber streiten, welches Betriebssystem das bessere ist.«
John nickte. Sein Blick glitt zur Pac-Man-Figur auf dem Monitor, während die blecherne Melodie weiter vor sich hin dudelte.
»Kannst du diese verfluchte Musik abstellen?«, meinte Ernie. »Meine Tochter war süchtig nach diesem bescheuerten Spiel. Es hat mich fast in den Wahnsinn getrieben.«
Paul starrte den Apparat an, unsicher, was er tun sollte. Ernie trat einfach vor, drückte den Knopf und schaltete das Gerät aus. Allen dreien verschlug es den Atem, nachdem der Bildschirm erlosch, als hätte Ernie einen Vorhang über die Rückkehr in die Vorkriegsvergangenheit gebreitet.
»Wenn man ihn vorhin einschalten konnte, kann man ihn jetzt auch wieder einschalten«, meinte Ernie gelassen. »Aber bevor wir das tun …«
Er langte in die Jackentasche, zückte eine kleine Taschenlampe und knipste sie an.
Wenn jemand in ihrer Gemeinschaft sich auf das Leben nach Tag eins vorbereitet hatte, dann Ernie Franklin mit seiner Familie. Nach mehr als drei Jahren zehrten sie immer noch von lange haltbaren Rationen, die sie bereits vor Jahren gehortet hatten. Ernies geländegängiger Polaris fuhr nach wie vor. John war klug genug, um nicht nachzuhaken, wie viel gegen den Verfall behandeltes Benzin er noch eingelagert hatte. Der Alte gab stets voller Stolz mit seinen Solartaschenlampen an, wie der, die er gerade angeknipst hatte. Ohne Paul überhaupt um Erlaubnis zu fragen, klappte er die Abdeckung des alten – um nicht zu sagen: antiquierten – Rechners auf.
Dieser Keller war Pauls Reich. John wartete auf eine Reaktion des jungen Mannes, der die Stromversorgung der Stadt rekonstruiert und zum Leben erweckt hatte, doch Hawkins sagte kein Wort und schien sich stumm zu fügen.
Wie ein Zahnarzt, der im Mund des Opfers auf dem Stuhl herumstochert, spähte Ernie ins Innere des alten Apple-Computers und brummte missbilligend.
»Unverzeihlich«, flüsterte Ernie. »Ihr Lehrer hattet noch nie eine Ahnung von Computerpflege. Seht euch nur den ganzen Staub an, und was, zum Teufel, ist das?«
Er deutete auf das Motherboard. Alle drei beugten sich vor, um ihm über die Schulter zu blicken.
»Sieht aus wie ein Hunde- oder Katzenhaar! Was für eine Schweinerei! Lasst das Teil vorerst ausgeschaltet. Ich nehm es mit nach Hause und blase es erst mal ordentlich durch.«
»Wie bitte?«, fragte John.
»Ich nehm ihn mit nach Hause. Dort habe ich noch ein bisschen Druckluft.«
»Druckluft?«, fragte Forrest. »Wovon zur Hölle redest du?«
»Druckluft aus der Sprühdose. Die verwendet man zum Reinigen von Computern.«
»Puste einfach mal über das verfluchte Ding«, flüsterte John.
Eine seiner Meinung nach so offensichtliche Dummheit würdigte Ernie keiner Antwort. »Packt ihn ein, ich nehm ihn mit.«
»Auf gar keinen Fall«, entgegnete John ruhig, aber mit Nachdruck. »Fürs Erste bleibt er hier.«
Ernie plusterte sich auf, bereit zu einem anständigen Streit. An so etwas fand er schon immer Gefallen.
»Hör zu, Ernie, der Computer bleibt hier. Dieses Teil ist für uns Gold wert. Ihn durch einen Sturm zu dir nach Hause zu transportieren, wäre Wahnsinn. Zieh einfach los, bring deine Druckluftdosen mit und was du sonst noch brauchst, und komm wieder her.«
»Das kostet mich fast vier Liter Sprit«, konterte Ernie mit durchtriebenem Grinsen. »Wird die Stadt dafür aufkommen?«
John seufzte. Sie kratzten bereits die letzten Reste ihrer Benzinvorräte zusammen; sein Traum, in Bezug auf Transportmittel und den Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen zur Dampfkraft überzuwechseln, steckte vorerst in den Kinderschuhen. Aber dies war zu wichtig, um darüber zu streiten; die Neugier aufgrund dieser Entdeckung und des Potenzials, das in ihr steckte, brachte ihn fast um.
»Gib mir morgen die Abrechnung. Ich komm dafür auf.«
»Klar doch!« Ohne weiteren Kommentar tastete er an die Seite des Computers, dessen Abdeckung nach wie vor offen stand, schaltete ihn wieder ein, und abermals blieb den dreien der Mund offen stehen, als der Monitor flackernd zum Leben erwachte.
»Hast du eben nicht gesagt, das Gerät müsste ausgeblasen werden oder so?«, fragte Forrest. Auf seinem Gesicht lag ein zaghaftes Lächeln, denn Ernie war berüchtigt dafür, dass er ausfällig wurde, wenn er aus dem Stegreif eine Frage beantworten musste. Paul räusperte sich und deutete mit einer Kopfbewegung nach hinten zur Treppe, wo seine Frau stand. Sie hatte die Zwillinge schlafen gelegt und verfolgte ihr Gespräch interessiert.
Ernie nickte. Er hielt sich zurück und spähte weiterhin in das Gehäuse. »Für den Moment ist es okay«, meinte er schließlich, während er mit einem vergnügten Glucksen neben der Hauptplatine auch die Steckkarten für Grafik und Sound inspizierte.
»Verflucht, ich muss zugeben, seinerzeit war das schon was, auch wenn es ein Spielzeug war, verglichen mit dem, was wir bei IBM entwickelt haben. Ein Gerät mit 64 KB RAM für unter 3000 Dollar – trotzdem ’ne Menge Geld in den 80ern. Wisst ihr, ich habe an der Konzeption der Betriebssysteme für die Space Shuttles mitgearbeitet. Fünf Computer, nicht viel größer als dieses Teil hier, steuerten das gesamte Raumschiff. Da mussten wir jedes nutzbare Byte aus der Software quetschen. Damals gab es noch keine Giga- und Terabytes, noch nicht mal bei den großen Cray-Geräten, über die sie beim Militär verfügten. Als ich anfing, speicherten wir die Daten noch auf Zehn-Zoll-Magnetbändern.«
Er seufzte, und für einen Moment erahnte John die innere Traurigkeit dieses Mannes, in dem so mancher bloß einen durchgeknallten Spinner sah, wenn er öffentlich davor warnte, wie anfällig die Infrastruktur des gesamten Landes war. Mit der düsteren Vorahnung im Hinterkopf, dass eines Tages alles zusammenbrechen würde, hatte er sich frühzeitig in diese Berge zurückgezogen.
»Ernie, die Frage lautet: wie und weshalb?«, riss John sich aus seinen Gedanken.
»Was?«
»Wie und weshalb funktioniert dieser Computer?«
Ernie trat einen Schritt zurück und ließ den Blick durch den halbdunklen Raum schweifen, der lediglich von einer einsamen Leuchtstoffröhre an der Decke und dem matten Schein des Bildschirms erhellt wurde.
»Leicht zu sagen! Ich wette, dieses Gerät wurde vor 15, vielleicht 20 Jahren hierher verfrachtet, als ihr endlich auf den Trichter kamt, Apple rauszuschmeißen und auf Pentium-Rechner aufzurüsten. Jemand stellte ihn in eine Ecke, und – das Wichtigste daran – er war völlig vom Netz getrennt. Bei einem elektromagnetischen Impuls und seinen Auswirkungen gibt es eine Vielzahl von Variablen zu berücksichtigen. Intensität, Blickachse zum Detonationspunkt, den Grad der Abschirmung in diesem Gewölbe.«
Ernie ließ den Strahl seiner Taschenlampe über die umliegende Fläche gleiten und stieß ein trauriges Lachen angesichts all der hier angehäuften Bücher, Zeitschriften und elektronischen Hilfsmittel aus, die einst wie selbstverständlich zum Lehrbetrieb an einem kleinen College gehört hatten. Er ging hinüber zu mehreren schwarz-weißen Kästen, die unter dem Tisch verstaut waren.
»Ach, diese Babys«, verkündete er voller Begeisterung, »die sind von mir; ich habe die Software mitentwickelt. IBM 8088, unser Konkurrent für den Apple, an dem ihr Pädagogen ja so lange festhalten musstet. Ich wette, zumindest die Verwaltung hatte diese Modelle im Einsatz. Wenn es um so was ging, waren die schon immer schlauer als ihr Gelehrten.«
Ein wenig gereizt registrierte John Ernies Stichelei, während der Ältere in die Hocke ging, um Staub und Moder von einem der Gehäuse abzuwischen.
»Japp, ein Tower Desktop. Den müssen wir uns als Nächstes vornehmen.«
»Moment mal«, warf John ein, »lass uns nichts überstürzen. Ernie, wie, warum und was machen wir damit?« Mit einer Kopfbewegung deutete er auf den Apple.
»Wie gesagt, er überstand den EMP-Schlag und stand dann einfach unversehrt hier herum. Daran ist nichts Ungewöhnliches.«
»Und wieso erfahren wir das erst jetzt?«, wollte Forrest wissen.
»Na ja, weil wir eben keinen Saft hatten«, erwiderte Paul. »Nachdem wir wieder ein bisschen Strom hatten, na ja, da machten wir …«
Wie dumm von uns!, zuckte es John durch den Kopf. Warum war nicht gleich nach dem Tag, als ihnen wieder ein paar Kilowatt Strom zur Verfügung standen, jemand in diesen Keller gerannt, um die Geräte versuchsweise ans Netz zu nehmen?
»Ich bin überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen«, erklärte Paul mit ausdrucksloser Stimme. »Ich war so damit beschäftigt, die Beleuchtung in Gang zu bringen, die Sache mit dem Strom hinzukriegen für den Dampfdrucksterilisator und für Warmwasser in der Klinik, verstärkte Beleuchtung im OP, mehr Saft für das Chemielabor und so weiter. Die Computer in den Fakultätsbüros und überall sonst hielt ich für nutzlose Klumpen aus verschmorten Kabeln und Platinen. Nach Tag eins wurden sie in irgendwelche Keller geschafft oder auf dem Müll entsorgt. Wir hielten sie alle für durchgebrannt.«
»Weil sie alle ans Stromnetz angeschlossen waren und bei der Überspannung die volle Ladung abbekamen«, konstatierte Ernie.
»Eine Frage, Ernie«, ergriff John erneut das Wort.
»Klar, was denn?«
»Hinterher redeten die Leute davon, man hätte einen Computer in einem faradayschen Käfig aufbewahren sollen. Wenn jemand daran gedacht hat, sich so was in den Keller zu stellen, dann doch du, oder?«
Die Frage traf Ernie unvorbereitet. Sichtlich verlegen wandte er den Blick ab, sein Schweigen war Antwort genug.
John musste daran denken, wie Paul und ein paar andere aus dem IT-Team, einige Monate bevor alles in die Brüche ging, das Rechenzentrum umgestaltet hatten, weil das College Cyber-Sicherheit als neues Hauptfach einführen wollte. In einem Zeitalter, in dem Computer eine kürzere Halbwertzeit besaßen als in den 80ern ein Auto aus Detroit, warfen sie die alten Geräte einfach in den Müllcontainer, nachdem sie zuvor alle Daten von Wert von den Festplatten gesichert und diese anschließend nullformatiert hatten.
Eine Wegwerfgesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Aus heutiger Sicht ein Unding.
Die Leuchtstoffröhre über ihren Köpfen surrte und begann zu flackern.
Mit einem raschen Griff langte Ernie hinter den Apple und zog den Stecker. Das Display erlosch.
»Diese Stromversorgung ist nicht gerade einwandfrei«, knurrte er mit einem Blick in Pauls Richtung.
»Was meinst du damit, nicht einwandfrei?«, wollte Forrest wissen.
»Na, was gerade passiert ist«, erwiderte Paul seufzend. »Jemand knipst im Krankenhaus einen Schalter an, der saugt ein paar Kilowatt, und im restlichen Netz schwankt die Spannung. So was kann tödlich sein, speziell für diese alten Geräte hier. Genau so was könnte diesem alten Computer den Rest geben, während wir ihn noch staunend anstarren. Ich werde einen Überspannungsschutz auftreiben müssen.«
Er zögerte.
»Schon gut«, seufzte Ernie. »Ich hab noch ein paar mit Solarenergie aufladbare Festkörper-Akkus zu Hause. Die liefern sauberen, konstanten Saft für elektronische Geräte – die werde ich auch mitbringen, um diesen Computer in Gang zu halten.«
»So was hast du?« Johns Stimme klang schneidend. »Schön, das auch mal zu erfahren.«
Ernie zuckte mit den Schultern. »Allzeit bereit, wie es bei den Pfadfindern hieß.«
»Aber du hast nicht irgendwo einen Computer versteckt, oder?«
»Willst du mir hier was unterstellen, John?«, schnauzte Ernie zurück.
Beschwichtigend hob John die Hand. »Nein, aber trotzdem?«
»Hör zu, auf die eine oder andere Art wurde jeder von uns auf dem falschen Fuß erwischt. Meine Frau Linda hat sich andauernd beschwert, dass ich den ganzen Keller mit ausrangierten Computern vollstelle. Deshalb hab ich die Teile, wie jeder andere auch, weggeworfen, wenn ich mir alle ein, zwei Jahre einen neuen zulegte.«
Er seufzte. John erkannte, wie sehr die Erinnerung daran ihn quälte. Wahrscheinlich lag der alte Bursche oft nächtelang wach und trat sich selbst in den Hintern bei dem Gedanken an all die Rechner, die er früher besessen und achtlos entsorgt hatte, statt sie zu behalten. Wie gesagt, die Wegwerfgesellschaft vor Tag eins! Wenigstens hatten einige alte Hasen unter den Amateurfunkern an ihren mittlerweile ungeheuer kostbaren Geräten festgehalten und sie – nur für alle Fälle – eingelagert. Manche waren sogar so stolz auf ihr Nischenhobby, dass sie tatsächlich lieber alte Röhrengeräte bedienten als diese »neumodischen Transistorapparate«, wie sie gern schimpften.
Eine untergegangene Welt, dachte John wehmütig, während er auf den dunklen Computermonitor blickte, Sinnbild all dessen, was ihnen entglitten war. Und sie hatten es zugelassen! Von einem Augenblick auf den anderen war Amerika in die Finsternis gestürzt worden. In diesem Moment drängte sich ihm die Frage auf, ob die wenigen verbliebenen Hoffnungsfunken nicht auch bald erloschen.
Er musste an Sir Edward Greys tief empfundenen Aufschrei denken, als es in einer warmen Augustnacht im London des Jahres 1914 Mitternacht schlug und der Krieg mit Deutschland ausbrach. »In ganz Europa gehen die Lichter aus und zu unseren Lebzeiten werden wir sie nicht mehr leuchten sehen«, hatte er seinerzeit verkündet.
In gewisser Weise eine Prophezeiung. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges endete ein 100 Jahre währender Frieden. H. G. Wells sagte hellsichtig den Anfang vom Ende voraus, ebenso prophezeite er den Einsatz von Atomwaffen. Der stete, friedvolle Fortschritt des Zeitalters Edwards VII. erlosch in der Tat in den Schützengräben Yperns, Verduns und der Somme. Es wurde zum Rückschritt für die gesamte Zivilisation, als sie Giftgas einsetzten, Flammenwerfer und Bomben vom Himmel auf wehrlose Städte regneten und Millionen von Menschen im dreckigen Morast einander in primitiver Wut mit Messern und bloßen Fäusten zerfleischten. Es führte zu einem zweiten Krieg mit Todeslagern und blendenden Lichtblitzen, die jeweils an einem Augustmorgen ganze Städte verglühen ließen, 31 Jahre nachdem Edward Grey seinen Ausspruch getätigt und H. G. Wells seine Vorhersagen getroffen hatte.
Darauf folgten die langen Jahre des Kalten Krieges. Zivilisierte Nationen waren bereit, ihre Gegner Tausenden solcher Lichtblitze auszusetzen. Als sie die ersten dieser Bomben erschufen, begriff zunächst niemand, dass es nicht die Druckwelle war, die so zerstörerisch wirkte, nicht das Feuer, so heiß wie die Sonne, sondern etwas wesentlich Subtileres: eine bloße Mikrosekunde intensiver Gammastrahlung, draußen im Weltraum entfacht. Während sie mit Lichtgeschwindigkeit zur Erdoberfläche raste, setzte sie im Stickstoff und Sauerstoff der oberen Atmosphäre Elektronen frei – und damit eine überwältigende statische Entladung, die es vermochte, die größte Nation der Menschheitsgeschichte lahmzulegen und innerhalb von zwei Jahren 90 Prozent ihrer Einwohner zu töten.
Schon vor langer Zeit hatte John die Erfahrung gemacht, dass es besser war, nicht zu viel darüber nachzudenken. Es trieb einen nur zur Verzweiflung und brachte rein gar nichts. Er hatte Ernie gefragt, wie es kam, dass ausgerechnet dieser Computer noch funktionierte, dabei bestand die eigentliche Frage doch darin, wie es dazu kommen konnte, dass sein Land, die ganze Welt das Unfassbare zulassen konnte. Wer trug die Verantwortung? Irgendjemand hatte es doch bestimmt kommen sehen. Das Todesurteil für seine jüngste Tochter und unzählige andere.
»John, ist alles in Ordnung?«
Becka stand hinter ihm und legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter. Er merkte, dass er Tränen in den Augen hatte, und zwang sich zu einem Lächeln.
»Ja, natürlich. Was machen die Babys? Schlafen sie?«
»Wie kleine Kätzchen.«
Angesichts dieser wenigen Worte fiel es John schwer, die seit Langem unterdrückten Tränen zurückzuhalten. In einer früheren Zeit hatte Mary diese Worte gebraucht, um ihm zu sagen, dass Jennifer in ihrem Bettchen lag und schlief. Als sie erfuhren, dass Jennifer an dem höchst aggressiven Diabetes Typ 1 litt, konnten sie nicht anders, als sie behutsam zu umsorgen. Die Erinnerung fiel umso schmerzlicher aus, weil Mary eines Tages die Diagnose erhielt, dass sie ebenfalls an etwas sehr Aggressivem litt: Brustkrebs. Letztlich sollte der Krebs sie holen und John mit zwei kleinen Mädchen zurücklassen, die er allein großziehen musste. Nächtelang hatte er sie im Bett beobachtet, die ebenfalls schlafenden Mädchen zu beiden Seiten. Sie wussten, dass ihre Mutter krank war, spürten mit kindlichem Instinkt, dass Mom sie bald für immer verlassen würde.
Und jedes Mal musste er dabei an zwei kleine Kätzchen denken, die sich an ihre Mutter schmiegten.
Er kämpfte darum, die Fassung zu wahren, wandte sich von den anderen ab und ging hinüber auf die andere Seite des Kellers, wo er gedankenverloren eine alte Life-Ausgabe durchblätterte und so tat, als lese er darin. Seine Freunde spürten instinktiv, dass er allein sein wollte.
Die Zeitschrift stammte aus der Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Artikel, bei dem er hängen blieb, trug den Titel ›Our Boys Are Coming Home‹ – Unsere Jungs kommen heim. Illustriert war er mit Aufnahmen der alten Queen Mary, wie sie in den Hafen von New York eskortiert wurde, flankiert von Feuerlöschbooten, die einen Salut aus Fontänen in Rot, Weiß und Blau in die Luft sprühten, im Hintergrund die Freiheitsstatue. Mütter, Frauen und Kinder umarmten voller Freude junge Männer mit düsterem, gehetztem Blick, in deren Gesichter sich Erfahrungen eingegraben hatten, die sie weit älter erscheinen ließen. Unter Tränen erwiderten sie die Geste. Auf den folgenden Seiten fand sich ein Artikel über einen Ort namens Levittown, in dem Tausende neue Häuser entstehen sollten.
Weg, verloren, alles verschwunden! Die junge Frau, Captain der ANR, die er im Frühjahr gefangen genommen hatte und die nun zu seinem engsten Beraterkreis gehörte, hatte mit jener Truppe kurze Zeit in Jersey gedient, am Ufer direkt gegenüber von Manhattan, das nun unter Quarantäne stand. Eine dem Tod geweihte Insel. Es hieß, dass unter den wenigen Tausend Überlebenden, die in den gewaltigen, verwaisten Betonschluchten Unterschlupf suchten und ein Leben als Bettler fristeten, Beulenpest und Cholera wüteten.
Es bedurfte keiner Atomexplosion, die alles dem Erdboden gleichmachte, um das einstmals pulsierende Herz der westlichen Welt, als das New York gegolten hatte, zum Erliegen zu bringen. Am Ende reichte es, lautlos den Saft abzudrehen, und von einem Moment auf den anderen ging es dort so unwirtlich zu wie in der Antarktis oder unter der sengenden Hitze der Wüste Gobi. Das fruchtbare Land, das einst Henry Hudson und Petrus Stuyvesant empfangen hatte, war längst unter Asphalt und Pflastersteinen verschwunden – ausgenommen der Central Park. Dort trieben, so wurde gemunkelt, verwilderte Hunde ihr Unwesen. Einst zahme, freundliche Retriever und Spaniels gab es nun nicht mehr, nur noch bunt gemischte Straßenköter, die im Rudel jagten und gnadenlos töteten – auch Menschen, sollten diese so töricht sein, sich in diesen überwucherten Urwald zu wagen.
John schlug das Magazin zu und legte es beiseite. Es trug nur zu seiner plötzlichen Niedergeschlagenheit bei. Erneut hörte er die vier miteinander reden, eine freundschaftliche Auseinandersetzung, bei der aber auch schärfere Töne hinsichtlich der Frage angeschlagen wurden, warum nicht längst jemand daran gedacht hatte, die alten Computer und sonstigen elektronischen Geräte auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
Er wischte sich die Tränen aus den Augen und holte tief Luft. »Galileo und das Teleskop«, stieß er aus.
Die anderen starrten ihn verwirrt an.
»Wie bitte?«, fragte Paul.
Er zwang sich zu einem Lächeln – ein wenig von dem College-Professor steckte noch in ihm –, und als er Paul und Becka anblickte, fühlte er sich in die Zeit zurückversetzt, als sie noch in seinem Unterricht zur Technikgeschichte saßen und ihm kaum zuhörten, weil sie hinten im Saal verliebte Blicke tauschten.
»Erinnert ihr euch noch an unsere Erörterung über Galileo und das Teleskop?«, fragte er, während er ein paar Schritte auf sie zuging.
»Nicht so richtig«, gestand Paul.





























