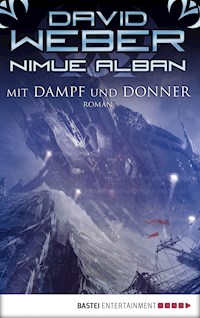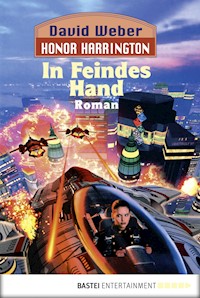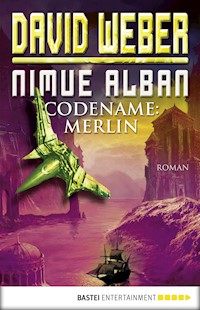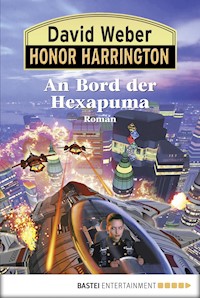9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Erde und alle Kolonien der Menschheit stehen vor der Vernichtung durch die außerirdische Spezies namens Gbaba. Die Menschen starten eine letzte Rettungsaktion: Operation Arche. Diese Expedition soll eine neue Zivilisation aufbauen, auf einer extrem entlegenen Welt. Die Operation fordert zahlreiche Verluste, darunter auch Lieutenant Commander Nimue Alban.
Doch für Nimue Alban ist der Tod nicht das Ende. 800 Jahre später wacht sie auf der Zielwelt wieder auf - in einem künstlichen Körper. Und sie hat eine Mission: die Menschheit vor der endgültigen Vernichtung zu bewahren...
Die ersten beiden Romane um die mutige Lieutenant Commander Nimue Alban: "Operation Arche" und "Der Krieg der Ketzer" erstmals in einem eBook.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1498
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
BASTEI ENTERTAINMENT Digitale Originalausgabe Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG Für die Originalausgaben: Copyright © 2007 by David Weber Titel der amerikanischen Originalausgabe: "Off Armaggedon Reef” (Teil 1 und 2) Für die Deutschsprachigen Ausgaben: Copyright © 2008, 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, im Auftrag von St. Martin‘s Press, L. L. C. Für diese Ausgabe: Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln Projektmanagement: Christina Bleser Covergestaltung: Massimo Peters unter Verwendung von Motiven © shutterstock/Molodec, © shutterstock/tsuneomp ISBN 978-3-7325-3800-3 www.bastei-entertainment.de www.lesejury.deDavid Weber
Operation Arche / Der Krieg der Ketzer
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Mai, im Jahr Gottes 890
.I. Der Tempel Gottes, Stadt Zion, Die Tempel-Lande
.II. Königlicher Palast, Tellesberg, Königreich Charis
.III. Die Berge des Lichts, Die Tempel-Lande
August, im Jahr Gottes 890
.I. Stadt Tellesberg, und das Harith-Vorgebirge, in der Nähe von Rothar, Königreich Charis
.II. Harith-Vorgebirge, in der Nähe von Rothar, Königreich Charis
.III. Tellesberg, Königreich Charis
.IV. Königlicher Palast, Tellesberg, Königreich Charis
.V. Königlicher Palast, Eraystor, Emerald
.VI. Königlicher Palast, Tellesberg, Königreich Charis
.VII. Tellesberg und die Styvyn-Berge, Armageddon-Riff
.VIII. Königlicher Palast, Tellesberg, Königreich Charis
.IX. Baron Wave Thunders Büro, Tellesberg
.X. Stadtvilla des Grafen Gray Harbor, Tellesberg
.XI. Baron Wave Thunders Büro, Tellesberg
.XII. Braidee Lahangs Wohnung, Tellesberg
.XIII. Saal des Geheimen Staatsrats, Königlicher Palast, Tellesberg
.XIV. Ein privates Audienzzimmer, Königlicher Palast, Tellesberg
.XV. Kathedrale von Tellesberg, Tellesberg
.XVI. Erzbischöflicher Palast, Tellesberg
September, im Jahr Gottes 890
.I. Bei Madame Ahnzhelyk, Stadt Zion
.II. Königlicher Palast, Tellesberg
.III. King's Harbour, Helen Island
Oktober, im Jahr Gottes 890
.I. Prinz Hektors Palast, Manchyr, Corisande
.II. Der Schoner Morgenröte, Vor Helen Island
November, im Jahr Gottes 890
.I. Erzbischof Erayks Räumlichkeiten, Stadt Zion
.II. Tellesberg, Königreich Charis
.III. Vikar Rhobair Duchairns Suite, Der Tempel Gottes
.IV. Marineausbildungsgelände, Helen Island
.V. Königlicher Palast, Eraystor
Charaktere
Glossar
Eine Anmerkung zur Zeitmessung auf Safehold
Fußnote
Über den Autor
David Weber ist ein Phänomen: Ungeheuer produktiv (er hat zahlreiche Fantasy- und Science-Fiction-Romane geschrieben), erlangte er Popularität mit der HONOR-HARRINGTON-Reihe, die inzwischen nicht nur in den USA zu den bestverkauften SF-Serien zählt. David Weber wird gerne mit C. S. Forester verglichen, aber auch mit Autoren wie Heinlein und Asimov. Er lebt heute mit seiner Familie in South Carolina.
David Weber
NIMUE ALBAN:
OPERATIONARCHE
Aus dem Amerikanischen vonUlf Ritgen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
© 2007 by David Weber
Titel der Originalausgabe: »Off Armageddon Reef« (Teil 1)
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2008/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
This work was negotiated through Literary Agency
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen,
on behalf of St. Martin's Press, L. L. C.
Lektorat: Uwe Vöhl / Ruggero Leò
Titelillustration: Fred Gambino / Agentur Schlück
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-0986-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Fred Saberhagen, dessen Werke mir ‒ und so vielen anderen ‒ so viel Freude bereitet haben. Es ist immer schön festzustellen, dass jemand, dessen Werke man so sehr liebt, ein noch viel liebenswürdigerer Mensch ist.
Und …
Für Sharon, die mich liebt, die meinen verrückten Zeitplan erträgt, die mir immer dabei hilft, im Kopf zu behalten, welcher Tag welchen Monats gerade ist, die praktisch alles über das Schwimmen weiß, was es nur zu wissen gibt, und die mir des Öfteren Vorschläge für eine oder zwei Szenen unterbreitet hat, die ganz besonders auf die Tränendrüsen drücken.
Womit ich nicht sagen will, dass sie es dieses Mal getan hat.
Oh nein, wirklich nicht!
Ich liebe Dich.
02. Juli 2378
Crestwell’s Star, HD 63077 A
Terra-Föderation
»Captain auf die Brücke! Captain auf die Brücke!«
Captain Mateus Fofão rollte sich aus der Koje, als die drängende Stimme des wachhabenden Offiziers aus dem Intercom plärrte, immer wieder übertönt durch das schrille Heulen des Gefechtsalarms. Bevor er auch nur die Augen ganz geöffnet hatte, berührten die nackten Füße des Captains schon das Deck, und er griff bereits nach dem Kom, das stets auf seinem Nachttisch lag. Er brauchte nicht hinzuschauen, um den roten Knopf für die Vorrangschaltung zu finden.
»Brücke.« Fast sofort kam die Antwort, eine tonlose Stimme, der deutlich anzuhören war, dass sie nur dank langem, ausgiebigem Training nicht in Panik verfiel.
»Chief Kuznetzov, hier spricht der Captain«, sagte Fofão nur knapp. »Geben Sie mir Lieutenant Henderson.«
»Aye, Sir!«
Kurz herrschte Schweigen, dann hörte Fofão eine andere Stimme.
»Offizier vom Dienst«, meldete sich eine Frau.
»Sag’s mir, Gabby«, sagte Fofão mit schroffer Stimme.
»Bogies1, Skipper.« Lieutenant Gabriela Henderson, die Taktische Offizierin des schweren Kreuzers, hatte diese Wache übernommen, und ihre üblicherweise ruhige Altstimme klang jetzt rau und angespannt. »Jede Menge Bogies. Sind in zwölf Lichtminuten Entfernung gerade eben aus dem Hyperraum gekommen, und jetzt steuern sie mit mehr als vierhundert G auf das Systeminnere zu.«
Fofãos Kiefer mahlten. Vierhundert G lag mehr als zwanzig Prozent oberhalb dessen, was selbst die besten Kompensatoren der Föderation aufzufangen vermochten. Was wiederum schlüssig belegte, dass, wer auch immer diese Fremden waren, sie nicht der Föderation angehörten.
»Abschätzung der Truppenstärke?«, fragte er nach.
»Noch nicht abgeschlossen, Sir«, gab Henderson sofort zurück. »Bislang wurden mehr als siebzig gemeldet.«
Fofão verzog das Gesicht.
»Also gut.« Er war selbst erstaunt, wie ruhig seine Stimme klang. »Protokoll für den Erstkontakt implementieren, dazu die Protokolle ›Fernglas‹ und ›Wachmann‹. Dann bringen Sie uns auf Alarmstufe Vier. Sorgen Sie dafür, dass die Governeurin über alles informiert wird und sagen Sie ihr, dass ich ›Code Alpha‹ verhänge.«
»Aye, aye, Sir!«
»Ich bin in fünf Minuten auf der Brücke«, fuhr Fofão fort, während sich die Tür seiner Schlafkabine öffnete und mit großen Sprüngen sein Steward mit der Uniform hereinkam. »Starten Sie weitere Aufklärer-Drohnen in Richtung unserer Besucher.«
»Aye, aye, Sir.«
»Wir sehen uns gleich«, sagte Fofão. Dann deaktivierte er das Kom und drehte sich zur Seite, damit sein kalkbleicher Steward ihm in die Uniformjacke helfen konnte.
Tatsächlich erreichte Mateus Fofão das Kommandodeck des Terran Federation Navy Ship Swiftsure in sogar etwas weniger als fünf Minuten.
Es gelang ihm gerade noch rechtzeitig, sich so weit zurückzuhalten, dass er nur mit forschem, zügigen Schritt aus dem Fahrstuhl trat, der ihn auf die Brücke gebracht hatte, doch sein Blick war augenblicklich ganz auf den Haupt-Taktikschirm gerichtet, und sofort presste er angespannt die Lippen aufeinander. Die unbekannten Schiffe waren als bedrohliche, rubinrote Punkte zu erkennen, sie steuerten geradewegs auf den GO-Primärstern und die blauweiße Murmel zu, als die der vierte Planet dieses Systems auf dem Schirm stand.
»Captain auf der Brücke!«, verkündete Chief Kuznetzov, doch mit einer Handbewegung bedeutete Fofão allen, wieder in ihren Sesseln Platz zu nehmen.
»Weitermachen«, sagte er knapp, und fast alle kamen seiner Aufforderung nach. Nur Lieutenant Henderson nicht. Sie erhob sich aus dem Sessel des Kommandanten im Zentrum der Brücke; ihre Erleichterung darüber, dass Fofão sie jetzt ablöste, war ihr deutlich anzusehen.
Er nickte ihr zu, trat an ihr vorbei und nahm in dem Sessel Platz.
»Der Captain hat das Kommando«, erklärte er förmlich, dann blickte er zu Henderson hinüber, die immer noch neben ihm stand. »Treffen von denen irgendwelche Nachrichten ein?«
»Nein, Sir. Wenn die in dem Augenblick, da sie aus dem Hyperraum gekommen sind, eine Übertragung gestartet hätten, dann hätten wir von denen vor …« ‒ sie warf einen Blick auf die digitale Zeitanzeige ‒ »… ungefähr zwei Minuten etwas hören müssen. Haben wir aber nicht.«
Fofão nickte. Nachdem er gesehen hatte, wie schnell sich diese Wolke aus roten Markierungen ausbreitete, wunderte ihn das tatsächlich nicht im Geringsten.
»Haben wir neue Daten über deren Truppenstärke?«, fragte er dann.
»Abschätzung liegt bei mindestens fünfundachtzig Schiffen«, gab Henderson zurück. »Bisher haben wir noch keine Anzeichen dafür, dass sie Kampfjäger ausgeschleust hätten.«
Wieder nickte Fofão, und nun verspürte er diese sonderbare Anspannung, die den ganzen Körper erfasste und beinahe schon wieder eine eigene Form der Ruhe darstellte. Es war die Ruhe eines Mannes, der sich gerade jetzt genau der Katastrophe gegenübersah, für die er jahrelang geplant hatte, für die er ausgebildet worden war, und doch hatte er niemals damit gerechnet, jemals tatsächlich mit ihr konfrontiert zu werden.
»›Wachmann‹?«, fragte er nur.
»Ist implementiert, Sir«, erwiderte Henderson. »Die Antelope ist vor zwei Minuten zur Hypergrenze aufgebrochen.«
»›Fernglas‹?«
»Aktiviert, Sir.«
Das ist ja wenigstens etwas, sagte eine leise Stimme in Fofãos Hinterkopf.
Die TFNS Antelope war ein winziges, völlig unbewaffnetes und sehr schnelles Kurierschiff. Crestwell’s World war der fortgeschrittenste Kolonialposten der Föderation, fünfzig Lichtjahre von Sol entfernt, zu neu und noch zu spärlich besiedelt, um schon über ein HyperCom zu verfügen. Damit blieb nur noch die Möglichkeit, Kurierschiffe einzusetzen, und im Augenblick bestand die einzige Aufgabe der Antelope darin, mit höchstmöglicher Geschwindigkeit in Richtung Sol zu flüchten ‒ mit der Botschaft, dass es tatsächlich zu ›Code Alpha‹ gekommen war.
›Fernglas‹ war der Codename für das Netz von Überwachungssatelliten, das sich rings um die Peripherie der Hypergrenze dieses Sternensystems erstreckte. Sie waren vollständig passiv und praktisch unmöglich zu orten (so hoffte man wenigstens). Sie waren dort auch nicht stationiert, damit die Swiftsure von ihnen würde profitieren können. Die Daten, die diese Satelliten aufnahmen wurden an die Antelope weitergeleitet, um sichergehen zu können, dass sie über ausgiebige, vollständige Taktik-Aufzeichnungen verfügte, wenn sie in den Hyperraum eintrat. Und die gleichen Informationen wurden auch an das Schwesternschiff der Antelope übertragen, die TFNS Gazelle, die sich getarnt im Orbit des Gasriesen am äußersten Rand des Systems verbarg.
Ihre Aufgabe bestand darin, dort ‒ wenn es nur irgendwie möglich war ‒ bis zum Ende verborgen zu bleiben, um dann Terra Bericht zu erstatten.
Und es ist auch gut so, dass die da draußen ist, dachte Fofão grimmig, weil wir nämlich ganz bestimmt keine Berichte mehr werden erstatten können.
»Schiffsstatus?«, fragte er dann.
»Sämtliche Waffensysteme sind auf Alarmstufe Vier eingestellt, Sir. Der Maschinenleitstand meldet sämtliche Gefechtsstationen bemannt und einsatzbereit, und Normalraum- und Hyperraum-Antriebe können jederzeit auf Ruderbefehle reagieren.«
»Sehr gut.« Fofão deutete auf den Posten, den Henderson üblicherweise einnahm, und schaute dem Lieutenant hinterher, als sie hinüberging. Dann atmete er tief durch und drückte einen Knopf auf der Armlehne des Kommandantensessels.
»Hier spricht der Captain«, sagte er, verzichtete dabei auf die üblichen Formalitäten, die zu einer Ankündigung an sämtliche Besatzungsmitglieder gehörten. »Mittlerweile wissen Sie alle, was hier vor sich geht. Im Augenblick wissen Sie über diese Leute da draußen ungefähr so viel wie ich selbst. Ich weiß nicht, ob das die Gbaba sind oder nicht. Wenn ja, dann sieht es nicht gut für uns aus. Aber ich möchte Sie alle wissen lassen, dass ich stolz auf Sie bin. Was auch immer geschehen mag: ein besseres Schiff oder eine bessere Mannschaft könnte sich kein Captain wünschen.«
Er ließ den Kom-Knopf wieder los und schwenkte den Sessel dann so herum, dass er den Rudergänger des schweren Kreuzers anschaute.
»Bringen Sie uns auf Null-Eins-Fünf, Eins-Eins-Neun, mit fünfzig G«, wies er ihn mit ruhiger Stimme an, und die TFNS Swiftsure bezog Position zwischen dem Planeten, dessen menschliche Kolonisten ihn ›Crestwell’s World‹ genannt hatten, und der gewaltigen Armada, die sich dieser Welt jetzt näherte.
Mateus Fofão war schon immer sehr stolz auf sein Schiff gewesen. Stolz auf ihre Besatzung, auf ihre Geschwindigkeit und auf die immense Feuerkraft, über die das Schiff mit dem Dreivierteltonnen-Rumpf verfügte. Im Augenblick jedoch dachte er vor allem daran, wie zerbrechlich es doch war.
Noch vor zehn Jahren hatte es keine Navy der Terran Federation gegeben, nein, das konnte man wirklich nicht behaupten. Es hatte da etwas gegeben, was die Föderation als Navy bezeichnet hatte, doch in Wirklichkeit war das kaum mehr als eine Flotte Erkundungsschiffe gewesen, unterstützt von einer Hand voll leichtbewaffneter Kampfeinheiten, deren Hauptaufgabe vor allem darin bestanden hatte, Such- und Rettungseinsätze durchzuführen und gelegentlich Raubtiere in Menschengestalt im Zaum zu halten.
Doch dann, vor zehn Jahren, hatte eines der Erkundungsschiffe der Föderation Belege für eine erste fortschrittliche Zivilisation von Nichtmenschen gefunden. Niemand wusste, wie sich die Bürger dieser Zivilisation selbst genannt hatten, denn niemand von ihnen lebte noch, sodass er dieses Wissen hätte weitergeben können.
Voller Entsetzen hatte die Menschheit entdeckt, dass eine ganze Spezies bewusst ausgelöscht worden war. Dass eine Spezies, die fortschrittlich genug gewesen war, die Rohstoffressourcen ihres eigenen Sonnensystems nicht nur zu nutzten, sondern gezielt abzubauen, unbarmherzig ausgelöscht worden war. Zunächst hatte man vermutet, diese Spezies habe sich dies selbst angetan, in einer Art selbstmörderischen Amoklaufs. Tatsächlich waren einige der Wissenschaftler, die damals die vorliegenden Belege untersucht hatten, noch recht lange davon überzeugt, dass es die wahrscheinlichste Erklärung war.
Doch diese Unbelehrbaren waren eindeutig in der Minderheit gewesen. Ein Großteil der Menschheit hatte schließlich die zweite ‒ und sehr viel entsetzlichere ‒ Hypothese akzeptiert: Diese Spezies hatte sich das nicht selbst angetan; dafür war jemand anderes verantwortlich.
Fofão wusste nicht, wer diesen mutmaßlichen Massenmördern den Namen ›die Gbaba‹ gegeben hatte, und es war ihm auch ziemlich egal. Doch die Erkenntnis, dass es diese Massenmörder tatsächlich geben mochte, war der Grund dafür, dass es jetzt eine echte Federation Navy gab, die diese Bezeichnung auch redlich verdiente ‒ und sie wurde von Tag zu Tag größer. Und diese Erkenntnis war auch der Grund dafür, dass Krisenpläne wie ›Fernglas‹ oder ›Wachmann‹ überhaupt eingerichtet worden waren.
Und auch der Grund dafür, dass die TFNS Swiftsure sich jetzt zwischen Crestwell’s World und der einkommenden, immer noch völlig schweigenden Flotte aus roten Markern befand.
Im ganzen Universum war es völlig unmöglich, dass ein einzelner schwerer Kreuzer eine Flotte dieser Größe würde aufhalten, verlangsamen oder auch nur stören können ‒ nicht bei einer Flotte, die so gewaltig war wie die, die jetzt auf Fofãos Schiff zuhielt. Und es war auch nicht gerade wahrscheinlich, dass es ihm gelingen würde, Abstand zu den feindlichen Kampfschiffen zu halten. Sie waren zu der Art Beschleunigung in der Lage, wie sie Fofão schon mit eigenen Augen erlebt hatte. Doch selbst, wenn es möglich gewesen wäre, so war dies nicht die Aufgabe der Swiftsure.
Selbst mit ihrer immensen Beschleunigung würden die Bogies immer noch fast vier Stunden benötigen, um Crestwell’s World zu erreichen ‒ vorausgesetzt, sie wollten den Planeten tatsächlich gezielt ansteuern. Falls sie ihn nur passieren wollten, konnten sie das in weniger als drei Stunden schaffen. Doch wie auch immer ihre Absichten aussehen mochten: es war die Aufgabe der Swiftsure, hier die Stellung zu halten und ihr Bestes zu tun, notfalls bis zum Letzten oder aber mit den Unbekannten in eine Art friedlicher Kommunikation zu treten. Als Schutzschild zu fungieren, wenngleich als sehr zerbrechlicher Schutzschild, oder als Stolperdraht, um vielleicht, wie unwahrscheinlich es auch sein mochte, einen Angriff auf den neubesiedelten Planeten abzuwehren, vor dem sie jetzt die Stellung hielt.
Und das war fast sicher, das erste Opfer dieses Krieges zu werden, den die Föderation seit fast einem Jahrzehnt befürchtete.
»Sir, wir orten hier weitere Antriebssignaturen!«, meldete Lieutenant Henderson. »Sieht nach Kampfjägern aus.« Sie sprach mit scharfer Stimme und sehr deutlich, äußerst professionell. »Die Ortung meldet etwa vierhundert.«
»Verstanden. Immer noch keine Antwort auf unsere Übertragungen, Kom-Leitstand?«
»Nein, Sir«, gab der Kommunikationsoffizier angespannt zurück.
»Taktik, Absetzen der Geschosse einleiten.«
»Aye, aye, Sir«, bestätigte Henderson. »Absetzen der Geschosse eingeleitet.«
Schwere Langstreckengeschosse lösten sich von den externen Geschützringen, während andere aus den Mittschiffs-Geschützluken des Kreuzers herausglitten. Unter dem Schub ihrer Sekundaräntriebe, die sonst der Positionsstabilierung dienten, bildeten sie eine Wolke rings um die Swiftsure, weit genug vom Rumpf des Schiffes entfernt, um sowohl die Swiftsure als auch die anderen Geschosse nicht durch die geradezu grotesk leistungsstarken Primärantriebe zu gefährden.
Sieht aus, als wollten die den ganzen Planeten einhüllen, dachte Fofão, während er beobachtete, wie die Bogies ihre Formation weiter und weiter ausschwärmen ließen, während sein Schiff ihnen immer weiter Nachrichten entgegenschickte, um doch noch in Kommunikation mit ihnen treten zu können. Sonderlich friedfertig wirkt das nicht gerade.
Er warf einen Blick auf den Taktik-Hauptschirm und betrachtete die Entfernungsanzeigen. Seit fast einhundertsechzehn Minuten steuerten diese Eindringlinge geradewegs auf den Planeten zu. Relativ zu Crestwell’s World betrug ihre Geschwindigkeit etwas mehr als einunddreißigtausend Kilometer in der Sekunde, und wenn sie nicht innerhalb der nächsten Sekunden den Schub umkehrten, dann würden sie diese Welt tatsächlich passieren.
Ich frage mich …
»Geschosseinsatz!«, verkündete Gabriela Henderson plötzlich. »Ich wiederhole: Geschosseinsatz! Zahlreiche Geschosse einkommend!«
Mateus Fofão hatte das Gefühl, ihm bliebe das Herz stehen.
Die können doch unmöglich erwarten, über diese Distanz hinweg ein Schiff zu treffen, das noch ausweichen kann?! Das war der erste Gedanke, der ihm durch den Kopf ging, als auf seinem Schirm plötzlich Tausende von neuen Markern aufflammten ‒ die der einkommenden Geschosse. Aber die können auf jeden Fall einen Planeten treffen, oder etwa nicht?, erklärte ihm sein Verstand nur einen Sekundenbruchteil später.
Er starrte diesen Wirbelsturm aus Geschossen an, und er wusste schon jetzt genau, was geschehen würde. Die Abwehrsysteme der Swiftsure würden niemals mehr als nur einen Bruchteil dieser Flut der Zerstörung aufhalten können, und irgendwo in seinem Hinterkopf fragte sich Fofão, was diese Geschosse wohl mit sich führten. Fusions-Gefechtsköpfe? Antimaterie? Chemische oder biologische Kampfstoffe? Oder vielleicht waren es auch nur einfache Projektilwaffen. Bei der unglaublichen Beschleunigung, die sie an den Tag legten, würden die beim Einschlag über genug Geschwindigkeit verfügen, um ihre Aufgabe auch ganz ohne jeden Gefechtskopf zu erfüllen.
»Kommunikations-Leitstand«, hörte sich Fofão mit tonloser Stimme sagen, während er zuschaute, wie die Scharfrichter der Bevölkerung von Crestwell’s World ‒ einer halben Million Menschen! ‒ immer weiter beschleunigten. »Kommunikationsversuche einstellen. Ruder, bringen Sie uns auf maximalen Schub, Kurs Null-Null-Null, Null-Null-Fünf. Taktik …« ‒ er wandte den Kopf zur Seite und schaute Lieutenant Henderson geradewegs in die Augen, »… auf Angriff vorbereiten.«
14. Februar 2421
TFNS Excalibur, TFNS Gulliver
Kampfverband Eins
Das Aufklärer-Schiff war zu klein, um eine Bedrohung darzustellen.
Die Gesamtmasse dieses winzigen Raumschiffs betrug weniger als drei Prozent allein nur des Rumpfes der TFNS Excalibur ‒ dem Flaggschiff des Kampfverbandes. Gewiss, es war schneller als ein Schiff der Dreadnought-Klasse, und sowohl die Waffensysteme als auch die Elektronik waren etwas fortschrittlicher, doch es hätte es niemals schaffen können, sich dem Kampfverband auf weniger als eine Lichtminute zu nähern.
Bedauerlicherweise war das jedoch auch nicht erforderlich.
»Damit ist es bestätigt, Sir.« Captain Somersets mahagonibraunes Gesicht, das Admiral Pei Kau-zhi jetzt auf dem Kommunikatorschirm der Brücke seines Flaggschiffs entgegenblickte, wirkte äußerst grimmig. Der Kommandant der Excalibur ist ziemlich gealtert, seit dieser Kampfverband in Dienst gestellt wurde, dachte Admiral Pei. Natürlich steht er damit nicht allein da.
»Wie weit noch, Martin?«, fragte der Admiral geradeheraus.
»Etwas mehr als Zwei Komma Sechs Lichtminuten«, gab Somerset zurück, und seine Miene wurde noch finsterer. »Das ist zu nah, Admiral.«
»Vielleicht auch nicht«, sagte Pei und lächelte dann den Kommandanten seines Flaggschiffs mit schmalen Lippen an. »Und wie auch immer die Distanz nun aussehen mag, wir können daran wohl nichts ändern, oder?«
»Sir, ich könnte den Abschirmverband aussenden und versuchen, ihn immer weiter vorzuschicken. Ich könnte sogar ein Zerstörer-Geschwader abstellen, der ihn bewacht, und ihn bis aus der Sensorreichweite der Flotte hinausschicken.«
»Wir wissen noch nicht, wie weit hinter dem da etwas Schwereres lauern könnte.« Pei schüttelte den Kopf. »Außerdem ist es doch erforderlich, dass die uns früher oder später sehen, oder nicht?«
»Admiral«, setzte Somerset an. »Ich glaube nicht, dass wir es uns leisten können, das Risiko einzugehen, …«
»Wir können es uns nicht leisten, dieses Risiko nicht einzugehen«, fiel ihm Pei entschlossen ins Wort. »Machen Sie nur, senden Sie den Abschirmverband in diese Richtung aus. Schauen Sie, ob Sie ihn wenigstens noch ein wenig weitertreiben können. Aber wie es auch aussehen mag, wir werden ›Operation Ausbruch‹ in der nächsten halben Stunde einleiten.«
Einen Augenblick lang schaute ihn Somerset über den Kom-Schirm nur an, dann nickte er schwerfällig.
»Sehr wohl, Sir. Ich werde die Befehle ausgeben.«
»Ich danke Ihnen, Martin«, gab Pei mit sehr viel sanfterer Stimme zurück und unterbrach die Verbindung.
»Möglicherweise hat der Captain recht, Sir«, meldete sich jetzt eine ruhige Altstimme zu Wort, und der Admiral schwenkte seinen Sessel auf der Brücke herum.
Lieutenant Commander Nimue Alban war eine noch sehr junge Offizierin ‒ vor allem für eine Gesellschaft, in der Antigeron-Therapien die Regel waren –, und so war es fast unvorstellbar, dass sie, so respektvoll sie dabei auch vorgehen mochte, es tatsächlich wagte, einem Vier-Sterne-Admiral gegenüber überhaupt auch nur anzudeuten, er könne vielleicht doch nicht unfehlbar sein. Doch Pei Kau-zhi hatte nicht die Absicht, das ihr gegenüber anzumerken. Zum einen, weil sie trotz ihres jugendlichen Alters eine der brillantesten taktischen Offiziere war, die die Terran Federation Navy jemals hervorgebracht hatte, und zum anderen: Falls sich irgendjemand jemals das Recht erworben hatte, das Urteil von Admiral Pei in Frage zu stellen, dann war das Lieutenant Commander Alban.
»Er hat wirklich möglicherweise recht«, gab Pei zu. »Seine Anmerkung ist sogar ziemlich berechtigt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir schon bald schlechte Nachrichten erhalten werden.«
»Das Gefühl, Sir?«
Die bemerkenswerte Kombination von dunklem Haar und blauen Augen hatte Alban ihrem walisischen Vater zu verdanken, doch ihre auffallende Körpergröße und die helle Haut hatte sie von ihrer schwedischen Mutter geerbt. Admiral Pei andererseits war ein kleiner, drahtiger Mann, mehr als dreimal so alt wie sie, und jetzt, wie sie ihn mit hochgezogener Augenbraue anschaute, schien sie ihn geradezu bedrohlich zu überragen. Dennoch, so stellte Pei mit einer gewissen bittersüßen Befriedigung fest, schwang keinerlei Unglaube in ihrer Frage mit.
Schließlich, rief er sich selbst ins Gedächtnis zurück, hat meine Vorliebe, meiner Intuition zu folgen, durchaus etwas damit zu tun, dass ich der letzte Vier-Sterne-Admiral bin, den die Terran Federation jemals haben wird.
»In diesem Falle hat das nicht mit geheimnisvollen Psi-Kräften zu tun, Nimue«, erklärte er. »Aber wo ist der andere Aufklärer? Sie wissen, dass die Aufklärer-Schiffe der Gbaba immer paarweise eingesetzt werden, und Captain Somerset hat bislang nur einen gemeldet. Dieser andere Bursche muss noch irgendwo stecken.«
»Und zum Beispiel den Rest des Rudels herbeirufen«, führte Alban mit finsterem Blick den Gedanken fort, und der Admiral nickte.
»Genau das wird er gerade tun. Die müssen uns zumindest irgendwie gewittert haben, bevor wir sie haben orten können, und einer von denen hat gewendet und sofort Hilfe geholt. Dieser eine hier wird uns immer weiter verfolgen, wird unsere Position genauestens bestimmen und den anderen den Kurs vorgeben. Aber was er auf keinen Fall tun wird, das ist, uns nahe genug zu kommen, um uns eine gute Gelegenheit zu bieten, auf ihn das Feuer zu eröffnen. Der kann es sich nicht leisten, dass wir ihn abschießen und dann aus dem Hyperraum heraustreten. Dann finden die uns vielleicht nie mehr wieder.«
»Ich verstehe, was Sie meinen, Sir.« Einen Augenblick wirkte Alban sehr nachdenklich; sie hatte die blauen Augen auf irgendetwas gerichtet, was nur sie allein sehen konnte, doch dann schaute sie wieder den Admiral an.
»Sir«, sagte sie leise, »wäre es ungebührlich, jetzt die Vorrang-Komschaltung dazu zu nutzen, mit der Gulliver Kontakt aufzunehmen? Ich würde … würde mich gerne vom Commodore verabschieden.«
»Nein, das wäre es nicht«, gab Pei zurück, ebenso leise. »Und wenn Sie das tun, dann richten Sie ihm bitte aus, dass ich an ihn denken werde.«
»Sir, Sie könnten es ihm persönlich sagen.«
»Nein.« Pei schüttelte den Kopf. »Kau-yung und ich haben uns bereits voneinander verabschiedet, Nimue.«
»Jawohl, Sir.«
Schnell verbreitete sich die Nachricht von der Excalibur, als das Zehnte Zerstörergeschwader den Gbaba-Aufklärer ansteuerte, und mit dieser Nachricht ging eine kalte, hässliche Welle der Furcht einher. Keine Panik, vielleicht weil jeder einzelne Angehörige der letzten noch verbliebenen Flotte der niedergemetzelten Föderation tief im Innersten bereits wusste, dass dieser Augenblick kommen würde. Tatsächlich hatten sie sogar entsprechende Pläne aufgestellt. Doch das machte niemanden gegen die Furcht immun, als dieser Augenblick dann tatsächlich kam.
Einige der Offiziere und Gasten auf der Brücke schauten zu, wie die Marker der Zerstörer sich auf dem Taktik-Display immer weiter näherten und beteten innerlich darum, dass sie das kleine Schiff einholen und zerstören würden. Sie wussten, wie unwahrscheinlich es war, dass das tatsächlich geschehen würde, und selbst wenn, würde es ihnen vielleicht nur einige weitere Wochen Aufschub verschaffen, möglicherweise einige Monate. Doch das hielt sie nicht davon ab, inständigst zu beten.
An Bord des schweren Kreuzers TFNS Gulliver betete ein kleiner, drahtiger Commodore ebenfalls. Er betete nicht um die Zerstörung des Aufklärer-Schiffes. Er betete nicht einmal für seinen älteren Bruder, der schon bald sterben würde. Er betete für eine junge Offizierin, einen Lieutenant Commander, die ihm fast wie eine Tochter geworden war … und die sich freiwillig dafür gemeldet hatte, auf die Excalibur abkommandiert zu werden, obwohl oder weil sie wusste, dass dieses Schiff unmöglich würde überleben können.
»Commodore Pei, hier geht eine Kom-Anfrage vom Flaggschiff für Sie ein«, meldete der Offizier vom Kommunikationsleitstand leise. »Es ist Nimue, Sir.«
»Ich danke Ihnen, Oscar«, gab Pei Kau-yung zurück. »Schicken Sie es mir hier auf meinen Schirm.«
»Jawohl, Sir.«
»Nimue«, begrüßte Pei sie, als das vertraute ovale Gesicht mit den saphirblauen Augen auf seinem Display erschien.
»Commodore«, erwiderte sie. »Sie haben es mittlerweile bestimmt schon gehört.«
»Allerdings. Wir bereiten uns gerade jetzt darauf vor, ›Operation Ausbruch‹ einzuleiten.«
»Das wusste ich. Ihr Bruder ‒ der Admiral ‒ hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass er an Sie denkt. Auch ich tue das. Und ich weiß, dass Sie auch an uns denken werden, Sir. Deswegen wollte ich diese Gelegenheit dazu nutzen, noch einmal mit Ihnen zu sprechen.« Sie blickte ihm geradewegs in die Augen. »Es war mir eine Ehre und ein Privileg, unter Ihnen Dienst tun zu dürfen, Sir. Ich bedaure nichts von dem, was geschehen ist, seit Sie mich in Ihren Stab berufen haben.«
»Das … bedeutet mir sehr viel, Nimue«, sagte Pei sehr leise. Wie sein Bruder war auch er Traditionalist, und es gehörte nun einmal nicht zu seiner Kultur, Emotionen offen zur Schau zu stellen; doch er wusste, dass sie den Schmerz erkennen würde, der ihm in den Augen stand. »Und darf ich auch sagen«, fügte er hinzu, »dass ich zutiefst dankbar bin für die zahlreichen Dienste, die Sie mir geleistet haben.«
Selbst für ihn klang das entsetzlich gestelzt, doch mehr zu sagen wagten sie über einen öffentlichen Kanal nicht ‒ vor allem, da sämtliche Nachrichten automatisch aufgezeichnet wurden. Und ob es nun gestelzt geklungen hatte oder nicht: Nimue wusste genau, was er damit meinte, ebenso, wie er auch sie verstanden hatte.
»Das freut mich, Sir«, gab sie zurück. »Und bitte verabschieden Sie sich in meinem Namen von Shan-wei. Sie liegt mir sehr am Herzen.«
»Selbstverständlich. Dass es ihr umgekehrt ebenso geht, wissen Sie ja bereits«, sagte Pei. Und dann, was auch immer seine Kultur von ihm verlangt hätte, räusperte er sich kräftig. »Und mir auch«, setzte er dann noch heiser hinzu.
»Das bedeutet mir sehr viel, Sir.« Das Lächeln, das ihm Alban zuwarf, war fast schon zärtlich. »Leben Sie wohl, Commodore. Gott segne Sie.«
Es gelang den Zerstörern, das Aufklärerschiff zurückzudrängen. Nicht ganz so weit, wie sie das gewünscht hätten, aber doch weit genug, um bei Admiral Pei für eine gewisse Erleichterung zu sorgen.
»Alle Mann auf Station«, sagte er, ohne den Blick von dem Haupt-Taktikdisplay abzuwenden. »Geben Sie den Befehl, ›Operation Ausbruch‹ einzuleiten.«
»Aye, aye, Sir!«, bestätigte der ranghöchste Kommunikationsgast, und nur einen Moment später flackerten auf Peis Display plötzlich die Lichtcodes.
Nur für einen Augenblick, und auch nur, weil seine Sensoren sie so konzentriert beobachteten.
So, dachte er sarkastisch, lautet zumindest die Theorie.
Sechsundvierzig riesige Raumschiffe deaktivieren ihre Hyperantriebe und fielen gleichzeitig in Unterlichtgeschwindigkeit. Doch im gleichen Augenblick, als das geschah, tauchten sechsundvierzig andere Raumschiffe auf, die bislang sorgfältig im Schleichfahrt-Modus verborgen geblieben waren. Es war ein genauestens koordiniertes Manöver, die Peis Stab immer und immer wieder in den Simulatoren trainiert hatte, und dazu mehr als ein Dutzend Mal tatsächlich im freien Raum, und nun brachten sie es ein weiteres Mal, ein letztes Mal, perfekt zum Abschluss. Die sechsundvierzig Neuankömmlinge glitten zügig und geschickt in die Löcher, die abrupt in der Formation aufgetaucht waren, und ihre Antriebssignaturen entsprachen fast perfekt der all jener Schiffe, die jetzt aus dem Hyperraum verschwunden waren.
Das wird eine unangenehme Überraschung für die Gbaba werden, sagte Pei kalt zu sich selbst. Und eines Tages wird es zu einer noch viel größeren, noch viel unangenehmeren Überraschung für sie führen.
»Wissen Sie«, sagte er und wandte sich von dem Display ab, um nun Lieutenant Commander Alban und seinen Stabschef Captain Joseph Thiessen, anzublicken, »wir waren so kurz davor, denen so richtig in den Hintern zu treten. Noch fünfzig Jahre mehr ‒ allerhöchstens fünfundsiebzig –, und wir hätten die erledigen können, ob die nun ein ›sternenweites Imperium‹ haben oder nicht.«
»Ich denke, das ist ein wenig zu optimistisch ausgedrückt, Sir«, gab Thiessen nach kurzem Schweigen zurück. »Wie Sie wissen, haben wir nie herausfinden können, wie groß deren Imperium denn nun wirklich ist.«
»Das hätte keinen Unterschied gemacht.« Scharf schüttelte Pei den Kopf. »Im Augenblick steht das Rennen um die Technologie praktisch unentschieden, Joe. Jetzt, in diesem Moment. Und wie alt sind deren Schiffe?«
»Ein paar von denen sind brandneu, Sir«, erwiderte Nimue Alban anstelle des Stabschefs. »Aber ich verstehe, was Sie meinen«, fuhr sie dann fort, und sogar Thiessen nickte, fast schon unwillig.
Pei ließ die Sache auf sich beruhen. Es hatte keinen Sinn, weiter darauf einzugehen, nicht jetzt. Auch wenn es in gewisser Weise eine immense Erleichterung für ihn dargestellt hätte, endlich irgendjemandem außer Nimue zu erzählen, was nun geschehen würde. Aber das konnte er Thiessen nicht antun. Der Stabschef war ein guter Mann, der absolut an die grundlegenden Voraussetzungen von ›Operation Arche‹ glaubte. Wie jeder und jede andere unter Peis Kommando war er bereit, sein Leben dafür hinzugeben, dass ›Operation Arche‹ erfolgreich werden konnte, und der Admiral konnte ihm nicht erklären, das sein eigener kommandierender Offizier Teil einer Verschwörung gegen genau die Personen war, deren Aufgabe darin bestand, diesen Erfolg auch zu erzielen.
»Glauben Sie, dass wir sie genügend in Angst und Schrecken versetzt haben, damit sie aktive Forschungsvorhaben einleiten, Sir?«, fragte Thiessen nach einer kurzen Pause. Pei schaute ihn an und hob eine Augenbraue, und der Stabschef zuckte mit den Schultern und grinste schief. »Ich würde gerne glauben, wir hätten diese Mistkerle wenigstens ins Schwitzen gebracht.«
»Oh, ich glaube, davon können Sie ruhig ausgehen«, erwiderte Pei und lächelte ebenfalls, doch in diesem Lächeln lag nicht einmal eine Spur Belustigung. »Ob die das allerdings dazu bringen wird, ihr Verhalten zu ändern, weiß ich wirklich nicht. Die Xenologen vermuten, dass dem nicht so ist. Die Gbaba haben ein System und eine Kultur, die mindestens acht- oder neuntausend Jahre lang bestens für sie funktioniert hat. Wir mögen für sie ein größerer Stolperstein gewesen sein, als sie es bislang gewohnt waren, aber letztendlich hat deren Vorgehensweise auch bei uns funktioniert. Wahrscheinlich werden sie jetzt ein paar Jahrhunderte lang ein bisschen nervös sein, und sei es auch nur, weil sie sich fragen, ob wir vielleicht irgendwo noch eine weitere Kolonie errichtet haben, ohne dass sie es bemerkt hätten, aber dann werden sie sich schon wieder beruhigen.«
»Bis die nächsten armen Teufel über sie stolpern«, sagte Thiessen verbittert.
»Bis dahin«, pflichtete Pei ihm mit ruhiger Stimme bei und wandte sich dann wieder dem Display zu.
Acht- oder neuntausend Jahre, dachte er. Das ist die beste Vermutung, die unsere Xenologen aufgestellt haben, aber ich wette, dass es in Wirklichkeit noch länger her ist. Oh Gott, ich frage mich, wie lange es wohl her ist, das die ersten Gbaba das Feuer entdeckt haben!
Über diese Frage hatte er mehr als einmal nachgedacht, während dieser vier Jahrzehnte, in denen das Imperium der Gbaba die Menschheit vernichtet hatte, denn zwei Dinge waren die Gbaba definitiv nicht: Sie waren weder innovativ noch anpassungsfähig.
Zunächst hatten die Gbaba die Herausforderung, die die Menschheit für sie darstellte, eindeutig unterschätzt. Ihre ersten Flotten waren denen ihrer Opfer ‒ beziehungsweise derer, die sie gerne zu ihren Opfern gemacht hätten ‒ zahlenmäßig nur um den Faktor drei oder vier überlegen, und so wurde es schnell und für die Gbaba äußerst schmerzhaft deutlich, dass sie der taktischen Flexibilität der Menschheit überhaupt nichts entgegenzusetzen hatten. Ihre erste selbstmörderische Angriffswelle war über Crestwell hinweggebrandet und hatte drei der vierzehn größeren Kolonien der Föderation außerhalb des Sol-Systems zerstört ‒ mit einhundert Prozent Verlusten der Zivilbevölkerung. Doch dann hatte sich die Federation Navy zusammengezogen und sie aufgehalten. Die Flotte hatte sogar einen Gegenangriff gestartet und dabei nicht weniger als sechs Sternensysteme der Gbaba eingenommen.
Doch dann hatte die gesamte Flotte der Gbaba mobil gemacht.
Commander Pei Kau-zhi hatte als Feuerleit-Offizier an Bord eines der Linienschiffe der Föderation im Starfall System Dienst getan, als die richtige Flotte der Gbaba auftauchte. Immer noch sah er vor seinem geistigen Auge die Displays, sah die endlose Welle scharlachroter Marker ‒ jeder einzelne stand für ein Großkampfschiff der Gbaba –, die wie ein manifestierter Fluch aus dem Hyperraum austraten. Es war, als steuere man ein Bodenfahrzeug geradewegs in einen scharlachroten Schneesturm hinein ‒ nur dass kein Schnee ihm jemals einen derartigen Schauer über den Rücken gejagt hätte.
Bis heute wusste er nicht, wie überhaupt irgendein Schiff der Flotte unter dem Oberkommando von Admiralin Thomas dort hatte entkommen können. Die meisten Schiffe hatten zusammen mit ihr den Tod gefunden, als sie die Flucht nur einer Hand voll Überlebender zu sichern versuchten ‒ Überlebende, deren Aufgabe nicht darin bestanden hatte, zusammen mit ihr die Stellung zu halten und bis zum Tod zu kämpfen, sondern darin, weiterzuleben und die entsetzlichen Nachrichten zu verbreiten. Hastig, panisch nach Hause zu flüchten und dort in den ersten vorwarnenden Böen des Sturms einzutreffen, um die Menschheit zu warnen, dass die Apokalypse nahte.
Nicht, dass es die Menschheit völlig unvorbereitet getroffen hätte.
Die Wucht des ersten Angriffs der Gbaba, auch wenn es gelungen war, ihn zurückzuschlagen, hatte wie ein grausamer Weckruf gewirkt. Jede Welt der Föderation hatte damit begonnen, sich zu bewaffnen und Abwehranlagen zu errichten, als die ersten Beweise für die Existenz der Gbaba aufgetaucht waren ‒ zehn Jahre vor den Ereignissen von Crestwell. Nach Crestwell hatte man die Anstrengungen geradezu hektisch fortgesetzt, und ein Sternensystem konnte eine immense Festung abgeben. Die überlebenden Einheiten der Flotte hatten sich auf stabile Abwehranlagen zurückgezogen, hatten die Stellung gehalten und bis zum Tode die Welten der Menschheit verteidigt, und sie hatten die Gbaba gezwungen, einen entsetzlichen Preis zu zahlen ‒ zahllose tote, geborstene Raumschiffe.
Doch die Gbaba hatten sich entschieden, diesen Preis zu zahlen. Nicht einmal die Xenologen hatten eine vernünftige Erklärung dafür gefunden, dass die Gbaba sich beharrlich weigerten, Verhandlungen auch nur in Erwägung zu ziehen. Sie ‒ oder zumindest ihre Übersetzercomputer ‒ verstanden ganz offensichtlich Standard-Englisch, denn sie hatten ganz eindeutig erbeutete Daten und Dokumente ausgewertet, und die Hand voll gebrochener, vernarbter Menschen, die sie gefangen hatten und die man aus ihrer Hand wieder hatte befreien können, waren mit einer beiläufigen, nüchternen Brutalität ›vernommen‹ worden, die einfach nur entsetzlich gewesen war. Also wusste die Menschheit, dass Kommunikation mit dem Feind zumindest möglich war, doch dennoch hatten die Gbaba nie auf einen einzigen offiziellen Versuch der Kontaktaufnahme reagiert ‒ sie hatten ihre Angriffe nur noch schärfer und unablässiger vorangetrieben.
Pei selbst fragte sich, ob die Gbaba überhaupt noch in der Lage wären, in durchdachter Art und Weise zu reagieren. Einige der Schiffe, die zu kapern oder außer Gefecht zu setzen der Föderation gelungen waren, hatten sich als geradezu unvorstellbar alt herausgestellt. Mindestens eines davon ‒ so sagten zumindest die Wissenschaftler, die mit der Analyse beauftragt gewesen waren –, war mindestens zwei Jahrtausende vor dessen Eroberung gebaut worden, und doch gab es keinerlei Hinweise auf einen wie auch immer gearteten technologischen Fortschritt in der Zeit zwischen dem Bau dieses Raumschiffs und seiner Eroberung. Schiffe, die, wie Alban angemerkt hatte, brandneu waren, wiesen die gleiche Bewaffnung auf, die gleichen Computer, die gleichen Hyperantriebe und die gleichen Ortungssysteme.
Das ließ auf eine kulturelle Stagnation schließen, die selbst das uralte China ‒ aus dem Pei stammte –, nicht einmal in seiner Phase extremster konservativer Ablehnung jeglicher äußeren Einflüsse erreicht hatte. Es war eine kulturelle Stagnation, gegen die sich das alte Ägypten wie eine Brutstätte der Innovation ausnahm. Es war Pei unmöglich, sich Lebewesen vorzustellen, die so lange ohne jeglichen Fortschritt überhaupt würden durchhalten können. Also waren die Gbaba vielleicht, nach menschlichem Verständnis dieses Begriffes, überhaupt nicht mehr ›vernunftbegabt‹. Vielleicht war das alles ‒ das alles hier ‒ nur das Resultat einer Reihe kultureller Gebote, die in den Gbaba so tief verwurzelt waren, dass tatsächlich alles nur noch rein instinktiv geschah.
Nichts davon hatte die Menschheit vor ihrer Vernichtung bewahren können.
Natürlich hatte es einige Zeit gedauert. Die Gbaba waren gezwungen gewesen, die Bollwerke der Menschheit auszuschalten, eines nach dem anderen, in gewaltigen Belagerungskriegen, die mehrere Jahre gedauert hatten. Zum Schutze der einzelnen System-Festungen war eine neue Federation Navy geschaffen worden, mit neuen Offizieren und Gasten ‒ von denen viele, wie auch Nimue Alban, niemals ein Leben kennen lernen sollten, in dem die Menschheit nicht mit dem Rücken zur Wand stand. In verzweifelten Ausfällen und Einzeleinsätzen hatte die Navy zurückgeschlagen, und diese Gegenangriffe hatten den Gbaba gewaltige Verluste eingebracht, doch das Endergebnis war immer noch unausweichlich.
Das Parlament der Föderation hatte versucht, Kolonieflotten auszuschicken, die dann verborgene Zufluchtsorte einrichten sollten, in denen wenigstens ein kleiner Teil der Menschheit diesen Sturm würden abwarten können. Doch wie unflexibel oder einfallslos die Gbaba auch sein mochten, diesem Trick sahen sie sich offensichtlich nicht zum ersten Mal gegenüber, denn sie umschlossen jedes einzelne der verbliebenen Sternensysteme der Föderation mit Aufklärer-Schiffen. Kampfverbände, die für die Eskorte dieser Kolonieflotten zuständig sein sollten, mochten örtlich tatsächlich schlagkräftig genug sein, um die Oberhand zu gewinnen und sich durch die Reihen der Aufklärer und der deutlich weniger häufig eingesetzten Kampfschiffe, die sie schützen sollten, hindurchzukämpfen. Doch irgendwie schienen diese Aufklärer immer in der Lage zu sein, den Kontakt zu den Kolonieschiffen zu halten, oder ihn zumindest äußerst schnell wieder herzustellen ‒ und so wurde jeder Versuch, die Blockade zu durchbrechen, rasch vereitelt.
Eine Kolonie war den Aufklärern tatsächlich entgangen … doch nur, um weniger als zehn Jahre später eine letzte, verzweifelte Nachricht über das HyperCom abzusetzen. Es mochte ja den Kordon der zahllosen Aufklärer-Schiffe durchstoßen haben, doch dann waren ihm andere hinterhergeschickt worden. Die Gbaba mussten wirklich Tausende dieser Aufklärer eingesetzt haben, um sämtliche möglichen Zielorte zu überprüfen, die diese Kolonie hätte ansteuern können, doch letztendlich hatte einer dieser Aufklärer sie tatsächlich ausgemacht, und diesem Aufklärer-Schiff waren die Killer-Flotten gefolgt. Der Administrator dieser Kolonie vermutete, es könnten die Emissionen der Kolonie selbst gewesen sein, die letztendlich die Gbaba auf sie aufmerksam gemacht hatten, so sehr die Kolonisten sich auch bemüht hatten, diese Emissionen einzuschränken.
Pei vermutete, dass dieser ‒ mittlerweile längst verstorbene ‒ Administrator mit seiner Vermutung recht gehabt hatte. Genau diese Vermutung war zumindest eine der grundlegenden Voraussetzungen, mit der die Planer von ›Operation Arche‹ gearbeitet hatten.
»Wenigstens haben wir es geschafft, deren verdammten Aufklärer weit genug zurückzudrängen, dass ›Operation Ausbruch‹ überhaupt eine Chance hat zu funktionieren«, merkte Thiessen jetzt an.
Pei nickte. Diese Bemerkung fiel in die Kategorie ›das liegt ja nun klar auf der Hand‹, doch unter den gegebenen Umständen wollte und konnte Pei das niemandem vorwerfen.
Außerdem wollte Joe das wohl als eine Art Kompliment verstanden wissen, dachte er und lächelte innerlich. Schließlich hatte Pei persönlich ›Operation Ausbruch‹ ersonnen ‒ eine Art ›Taschenspielertrick‹, mit dem er die Gbaba davon überzeugen wollte, sie hätten auch den letzten Versuch der Menschheit, eine neue Welt zu kolonisieren, erfolgreich aufgespürt und völlig zerstört. Deswegen hatten die sechsundvierzig Dreadnoughts und Transporter, die den Rest seines Kampfverbandes im Schleichfahrtmodus begleitet hatten, während ihres Kampfes, den Kordon aus Kampfschiffen, der den Aufklärer-Kordon der Gbaba rings um das Sol-System sicherte, kein einziges Geschoss abgefeuert und keinen einzigen Kampfjäger eingesetzt.
Es war ein harter Kampf gewesen, auch wenn das Endergebnis nie angezweifelt worden war. Doch dadurch, dass sie auf den Schleichfahrtmodus umgeschaltet hatten, und zudem gedeckt durch das Hintergrundrauschen der schweren Geschütze und der elektronischen Kampfführung der widerstreitenden Einheiten, hatten die Gbaba sie ‒ hoffentlich! ‒ nicht entdeckt und ihre Anwesenheit auch nicht vermutet.
Dadurch, dass sie zwei vollständige Zerstörer-Geschwader geopfert hatten, die sich hatten zurückfallen lassen, um die einzigen Aufklärer-Schiffe abzufangen, die nah genug gekommen waren, um die flüchtende Kolonie-Flotte mit ihren Sensoren zu erfassen, war es Pei gelungen, tatsächlich auszubrechen und zu flüchten, und tief in seinem Innersten hoffte er, dass es ihnen gelingen würde, den Gbaba-Aufklärern zu entkommen. Dass, allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz, seine ganze Flotte doch noch würde überleben können.
Wenn die Flotte der Gbaba einträfe ‒ und das würde sie, so alt die Gbaba-Schiffe auch sein mochten, sie waren immer noch schneller als alle Schiffe der Menschheit ‒ sie tatsächlich genau die Anzahl von Schiffen orten würde, die ihre Aufklärer auch gemeldet hatten, als sie endlich wieder in Kontakt mit den Flüchtlingen getreten waren.
Und sobald erst einmal jedes dieser Schiffe zerstört und jedes einzelne Mitglied ihrer Mannschaften getötet wäre, dann würden die Gbaba davon ausgehen, sie hätten jetzt wirklich alle Flüchtlinge getötet.
Aber sie würden sich täuschen, sagte sich Pei Kau-zhi innerlich mit eisiger Stimme. Und eines Tages, trotz allem, was Leute wie Langhorne und Bedard auch dagegen unternehmen könnten, werden wir zurückkehren. Und dann, ihr Dreckskerle, dann werdet ihr …
»Admiral«, sagte Nimue Alban leise, »die Langstreckensensoren haben einkommende Feindschiffe geortet.«
Er drehte sich zu ihr herum und schaute sie an; sie hielt seinem Blick stand.
»Wir haben zwei bestätigte Kontakte, Sir«, fuhr sie fort. »Das KSZ schätzt den ersten auf etwa eintausend Punktquellen ab. Der zweite ist größer.«
»Naja«, merkte er an und klang dabei fast belustigt, »zumindest machen die sich genug Sorgen, um uns ihre besten Leute entgegenzuschicken, was?« Er schaute zu Thiessen hinüber.
»Bringen Sie bitte die Flotte in Stellung«, sagte er dann. »Kampfjäger absetzen und Geschosse für den Abschuss positionieren.«
07. September 2499
Enklave Pei-See,
auf dem Kontinent Haven
Safehold
»Großvater! Großvater, komm schnell! Ein Engel! Ein Engel!«
Timothy Harrison blickte auf, als sein Urenkel so unsanft und lautstark durch die offenstehende Tür seines Büros im Rathaus hereingestürmt kam. Das Verhalten des Jungen war natürlich ungeheuerlich, aber es war nie einfach, auf Matthew wütend zu werden, und niemand, den Timothy kannte, schaffte es längere Zeit, auf ihn wütend zu bleiben. Und das bedeutete ‒ Jungs waren nun einmal Jungs –, dass der kleine Matthew sich üblicherweise Dinge herausnehmen konnte, für die er zumindest eine Tracht Prügel verdient hätte.
In diesem Fall jedoch, so vermutete Timothy, konnte man ihm seine Aufregung vielleicht sogar nachsehen. Nicht dass er bereit gewesen wäre, das auch zuzugeben.
»Matthew Paul Harrison«, sagte er streng, »das hier ist mein Büro, nicht die Gemeinschaftsdusche neben dem Baseball-Feld! Zumindest eine Prise geziemendes Benehmen wird hier von jedem erwartet ‒ selbst, oder auch vor allem, von einem jungen Raufbold wie dir!«
»Es tut mir leid«, gab der Junge zurück und ließ den Kopf hängen. Doch gleichzeitig blickte er auch schon wieder zu seinem Urgroßvater hinauf, über die Augenbrauen hinweg, und die Grübchen seines geradezu enorm charmanten Lächelns, das ihm in wenigen Jahren zahllose Schwierigkeiten einbringen würde, zuckten an seinen Mundwinkeln.
»Nun …«, grollte Timothy, »ich denke, wir können darüber hinwegsehen … ausnahmsweise!«
Immerhin konnte er mit Befriedigung feststellen, dass diese Einschränkung seinen Urenkel tatsächlich ein wenig erzittern ließ, und so lehnte er sich wieder in seinem Sessel zurück.
»Also, was hat es da mit diesem Engel auf sich, den du erwähnt hast?«
»Die Signalleuchte«, sagte Matthew eifrig, und in seinen Augen glomm wieder die Aufregung auf, die ihn überhaupt erst dazu gebracht hatte, seinen Urgroßvater so unsanft zu stören. »Die Signalleuchte ist gerade eben angegangen! Pater Michael hat gesagt, ich soll zu dir laufen und dir sofort davon erzählen! Ein Engel kommt, Großvater!«
»Und welche Farbe hatte die Signalleuchte?«, fragte Timothy nach. Er sprach mit so ruhiger, bedächtiger Stimme, dass er, ohne es zu merken, in der Wertschätzung seines Urenkels gerade eben noch weiter gestiegen war.
»Gelb«, gab Matthew zurück, und Timothy nickte. Also einer der niederen Engel. Kurz durchzuckte echtes Bedauern ihn, doch sofort schalt er sich innerlich dafür. Es mochte ja aufregender sein, auf den Besuch eines der Erzengel selbst zu hoffen, doch sterbliche Menschen taten nicht gut daran, Gott Befehle erteilen zu wollen –, selbst indirekt nicht.
Außerdem wird auch ein ›niederer‹ Engel für dich schon mehr als genug an Aufregung bedeuten, alter Mann!, fuhr er mit seiner geistigen Strafpredigt fort.
»Nun«, sagte er dann und nickte seinem Urenkel zu, »wenn ein Engel nach Seeblick kommt, dann müssen wir uns darauf vorbereiten, ihn willkommen zu heißen. Geh hinunter zum Kai, Matthew! Such Jason und sag ihm, er soll das Signal geben, dass alle Fischerboote in den Hafen zurückkehren. Sobald du das getan hast, gehst du nach Hause und erzählst deiner Mutter und deiner Großmutter davon. Ich bin mir sicher, Pater Michael wird schon bald die Glocke läuten, aber du kannst schon vorgehen und sie alle warnen.«
»Ja, Großvater!« Matthew nickte eifrig, dann drehte er sich um und rannte wieder hinaus ‒ genau so unziemlich, wie er hereingekommen war. Timothy schaute ihm hinterher, lächelte kurz, dann straffte er die Schultern und verließ sein Büro.
Ein Großteil der Mitarbeiter im Rathaus hatten ihre Arbeit unterbrochen. Sie schauten zu ihm hinüber, und wieder lächelte er, belustigt.
»Wie ich sehe, haben Sie alle Matthews Bericht mit angehört«, sagte er trocken. »Da dem schon so ist, sehe ich keinerlei Notwendigkeit, mich darüber im Augenblick noch weiter auszulassen. Schließen Sie Ihre Arbeit ab, geben Sie alles zu den Akten und dann eilen Sie nach Hause, um sich vorzubereiten.«
Die Mitarbeiter nickten. Hier und dort war das Scharren von Stühlen zu hören, die über den Holzboden geschoben wurden, als Sachbearbeiter ‒ die diese Instruktionen bereits erwartet hatten ‒ sich eilends daran machten, Akten in die entsprechenden Schränke zu räumen. Andere beugten sich wieder über ihre Schreibtische, und ihre Federn huschten über das Papier, um noch einen Punkt zu erreichen, an dem eine Unterbrechung sinnvoll wäre. Einige Sekunden lang schaute Timothy ihnen noch zu, dann ging er weiter, zur Eingangstür des Rathauses hinaus.
Das Rathaus stand auf einem Hügel in der Mitte des Dorfes Seeblick. Seeblick wuchs stetig an, und Timothy war sich sehr wohl bewusst, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis aus dem ›Dorf‹ eine ›Kleinstadt‹ werden würde. Er war sich nicht ganz sicher, wie er darüber eigentlich dachte, und das aus vielerlei Gründen. Doch wie auch immer er darüber denken mochte, es gab keinen Zweifel, wie Gott und Seine Engel darüber dachten, und das machte jegliche persönlichen Vorbehalte, die er hegen mochte, schlichtweg bedeutungslos.
Wie er sah, verbreitete sich die Kunde bereits. Leute eilten über das Kopfsteinpflaster der Straßen und der Bürgersteige, mit gesenkten Köpfen unterhielten sie sich angeregt mit anderen, oder sie strahlten einfach nur über das ganze Gesicht. Die Signalleuchte in Pater Michaels Kirchturm war bewusst so angebracht worden, dass so viele Dorfbewohner wie möglich sie ständig im Blick halten konnten, und jetzt konnte Timothy von dort, wo er gerade stand, ihr bernsteinfarbenes Glimmen erkennen, trotz der gleißenden Sommersonne.
Jetzt läutete auch die Glocke im Kirchturm. Ihre tiefe, donnernde Stimme sang in der Sommerluft, verbreitete lauthals die frohe Kunde, informierte all diejenigen, die bislang die Signalleuchte noch nicht gesehen hatten, und Timothy stand inmitten dieser hellen, fröhlichen Blase der allgemeinen Zufriedenheit und nickte kurz. Dann ging er auf die Kirche zu und grüßte mit einem Nicken all diejenigen, an denen er dabei vorbeiging. Schließlich war er der Bürgermeister von Seeblick, und mit diesem Amt ging auch eine gewisse Verantwortung einher. Wichtiger noch: er war einer der wenigen ‒ und langsam aber stetig immer weniger werdenden ‒ ›Adams‹ von Seeblick, ebenso wie seine Gemahlin Sarah eine der wenigen ›Evas‹ dieses Dorfes war. Damit fiel ihnen beiden die besondere Aufgabe zu, stets in angemessen würdevoller Form aufzutreten und den Respekt, die Verehrung und die Ehrfurcht entgegenzunehmen, die ihnen als unsterbliche Diener eben jenes Gottes zufiel, der ihnen den Odem des Lebens in die Nase eingeblasen hatte.
Er erreichte die Kirche, vor der Pater Michael bereits auf ihn wartete. Der Priester war tatsächlich sogar ein wenig jünger als Timothy, doch er wirkte viel älter. Michael war eines der ersten Kinder gewesen, die zur Antwort auf Gottes Geheiß, fruchtbar zu sein und sich zu mehren, auf Safehold geboren worden war. Timothy selbst war natürlich überhaupt nicht ›geboren‹ worden. Gott hatte seine unsterbliche Seele mit Seiner Eigenen Hand geschaffen, und der Erzengel Langhorn und sein Diener, der Erzengel Shan-wei, hatten Timothys physischen Körper nach Gottes Eigenem Plan hervorgebracht.
Genau hier hatte Timothy seine ›Erweckung‹ erlebt, hier in Seeblick, hatte zusammen mit den anderen ›Adams‹ und ›Evas‹ auf dem Dorfplatz gestanden, und allein die Erinnerung an jenen ersten, glorreichen Morgen ‒ der erste Anblick des atemberaubend blauen Himmels von Safehold, des gleißenden Lichtes von Kau-zhi, die über den östlichen Horizont stieg wie eine tropfende Kugel aus geschmolzenem Kupfer, und der hoch aufragenden grünen Bäume; die Felder waren schon bestellt und harrten überreich der Ernte, am Kai des dunkelblauen Wassers des Pei-Sees waren schon die Fischerbote festgemacht und warteten nur darauf, genutzt zu werden ‒ all das erfüllte seine Seele mit Ehrfurcht. Es war zugleich auch das erste Mal gewesen, dass er seine Sarah gesehen hatte, und das für sich allein war schon ein Wunder.
Doch das war vor fast fünfundsechzig Jahren gewesen. Wäre Timothy wie andere Männer gewesen ‒ ein Mann, der aus der Vereinigung von Mann und Frau hervorgegangen wäre –, so hätte schon lange sein körperlicher Verfall eingesetzt. Tatsächlich: Obschon Timothy vier Jahre älter war als Pater Michael, ging der Priester schon gebeugt und hatte silbernes Haar, die Finger vom Alter gekrümmt, während Timothys Haar immer noch dicht und dunkel war, ohne jede Spur von Weiß, auch wenn es tatsächlich in seinem Bart hier und dort schon einige wenige silbrige Strähnen gab.
Timothy konnte sich noch gut daran erinnern, wie Pater Michael als rotgesichtiges Neugeborenes weinend in den Armen seiner Mutter gelegen hatte. Timothy selbst war damals schon ein ausgewachsener Mann gewesen ‒ in der Blüte des frühen Mannesalters, so wie alle ›Adams‹ zur Zeit ihrer Erweckung. Und da er nun einmal das war, was er eben war, das unmittelbare Werk Gottes Eigener Hände, war es nur zu erwarten, dass sein Leben länger währen würde als das derjenigen, denen die unmittelbare Berührung Gottes nicht vergönnt gewesen war. Doch falls Michael das ihm in gleich welcher Weise auch immer verübelte oder neidete, so hatte Timothy davon auch nie nur ein Anzeichen bemerkt. Der Priester war ein bescheidener Mann, sich stets bewusst, dass das Priesteramt, das zu bekleiden ihm gestattet war, ein direkter, greifbarer Beweis für Gottes Gnade war ‒ einer Gnade, der sich kein Mensch jemals als wahrhaftig würdig erweisen konnte. Was jedoch keinen Menschen davon entband, genau das stets zu versuchen.
»Frohlocket, Timothy!«, sagte der Priester jetzt, und die Augen unter den buschigen, weißen Brauen blitzten.
»Frohlocket, Pater«, erwiderte Timothy und beugte kurz ein Knie, damit Michael ihm zum Segen die Hand auf das Haupt legen konnte.
»Möge Langhorne dich segnen und stets auf Gottes Wegen und in Gottes Gesetzen führen, bis der Verheißene Tag für uns alle kommt«, murmelte Michael schnell, dann tippte er Timothy leicht gegen die Schulter.
»Jetzt steh schon auf!«, befahl er dann. »Du bist hier der ›Adam‹, Timothy. Sag mir, ich sollte nicht so nervös sein!«
»Du solltest nicht so nervös sein«, erwiderte Timothy gehorsam, erhob sich und legte seinem alten Freund den Arm um die Schulter. »Wahrlich«, fuhr er dann deutlich ernsthafter fort, »du hast deine Sache gut gemacht, Michael. Seit dem letzten Himmlischen Beistand hast du deine Gemeinde gut gehütet, und sie ist stetig gewachsen.«
»Unsere Gemeinde, meinst du wohl«, erwiderte Pater Michael.
Timothy wollte gerade schon den Kopf schütteln, doch dann unterdrückte er diese Geste. Es war sehr freundlich von Michael, es so auszudrücken, doch sie beide wussten, dass, so sehr Timothy sich auch bemühte, seinen Pflichten als Verwalter von Seeblick und der umliegenden Höfe nachzukommen, seine Autorität letztendlich doch von den Erzengeln stammte, und durch sie von Gott Selbst. Und das bedeutete, dass hier in Seeblick die letztendliche Autorität in jeglicher Hinsicht, ob nun spirituell oder weltlich, bei Pater Michael lag, als Vertreter von Mutter Kirche.
Aber es ist ganz typisch für ihn, es so auszudrücken, nicht wahr?, dachte Timothy und lächelte.
»Komm jetzt«, sagte er dann laut. »Dem Muster gemäß, in dem die Signalleuchte jetzt blinkt, kann es nicht mehr lange dauern. Wir müssen Vorbereitungen treffen.«
Als der leuchtende Heiligenschein des Kyuosei hi in der Ferne über den blauen Wassern des Pei-Sees zu erkennen war, hatten sie alles vorbereitet.
Die gesamte Bevölkerung von Seeblick, von wenigen Fischern abgesehen, die zu weit auf den gewaltigen See hinausgefahren waren, um das Signal zu sehen, mit dem sie zur Rückkehr aufgefordert worden waren, hatte sich auf dem Dorfplatz und in den dorthinführenden Straßen versammelt. Die Familien einiger der näher gelegenen Höfe waren ebenfalls eingetroffen, und der Dorfplatz von Seeblick war schon lange nicht mehr groß genug, ihnen allen Platz zu bieten. Sie quollen über den Platz hinaus, drängten sich in den Seitenstraßen, und Timothy Harrison wurde von tiefer, befriedigender Freude erfüllt, als er so feststellen konnte, dass er und seine Gefährten, all die anderen ›Adams‹ und ›Evas‹, tatsächlich fruchtbar gewesen waren und sich gemehrt hatten.
Schnell kam das Kyuosei hi näher, schneller, als das schnellste Pferd galoppieren konnte, schneller als die schnellste Peitschenechse angriff. Die Lichtkugel wurde heller und heller, je näher sie dem Dorf kam. Zunächst war sie nur ein gleißender Lichtpunkt, weit in der Ferne über dem See. Dann wurde sie größer und heller. Sie wurde zu einem Stern, der aus Gottes eigenem Himmelsgewölbe gefallen war. Dann noch heller, eine zweite Sonne, kleiner als Kau-zhi, aber doch grell genug, um sogar mit deren gleißender Helligkeit in Wettstreit zu treten. Und dann, als es blitzend die letzten Meilen zurücklegte, so rasch wie eine herabstoßende Wyver, war sie so hell, dass sie sogar jede Sonne überstrahlte. Gleißend stand sie über dem Dorf, ohne Hitze abzustrahlen, und doch zu grell, als dass eines Menschen Auge ihren Anblick hätte ertragen können, erzeugte messerscharfe Schatten, der Mittagssonne zum Trotze.
Wie jeder andere Mann und jede andere Frau auch, neigte Timothy den Kopf und bedeckte die Augen, schützte sie vor dem blendenden Glanz. Und dann nahm die Helligkeit ab, so rasch, wie sie gekommen war, und langsam hob Timothy den Kopf wieder.
Das Kyuosei hi stand immer noch über Seeblick, doch es war so weit zum Himmel aufgestiegen, dass es wieder kaum heller war als Kau-zhi selbst. Immer noch war sie zu hell, als dass man sie hätte betrachten können, doch nun war sie weit genug entfernt, dass zumindest das Fleisch Sterblicher ihre Anwesenheit zu ertragen vermochte. Doch auch wenn das Kyuosei hi sich zurückzog, galt das doch nicht für das Wesen, dem es als Triumphwagen diente.
Alle, die sich auf dem Dorfplatz versammelt hatten, knieten nun voller Ehrfurcht nieder, und Timothy tat es ihnen gleich. Sein Herz jubelte vor Freude, als er des Engels gewahr wurde, der nun auf der erhobenen Plattform inmitten des Dorfplatzes stand. Diese Plattform war nur und ausschließlich für Augenblicke wie diesen gedacht. Kein Sterblicher durfte ihre Oberfläche entweihen, abgesehen von den geweihten Priestern, die sie rituell reinigten und stets für derartige Momente bereit hielten.
Timothy erkannte diesen Engel wieder. Fast zwei Jahre waren seit dem letzten Himmlischen Beistand vergangen, und der Engel hatte sich seit seinem letzten Kommen nach Seeblick nicht verändert. Er wirkte ein wenig gealtert ‒ nur sehr wenig, aber doch erkennbar –, seit Timothy ihn zum ersten Mal gesehen hatte, unmittelbar nach seiner Erweckung. Doch die Heilige Schrift besagte, dass die Leiber, in die Engel und Erzengel gekleidet waren, um Gottes Volk zu lehren und zu führen, obschon sie unsterblich waren, aus dem gleichen Stoff bestanden wie die sterbliche Welt. Belebt durch das Surgoi kasai, das ›Große Feuer‹ von Gottes Eigener Berührung, vermochten jene Körper länger zu überdauern, ebenso wie die Leiber der ›Adams‹ und der ›Evas‹ länger überdauerten als die ihrer Nachfahren, doch auch sie alterten. Tatsächlich würde der Tag kommen, an dem alle Engel ‒ und selbst die Erzengel persönlich ‒ vor Gottes Antlitz gerufen wurden. Timothy wusste, dass Gott Selbst es so gefügt hatte, doch er war zutiefst dankbar dafür, dass er selbst schon lange, bevor dieser Tag kam, im Tode die Augen geschlossen haben würde. Eine Welt, die nicht mehr länger durch Engel bevölkert wäre, musste düster, überschattet und freudlos erscheinen, wenn man Gottes Eigene Boten von Angesicht zu Angesicht im Glanz der ersten Tage dieser Welt gesehen hatte.
In vielerlei Hinsicht sah der Engel ein wenig anders aus als ein gewöhnlicher Sterblicher. Er war nicht größer als Timothy, seine Schultern nicht breiter. Und doch war er von Kopf bis Fuß in glänzende, schimmernde Gewänder gekleidet, prächtige Kleidung, deren Farben stets verschwommen und zerflossen, und sein Haupt war von prasselndem, blauem Licht gekrönt. An seiner Hüfte trug er seinen Stab, eine Rute aus unvergänglichem Kristall, halb so lang wie der Unterarm eines ausgewachsenen Mannes. Timothy hatte schon gesehen, wie dieser Stab zum Einsatz gekommen war. Nur ein einziges Mal, doch der Blitz, den der Stab geschleudert hatte, ließ die angreifende Echse damals unter einem gewaltigen Donnerschlag zu Boden stürzen. Die Hälfte des Echsenkadavers war völlig verbrannt, keine Spur war mehr zu erkennen, und noch Stunden danach hatte Timothy es in den Ohren nachgeklungen.
Mehrere Sekunden lang schaute der Engel schweigend auf die ehrfürchtig niederkniende Gemeinde herab. Dann hob er die Hand.
»Friede sei mit euch, Meine Kinder«, sagte er; seine Stimme war unmöglich laut und deutlich zu vernehmen, obwohl er nicht schrie, nicht rief, die Stimme nicht einmal erhoben hatte. »Ich bringe euch Gottes Segen und den Segen des Erzengels Langhorne, der Ihm treu dient. Ehre sei Gott in der Höhe!«
»Und seinen Dienern«, erscholl aus zahllosen Mündern die Entgegnung, und der Engel lächelte.
»Gott hat Wohlgefallen an euch, Meine Kinder«, verkündete er. »Und nun geht wieder eurer Arbeit nach, ihr alle, und frohlocket dem Herrn! Ich bringe Kunde für Pater Michael und Bürgermeister Timothy. Wenn ich mit ihnen gesprochen habe, werden sie euch verkünden, was Gott von euch verlangt.«
Seite an Seite standen Timothy und Michael dort, schauten zu, wie sich Dorfplatz und Seitenstraßen leerten, zügig und doch ohne Hast, ohne Gedränge. Einige der Bauern von den abgelegenen Höfen waren weit geritten ‒ oder in manchen Fällen buchstäblich meilenweit gerannt –, um zum Zeitpunkt der Ankunft des Engels zugegen zu sein. Doch nirgends gab es Groll, nirgends Enttäuschung darüber, dass sie alle so schnell wieder zur Arbeit zurückgeschickt wurden. Es war ihre freudige Pflicht, Gottes Boten willkommen zu heißen, und sie wussten, dass ihnen weit über das Verdienst eines jeden fehlbaren, sündigen Sterblichen hinaus ein Segen zuteil gekommen war, den Engel mit eigenen Augen sehen zu dürfen.
Der Engel stieg von der geweihten Plattform herab und ging auf Timothy und Michael zu. Sofort knieten sie wieder vor ihm nieder, doch der Engel schüttelte den Kopf.
»Nein, Meine Söhne«, sagte er sanft. »Dafür wird später noch genug Zeit sein. Jetzt müssen wir miteinander sprechen. Gott und der Erzengel Langhorne sind mit Euch zufrieden, und auch zufrieden damit, wie Seeblick wächst und gedeiht. Doch es mag sein, dass neue Aufgaben vor euch liegen, und der Erzengel Langhorne hat mir den Auftrag erteilt, euren Glauben und euren Mut zu stärken für die Aufgaben, zu denen ihr berufen werden mögt. Kommt, lasst uns in die Kirche gehen, auf dass wir in einer angemessenen Umgebung miteinander sprechen können.«
Pei Kau-yung saß in dem bequemen Sessel, und seine Miene war eine ausdruckslose Maske, während er der Debatte lauschte.
Die G6-Sonne, die man zu Ehren seines Bruders Kau-zhi getauft hatte, stand am Himmel, er konnte sie durch das Fenster hindurch erkennen. Die Mittagsstunde war gerade vorüber, und der Sommer im Norden war heiß, doch eine kühle Brise wehte vom Pei-See durch das offene Fenster herein; nur mit Mühe konnte er es sich verkneifen, eine Grimasse zu schneiden, als der Wind nun über sein Gesicht strich.
Die Dreckskerle konnten uns wirklich nicht genug mit ›Ehren‹ überhäufen, was? Haben die Sonne dieses Systems nach Kau-zhi benannt. Den See auch, nehme ich an ‒ oder vielleicht bewusst nach uns beiden. Vielleicht sogar nach Shan-wei ‒ wäre zu dem Zeitpunkt ja auch möglich gewesen. Aber mehr wird es auch nicht geben. Ich frage mich, ob die von der Einsatzleitung Langhorne und Bedard ausgewählt haben, weil die Planer wussten, dass die beiden wirklich größenwahnsinnig sind?
Er versuchte sich selbst einzureden, dass diese Gedanken und dieser Verdruss nur die unweigerliche Folge davon waren, die beiden fast sechzig Standardjahre ‒ nach örtlicher