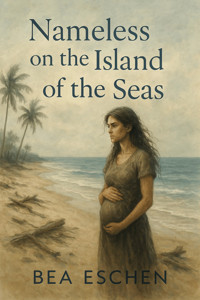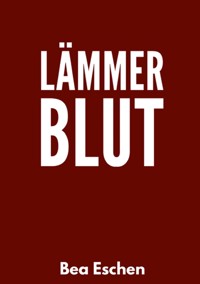8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es handelt sich um die Lebensgeschichten des Bauernsohnes Orontius und seiner dritten Tochter Mafalda; zwei Protagonisten, die auf ihren Reisen und Abenteuern ihre Herkunft, Identität und ihre spirituellen Erkenntnisse erforschen. Das erste Buch mit dem Titel 'Orontius, der Gaukler Gottes' spielt im Spätmittelalter und erzählt von Orontius' Reise mit einem fahrenden Gaukler, seinem späteren Leben im Kloster und seiner Rückkehr in die Heimat. Orontius' Vater vertraut seinen Sohn dem Gaukler Eberlein an, um ihn vor Armut zu bewahren und ihn im Franziskanerkloster in Siegen, dem Geburtsort seiner verstorbenen Frau und Orontius' Mutter, unterzubringen. Das Klosterleben ist von einem festen Tagesablauf geprägt. Bruder Orontius unterscheidet sich von seinen Mitbrüdern, denn er hat seine eigene Art, Gott zu finden. Außerdem stößt er auf ein Geheimnis, das seine Herkunft in Frage stellt. Nach zwei Jahrzehnten im Kloster verlässt er es und begibt sich erneut auf eine Reise, die von überraschenden Ereignissen begleitet wird. Das zweite Buch, Mafalda, Tochter des Gauklers, spielt im Jahr 1551 und folgt Mafalda, der dritten Tochter von Orontius. Bei einem Besuch in ihrem Geburtsort Flecken entdeckt sie eine antike Münze in den Ruinen einer Kapelle, die der Heiligen Katharina gewidmet war. Die Münze zeigt ein Kopfprofil, das Mafalda in aller Einzelheit ähnelt. Neugierig darauf, wer diese Frau aus der fernen Vergangenheit war, begibt sie sich gemeinsam mit einem Kindheitsfreund auf eine Reise nach Ägypten zum Katharinenkloster. Diese Reise ist gespickt mit historischen Ereignissen, Liebe und Mafaldas spiritueller Suche nach ihrer Identität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
orontius und Mafalda
AUF MYSTISCHEN REISEN
BEA ESCHEN
Urheberrecht © 2022 Bea Eschen
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung der Autorin in irgendeiner Form, sei es mit elektronischen oder mechanischen Mitteln, einschließlich Informationsspeicher und Abruf-Systemen, reproduziert werden, außer durch die Verwendung von kurzen Zitaten in einer Buchbesprechung.
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin: tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg
Zum Buch
Dieser Band enthält:
- Orontius, der Gaukler Gottes
- Mafalda, Tochter des Gauklers
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Kapitel: Eins
Kapitel: Zwei
Kapitel: Drei
Kapitel: Vier
Kapitel: Fünf
Kapitel: Sechs
Mafalda
Kapitel: Sieben
Kapitel: Acht
Kapitel: Neun
Kapitel: Zehn
Kapitel: Elf
Kapitel: Zwölf
Kapitel: Dreizehn
Kapitel: Vierzehn
Kapitel: Fünfzehnn
Gedicht
Über die Autorin
Büceer von bea eschen
Der Betrug an Max von Braumann
Das Leben der Sofia: Die Wiege der Weißen Löwin In der Vergangenheit war Sofia Waters eine berühmte und reiche Kinderbuchautorin mit einem verschwenderischen Lebensstil. Dann wendet sich das Blatt und Sofia wird obdachlos, einsam, krank und verzweifelt, da sie ihres Reichtums beraubt wurde. Ihre Düstere Stimmung hellt sich auf, als sie Avril trifft, eine sterbende Frau. Avril bietet Sofia eine neue Chance und Sofia ergreift sie. Dabei begegnet sie Jamie, ein Fremder mit einer geheimnisvollen Vergangenheit. Sofia und Jamie entwickeln ein tiefe Freundschaft, als sie ihm mit ihren Tricks hilft, einen Mord aufzuklären.
Ich, Yana
Ich war einer vieler Sklaven
Der Obstpflücker
Ins Dasein gesungen
Kurzgeschichten von bea esceen
Die Kinderfrau
Wie Medea
Der Waffendeal
Eine unbeschreiblich schöne Blume Können Pflanzen fühlen?
Orontius und Mafalda
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
KURZGESCHICHTEN VON BEA ESCEEN
Orontius und Mafalda
Cover
I
II
III
IV
V
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
Vorwort
Es handelt sich hierbei um ein fiktives Werk. Namen, Charaktere, Orte, Ereignisse und Vorfälle sind entweder das Ergebnis der Phantasie der Autorin oder werden fiktiv verwendet.
Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebendig oder tot, oder tatsächlichen Ereignissen, ist rein zufällig.
KAPITEL
EINS
Dicke Schneeflocken fallen auf mein fiebrig heißes Gesicht. Jeder Treffer lässt mich unter der schmelzenden Kühle erschauern. Der Gedanke, dass es nicht lange dauern wird, bis sich die weiße Masse über mir schließt und mich lebendig darunter begräbt, macht mich wahnsinnig. Über mir sehe ich durch die weißen Baumkronen, von denen bei jedem Windhauch der Schnee von den Ästen rieselt, in den grauen Himmel. Das Geräusch der sich in einer Windböe bewegenden Äste erinnert mich an den letzten Atemzug meines Vaters. Ich fühle, wie die Eiseskälte in mich eindringt und sich in meinem schmerzenden Körper ausbreitet.
Trotz meines fast gelähmten Bewusstseins nehme ich im Augenwinkel die verschwommenen Umrisse mehrerer Wölfe wahr. Langsam und schleichend kommt das Leittier immer näher, ohne mich auch nur für eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Jetzt hat mich das Rudel umzingelt und ich erstarre in der Aussichtslosigkeit meiner Situation.
Es ist still. Gebannt nehme ich jeden einzelnen ihrer Schritte wahr, als die Wölfe auf mich zukommen. Mit letzter Kraft greife ich in die rechte Tasche meiner Kutte und taste mit meinen eiskalten Fingern nach der Schleuder. Zacharas, der Novize, vertraute sie mir vor meiner langen Wanderung an. „Falls die Wölfe dir zu nahe kommen“, flüsterte er mir zu und sah mich dabei an, als wenn er geahnt hätte, dass das geschehen würde. Überrascht nahm ich die Waffe an mich und ließ sie in meinem Gewand verschwinden. Es war uns nicht erlaubt, etwas zu besitzen, außer der Kleidung, die wir am Körper trugen — von einer Waffe ganz zu schweigen.
In panikartiger Angst vor einem blutigen und schmerzhaften Tod erinnere ich mich jetzt daran, dass sich das Geschoss nicht in der rechten, sondern in der linken Tasche meiner Kutte befindet. Aber bei einem Sturz wickelte sich mein weites Gewand um meinen Körper, sodass sich die Tasche jetzt unter mir befindet. Vorsichtig hebe ich meinen Arm und suche verzweifelt nach ihrer Öffnung. Ich bin zu schwach, in sie hineinzugreifen, und lasse meinen Arm in den Schnee fallen.
Den Wölfen entgeht diese Bewegung nicht. Das Leittier ist nur noch eine Armlänge von mir entfernt. Sein nach verfaultem Fleisch stinkender Atem kriecht mir direkt in die Nase. In einem letzten Versuch, einem grauenvollen Schicksal zu entgehen, drehe ich meinen Kopf und starre ihm direkt in die Augen. Tatsächlich bleibt das Tier stehen. Während die Wölfe ihre nächste Mahlzeit unbedingt zu sich nehmen wollen, hoffe ich, doch noch eine Chance zum Überleben zu bekommen. Ein wilder Schrei formt sich wie ein Kloß in meinem Bauch zusammen und droht in meinem Rachen zu explodieren. Verkrampft öffne ich den Mund, ohne meinen starren Blick von den Augen dieses wilden Tieres abzuwenden.
Mein Schrei kommt aus dem tiefsten Inneren meiner Seele. Es kommt mir vor, als ob die Erde unter mir erzittert und die Äste über mir knirschen. Laut, schrill und mit all meinen Leibeskräften stoße ich ihn aus. Er nimmt mir fast den Atem, aber befreit mich von meiner mich betäubenden Todesangst. Das Leittier steckt mit großem Schreck seinen Schwanz zwischen die Beine, legt die Ohren zurück und schleicht sich mit eingeknickten Beinen davon.
Mit neu gefundener Energie schaffe ich es, mich leicht aufzurichten. Ich sehe dem Rudel nach, das im Dunkel des Waldes verschwindet. Die Spuren im Schnee verbleiben als Zeugen des soeben Geschehenen. Erleichtert lege ich mich zurück und spreche leise ein Dankgebet für die vom Herrn erhaltene Gnade. So, wie ich es schon immer getan habe, hebe ich dabei meinen rechten Arm zum Himmel und öffne meine Hand. Erhört er mich? Sieht er mich? Das Schweigen lässt meinen Zweifel an seiner Existenz, wie schon so oft zuvor, wieder aufsteigen. Meine Hand mit dem Daumenstummel hebt sich schwarz von dem grauen Himmel ab.
ES IST DIESELBE HAND, mit der ich als Kind auf dem Markt unser Brot, Fleisch und Gemüse zusammen klaute. Dabei zog ich meine Mütze tief in mein mit Dreck beschmiertes Gesicht und wickelte mir einen Schal um den Hals, der so groß war, dass mein Oberkörper bis zum Bauchnabel bedeckt war. Gott sei Dank wurde ich nie als der Sohn meines Vaters erkannt. Meine Bewegungen waren schnell. Keiner konnte mit mir mithalten. Sogar die Kinder der Gauner, Hexen und Mörder folgten mir, um sich von mir den einen oder anderen Trick abzuschauen. Das Wichtigste dabei war, die Händler an ihren Ständen genau zu beobachten und zu wissen, wie sie sich bewegten. Die Frau des Fleischers drehte sich von Zeit zu Zeit zu ihrem Baby um, das hinter ihr in einem Korb lag. Die Bäckersfrau verschwand hinter dem Vorhang, um das Brot aus dem Feuer zu holen. Der Gemüsebauer war ein dicker, alter Mann, zudem noch blind auf dem linken Auge. Er nickte regelmäßig ein. In diesen Momenten schlug ich zu. Für mich waren das keine Tricks, sondern schlicht und einfach die einzige Möglichkeit, überleben zu können. Schnell füllte sich mein Sack mit Vorräten für die ganze Woche.
Heute bin ich mir sicher, dass mein Vater Bescheid wusste. Aber jedes Mal tat er so, als seien meine Diebestouren normal. Das hätte uns den Kopf kosten können!
MEINE ELTERN WAREN BAUERN. Unser Korn war jedoch immer minderwertig. Der Boden war lehmig, steinig und hart. Mein Vater rackerte sich ab, aber leider konnten wir unser Feld nicht richtig pflügen, weil unser alter hölzerner Hakenpflug den Boden nur aufritzte. Außerdem benutzten wir einen alten Ochsen als Zugtier, der eigentlich zur Schlachtung reif war, wir aber keine Mittel hatten, um uns einen neuen anzuschaffen. Wenn das Tier müde wurde, legte es sich einfach hin und wir mussten warten, bis es wieder aufstand. Noch heute kann ich mich daran erinnern, wie mein Vater es antrieb. Unter dem Druck, das Feld für die Saat rechtzeitig vorbereitet zu haben, schrie er es an und hieb mit seinem Stock auf sein Hinterteil.
Unser Grundherr war ein Fürst. Ich kann mich an seinen Namen nicht mehr erinnern, weil er schwierig auszusprechen war und mein Vater ihn spöttisch Hoheit nannte. Unser Fürst besaß Schweine, die ihm seinen Reichtum sicherten. Man sah es am Ende des Jahres, nach der Mast, wenn die Schweine für die Schlachtung verkauft wurden.
Jedes Jahr zu Weihnachten gab es in dem Gutshaus ein großes Fest, zu dem die Adligen aus der Umgebung eingeladen wurden. Dazu gab es auch ein Schwein, welches meine Eltern schlachten und verarbeiten mussten. Es war schrecklich für mich, dabei helfen zu müssen, weil ich während der Zeit, die ich mit den Schweinen im Wald verbrachte, eine Verbindung aufgebaut hatte.
Die Schweinebetreuung war ein Teil des Frondienst, den wir leisten mussten, um unseren Gutsherrn — diesen Fürsten mit dem schwierigen Namen — zufriedenzustellen, damit wir weiterhin auf seinem Land leben konnten.
Es war meine Pflicht, die Tiere nach dem Festtag des Heiligen Michael in den Wald zu treiben, wo sie nach Eicheln, Bucheckern, Kastanien, Pilzen und Wildfrüchten suchten. Ich musste regelmäßig nach ihnen sehen, was mir während dieser Zeit einen Grund gab, gelegentlich die Feldarbeit zu verlassen. Ich war sehr froh, diese Freiheiten zu haben und nahm mir oft Steine vom Feld mit, um das Jonglieren zu üben. Die Zeit im Wald gab mir auch die Möglichkeit, andere Tricks zu proben, wie ich sie bei Gaukler-Truppen auf Kirchenfesten im Dorf gesehen hatte — Klettern, Balancieren und Salti schlagen. Es gab eine mit Steinen ausgekleidete Grube, die vorher einmal als Vorratskeller gedient haben musste. Das Holzdach lag in Teilen daneben und ich nahm zwei schmale Latten und legte sie quer über die Grube, wobei ich sie in der Mitte mit aufgestapelten Steinen abstützte. Während die Schweine um mich herum grunzten, übte ich das Balancieren und fiel dabei mehrfach in das weiche Laub, was mich jedes Mal aufs Neue auflachen ließ.
WIR HATTEN KEIN GLÜCKLICHES ZUHAUSE. Meine Mutter hatte einige Fehlgeburten gehabt und war stets traurig. Mein einziges Geschwisterlein, das lebend geboren wurde, starb in seinem dritten Lebensjahr an Masern. Ich war das einzige Kind meiner Eltern, das seine Kindheit überlebte. Deswegen waren sie immer sehr um mich bemüht.
Im letzten Winter wurde meine Mutter plötzlich krank. Eines Tages stand sie morgens nicht auf. Sie lag auf ihrem Strohsack und starrte vor sich hin. Ich ging zu ihr und sprach sie an: „Mutter, was ist los mit dir? Warum stehst du heute nicht auf?“ Sie reagierte nicht. Sie lag einfach nur da und starrte an die Decke. Plötzlich hustete sie und spuckte Blut. Mir fuhr der Schreck in die Glieder. Was sollte ich tun? „Mutter, was ist los mit dir?“, fragte ich sie ein zweites Mal. Anstatt mir zu antworten, stöhnte sie leise auf und dann kam aus ihrem Mund ein gurgelndes Geräusch. Wie gelähmt stand ich vor ihr und war zu keinem Gedanken fähig. Was hatte sie nur? Ich begriff, dass sie schwer krank sein musste. Vater! Mir fiel mein Vater ein. Er hatte bisher immer einen Rat gehabt, wenn etwas passiert war. Stets wusste er, was zu tun war. Ich musste ihn holen. Kaum hatte ich diesen Gedanken zu Ende gedacht, stürzte ich zur Tür hinaus. „Vater, Vater, schnell!“ rief ich ins Freie hinein. Ich konnte ihn nicht sehen, trotzdem rief ich weiter: „Vater, komm schnell, Mutter ist krank!“
Er kam aus dem Stall heraus, eine Hand voll mit Futter für den alten Ochsen. „Orontius, was schreist du hier so herum?“ „Bitte, Vater, du musst schnell zu Mutter kommen, sie spuckt Blut. Schnell, ich habe Angst um Mutter!“
Als mein Vater und ich an ihr Strohbett zurückkamen, hatte meine Mutter noch mehr Blut gespuckt. Es lief ihr vom Mund aus am Hals herunter. Schnell war mein Vater bei ihr, berührte sie und erschrak. Dann legte er ihr seine Hand auf die Stirn. Nach einigen Augenblicken, die mir wie eine Ewigkeit erschienen, sagte er zu mir: „Sie hat hohes Fieber.“ Er dachte kurz nach. „Orontius, hole kaltes Wasser und einen Lappen. Den tauchst du ins kalte Wasser und legst ihn ihr auf die Stirn. Ich gehe und hole einen Wundarzt, vielleicht kann der ihr helfen. Bete zu Gott, dass sie wieder gesund wird.“
Kaum hatte er das ausgesprochen, als er uns auch schon wieder verließ. Nun war ich mit meiner Mutter allein und begriff nicht, was geschah. Meine Gedanken überschlugen sich. Beten! Mein Vater hatte gesagt, ich solle beten. Ich kniete nieder. „Lieber Gott im Himmel, mach bitte, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wir brauchen sie doch. Bitte Gott …“ Plötzlich fielen mir auch die anderen Worte meines Vaters wieder ein. Ich stand auf, um zum Brunnen zu eilen und kaltes Wasser zu holen. Auf dem Tisch stand eine Schüssel, die nahm ich mit. Als ich mit dem Wasser zurück zu meiner Mutter kam, legte ich ihr, wie mein Vater es gesagt hatte, einen mit in Wasser getränkten Lappen auf ihre Stirn. Dabei berührte ich sie mit meinen Fingerspitzen. Sie glühte förmlich. Meine Sorgen wurden größer. „Mutter, sag doch etwas, Mutter, bitte!“ Noch einmal spuckte sie Blut. Jetzt war es fast schwarz.
Ich holte einen zweiten Lappen und haderte dabei mit Gott. Warum hatte er meine Mutter so krank werden lassen? Hatte er denn gar nicht bemerkt, dass wir sie brauchten? Ich verschwendete keinen einzigen Gedanken daran, dass meine Mutter sterben könnte. Sie war immer für mich da gewesen, solange ich denken konnte. Warum sollte sich das plötzlich ändern? Das war für mich schier unmöglich. Meine Mutter konnte gar nicht sterben!
Plötzlich stöhnte sie erneut auf. Ich nahm ihr den Lappen von der Stirn. Er war richtig heiß geworden. Schnell tauchte ich ihn ins kalte Wasser, wrang ihn aus und legte ihn ihr wieder auf die Stirn. Mit dem zweiten Lappen wusch ich ihr das Blut vom Mund und Hals, das sich jetzt auch unter ihrem Kopf angesammelt hatte.
Die Zeit verstrich – wo blieb nur mein Vater? Mutter ging es immer schlechter. Ich hatte Angst um sie. Gemeinsame Erlebnisse aus der Vergangenheit schossen mir durch den Kopf. Nur sie und ich. Ich bemerkte gar nicht, dass ich weinte. Erst als ich die salzige Flüssigkeit schmeckte, wurde ich mir meiner Tränen bewusst und wischte sie mir schnell mit beiden Händen aus dem Gesicht. Meine Angst um meine Mutter blieb.
Und wieder spuckte sie Blut. Noch einmal wechselte ich den Lappen auf ihrer Stirn. Zum wievielten Male tat ich das schon? Ich wusste es nicht mehr. Und wieder wischte ich das Blut von ihrem Gesicht.
Endlich ging die Tür auf. Mein Vater kam mit einem Mann herein, den ich nicht kannte. Er nickte mir kurz zu. Dann sah er auf meine Mutter hinunter. Er musste der Wundarzt sein. Niemand sprach ein Wort. Wieder spuckte meine Mutter Blut, das auch dieses Mal beinahe schwarz aussah. Dann sagte der Mann leise: „Tut mir leid, aber ich kann nichts für sie tun.“
Ich glaubte, nicht richtig gehört zu haben. Verzweifelt sprach ich zu ihm: „Aber Ihr müsst ihr doch irgendwie helfen können. Ihr seid doch ein Arzt. Irgendetwas muss es doch geben, das meiner Mutter helfen kann.“
„Nein, ich kann ihr nicht helfen, auch Ärzte sind manchmal machtlos!“, antwortete er mit harter Stimme und sah mich dabei streng an.
„Was seid Ihr denn für ein Arzt, wenn Ihr ihr nicht helfen könnt!“, rief ich erregt.
„Orontius“, ermahnte mich mein Vater, „sei nicht respektlos.“
Ich senkte den Kopf. Tränen standen mir in den Augen. Ich hörte, wie der Arzt uns verließ. Mein Vater strich mir mit einer Hand über meinen Schopf. Danach verließ auch er das Haus.
Der Gedanke, dass meine Mutter im Sterben lag, schlich sich in mein Bewusstsein. Noch konnte ich es gar nicht fassen, was das für mich und meinen Vater bedeutete. Noch einmal spuckte meine Mutter Blut. Oh, mein Gott, wo kam denn nur all das viele Blut her? Ich wusch es wieder von ihrem Gesicht und dem Hals ab.
Ich hasste den Wundarzt. Der hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, sie zu untersuchen. Er hätte sich ja auch an ihrem Blut die Finger schmutzig machen können. So ein dummer Kerl, der war doch kein Arzt, sondern eher ein Viehdoktor.
Meine Mutter sollte sterben? Nein, das ging nicht, das durfte gar nicht sein. „Gott, du kannst sie doch nicht sterben lassen!“, rief ich ihm in meiner Verzweiflung zu. „Was bist du denn nur für ein Gott, wenn du mir meine Mutter nimmst!“ Ich konnte meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Warum ist denn Vater nicht geblieben? Wollte er ihr nicht beistehen, wenn sie nun schon sterben musste?
Und wieder Blut, das ich wegwischen musste. Das Wasser war schon ganz rot und der Lappen ließ sich nicht mehr auswaschen. Wie sollte ich meiner lieben Mutter damit noch das viele Blut aus dem Gesicht waschen?
Meine Gedanken überschlugen sich. Während ich frisches Wasser und einen sauberen Lappen holte, wurde ich auf den Wundarzt noch wütender. Wäre er noch hier gewesen, hätte ich ihm bestimmt ins Gesicht geschlagen. Ein wenig mehr Mühe hätte der sich doch geben können.
Warum wollte mein Vater ihr nicht beim Sterben beistehen? Meine Verwirrung war groß, doch fühlte ich mich irgendwie erleichtert, weil ich jetzt mit ihr alleine sein konnte. Die letzten Minuten, oder waren es sogar Stunden, hatte ich meine Mutter für mich ganz alleine. Ich tat alles, was ich für sie tun konnte. Aber auch mir wurde immer mehr bewusst, dass meine Mutter bald nicht mehr für uns da sein würde.
Als sie für immer einschlief, hielt ich ihre Hand mit meiner linken. Mit der rechten Hand streichelte ich sie sanft. Dabei hoffte ich, dass sie wieder aufwachen würde. Wie sich ein Schmetterling aus seiner Puppe löst, sah ich ihre Seele im Geiste wegflattern. Der Schmetterling hatte wunderschöne bunte Flügel, er war graziös und als ob er mir einen Tanz vorführen wollte, flog er noch einmal im Kreis herum, bevor er endgültig verschwand. Daraufhin gab ich meine Hoffnung, dass sie wieder aufwachen würde, auf. In diesem Moment fragte ich mich noch einmal, wo Gott war. Hatte er alles gesehen? Warum hatte er sie so sehr leiden lassen? Warum hatte er meine Mutter überhaupt sterben lassen?
Nach ihrem Tod wurde unser Leben noch schwerer als zuvor. Zu ihren Lebzeiten hatte sie Schafwolle gesponnen und Tücher und Decken für den Fürsten und seine Familie gewebt. Weil das nun nicht mehr möglich war, verlangte der Fürst mehr Zins für das wenige Getreide, das wir billig verkaufen mussten, weil es minderwertig war. Mein Vater und ich nagten am Hungertuch und weil wir nicht Wurzeln und Baumrinde essen wollten, war das, was ich auf den Wochenmärkten stahl, überlebenswichtig.
MEIN VATER HATTE NIE die Zeit oder die Möglichkeit gehabt, seine künstlerische Ader auszuleben. Auch ich war von Kunststücken fasziniert, und wenn die Gauklertruppen ins Dorf kamen, standen wir mit Begeisterung in der ersten Reihe. Die Vorführungen beeindruckten uns sehr. Die graublauen Augen meines Vaters weiteten sich und sein Gesicht verzog sich in unzählige Falten, wenn er zum Lachen ansetzte. Dabei kamen seine dunklen Zahnlücken und halb verfaulten Zähne zum Vorschein, die er sonst vorsichtig hinter steifen Lippen versteckt hielt. In diesen Augenblicken konnte ich seinen schlechten Mundgeruch riechen, der mich mit den ausströmenden Wellen seines Lachens erreichte. Trotz dieser kleinen Hässlichkeit genoss ich es, wenn er sich amüsierte. Dazu hatte er selten die Gelegenheit. Es waren die einzigen Momente, in denen ich ihn herzhaft lachen sah.
„Mach es noch einmal, mir zuliebe“, rief er dem Gaukler begeistert zu, der gerade nach einem Balanceakt vom Seil gesprungen war. Viele der Gaffer waren von dem Risiko des Kunststückes aufgeregt, ja, einige waren sogar erschrocken. Das Seil befand sich zwischen dem Schornstein des Backhauses und dem Vordach der kleinen Dorfkirche in knapp fünf Ellen Höhe. Der Gaukler hatte eine Entfernung von zwanzig Ellen ohne größere Zwischenfälle geschafft. Dabei setzte er jedes Mal sein Leben aufs Spiel, aber das schien meinem Vater egal zu sein.
„Was bietest du mir an, dass ich es noch einmal mache?“, fragte der Gaukler herausfordernd.
Mein Vater senkte die Augen. Was sollte diese Frage? Der Gaukler wusste doch genau, dass wir nichts hatten, was wir ihm hätten geben können. Ich fühlte einen Stich in meinem Herzen. In diesem Moment — ich weiß nicht, welcher Teufel mich ritt — rannte ich wie von der Tarantel gestochen zum Backhaus los, kletterte auf das Dach und erreichte den Anfang des Seiles. War es Glück, Zauberei oder von Gott gewollt, aber dort lag ein Stock in meiner Körpergröße. Er eignete sich ideal als Balancierstange. So begann ich, ohne auch nur die geringsten Zweifel zu haben, den ersten Balanceakt meines Lebens auf einem Seil. Die Menge unter mir erstarrte und hielt den Atem an. Ich aber wandte meinen Blick von ihnen ab und schaute in den Himmel. Nicht, dass ich Gott um Hilfe bitten wollte — nein, aber je höher ich schaute, desto besser hatte ich mein Gleichgewicht im Griff. Es fühlte sich an, als würde ich über das Seil schweben, es kostete mich keinerlei Anstrengung. Als ich das Ende erreicht hatte, machte ich zum Schrecken aller Zuschauer noch einen doppelten Salto rückwärts und landete mit beiden Beinen grandios, als hätte ich nie etwas anderes getan, auf dem schlammigen Boden des Platzes. Die Menschen sahen mich wie verzaubert an. Solch ein Kunststück hatten sie offensichtlich nicht erwartet, besonders nicht von einem Jungen, der gerade das zwölfte Jahr seines Lebens vollendet hatte. Selbst der Gaukler zupfte vor Staunen an seinem Bart und schien verwirrt zu sein.
Mein Vater hingegen hatte sich sofort von meinem atemberaubenden Kunststück erholt und nutzte die Gelegenheit zu seinem Vorteil. Er lächelte den Gaukler hochmütig ins Gesicht.
„Wie du siehst, bedarf dein Auftritt keiner Belohnung. Sogar mein Sohn kann es besser als du.“
Ich hatte es nicht getan, um anzugeben oder den Gaukler in ein schlechtes Licht zu rücken. Meine Tat war aus dem Nichts entstanden und genau das erzählte ich meinen verstummten Zuhörern.
„Woher hast du diese gottlosen Ideen?“, fragte mich eine Person, die ich als die Frau erkannte, die meiner Mutter zu Lebzeiten die Schafwolle geliefert hatte. „Du bist ein von Gott gesandter Junge. Unser Herr ist nicht ein Nichts!“
Mir fiel darauf nichts anderes ein, als mit den Schultern zu zucken und meinen Kopf hängen zu lassen. Der Gaukler, der sich Eberlein nannte, wie ich später erfuhr, kam mir zur Hilfe.
„Weib, woher soll der Junge das wissen?“
Mit seiner dröhnenden Stimme holte er sich wieder den eben verlorenen Respekt zurück. Die Menge nickte verständnisvoll. Sie alle hatten Kinder, die weder zur Schule gingen, noch Hoffnung auf Bildung hatten. Die Wenigsten in unserem Dorf konnten lesen oder schreiben. Wir hingen an unserem Glauben, taten von Zeit zu Zeit Buße und das, was uns am Leben erhielt.
Die Vorstellung war zu Ende und die Menge löste sich auf. Ich beobachtete, wie der Gaukler Eberlein, für den ich Bewunderung und Dankbarkeit empfand, auf meinen Vater zuging. Er war ein hochgewachsener, dünner Mann. Sein grob gewebter Mantel hing in großzügigen Falten an seinem Körper hinunter. Die tiefen Furchen in seinem Gesicht zeugten von einem harten Leben, genau wie die Narbe, die sich an seiner linken Wange von der Stirn bis zum Kinn hinunterzog. Doch gleichzeitig strahlte er eine Schläue aus, die ihn von den Menschen im Dorf unterschied.
„Komm heute Abend in die Ochsenklause, Mann. Ich werde dir und deinem Sohn ein Mahl schenken.“
Mein Vater und ich sahen überrascht auf. Noch nie waren wir zu einem Mahl in einer Schänke eingeladen worden — schon gar nicht von einem Gaukler! Zu dieser Zeit reichte ich meinem Vater gerade mal bis zur Schulter und bemerkte, wie er in diesem Moment scharf ein- und wieder ausatmete. Das tat er immer, wenn er verunsichert war. Er schien seine Verwirrung aber nicht zeigen zu wollen und nickte zustimmend mit dem Kopf. Ich machte ihm das nach und so standen wir nickend vor dem Gaukler Eberlein. Der schien sich über uns zu amüsieren und verabschiedete sich grinsend: „Ich werde nach Sonnenuntergang dort sein und auf euch warten.“
Gleichzeitig wendeten wir uns zum Gehen um. Ich kannte meinen Vater als einen wortkargen Mann, aber auf dem Rückweg nach Hause sprach er nicht einmal das, was er immer sagen würde. An der Ecke des Feldes hätte er mir von dem kommenden Regen erzählt. Auf dem kurzen Weg unter den Birken hätte er mich vor dem Birkenstaub gewarnt, der ihn häufig zum Niesen brachte. Schnellen Schrittes lief er still und in sich gekehrt vor mir her. Mein Blick hing an den Absätzen seiner Stiefel, die sich tief in den Schlamm bohrten.
„Warte doch!“, rief ich hinter ihm her. Ich konnte kaum mit ihm mithalten und keuchend folgte ich ihm. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was ihn so sehr bewegte. Dass er versuchte, seine Gefühle vor mir zu verstecken, entging mir nicht. Er vermied es, sich nach mir umzudrehen. Ich rannte und streckte meine Hand nach seinem Arm aus. Die Berührung schien ihn wieder zu Sinnen kommen zu lassen. Er nahm meine Hand in seine und hielt sie fest umschlossen, bis wir zu Hause waren. Als Halbwüchsiger war es mir peinlich, mit meinem Vater Hand in Hand zu laufen, aber in diesem Moment verband uns etwas Inniges. Das Händehalten bestätigte mir seine Liebe und gab mir in meiner Verwirrung einen Halt.
• • •
IN DER OCHSENKLAUSE ging es hoch her. Als wir eintraten, scharrte sich gerade eine Gruppe von verschiedenen Leuten um einen Tisch herum, der mit Spielkarten übersät war. Ein mit buntem Kostüm aufgeputzter Musikant spielte auf seiner Laute eine süß klingende Melodie und sang dazu ein Lied, dessen Worte ich nicht verstand. Bei unserem Eintritt sahen viele von ihnen auf. Sogar die Musik stoppte für einen kurzen Moment. Ich merkte, wie meine Wangen heiß wurden. Die Leute musterten uns von oben bis unten. Warum nur? Mein Vater presste mich an sich und zum zweiten Mal an diesem Tag spürte ich seine Verunsicherung.
Eberlein trat aus der Menge hervor. Er hatte seinen langen Mantel abgelegt und sein ausgezehrter Körper kam in seiner schäbigen Bekleidung um so mehr zum Vorschein. Erleichtert grüßte ich ihn mit einem leichten Nicken. Lässig kam er auf uns zu. Ich beobachtete, wie mein Vater und er sich auf gleicher Augenhöhe trafen und ihre Blicke sich ineinander verbohrten. Mein Vater schluckte so heftig, dass ich die Wallung in seiner Luftröhre hören konnte.
„Was willst du?“, fragte er ihn.
„Setzen wir uns doch“, schlug Eberlein vor und führte uns von der Menge weg zu einem Ecktisch hin. Er drehte sich zum Schanktisch um. „Wirt, bring uns ein Mahl und Bier!“
Er beeindruckte mich aufs Neue. Nur edle Nobelherren sprachen mit solch einer Kühnheit. Er jedoch schien sich seiner Sache vollkommen sicher zu sein und grinste mich an.
„Junge, wie heißt du?“
„Orontius“, antwortete ich.
„Das hast du gut gemacht, heute auf dem Seil“, sagte er und sah mich bewundernd an. „Die Natur hat es dir mitgegeben.“
Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte und sah hinüber zu meinem Vater. Eigentlich hätte er derjenige sein sollen, der spricht. Fremde redeten selten mit den Kindern anderer, besonders nicht, wenn die Eltern dabei waren. Dieser Gaukler benahm sich schlichtweg anders als die Bewohner aus unserem Dorf.
Nach einer unendlichen Weile des Schweigens setzte mein Vater erneut zum Reden an.
„Was willst du?“, fragte er ein zweites Mal.
Eberlein richtete seinen eindringlichen Blick auf meinen Vater.
„Darf ich mich und meine Truppe als Freudebringer des Volkes, Träger von Neuigkeiten und Bewahrer alter Poesie und darstellender Künste vorstellen?“
Mein Vater starrte ihn stumpf an. „Wo ist denn deine Truppe?“
„Äh“, sagte Eberlein, verwirrt über die Frage, mit der er nach seiner erhobenen Selbstvorstellung offenbar nicht gerechnet hatte. „Sie ist in unserem Lager.“
„Und wo ist euer Lager?“, fragte mein Vater.
„Im Wald, da draußen“, sagte Eberlein und zeigte in Richtung Dorfeingang.
„Was willst du?“, fragte mein Vater zum dritten Mal. Diesmal zeigte er seine Ungeduld, indem er mit seinen Fingern auf den Tisch trommelte. Eberlein ignorierte es.
„Lass uns erst essen und trinken“, schlug er vor.
In diesem Moment stellte eine Wirtsfrau eine große Schüssel mit Speck und Bohnen vor uns. Es roch köstlich und da ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte, griff ich reichlich zu. Das Fett lief mir am Kinn hinunter, als ich mir meines Vaters bewusst wurde, der steif wie ein Brett dasaß. Hatte er keinen Hunger?
„Trink, Mann“, sagte Eberlein und stellte einen Krug Bier vor ihn. Der nahm ihn ohne zu zögern auf und trank den Inhalt in einem Zug aus. Während er sich mit dem Handrücken über den Bart wischte, atmete er laut und lustvoll aus. Ich traute meinen Augen und Ohren nicht. Nicht, dass mein Vater kein Bier getrunken hätte, aber wenn er es trank, dann immer nur sehr langsam und in kleinen Schlucken. Ich glaube, er hatte immer ein gutes Vorbild für mich sein wollen, aber in diesem Moment ließ er seinen Sinnen freien Lauf. Es dauerte keine fünf Minuten und der Alkohol in seinem leeren Magen schien ihn aufgelockert zu haben. Er wandte sich an Eberlein:
„Wenn du meinen Sohn haben willst, habe ich Bedingungen.“
Die Gabel fiel mir aus der Hand. Schockiert schaute ich zwischen Eberlein und meinem Vater hin und her. Dabei stand mir der Mund offen, aus dem halb gekauter Speck und Bohnen trieften. Es ging um mich!
Eberlein stellte einen weiteren Krug vor meinen Vater auf den Tisch. Wieder nahm er ihn auf und trank ihn in einem Zug aus. Vorsichtig zupfte ich an seinem Ärmel. Sein Verhalten hatte mich durch und durch verängstigt. Entweder ignorierte er mich oder er merkte es nicht, aber er schien an diesem Abend ein anderer Mann geworden zu sein.
„Was sind das für Bedingungen?“, fragte Eberlein lässig.
„Ein Versprechen“, antwortete mein Vater. „Und eine Bezahlung“, fuhr er fort.
Endlich begann er zu essen. Mit einem großen Holzlöffel schob er sich die Mahlzeit genüsslich in seinen fast zahnlosen Mund. Dabei war sein Schmatzen nicht zu überhören. Keiner außer mir störte sich daran, denn zu Hause hatte er nie geschmatzt. Vorsichtig zupfte ich wieder an seinem Ärmel. Diesmal schüttelte er mich ab. In diesem Moment ahnte ich mein mir bevorstehendes Schicksal.
„Warum willst du mich loswerden?“, fragte ich unsagbar leise.
„Damit aus dir was wird.“
„Was soll aus mir werden, außer Bauer zu sein, wie du es bist?“
„Sei still, Junge.“
Ich hielt still, gedemütigt und erschrocken über den Plan meines Vaters, mich an den Gaukler verkaufen zu wollen.
Eberlein beobachtete mich. Zumindest hatte er Mitleid mit mir, das sah ich deutlich in seinem Gesicht.
Dann richtete er sich an meinen Vater. „Was willst du versprochen haben?“
Ohne mit der Wimper zu zucken, brachte mein Vater seinen erbarmungslosen Plan für mich vor.
„Der Junge muss am Anfang seines fünfzehnten Lebensjahres in dem Kloster Siegen abgeliefert werden. Dort soll er lesen und schreiben lernen und Franziskaner-Mönch werden.“
Eberlein war sichtlich erstaunt. „Du lässt ihn dafür mit mir und meiner Truppe ziehen? Mit meinem Gefolge, vor dem Gesetz heimatlos und rechtlos und in der Gesellschaft gefürchtet unserer bösen Zungen wegen?“
Anstatt Eberleins Frage zu beantworten, stellte mein Vater die nächste Frage.
„Wie willst du dafür bezahlen?“
Meine Seele schmerzte so sehr, dass mir übel wurde. Mein Vater, zu dem ich stets aufgeschaut und den ich für seine Würde verehrt hatte, war gerade dabei, mich völlig gefühllos an einen fremden Mann zu verkaufen. An einen Mann, der vom größten Teil unserer Gesellschaft verachtet wurde, weil er zum herumziehenden Gesindel gehörte! Plötzlich erinnerte ich mich an meine Mutter und das, was sie mir vor langer Zeit einmal erzählt hatte. Daraufhin zupfte ich wieder an meines Vaters Ärmel, um meine nagende Frage loszuwerden. „Warum denn nach Siegen? Mutter sagte einmal, dass es dort neblig und kalt sei. Außerdem soll der Wald Geheimnisse bergen, die, wenn sie herauskommen, Unheil über die Menschen bringen.“
„Ja“, mischte Eberlein sich ein, „das möchte ich auch gerne wissen. Warum Siegen? Soviel ich weiß, gibt es dort doch gar kein Kloster!“
„Es wird aber eins gebaut“, erwiderte mein Vater. Unbeirrt fuhr er fort. „Ein Graf Johann aus Dillenburg hat sechstausend Gulden für den Bau hingelegt. Wenn es fertig ist, wird es Weihe und Einzug für die Barfüßer-Mönche gewähren.“
Zwei paar Augen starrten meinen Vater ungläubig an. „Woher weißt du das alles?“, fragte ich völlig perplex.
„Du erinnerst dich nicht, Junge, aber deine Mutter war gebürtig aus Siegen. Sie kennt die Umgebung und hat auch noch Verwandtschaft dort.“
„Was für Verwandtschaft?“, fragte ich.
„Die Polmanns. Es gibt einen Konrad Polmann, ein Cousin von ihr. Es wird davon geredet, dass er der erste Vorsteher des Klosters werden soll.“
Dann richtete er sich wieder an Eberlein. „Also, wie willst du für die Dienste meines Sohnes bezahlen?“
Eberlein dachte nach. Er trank einen kräftigen Schluck aus seinem Krug. „Warum soll ich dafür bezahlen, deinen Sohn nach Siegen zu bringen? Du solltest mich bezahlen, dass ich deinem Kind Gesellschaft und Schutz auf dem Weg ins Kloster spende!“
Vater geriet etwas aus dem Gleichgewicht. Er fing an zu schwitzen.
„Du hast recht, wir ziehen beide einen Nutzen daraus. Ich kann keine Bezahlung von dir verlangen“, gab er zu. „Ich brauche jedoch einen Beweis dass du das Versprechen einhältst. Der wäre dann fällig, wenn du Orontius in Siegen abgeliefert hast.“
Es entstand eine lange Pause, in der ich mich etwas erholte. Ich begriff endlich, dass mein Vater mir Gutes tun wollte. Ich begriff aber auch, dass mein Schicksal in den Händen dieser beiden Männer lag. In diesem Moment erfuhr ich eine geistige und seelische Umwandlung, die mich um Jahre reifen ließ. Bei klarem Verstand beschloss ich, dass ich in Zukunft selber über mein Los entscheiden wollte, ohne den Einfluss anderer.
Derweil wühlte Eberlein in seinem schäbigen Lederbeutel herum und holte einen runden, geschnitzten Holz-Gegenstand heraus. Das Artefakt war so klein, dass es in die Kuhle seiner Handfläche passte. Er öffnete es und hielt es ins Licht, damit wir hineinschauen konnten.
„Was ist das?“, fragte mein Vater.
„Es ist eine Buchsbaum-Ikone. Sie soll wertvoll sein. Ich bekam sie von einem reisenden holländischen Kaufmann, weiß der Geier, woher er sie hatte.“
Mein Vater nahm sie vorsichtig in seine Hand. Zusammen betrachteten wir das Kunstwerk. Die Figuren waren so klein, dass ich genau hinschauen musste, um die Szene ausmachen zu können. Eine Gruppe von Menschen in biblischen Gewändern scharrte sich um eine Zentralperson.
„Was machen die da?“, fragte ich neugierig.
„Es ist eine religiöse Szene“, erwiderte mein Vater. Er sah sich begeistert die Einzelheiten an. „Die Menschen scharen sich um Jesus Christus — sie beten ihn an. Siehst du, manche knien vor ihm.“
„Woher weißt du, dass das Jesus Christus ist?“, fragte ich, angesteckt von seinem Interesse.
„Du erkennst ihn an den Strahlen, die um ihn herum arrangiert sind. Das ist seine Aura.“
Er schloss die Ikone und rollte sie in seiner großen knochigen Hand hin und her, wobei er sie ausgiebig von allen Seiten betrachtete. Dann öffnete er sie aufs Neue und sah konzentriert hinein. Ich bemerkte, wie hingerissen er war; wie seine Ohren vor Eifer glühten, seine Augen leuchteten und sein seltenes Lächeln immer breiter wurde.
Eberlein brachte uns wieder in die Realität zurück. „Wie wäre es denn, wenn du die Ikone behältst, bis der Mönch Orontius sie bei dir abholt, um sie mir wieder zurückzubringen?“
Mein Vater blickte auf. An seinem Ausdruck erkannte ich sofort, dass er mit dem Vorschlag einverstanden war.
„Gut.“ Er nickte und steckte die wertvolle Ikone in seine Hosentasche.
Die beiden Männer gaben sich die Hand. Mein Vater legte seinen Arm um mich und drückte mich an sich. „Ich werde meinen Sohn morgen um die Mittagszeit in dein Lager bringen.“
„Das passt. Wir ziehen in drei Tagen weiter“, sagte Eberlein.
„Wo soll es hingehen?“, fragte mein Vater. Er sah plötzlich grau aus.
„Zu der Herbstmesse in Frankfurt.“
„Die Fechterspiele?“
Eberlein nickte.
„Pass auf meinen Sohn gut auf.“
Wir drehten uns zum Gehen um.
„Mach dir keine Sorgen. Ich werde deinen Sohn wie meinen eigenen behüten“, rief Eberlein uns nach.
AM ABEND vor meiner Abreise fragte ich meinen Vater, ob er auf dem Hof bleiben würde. Er überlegte lange und ich ahnte, dass meine Frage schwierig zu beantworten war.
„Ich habe mich gestern mit der Hoheit arrangiert, damit er dich gehen lässt“, begann er. „Ich werde zukünftig in einer Kammer auf dem Gutshof untergebracht und der Schweinehirt sein.“ Er stockte. „Es passt mir sowieso besser, weil ich immer ein schlechter Bauer war. Ich will die Verantwortung nicht mehr tragen.“
„Was passiert mit unserem Hof?“
„Die Hoheit hat eine andere Bauernfamilie gefunden. Sie wird unseren Hof bewirtschaften.“
„Heißt das, dass wir ihn an die andere Familie abgeben müssen?“, fragte ich.
„Ja.“
Wir schwiegen, vertieft in schmerzhafte Erinnerungen.
NOCH NIE HATTE ich mich selbst betrachtet, aber an diesem Abend stand ich vor dem alten Spiegel meiner Mutter und sah mich von oben bis unten an. Meine alten, schmutzigen Lumpen lagen in einem Haufen neben mir. Gemeinsam hatten wir die alte Holzwanne mit heißem Wasser gefüllt. Zumindest sollte ich meinen neuen Lebensabschnitt sauber beginnen. Ich hatte lange in der Truhe wühlen müssen, um passende Kleidung zu finden. Mein Vater rückte seinen Schweinsleder-Mantel heraus, der mir zwar etwas zu lang, aber wegen des Pelzinnenfutters schön warm war. Er fühlte sich speckig und dick an und roch nach ihm.
„Du kannst dich nachts darin einwickeln“, riet er mir, „darin wird es dir nicht kalt werden.“
Dann gab er mir noch ein paar Wollstrümpfe. Er sah gequält aus, als er sie mir reichte. „Deine Mutter hat sie gestrickt.“
Dankbar nahm ich sie an. Jedes Teil von Zuhause würde mir das Leben auf meiner Reise erleichtern. Es würde mir Trost geben — etwas zum Festklammern, zur Erinnerung und abends zum Einschlafen.
Ich tauchte in das heiße Badewasser ein und wurde von einem prickelnden Gefühl befallen. Ein intensives Kribbeln lief über meinen Oberkörper nach unten, kam von den Beinen nach oben und sammelte sich in meinen Lenden. Eine Energie überkam mich, die ich noch nie zuvor gespürt hatte. Ich stöhnte, umfasste mein steifes Glied und begann, daran zu reiben. Der Höhepunkt war berauschend, überwältigend und zugleich erleichternd. Mir wurde bewusst, dass meine Kindheit vorbei war, sowohl geistig als auch körperlich. Von da an hatte ich mich mit meinem Schicksal, das Zuhause verlassen zu müssen und auf Reisen zu gehen, abgefunden.
KAPITEL
ZWEI
Als wir über den Hügel kamen, erblickten wir eine Ansammlung durcheinander stehender Laubhütten und Zelte. Der Rauch eines großen Feuers mischte sich unter den Wirrwarr der Menschen, die mit vielen verschiedenen Aufgaben beschäftigt waren. Bunt gekleidete Frauen, die anscheinend nichts Weiteres zu tun hatten, als Fremde auszukundschaften, scharten sich um mich herum und strichen mir mit ihren schmutzigen Fingern frech übers Gesicht.
„Ein weicher Flaum ist schon da“, schrie eines der Weiber mit rotem lockigem Haar. Die anderen lachten kreischend auf.
Angewidert wich ich zurück. „Lass mich in Ruhe!“
Wir starrten einander an. Ich bemerkte mehrere große und kleine Sommersprossen an der Frau, die in ungewöhnlicher Weise zwischen Nase und Mund verteilt waren.
„Oh, der junge Mann ist empfindlich!“
Die Weiber prusteten aufs Neue los.
Mein Vater stieß sie mit einer brüsken Armbewegung zur Seite. „Lasst ihr uns jetzt durch, oder muss ich euch erst den Marsch blasen?“, woraufhin sich die Schar wiehernd wie Pferde davonmachte.
Es gab Affen, Meerkatzen, Murmeltiere, Kamele und andere fremde Tiere. Ja, sogar ein Bär brüllte aus seinem Käfig heraus im Einklang mit den wilden Trommelschlägen einer Person, die dem Teufel ähnelte. Erschrocken sah ich ihn an. Er trug ein Kostüm, das mich an einen bösen Waldgeist erinnerte. Eine gehörnte, bestialische, pelzige Gestalt mit einem Schwanz und gespaltenen Füßen. Sofort kamen mir die Worte unseres Pfarrers in den Sinn: „Satan, der große Feind Christi, der Kirche und der Menschheit!“
Als der Teufel mich bemerkte, winkte er mir freundlich zu. „Bist du Orontius, der neue Junge des Gauklers Eberlein?“
„Ja“, sagte ich zögernd. Ich konnte es nicht fassen, dass ich mit dem Teufel sprach.
Der Schreck muss mir im Gesicht gestanden haben, denn der Teufel wusste, was in mir vorging. „Keine Sorge! Das ist nur eine Verkleidung. Ich bin Gottfried. Wie der Name es schon sagt, der Friede Gottes. Ich bin Eberleins Bruder.“
Er reichte mir die Hand. Widerwillig nahm ich sie an. Entgegen meiner Angst war sie warm und ich fühlte mich zuversichtlicher.
Mein Vater räusperte sich. „Wo finden wir Eberlein?“
Gottfried zeigte zu einem großen Baum.
„Siehst du die große königliche Holzkutsche unter der Rieseneiche? Wir nennen sie die Arche. Dort findet ihr meinen Bruder.“
Wir kämpften uns durch ein Gewühl von grotesken Spielmännern, Quacksalbern, Musikanten und Narren, bevor wir an Eberleins Kutsche ankamen. Ich traute meinen Augen nicht. Sie stach von den anderen teilweise mit Tuch bespannten Planwagen alleine durch ihre kolossale Größe hervor. Die Räder waren fast so hoch wie ich! Außerdem war der hölzerne Wagenkasten am Fahrgestell mit Lederriemen aufgehängt, die an den unteren Ecken und auf den hohen Achsen befestigt waren. Zwei kräftig aussehende Maultiere standen in der Nähe und fraßen Gras. An verziertem Zuggeschirr, wie ich es noch nie gesehen hatte, und einem gepolsterten Kutschbock fehlte es auch nicht.
„Da seid ihr ja!“ Eberlein gesellte sich zu uns. Er schien erfreut zu sein, uns zu sehen.
„Wird mein Sohn in deiner Kutsche untergebracht sein?“, fragte mein Vater begeistert.
„Aber ja doch“, erwiderte Eberlein. „Es ist die alte Kutsche von Friedrich III, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Damit zog er vor über einem Jahrzehnt in Frankfurt ein.“
„Willst du mich veräppeln?“, fragte mein Vater.
„Es ist kein Scherz“, sagte der Gaukler und lächelte. „Auf dem Rückweg wurden der Kaiser und seine Ritter von einer Gaunerbande überfallen. Die Kutsche wurde angezündet und schwer beschädigt. Der Kaiser kam glimpflich davon. Zufälligerweise arbeitete ich damals beim Wagen-Bau und zusammen mit einem anderen Gesellen wurden wir beauftragt, die Kutsche zu reparieren. Die Räder und der Ledergurt-Unterbau mussten komplett erneuert werden. Der Wagen hatte durch das Feuer schwere Beschädigungen.“ Er drehte sich um und zeigte auf eine stark verrußte Stelle. „Siehst du, da oben ist einiges weggebrannt.“
Ich sah dorthin, wohin seine Hand zeigte. Der Schaden war unmöglich zu reparieren gewesen — das war mir sogar als Laie klar.
„Eine zu große Macke für unseren Kaiser! Deswegen wollte er nicht mehr mit seiner alten Kutsche fahren und schenkte sie uns.“
Ich schluckte. „Das war aber großzügig.“
Mein Vater drehte sich zu mir um. „Ich geh jetzt. Du bist hier gut aufgehoben.“ Er umfasste meinen Nacken und zog mich an sich. „Komm zu mir, wenn du Mönch bist, um die Ikone abzuholen. Leb wohl, Junge.“
Er verließ mich schneller, als es mir lieb war. Ich sah ihm nach und ein Gemisch aus Unbehagen und Freiheit überkam mich. Allerdings kam ich schnell darüber hinweg, denn meine neue Umgebung lenkte mich vom Abschiedsschmerz ab.
In der Arche hatte Eberlein für mich eine Hängematte eingerichtet. „Damit du während der Fahrt wie ein Baby gewogen wirst!“, erklärte er.
Ich lachte. Auch das hatte ich noch nie gesehen. Dann stellte er mich seiner Truppe vor. Ich konnte damals nur bis zehn zählen und wenn ich jede Person einem meiner Finger zuordnete, hatte ich zwei Finger zu wenig.
„Das ist unser Hannes Harnischer, auch als die böse Zunge unserer Truppe bekannt“, sagte Eberlein.
Hannes verbeugte sich und zog sogar den Hut vor mir. Er war ein kleiner, dünner Mann mit einem auffallend großen Mund. „Ich bin der Sänger der Truppe und die Schande des kargen Mannes. Mein Spottlied ist das beste Mittel, um uns Trank, Speise, Kleider, goldene Armringe und Geld zu sichern, wenn wir die Burgen und die Häuser der Vornehmen besuchen. Denn nur meine Spottlieder lehren ihnen das Fürchten vor uns, weil ich darin der ganzen Welt von ihrem Geiz erzähle, wenn sie uns nicht bezahlen!“
„Im Angeben warst du schon immer gut! Du bist nicht der Einzige, der uns am Leben hält“, erwiderte Eberlein.