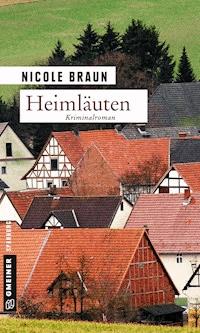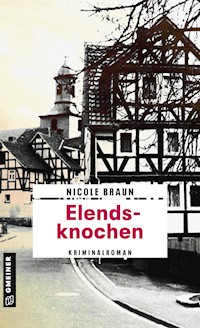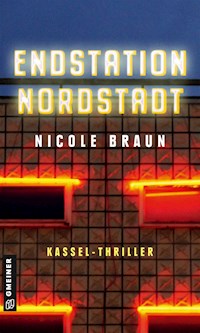Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Landarzt Edgar Brix
- Sprache: Deutsch
Ostern 1965: Der alte Kneipenwirt Noll sitzt wie ein geschlachtetes Osterlamm in seinem Lieblingssessel, die Kehle sauber durchtrennt. Hauptverdächtig ist der nach Jahrzehnten heimgekehrte Johann Veit. Die Dorfbevölkerung ist sicher, dass Rache der Grund für seine Rückkehr ist. Niemand glaubt Veit, dass ihm jede Erinnerung an jenen unheilvollen Abend fehlt, der zu seiner Vertreibung führte. Edgar Brix macht sich auf die Suche nach Antworten auf Veits Fragen und weckt die bösen Geister der Vergangenheit …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicole Braun
Osterlämmer
Kriminalroman
Zum Buch
Erinnerungslücken Ostern 1965: Johann Veit kehrt auf der Suche nach Antworten nach Wickenrode zurück – 27 Jahre nachdem er unter falschem Verdacht aus dem Dorf gejagt wurde. Sein Gedächtnis verwehrt ihm den Zugriff auf die Ereignisse, die zu seiner Vertreibung führten. Doch kaum ist er wenige Tage im Ort, wird der alte Kneipenwirt tot aufgefunden – die Kehle wie bei einem geschlachteten Osterlamm sauber durchtrennt. Die Dorfgemeinschaft ist sicher, dass Johann Veit zurückkehrte, um Rache zu üben. Edgar Brix und Albrecht Schneider halten zu ihm und wollen helfen, seine vergrabenen Erinnerungen zu heben. Einer kennt die Details der Vergangenheit, die im Dunkel liegen, doch der hüllt sich jenseits des Atlantiks in bleiernes Schweigen: Edgars Vater Conrad Brix. Nur allmählich entblättert sich die Wahrheit und Edgar muss erkennen, dass Erinnerungen nicht objektiv sind und die Vergangenheit ein Konstrukt sein kann.
Nicole Braun wurde 1973 in Kassel geboren und ist beruflich schon in einige Rollen geschlüpft: Tischlerin, Dozentin oder Betriebswirtin. Die Liebe zum Schreiben hat alles überdauert. Die Autorin lebt in der geschichtsträchtigen Region zwischen Meißner und Kaufunger Wald und selbstverständlich spielen auch ihre Krimis vor dieser märchenhaften Kulisse. Dort durchstreift sie mit ihren Hunden den Wald, auf der Suche nach Inspiration für mörderische Geschichten und düstere Tatorte. Wenn sie nicht an einem Krimi arbeitet, gibt sie Workshops für kreatives Schreiben und singt als Frontfrau einer Coverband.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Elendsknochen (2018)
Elsternblau (2017)
Heimläuten (2016)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Terrorkind / photocase.de
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-5900-9
Zitat
Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
gib ihnen die ewige Ruhe.
Wickenrode, Sommer 1938
Die Kirchturmglocke schlug zur halben Stunde. Karl-Friedrich Hochapfel hatte Bücher auf dem Altar ausgebreitet. Kaleidoskopartige Farbkleckse wanderten über die Seiten. Die Sonne stand bereits tief am Horizont.
Nach einem kargen Abendbrot hatte Pfarrer Hochapfel sich in die Kirche zurückgezogen. Eine Wand aus verbrauchter Luft hatte ihn aus dem Pfarrhaus vertrieben. In dieser Affenhitze brachte er die notwendige Konzentration für die Predigtvorbereitung nicht zustande. Der Kirchenraum war schlecht beleuchtet, aber wenigstens kühl.
Hochapfel guckte unzufrieden auf seine Notizen: wenige Zeilen, unzusammenhängende Sätze. Ihm fehlte die rechte Inspiration und von Nordwest näherte sich ein Gewitter. Nach Wochen drückender Hitze stünde dem Ort einiges bevor.
Es klopfte an der Kirchentür.
Hochapfel ignorierte das Geräusch und starrte auf sein Geschreibsel.
Das Klopfen steigerte sich zum Hämmern.
Hochapfel seufzte und ließ den Stift sinken. »Ich komm ja schon«, murmelte er. Es laut zu sagen, hätte nichts gebracht, kein Mucks drang durch die dicken Mauern und die massive Tür nach außen.
Er öffnete einen Türflügel einen Spalt, damit er den Störenfried sehen konnte. Ein warmer Luftzug streifte sein Gesicht und trug einen Schwall Alkoholdunst in Hochapfels Nase. »Du bist betrunken, so kommst du hier nicht rein.«
Fritz Veit drückte mit dem gesamten Körpergewicht gegen die Tür, Hochapfel wurde einfach zur Seite geschoben.
Veit stolperte in die Kirche, seine Schritte hinterließen ein Echo. »Ich muss mit dir sprechen, un wenn’s das Letzte is, was ich tu.«
Hochapfel verfolgte, wie Veit am Trog mit dem Weihwasser vorbeiwankte. Er nahm vom Herrn am Kreuz keine Notiz und beim Versuch, den Körper auf eine Kirchenbank zu wuchten, legte er sich beinahe lang hin.
Seufzend trottete er hinter Fritz Veit her. Er sandte dem Gekreuzigten einen verzweifelten Blick und setzte sich, eine Bank zwischen sich und dem Alkoholisierten als Sicherheitsabstand, nieder.
»Sinn wir allein?«, flüsterte Veit.
»Ganz sicher.«
»Wirst du über das, was ich dir spreche, stilleschweigen?«
»Willst du die Beichte ablegen?«
»Ne, ich brauch Rat, kinne Beichte. Also: Wirst du stilleschweigen?«
»Wenn du es wünschst, werden nur wir zwei und der Herr wissen, was hier gesprochen wurde.«
»Schwör!« Veit reckte den Kopf nach vorne und kniff die Augen zusammen.
»Es gibt nur einen, dem ich zum Schwur verpflichtet bin. Mein Wort muss dir genügen.«
Veit kratzte sich am Kinn, seine rauen Hände machten ein schabendes Geräusch auf den Bartstoppeln. »Also gut.« Er zog ein fleckiges Taschentuch hervor und wischte sich die Stirn. »Ich komm grad uss der Kneipe.«
»So?«
»Erst wollt ich’s gar nit glauben. Aber dann honn ich de Flasche Holunderblut gesehen. Un der Heinrich hot mir gesprochen, wos der Wagner für Reden geschwungen hot, und da wurd mir ganz übel.«
»Und da musstest du die Übelkeit mit einigen Schnaps hinunterspülen.« Hochapfel gab sich Mühe, nicht missbilligend zu klingen. Der Versuch misslang.
Das vertrauliche Flüstern kam Veit in der Aufregung abhanden: »Jo. Du hättst au gesoffen, wenn du insehen müsstest, dass dinn Sohn gar nit dinner is.« Seine Stimme hallte durch den Kirchenraum.
Hochapfel spürte, wie sich jeder einzelne Muskel in seinem Rücken anspannte. »Wie bitte? Hat der Wagner das etwa behauptet?«
»Diese ahle Schässmade, diese ahle.« In Veits Aufregung hatte sich Verzweiflung gemischt.
»Fritz, bitte! Du bist in einer Kirche!«
»Ach, hör doch uff.« Veit winkte ab. Trotzdem senkte er die Stimme. »Ne Pulle Holunderblut hat hä rumgehen lossen. ›Uff sinnen kommenden Enkel‹, hot hä gesprochen. Geprahlt hot er, dass hä der Urvadder von dem ganzen Dorfe is. Erst honn ich gedacht, de Lump wollt damitte sprechen, dass hä der Vadder von dem Kind is, dass de Magda trägt. Aber dann honn ich’s kapiert.«
Hochapfel konnte sich die Szene lebhaft vorstellen. Ihm blieb trotzdem schleierhaft, was Veit ihm sagen wollte. »Was hat das mit der Flasche Holunderblut zu tun?«
»Der Vadder reicht das Blut an den Sohn weiter. Es wär minne Uffgabe, dem Johann uff sinn Kind ’ne Pulle Holunderblut usszugeben. Der Wagner hot eine Flasche middegebrohd und sie lautstark durch de Kneipe geschwenkt. ›Für minnen Enkel‹, hot hä gebrüllt.«
»Bist du sicher, dass du es nicht falsch verstanden hast? Das Kind ist ja noch nicht mal geboren.«
»Es geht ja nit um Johanns Kind. Wos kann man do falsch verstehen? Ich honns ja geahnt, aber ich wollt’s nit wahrhaben.«
»Du meinst, das könnte der Grund sein, warum die Luise sich umgebracht hat? Weil euer Johann vom Wagner war?«
Veit nickte. »Und schau den Bengel doch an! Hä sieht mir überhaupts nit ähnlich.«
Das stimmte. Hochapfel lehnte sich in der Bank zurück. Er hatte nicht bemerkt, dass seine Hände den Stoff der Soutane kneteten. Das grobe Gewirk hatte die verschwitzte Haut in den Innenflächen wundgescheuert.
Ihm kam ein Gedanke. Er brachte es nicht über sich, ihn laut auszusprechen. Er presste die Worte, gerade noch verständlich, durch die Zähne. »Aber dann ist der Johann mit seiner Halbschwester verheiratet.«
»Hostest jetze? Kannste jetze verstehn, wie’s mir grad gehen tut? Ich kann dir sprechen, uss allen Wolken bin ich gefallen. Am liebsten wär ich gleich hoch zum Wagner und hät dem Deiwel den Rest gegeben.«
»Fritz, nein!« Hochapfel dachte nach. Er hätte es sogar verstehen können. »Warum bist du stattdessen zu mir gekommen?«
Veit knickte im Rücken ein, der Kopf sank ihm auf die Brust. »Weil der Johann das erledigen tut«, nuschelte er in den Kragen seiner Jacke.
Hochapfel sprang auf. »Was? Du lässt deinen Sohn in sein Unglück rennen?« Er hörte die eigenen Worte von den Kirchenwänden abprallen und erschrak. Er setzte sich und wiederholte flüsternd: »Du lässt deinen Sohn in sein Unglück rennen?«
»Hä is nit mein Sohn.«
»Bis vor einer Stunde war er’s noch. Du hast den Jungen großgezogen und jetzt lässt du ihn zum Mörder werden?« Hochapfel stutzte, als er sich das sagen hörte. Dieser Satz hatte einen gravierenden Fehler: Johann, ein Mörder? Niemals. Der Junge war vielleicht ein wenig dumm, grobschlächtig und ungelenk auch. Aber ein Mörder? Soweit Hochapfel sich erinnern konnte, hatte Johann keiner Fliege je etwas zuleide getan. »Der Johann kann das gar nicht, den Wagner zur Strecke bringen. Egal, was der gesagt hat.«
»Richtig.« Veit hatte den Kopf erhoben.
Eine Entschlossenheit war in seinem Gesicht aufgetaucht, die Hochapfel in Panik versetzte.
»Uss diesem Grund werd ich es zu Ende bringen.«
»Nein«, flüsterte Hochapfel.
»Doch. Ich geh jetze hinnerher und werd erledigen, was der Johann mit Sicherheit nit geschafft hot. Aber alle wern denken, dass hä es war.«
»Und dann?«
»Dann muss hä das Dorfe verlassen. Hä kann doch nit mit sinner Halbschwester in Sünde leben. Wie soll das gehen?«
Da sprach der Veit die Wahrheit. Johann und Magda, hochschwanger vom Halbbruder. Das durfte keinen Tag länger gehen. Freiwillig würde Johann seine Magda niemals im Stich lassen. Hochapfel kamen die Bilder von der Hochzeitsfeier ins Gedächtnis. Getraut hatte er die zwei im Angesicht des Herrn. Sie hatten im Garten der Veits gefeiert, an einem herrlichen Sommertag. Die beiden jungen Leute waren so verliebt. Ein Glückstag war das gewesen – wäre das gewesen –, wenn der Wagner nicht, voll wie eine Haubitze, mit jedem gröhlend auf seinen Sohn und seine Tochter angestoßen hätte. Der Besuch Veits warf ein anderes Licht auf diesen Tag und Hochapfel schämte sich, dass er es hatte nicht wahrhaben wollen. Wie alle. Wie viele Situationen wie diese hatte es zwischenzeitlich gegeben, wie oft hatten ihn Frauen in der Beichte angefleht, den Männern nichts zu erzählen und die Kinder der Unzucht trotzdem zu taufen. Hochapfels Magen krampfte sich zusammen, als er die Entschlossenheit in Veits Gesicht sah. Irgendwann musste es genug sein. »Du hast recht«, flüsterte er. »Diese Unzucht muss jemand beenden.«
»Danke«, wisperte Veit. Er kämpfte sich ungelenk hoch und taumelte aus der Kirche.
Das Stundenläuten der Kirchturmuhr mischte sich in das Krachen eines einschlagenden Blitzes. Karl-Friedrich Hochapfel saß in der Bank und flehte seinen Herrn am Kreuz um Beistand an. Er blieb sitzen, bis ihm die Beine einschliefen. Das Kreuz, das von der Decke hing, warf einen langen Schatten. Der Herr schwieg beharrlich.
Das Gewitter war wenige Kilometer entfernt. Das Zittern der Bleiverglasung in den Kirchenfenstern klirrte leise durch den Kirchenraum. Das Echo des Donnergrollens kroch über die Berghänge und fing sich im Talkessel. Hochapfels Gedanken sprangen hin und her. Eine Frage der Zeit war es gewesen, bis Wagner bekam, was er verdiente. Dass Veit die Gelegenheit nutzte, diesem Unhold die Quittung zu präsentieren und Johann und Magda vor einem Leben in Sünde zu bewahren, schien Hochapfel die einzige Lösung zu sein. Wenn sich die Brut vermehrte, die Karl Wagner in die Welt gesetzt hatte, und der böse Samen aufging, war das Dorf am Ende voll mit solchen wie ihm: Mädchenschänder, Erpresser, gewalttätige Trunkenbolde. Er schaute zum Kreuz. »Du kannst es trotzdem nicht gutheißen, richtig?«, flüsterte Hochapfel. Er erhielt keine Antwort.
Das Grollen folgte den Blitzen in kürzer werdenden Abständen wie ein böses Omen. Übles Ungemach dräute über dieser hereinbrechenden Nacht. Schon von Amts wegen hatte Karl-Friedrich Hochapfel jeder Form von Gewalt nichts entgegenzusetzen. Das ganze Dorf würde über den Pfarrer lachen, wenn der sich zwei Streithammeln in den Weg stellen wollte.
Ich werde jemanden um Hilfe bitten müssen.
Die Hitze außerhalb der Kirche traf ihn wie ein Hammerschlag. Der Pfarrer blieb an der Kirchenmauer stehen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es gab nur einen, der am Ende eines solchen Tages nüchtern zu Hause anzutreffen war: der Jude. Ausgerechnet den hatte Hochapfel in der letzten Predigt so unverhohlen geschmäht, dass es Brix zu Ohren gekommen sein musste. Das Grollen rollte durch die Hänge und schien mit seinem Schall die Hitze aufzuwirbeln. Unter Hochapfels Soutane rann der Schweiß, und der schwere Stoff klebte wie ein Panzer.
Einige Minuten später stand er vor dem Haus des Juden. Der Hintereingang und die Praxisräume waren dunkel, aus den Fenstern des Wohnhauses drang Licht. Karl-Friedrich Hochapfel öffnete das Gartentörchen und schlich bis zur Haustür. Er atmete tief ein und klopfte an.
Im Türspalt tauchte das Gesicht eines Jungen auf. Bei genauerem Hinsehen erkannte der Pfarrer den älteren der beiden Arztsöhne. »Sag, Gutmund, ist dein Vater zu Hause?«
Der Junge schüttelte den Kopf. Er starrte das Kreuz an, das vor der schwarzen Brust des Pfarrers baumelte.
Hochapfel legte die Hand über das Kreuz. »Ist er bei einem Patienten?«
Wieder schüttelte der Junge den Kopf.
So ging das nicht. »Ist deine Mutter zu Hause?«
In dem Moment näherte sich die Stimme einer Frau. »Wer ist denn da, Gutmund?«
Der Junge sagte keinen Ton. Hinter ihm tauchte das Gesicht von Helene Brix auf.
»Oh!« Mit einem Besuch des Pfarrers schien sie zu allerletzt gerechnet zu haben.
»Doktor Brix ist nicht zufällig zugegen?«
»Nein. Aber er kann zu Ihnen kommen, wenn er zurück ist. Ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Seine Tasche steht noch im Flur, er kann also nicht weit sein.«
Die Hoffnung auf Unterstützung schwand. Sein Gott schien Karl-Friedrich Hochapfel eine Lektion erteilen zu wollen. Wenn du leichtsinnig jemanden in seinen Racheplänen bestärkst, dann sieh auch zu, dass du das geradebiegst.
»Er muss nicht bei mir vorbeikommen. Es ist ja nichts Schlimmes passiert.« Noch nicht.
»Wie Sie meinen.«
In Helene Brix’ Blick konnte Hochapfel lesen, dass sie es ihm nicht abnahm. Er verabschiedete sich rasch, bevor sie auf die Idee kam, nachzuhaken.
Als er wieder am Gartentor ankam, hörte er, wie die Haustür hinter seinem Rücken ins Schloss fiel.
Auf der Straße warf er einen Blick in den Himmel. Gewitterwolken schoben sich unter den Horizont, nur noch wenige Minuten, dann würde es stockdunkel sein. Karl-Friedrich Hochapfel spürte einen Druck im Rücken, der ihn zur Eile mahnte; längst konnte alles zu spät sein und Fritz Veit oder sein Sohn Johann hatten Fakten geschaffen. Gleichzeitig kam es Hochapfel vor, als renne er vor eine Mauer aus Zweifeln. Was konnte er schon ausrichten, wenn die Kerle ernsthaft aufeinander losgingen? Seitdem überall diese Hakenkreuze aufgetaucht waren, war die Stimmung ruppiger denn je. Die Fäuste flogen rascher, die Beleidigungen saßen lockerer und allenthalben offenkundiger Hass. Seit es so geworden war, hatte Karl-Friedrich Hochapfel die Kirche immer seltener verlassen und betete doppelt so lang wie sonst. Bloß die Kerle mit den Knüppeln verschwanden nicht. Sie krochen aus sämtlichen Löchern und vermehrten sich wie die Ratten.
Am liebsten wäre der Pfarrer zurück in seine Kirche geschlichen, hätte sich vor das Kreuz geworfen und den Allmächtigen über das Schicksal von Johann und Fritz Veit und Karl Wagner entscheiden lassen. Ein gewaltiger Blitz ließ ihn zusammenzucken. »Ist ja gut«, murmelte er, »ich geh ja schon.«
Widerwillig erklomm er die Gasse zum Haus von Karl Wagner. In sämtlichen Fenstern waren die Vorhänge zugezogen. Er meinte erkennen zu können, dass sie sich hinter den Scheiben bewegten. Er wurde beobachtet.
Er drückte sich im Schatten der Fassaden entlang. Das Haus von Karl Wagner war unbeleuchtet. Er schlich daran vorbei, bis sich am Ende des Grundstücks die Gasse teilte. Ein Teil lief geradeaus, der andere bog in einem scharfen Knick ab. Linkerhand lag das Haus von Albrecht Schneider. Rechts davon, oberhalb der Straße, der Hof der Söders. Hochapfel kämpfte sich weiter die Gasse hinauf. Seine Beine waren wie mit Blei gefüllt.
Im Hof vor Albrecht Schneiders Haus klopften die Kaninchen wild im Stall. Das Gewitter, dachte Hochapfel.
Er bemerkte zwei Schatten im Innenhof. Er hielt den Atem an und drückte sich gegen die Hauswand des angrenzenden Hauses. In der Küche der Schneiders waren die Vorhänge zugezogen, dahinter schien dumpf das Licht. Hatten die nicht bemerkt, was in ihrem Hof vor sich ging? Hochapfels letzte Hoffnung schwand, dass ihm jemand die Bürde abnehmen würde, sich einmischen zu müssen; hinter den Gardinen regte sich nichts.
Er trat genau so weit nach vorne, bis er unentdeckt um die Hausecke in den Innenhof linsen konnte.
Was er sah, verschlug ihm den Atem. Er zuckte zurück, schloss die Augen und fasste das Kreuz um seinen Hals. Sauer drängte es die Speiseröhre hinauf, er schluckte es hinunter und richtete den Blick in den Himmel. Was für eine Prüfung hältst du für mich bereit? Die Antwort war ein Grollen. Mit größter Umsicht drückte Hochapfel den Körper an die Hauswand und schob den Kopf um die Ecke herum.
Im Innenhof kniete einer auf dem Pflaster. Hochapfel erkannte die grobschlächtige Statur: Karl Wagner. Davor stand, den Rücken zu Hochapfel, ein anderer Mann. Er hielt eine Axt in der Hand. Wie ein Scharfrichter hob er sie in Zeitlupe.
Mein Gott, lass mich nicht allein. Ein Blitz zuckte durch die Szene. Hochapfel erkannte das Profil von Fritz Veit. Und ich habe ihn dazu getrieben!
Hochapfel nahm all seinen Mut zusammen. Er erhob das Bein zum Schritt, als sich aus dem Schatten des gegenüberliegenden Hauses zwei Gestalten lösten. Eine hielt sich im Hintergrund, die andere trat bis an den Rand des Laternenscheins, blieb aber im Dunkeln stehen. Hochapfel kniff die Augen zusammen, außer Umrissen konnte er nichts erkennen. Der hochgewachsene Körper verharrte einen endlosen Moment. Er war Hochapfel so nahe, dass er ihn in seinem Versteck bemerkt haben musste. Wenn die beiden schon länger im Schatten des Hauses gestanden hatten, hatten sie Hochapfel auf jeden Fall die Gasse hinaufkommen sehen.
Niemand kümmerte sich um die Anwesenheit des Pfarrers. Der Mann, der vorgetreten war, fixierte das Geschehen im Innenhof. Er wisperte etwas, gerade so laut, dass die Worte Fritz Veit mit der erhobenen Axt und den lauschenden Pfarrer erreichen mussten. Hochapfel traute seinen Ohren nicht. Zwei Worte waren es, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließen.
»Tu es!«
Die Axt sauste nieder.
Samstag, der 3. April 1965
Johann Veit tauchte an Edgars Geburtstag auf.
Edgar war mit der dumpfen Hoffnung zu Albrecht gegangen, Fiona dort anzutreffen. Seit sie ihn in einer harmlosen Umarmung mit einer anderen Frau erwischt hatte, strafte sie ihn mit Schweigen. Edgars Zuversicht war also gering. Dennoch hatte er sich vorgenommen, den Umständen zum Trotz einen gemütlichen Abend mit Albrecht zu verbringen.
Stattdessen saß Johann Veit in der Küche.
Albrecht sah aus, als wäre ihm ein Geist begegnet, und so wie Edgar die Geschichte erinnerte, die sich vor 27 Jahren genau an dieser Stelle abgespielt hatte, entsprach das irgendwie den Tatsachen.
Johann Veit saß am Tisch, die schaufelgroßen Hände auf die Platte gelegt und den riesigen Körper auf einen Stuhl gequetscht. Edgar dachte, wenn Veit aufstünde, schlüge er mit dem Kopf an die Decke.
Albrecht schlich durch die Küche wie ein Tiger im Käfig. Johann Veit und Edgar sahen ihm hilflos dabei zu. Edgar rechnete damit, dass Albrecht jede Sekunde aus seinem eigenen Haus stürzen würde. Glücklicherweise behielt er die Nerven.
»Meinen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, sagte Johann Veit mit einer erstaunlich weichen Stimme in Anbetracht seines grobschlächtigen Äußeren.
»Danke«, antwortete Edgar schlicht, weil ihm nichts Klügeres einfiel. Nach einer Pause fügte er hinzu: »Das ist ein sehr unerwarteter Besuch, nicht wahr, Albrecht?«
Albrecht Schneider zuckte zusammen. Er seufzte ergeben und setzte sich zu Edgar und Johann Veit an den Tisch. »Ja«, sagte er, »unerwartet.«
»Ich wollte Ihre Feier nit stören, aber wo hätte ich denn hingehen können?« Johann Veit sprach mit einem seltsamen Dialekt, den Edgar nicht zuordnen konnte.
Statt Veits Frage zu beantworten, zuckte Albrecht die Schultern.
Edgar sah ein, dass er das Gespräch übernehmen musste, wenn er etwas aus Johann Veit herausbekommen wollte. »Wieso kommen Sie nach all den Jahren ausgerechnet jetzt zurück?«
»Peer Fram ist verschwunden. Die Polizei wollte mir keine Auskunft geben. Ich habe nur erfahren können, dass er zuletzt hier war.«
Edgar tat es leid, dass er die Wahrheit nicht schonender verpacken konnte, also legte er die Fakten auf den Tisch. »Peer Fram ist tot.«
»Oh.«
Ein Blick in Veits Augen genügte und es tat Edgar noch mehr leid. »Was sollte Fram hier herausfinden, was Sie nicht schon wissen? Ich meine, Sie waren doch in jener Nacht dabei.«
Albrecht nickte bekräftigend.
»Mir ist ein kompletter Tag wie ausradiert«, sagte Veit kleinlaut. »Ich weiß noch, dass ich Streit mit Karl Wagner in der Kneipe hatte, danach ist alles weg. Ein oder zwei Tage später las mich eine holländische Zirkustruppe auf der Landstraße auf. Da wusste ich noch nit mal mehr meinen Namen. Immerhin fiel der mir einige Wochen später wieder ein.«
»Sie sind mit denen nach Holland gegangen?« Jetzt bekam der Besuch von Peer Fram einen Sinn und der seltsame Dialekt von Veit ebenfalls. »Und warum haben Sie Fram hierhergeschickt?«
Veit schüttelte den Kopf. »Nein, ich war das nit. Er hat mich aufgesucht. Er sollte mir mitteilen, was er im Auftrag von jemandem, den er nicht preisgeben durfte, recherchiert hatte. Er hat mir erzählt, dass mein Kind bei der Geburt starb und meine Frau wenig später. Ich hatte keine Ahnung, dass er hat herkommen wollen, um herauszufinden, wie es damals weiterging. Und er ist tot, sagen Sie?«
Albrecht machte ein Geräusch, als habe er Zahnschmerzen.
Diese Unterhaltung weiterführen zu müssen, würde an Edgar hängen bleiben. »Letzten Sommer kam er her und stellte unangenehme Fragen. Ihr Vater hatte wohl Angst, dass Sie hier auftauchen könnten, wenn Fram mit Antworten zu Ihnen zurückkehren würde.«
Veit saß mit offenem Mund da. »Mein Vater?«
»Er hat Fram getötet und später sich selber.«
Wieder gab Albrecht ein schmerzvolles Geräusch von sich. Edgar hätte ihm diese Unterhaltung am liebsten erspart. Aber genauso wie Johann Veit konnten sie alle nicht vor der Wahrheit davonlaufen.
Veit nickte traurig. »Ich habe so etwas befürchtet. Ich hatte nur viel früher damit gerechnet, dass er sich das Leben nehmen würde. So wie meine Mutter.«
»Sie können sich demnach an das erinnern, was Ihnen Karl Wagner an jenem Abend in der Kneipe zu verstehen gab?«
Veit schaute zu Boden. »Ja, leider. Das habe ich leider nit vergessen. Wie konnte mein Vater nur all die Jahre mit der Schande leben? Also … ich meine den Mann, der mich großgezogen hat.«
»Ich habe ihn nur kurz kennengelernt. Glauben Sie mir, er konnte es nicht. Er hatte sich in die Jagdhütte im Wald zurückgezogen und hauste dort ohne Kontakt zum Dorf.«
Edgar überlegte, wie er die Wahrheit abfedern konnte, dass es Fritz Veit gewesen war, der Karl Wagner erschlagen hatte, doch Johann Veit kam ihm zuvor.
Er legte die Hände vor das Gesicht und murmelte: »Er hat mit dem Mord an Karl Wagner dafür gesorgt, dass ich das Dorf verlassen musste, oder?«
Edgar wartete, bis Veit die Hände wieder sinken ließ, und nickte.
Albrecht sah aus, als ob ihm alles Blut aus dem Körper gewichen sei. Es war an der Zeit, ihn aus dieser Situation zu erlösen. Edgar stand auf, holte drei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank, öffnete sie und stellte sie auf den Tisch. »Ich glaube, wir haben für heute alle genug. Haben Sie eine Unterkunft?«
Albrecht hob den Kopf. Sein Blick sagte: Komm nicht mal im Traum auf die Idee, mich zu fragen.
Edgar mochte sich nicht vorstellen, was los wäre, wenn er Veit bei sich wohnen ließe. Eine andere Lösung musste her. Mit gespielter Zuversicht verkündete Edgar: »Ich kümmere mich darum.«
Dienstag, der 6. April
Wie ein Lauffeuer fraß sich die Neuigkeit von Johann Veits Rückkehr durch das Dorf und hinterließ statt verbrannter Erde eine Schneise bleiernen Schweigens.
Edgar versuchte, sich durch Geschäftigkeit abzulenken, doch die Beklemmung wich selbst in der Sprechstunde keine Sekunde von ihm. Diese alles beherrschende bedrückende Stimmung kroch wie die Feuchtigkeit, mit der der April seine Aufwartung machte, in sämtliche Ritzen. Edgar hatte auf die Bauernregel vertraut, die nach einem harschen Winter ein mildes Frühjahr versprach, und keine neuen Briketts bei Lukas bestellt. Die Fröste waren mit dem März gegangen, nun prasselte der Regen unaufhörlich auf das Tal nieder und Ostern stand vor der Tür. An einen sparsamen Umgang mit Brennmaterial war kein Gedanke zu verschwenden: Der Ofen bollerte und kämpfte vergeblich gegen die Feuchtigkeit in den Räumen an. Die hatte sich genauso hartnäckig in den Winkeln der Praxis eingenistet wie das mulmige Gefühl, das jeder Kranke in Edgars Behandlungszimmer trug. Von heute auf morgen war Schluss mit der Neugierde. Niemand bohrte indiskret oder fiel wie sonst mit der Tür ins Haus. Edgar konnte seinen Patienten die Fragen förmlich von der Stirn ablesen: »Hat er mit Ihnen gesprochen? Was will er hier? Und warum nach all den Jahren?« Doch die Fragen blieben unausgesprochen und die Patienten stumm. Und wenn sich einer getraut hätte, den Mund aufzumachen, was hätte Edgar denn antworten sollen?
Mehrmals in den letzten Tagen hatte er das Notizbüchlein aus der Schublade geholt und darin gelesen. Auch an diesem Morgen saß er in seiner Praxis und ging vor Beginn der Sprechstunde ein weiteres Mal die Notizen durch, die er im Sommer des letzten Jahres angefertigt hatte. Damals war er sicher gewesen, die Sache sei für alle Zeiten ausgestanden. Hätte er jemals geglaubt, dass Johann Veit zurückkehren und damit die Geschichte wieder von vorne anfangen würde? Die Gedanken schweiften ab und die Notizen verschwammen vor seinen Augen.
Sein erster Versuch, Johann eine Unterkunft zu besorgen, hatte Edgar in das örtliche Gasthaus »Brauborn« geführt. Sabine Noll hatte mit einer knappen Geste Richtung Ausgang gedeutet, nachdem Edgar ihr flüsternd über die Theke sein Anliegen unterbreitet hatte. Zumindest hatte sie dafür gesorgt, dass binnen Stundenfrist das gesamte Dorf über Veits Rückkehr im Bilde war.
Gudrun Pfeiffer hatte ebenso wenig glücklich dreingeschaut, aber die Frau, die es in puncto Größe und Grobschlächtigkeit locker mit Johann Veit aufnehmen konnte, besaß das Herz eines Ochsen und ließ sich erweichen; am Tag seiner Ankunft hatte Veit die Kammer auf dem alten Speicher der Mühle bezogen. Seitdem grübelte Edgar, wie diesem unwürdigen Zustand ein Ende zu setzen war, ohne das ganze Dorf gegen sich aufzubringen. Dass Veit weder einen Ofen noch eine Waschgelegenheit zur Verfügung stand, bereitete Edgar genauso Magenschmerzen wie die Tatsache, dass er ihm verschwiegen hatte, dass vor wenigen Monaten Piotr Luschek auf dem Speicher tot aufgefunden worden war. Obendrein konnte der Zweimetermann an keiner Stelle aufrecht stehen und die Stiege auf den Dachboden schwankte unter seinem Gewicht, als bräche sie jeden Augenblick zusammen.
Edgars Blick hob sich von den Aufzeichnungen im Notizbüchlein und folgte den Regentropfen, die die Außenseite der Scheiben hinabrannen. Auf der Innenseite sammelte sich Kondenswasser auf der Laibung und troff auf die Fensterbank. Überall hatte Edgar Handtücher hingestopft. Mittlerweile trockneten die auch nicht mehr. Wenn der Regen nicht bald nachließe, würde das Dorf in Schlamm und Traurigkeit ersticken und der Dorfarzt mit ihm. Dieser verdammte verregnete April! Edgar konnte sich keine Vorstellung darüber abringen, wie so eine Schlammschlacht zu einer besinnlichen Osterzeit werden sollte.
Grübelei führt dich nirgendwohin, sagte er stumm zu sich selber. Er klappte das Notizbüchlein zu und riskierte einen hoffnungsvollen Blick in das Wartezimmer.
An diesem Morgen wartete dort nur einer: Georg Fuhrmann hatte mit seinen Gummistiefeln eine Spur aus Matsch von draußen hereingetragen. Unter der Jacke, die an der Garderobe hing, hatte sich eine Pfütze auf dem brüchigen Linoleum gebildet.
Edgar verwarf die Idee, Fuhrmann darum zu bitten, die Stiefel vor dem Behandlungszimmer auszuziehen. Das Aroma, das ihnen entsteigen würde, war lästiger, als den Wischmopp schwingen zu müssen, der um die Ecke bereitstand.
Kaum hatte Edgar die Frage: »Sind die Wunden gut verheilt?« ausgesprochen, sah er sich dem entblößten Hinterteil von Fuhrmann gegenüber.
Edgar setzte sich auf einen Hocker und rückte an Fuhrmanns Kehrseite heran. Die Schrotkugeln, die er ihm mühselig hatte aus dem Fleisch pulen müssen, hatten ein Muster hinterlassen, das wie ein Unfall mit roter Farbe aussah. Edgar hatte die Kugeln gezählt – vierundzwanzig Stück. Entgegen der sonst bei ihm vorherrschenden Prahllaune hatte Fuhrmann über die Ursache der Verletzung geschwiegen. Edgar vermutete, dass 24 Schrotkugeln im Hinterteil nicht auf eine Heldentat zurückzuführen waren, mit der er sich hätte brüsten können.
Edgar untersuchte die rosa Hautwülste, die sich auf den Einschusslöchern gebildet hatten. Die Haut war trocken und rundherum leicht gerötet. Fuhrmann verfügte über das, was man in dieser Region als »gutes Heilfleisch« bezeichnete. Eine von Fuhrmann in Heimarbeit mit Angelschnur geflickte Wunde hatte Edgar zuletzt lediglich aufgefrischt und desinfiziert. Selbst davon war mittlerweile nichts mehr zu sehen. Wie es zu der fragwürdigen Häufung an Verletzungen kam, behielt Fuhrmann stets für sich, die Erklärung »Jagdunfall« musste Edgar genügen.
Heute kam Fuhrmann ohne langes Drumherumgerede zur Sache. »Na, honn Se den ahlen Schlawiner bei das Gudrun unnergebracht? Die hot au vor nix Manschetten.«
Wenigstens einer, der mit der Sprache rausrückte und nicht stumm wie eine Kaulquappe rumsaß, dachte Edgar. »Sie war so freundlich, ihm die Kammer auf dem Speicher zur Verfügung zu stellen, bis etwas Besseres gefunden ist.«
»Hä will doch nit etwa länger bleiben?«
»Wieso nicht?«
»Das gibbet nur Ärger.«
»Aber er ist unschuldig aus dem Dorf vertrieben worden, das sollte sich doch mittlerweile rumgesprochen haben.«
»Das mein ich nit.«
»Sondern?«
»Na immerhin war’s sinn Ahler, der das Dorf mit dem Mord an dem Käsekopp schlecht hat usssehen lossen. Das wird hä au nit loswerden.«
»Das werden wir ja sehen.« Edgar wurde diese Unterhaltung mit dem Hinterteil von Fuhrmann lästig. Er erhob sich. »Sie können die Hose wieder anziehen. Die Wunden sind gut verheilt. Versprechen Sie mir, demnächst bei der Jagd besser aufzupassen. Scheint ein wirklich gefährliches Hobby zu sein, so oft, wie es Sie dabei erwischt.«
Fuhrmann schien nicht über seine Jagdunfälle plaudern zu wollen. »Honn Se emme nit gesprochen, dass es besser wär, sich zu verdünnisieren?«
»Wieso sollte ich das tun?«
»Vor Ihnen muss hä Respekt honn. Wie de übrigen Liede au.«
»Ach ja? Davon habe ich in den letzten Monaten noch nicht allzu viel gemerkt.«
»Wie seinerzeit vor dem Juden. Dem hot sich au kinner getraut, innen Weg zu stellen.«
»Dem Juden?«
»Na, Ihrem Vadder.«
Edgar erinnerte sich dumpf an diese Anrede. Er vermutete, dass es eine Zeit gegeben haben musste, wo sie weniger despektierlich, vielleicht sogar mit Achtung verwendet wurde, bis dann die Jahre kamen, die sie zwangen, das Dorf zu verlassen. »So? Und weil mein Vater so eine Respektsperson war, hat man uns auch wie Hunde fortgejagt.«
»Der Jude … also Ihr Vadder hots Ihnen nit gesprochen? Sie honn kinne Ahnung, oder?«
Edgar fahndete in Fuhrmanns versoffenen Augen danach, ob der es lediglich darauf anlegte, ihn zu provozieren.
Fuhrmann glotzte gelangweilt zurück.
»Na, offensichtlich habe ich weniger Ahnung als Sie. Wollen Sie meine Wissenslücke nicht füllen?«
»Ne. Wenn hä es Ihnen nit gesprochen hot, wird hä sinne Gründe gehobt honn.«
Edgar musste den Impuls gewaltsam unterdrücken, Fuhrmann achtkantig vor die Tür zu setzen. Was für eine Frechheit, hier reinzuschneien und solche nebulösen Behauptungen aufzustellen. Edgar bemühte sich, gelassen zu wirken, aber er spürte, wie ihm die Enge im Brustkorb die Worte aus dem Mund presste. »Wir sind hier fertig. Noch ein paar Tage Salbe drauf und in einer Woche können Sie wieder ohne Kissen sitzen.«
»Vielleicht hilft Ihnen Ihr neuer Freund, de Vergangenheit uffzurollen.«
»Vielleicht kümmern Sie sich um Ihre eigenen Probleme.« Vorbei war es mit Edgars Beherrschtheit.
Fuhrmann grinste ihn dreist an. »Ich bin gleich bi den Nolls, Wild im Brauborn abliefern. Hä könnt ja do unnerkommen.«
Jetzt kam der Kerl plötzlich mit einem solchen Angebot um die Ecke. »Dort hatte ich bereits gefragt. Und wenn man mir so viel Respekt entgegenbringt, wie Sie meinen, wird eine erneute Frage von Ihnen kaum etwas ändern, oder?«
»Fragen kost ja nix.«
Edgar konnte sich kein Dankeschön abringen. Er hielt Fuhrmann stumm die Hand zum Abschied hin.
Der erfasste sie mit eisernem Griff. »Nix für ungut, Herr Doktor. Es war halt ’ne böse Zitt damals. Un der Johann weckt böse Erinnerungen.«
Fuhrmann stand auf und ging, ohne sich umzudrehen.
Edgar verfolgte, wie jeder seiner Schritte Brocken lehmiger Wickenröder Erde auf dem Fußboden verteilte. Ein Seufzen drängte sich aus tiefstem Herzen nach oben und verschaffte sich geräuschvoll Luft. Wie sehr war er all das leid: die Andeutungen, das vielsagende Schweigen und die bohrenden Blicke. Das alles machte ihn müde. Edgar brachte nicht den Elan auf, den Besen rauszuholen, nicht, den Ofen zu heizen, und schon gar nicht, sich auf den Weg zu Albrecht zu machen, um ihn zu fragen, ob er etwas mit Fuhrmanns Andeutungen anfangen konnte. Außerdem hatte er das in den letzten Tagen mehrfach vergeblich versucht. Albrecht zog es vor, sich zu verdrücken und die Wunden, die die Erinnerung aufgebrochen hatte, bei der Witwe Helferich zu lecken. Wie ein alter Gockel ließ Albrecht sich betüddeln, seit die Helferich ihm die Kissen auf dem Sofa aufklopfte und ihn mit Keksen und Kuchen vollstopfte. In diese traute Zweisamkeit hereinzuplatzen, war das Letzte, was Edgar gebrauchen konnte. Vielleicht, weil Zweisamkeit mit Fiona in so unerreichbare Ferne gerückt war. Eine weitere Nacht mit Fiona war genauso wenig vorstellbar wie Sonnenstrahlen, die durch die Wolken brachen.
Ziemlich wehleidig heute. Muss an diesem Scheißwetter liegen.
Er ging zum Fenster, wischte mit dem Ärmel die Feuchtigkeit auf der Innenseite weg und schaute in eine trübe Suppe. Das war nicht das richtige Wetter, um Zuversicht und Tatendrang zu entwickeln.
Dem Rest des Ortes schien es nicht anders zu ergehen, denn nach einer weiteren Stunde hatte sich kein Patient ins Wartezimmer verlaufen. Edgar schloss die Praxis vor der Zeit. Er heizte die Wohnstube ein und ließ sich mit der Tageszeitung am Couchtisch nieder. Das Zeitungspapier wellte sich und die Polster der Sessel fühlten sich klamm und kühl an. Er breitete die Zeitung aus und fahndete nach einem Artikel des Journalisten Eugen Bock. Seit Wochen hatte er von dem nichts gehört und gelesen. Dem musste der Schock in allen Gliedern steckengeblieben sein; die Geliebte tot in den Armen halten zu müssen, haute den abgebrühtesten Journalisten für eine Weile aus der Spur. Seitdem Bock sich zurückgezogen hatte, berichtete niemand mehr über die Vorgänge in Hirschhagen. Darüber, dass das Gelände der stillgelegten Sprengstofffabrik von vielen gerne als Müllhalde benutzt wurde, auf der man mit der illegalen Entsorgung von giftigen Flüssigkeiten bis hin zu Altgummi dreckiges Geld verdienen konnte. Und niemanden schien es zu scheren. Dabei hätte ein Aufschrei durch die Bevölkerung gehen müssen, als bekannt wurde, dass das Grundwasser hoch belastet war. Aber die Dörfler steckten ihre Köpfe lieber in die lehmige Scholle und wälzten die Sorgen, die das Auftauchen von Johann Veit nach all den Jahren mit sich brachte.
Edgar bemühte sich, sich einzureden, dass er auf die Andeutungen von Fuhrmann nichts gab. Dennoch wanderten seine Gedanken ständig weg von der Zeitung und hin zu dem Satz: »Sie haben keine Ahnung, oder?« Wie oft hatte Edgar diese Worte in den letzten Monaten hören müssen? Eigentlich immer, wenn die vergangenen zwanzig Jahre zur Sprache kamen. Die Zeit, die er in den USA verbracht hatte und in der die Ereignisse in Deutschland an ihm vorbeigegangen waren. Natürlich hatte er keine Ahnung. Woher auch? Acht war er gewesen, hatte mitten in der Nacht seinen Koffer packen müssen, um zwei Stunden später heimlich in einer schwarzen Limousine aus dem Dorf gebracht zu werden. Er hätte nicht im Traum daran gedacht, dieses Nest jemals wiederzusehen. Und er wäre niemals in das Flugzeug gestiegen, hätte ihm das Leben nicht derart übel mitgespielt. All die Pläne seines Vaters hatte er im Handstreich durchkreuzt; eine Karriere als Mediziner in einem Vorzeigekrankenhaus in Neuengland, das war es, was in den Augen von Conrad Brix das einzig Erstrebenswerte für seine Söhne war. Jeden Augenblick, in dem Edgar das Ziel des Vaters infrage gestellt hatte, hatte der alte Brix ihn mit jener Missachtung gestraft, die diese vermeintliche Ausgeburt an Tugend in all den Jahren geradezu perfektioniert hatte. Sich morgens hinter einer Zeitung zu verkriechen und seine Umwelt mit Schweigen zu strafen; das Wort »Versager« hätte nicht unmissverständlicher im Raum stehen können.
Bis nach Deutschland war Edgar geflohen, um dem Schweigen des Vaters zu entrinnen, und was bekam er stattdessen? Verschwommene Andeutungen! Wenn ihm das wenigstens dabei helfen würde, Johann Veits Erinnerung auf Trab zu bringen. Edgar hatte von solchen Fällen von Gedächtnisverlust in den Fachzeitschriften gelesen, die ihm sein Bruder Gutmund regelmäßig schickte. Ehemalige Insassen von Konzentrationslagern hatten über das Phänomen berichtet. Das Gedächtnis tilgte die Erinnerung, um seinen Besitzer vor Erlebnissen zu schützen, die zu schmerzhaft waren, um mit ihnen weiterzuleben. Wie oft hatte Edgar sich gewünscht, vergessen zu können und nicht jedes Mal beim Geräusch quietschender Autoreifen bis ins Mark zu erschrecken.
Ein Klopfen an der Tür riss ihn aus den Gedanken.
Als ob er durch Edgars Grübeleien auf den Plan gerufen worden war, stand Johann Veit vor der Tür. »Frau Pfeiffer geht’s nit gut. Wäre es wohl möglich, dass Sie mitkommen?« Veits Aussprache war eine Mischung aus Deutsch in holländischem Singsang mit dem hartnäckigen nordhessischen »nit« geworden.
Du wirst genauso wenig jemals wieder dazugehören wie ich, dachte Edgar, unsere Sprache verrät uns als Vaterlandsflüchtlinge. »Was hat sie denn?«
»Ich weiß auch nit. Wollte mir eben bei ihr in der Küche Wasser heiß machen, da kippt sie beinahe vom Stuhl. Und Sie wissen, dass es da kein Halten gibt.« Johann Veit grinste schief.
»Warum haben Sie nicht angerufen? Sie hätten sich den Weg sparen können.«
»Die Telefone sind tot.«
Edgar trat einen Schritt zurück in den Flur und hob den Hörer vom Apparat. Kein Ton drang aus der Muschel, auch nach mehrmaligem Drücken der Gabel nicht.
»Stimmt, tot«, sagte er. »Warten Sie kurz. Ich hole meine Tasche.«
Johann Veit hatte recht gehabt. Gudrun Pfeiffer war ganz weiß um die Nase und saß zittrig auf dem Küchenstuhl, der unter dem Gewicht der Frau bebte.
Edgar fühlte ihren Puls, der fest und normal war, und maß den Blutdruck, der sich im Rahmen ihres Körpervolumens bewegte. Er fragte sie, ob sie etwas Falsches gegessen habe. Sie schüttelte den Kopf. Gudrun Pfeiffer war nie ausgeprägt mitteilsam, aber im Augenblick kam sie Edgar vor wie ein verschrecktes Kaninchen, und das war im Angesicht dieses weiblichen Haudegens ein Grund zur Sorge.
Veit hatte einen Kaffee aufgesetzt und Edgar wartete ab, bis Gudrun Pfeiffer einige Schlucke genommen hatte. »Haben Sie überhaupt schon etwas gegessen?«
Sie schüttelte den Kopf. Ein braunes Haarnetz war ihr halb heruntergerutscht und offenbarte einen unfrisierten Schopf.
Edgar wandte sich an Veit. »Könnten Sie uns wohl einen Augenblick allein lassen? Ich möchte Frau Pfeiffer abhören.«
Veit trollte sich mit sorgenvoller Miene.
Edgar musste Gudrun Pfeiffer nicht abhören. Unter ihrem panzerartigen Korsett in dezenter Fleischfarbe drangen gleichmäßige Atemzüge an sein Ohr. In diesem Brustkorb, auf den manche Opernsängerin neidisch gewesen wäre, war alles in bester Ordnung.
Edgar wurde das Gefühl nicht los, dass sie über irgendetwas in der Gegenwart von Johann Veit nicht mit der Sprache rausrücken wollte. »So, Frau Pfeiffer, jetzt erzählen Sie mir mal, was los ist.«
Sie hielt mit ihren Männerhänden die Tasse wie ein Schraubstock umklammert. Der Kaffee zitterte darin. »So was honn ich in all den Jahren nit erlebt, das können Se mir glauben.«
»Was meinen Sie?«
Sie griff in die Tasche ihrer Kittelschürze, zog ein verknautschtes Blatt Papier heraus und reichte es Edgar. Der musste es nicht erst auseinanderfalten, um zu ahnen, was darauf geschrieben stand. Er tat es trotzdem. Der Text überstieg seine schlimmste Befürchtung.
»Ostern steht vor der Tür. Und du weißt, was man an Ostern mit den dummen Schafen macht.«
»Ich honn schon vieles durch. Wenn Se wie ich allein ’ne Mühle führen, dann müssen Se sich alszus gegen de Kerle behaupten. Aber sowas honn ich nit erwartet.«
»Sie haben Johann nichts davon erzählt?«
»Ne, der Junge is onnehin so durch den Wind. Was wolln die denn? Hä tut doch niemandem was.«
Edgar versuchte, ein unangebrachtes Schmunzeln zu unterdrücken. Der »Junge« war im gleichen Alter wie Gudrun Pfeiffer und ihr obendrein von Größe und Statur her ebenbürtig. Aber die Bezeichnung »Mann« hatte Gudrun Pfeiffer wohl für Kerle reserviert wie den, der sich oberhalb des Kasseler Bergparks auf eine Keule stützte.
Edgar untersuchte den Zettel. Schreibmaschine auf einem ordentlichen, weißen Blatt Papier. »Haben Sie eine Vermutung, wer dahinterstecken könnte?«
»Hier im Ort kommt doch kinner uff die Idee, ’ne Schreibmaschine zu benutzen. Ich kenn doch minne Pappenheimer.«
Gudrun Pfeiffer stand fest wie ein Baum im Leben, aber Edgar merkte, dass die Drohung ihr Angst eingejagt hatte. »Ich überlege mir schleunigst, wie wir den Johann woanders unterbringen können.«
»Ach, Herr Doktor, das will ich doch gar nit. Ich honns dem Jungen versprochen, dass hä bei mir wohnen darf, und nu zieh ich den Schwanz nit in.«
»Das verstehe ich, aber wenn der Johann rausbekommt, dass Sie bedroht werden, bleibt der keine Minute länger bei Ihnen.«
»Sie werns ihm aber nit sprechen.«
»Wenn Sie das wollen, halte ich mich an meine Schweigepflicht. Nur finde ich, dass er wissen muss, was vorgeht. Es geht ja immerhin um ihn.«
»Aber nit heute. Ich honn emme Bradkartuffeln zum Middach versprochen und die soll der Junge au bekommen.«
Edgar drückte Gudrun Pfeiffer den Unterarm, der dick war wie sein Bein. »Ich mache mich erst mal auf die Suche nach einer anderen Unterkunft und dann sehen wir weiter.«
Sie sah ihn dankbar an.
»Machen Sie sich keine Sorgen. Ich hab schon mehrere von diesen Briefen erhalten und nie ist etwas passiert.« Als Edgar seine eigenen Worte hörte, fiel ihm auf, dass das eine faustdicke Lüge war. Menschen waren gestorben, das konnte er kaum ernsthaft leugnen. Trotzdem ließ er die Unwahrheit im Raum stehen.
Er packte die Tasche, verabschiedete sich mit dem Versprechen, sich zu melden, und verließ die Mühle.
Vor der Tür wartete Johann Veit unter dem Schleppdach des angrenzenden Schuppens. Der Regen prasselte auf das Blech. Die wenigen Schritte bis zum schützenden Dach reichten aus, dass Edgar das Wasser die Stirn herunterrann. Er klaubte ein Taschentuch aus der Manteltasche und wischte sich über das Gesicht.
Johann Veit stand da, mit offenem Mund, es kam jedoch kein Ton heraus.
Edgar stellte die Tasche ab. Er nutzte die Zeit, bis Veit die richtigen Worte gefunden hatte, um ihn zu mustern.
Veit musste früher einer dieser Kerle gewesen sein, die weit bis in die zwanziger wie ein Bengel aussahen. Zu groß geraten, mit Schaufeln statt Händen, dem Kreuz eines Ochsen und einem ebensolchen Gemüt. Weiche Gesichtszüge auf einem unproportionierten Schädel und darauf weißes Haar, das kein Kamm zu bändigen vermochte. So mochte er früher ausgesehen haben, Edgars Erinnerung lieferte nur noch Schemen. Jetzt stand dort ein Mann, dem das Leben das Gesicht zerfurcht hatte. Das dünne Haar mit Pomade an den Schädel geklebt und die Kleidung nicht wie früher verschlissen, sondern gepflegt und passend für den unförmigen Leib. Und trotzdem war etwas geblieben: Eine Haltung, die verriet, dass der Körper im Wachstum zu wenig Nährstoffe erhalten, zu hart gearbeitet und zu enge Kleidung getragen hatte, und blaue Augen, die wie zwei kleine Bergseen aus zerfurchtem Gelände strahlten.
Johann Veit waren scheinbar die richtigen Worte eingefallen. »Bin ich schuld?«
Edgar überlegte, was er wohl meinen konnte. Er antwortete taktisch mit einer Gegenfrage: »Am Zustand von Frau Pfeiffer?«
»Auch.«
Edgar startete einen weiteren Versuch, vermintes Gelände zu meiden. »Sie können nichts dafür, dass Frau Pfeiffers Kreislauf heute nicht auf der Höhe ist.«
»Und kann ich etwas dafür, dass mein Vater tot ist? Und Peer Fram? Hätte ich früher zurückkommen sollen? Hätte ich wegbleiben sollen?«
Hätte ich das Auto im gleißenden Licht der tiefstehenden Sonne nicht auf die Kreuzung lenken sollen?
»Solche Dinge liegen nicht in unserer Hand. Und sich im Nachhinein selbst dafür zu bestrafen, was andere getan haben, ist nicht nur müßig, sondern führt zu nichts Gutem. Irgendwann ist es Zeit, nicht noch mehr Schlechtes in die Welt zu tragen, nur weil man in der Vergangenheit festhängt.« Edgar war, als spräche er zu sich selber.
Johann Veit nickte. »Aber es ist so schwer. Und alle gucken mich so an. Dabei kann ich mich nit erinnern, nur glaubt mir das keiner.«
»Doch. Ich glaube Ihnen das. Und wenn Sie möchten, begleite ich Sie dorthin, wo Sie Ihre Erinnerung wiederfinden können.«
»Und wo soll das sein?«
»Na, zum Beispiel dort, wo Sie Ihren Vater zuletzt getroffen haben.«
»Ich weiß ja noch nit mal, wo das war.«
Edgar hob seine Tasche und berührte Veit am Arm. »Aber ich kenne jemanden, der das wissen müsste. Haben Sie ein wenig Vertrauen.«
Edgar spannte den Schirm auf und ließ Veit vor der Mühle stehen. Er kämpfte mit dem Impuls, auf schnellstem Wege in seine Praxis zurückzukehren. Stattdessen tat er etwas, womit er sich selber überraschte: Er marschierte rüber zum »Brauborn«.
Reinhold Noll stand hinter der Theke, erkannte ihn, stutzte und schaute demonstrativ weg. »Den nassen Schirm russ!«
Gut, dachte Edgar, dann eben auf die unhöfliche Art. Er musste sich über den Trotz wundern, der von irgendwo aus der Tiefe seiner Eingeweide aufstieg. Er war nicht gekommen, um den Duckmäuser zu geben, und er würde nicht gehen ohne eine Lösung für sein Problem.
Er verließ den Gastraum und stand im Flur. Er spannte den Schirm auf und platzierte ihn vor dem Aufgang zu den Fremdenzimmern. Sicher würde er niemanden behindern, es parkten kaum Autos vor dem »Brauborn«. In diesen verregneten Ostertagen gab es wohl nur wenige Besucher.
Vor der Tür zur Gaststube atmete Edgar tief durch, trat ein, hängte den Mantel an die Garderobe und stellte die Tasche darunter ab.