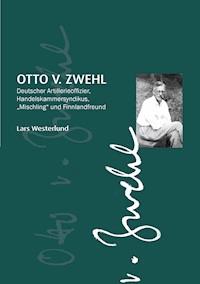
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Aue-säätiön julkaisuja / Skrifter utgivna av Aue-Stiftelsen / Veröffentlichungen der Aue-Stiftung
- Sprache: Deutsch
Otto v. Zwehl war einer der 15 Deutschen, die in Distanz zum Hitler-Stalin-Pakt im sowjetisch-finnischen Winterkrieg 1939/40 freiwillig auf der Seite Finnlands kämpften. 1918 war er mit den deutschen Interventionstruppen ins Land gekommen, hatte dort eine Familie gegründet und seit 1924 für die Deutsch-finnische Handelskammer gearbeitet. Deutschland aber bestrafte den „Verräter“ nicht, sondern setzte ihn im Fortsetzungskrieg (1941-1944) als Verbindungsoffizier ein. Er konnte nach dem Krieg nach Schweden gelangen und wurde 1953 deutscher Handelsattaché in Finnland. Otto v.Zwehls Persönlichkeit vereinigt viele Facetten –ein Mann der Zivilgesellschaft, aber Offizier in zwei Weltkriegen; zeitlebens deutscher Patriot, aber auch ein konsequenter Freund Finnlands. Von Hitler-Deutschland als „Vierteljude“ diskriminiert, vertrat er doch dessen Interessen, versuchte aber, radikalen Positionen die Spitze zu nehmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Übersetzung aus dem Schwedischen:
Helene Nygard und Robert Schweitzer
Aue-Stiftung
Helsinki 2016
Inhalt
Vorwort
Redaktionelle Vorbemerkung
Finnlandkämpfer 1918
Die Niederschlagung der bayerischen Arbeiterrepublik im Frühling 1919
Sozialwissenschaftliche Studien in Deutschland 1919–1921
Familiengründung und Wohnungen in Finnland 1921
Otto v. Zwehls neue Familie.
Das Sanmarksche Haus am Bulevardi (Bulevarden)
Die Villa in Kuusisaari (Granö)
Auf den Gutshöfen Hakunila (Håkansböle) und Tjusterby
Feriendomizile auf Kuusisaari (Granö) in der Bucht von Pernaja (Pernå)
Freizeitinteressen
Anstellung bei einer Bank und dem Deutschen Handelskammerverein in Finnland 1924–27
Beim Deutschen Handelskammerverein 1924–27
Übersetzung von „Finlands politiska historia“
Die „Deutsche Gefahr“ in den 1920er Jahren
An der Spitze der Deutschen Handelskammer in Finnland 1927–1939
Syndikus
Vertreter des Deutschen Nachrichtenbüros und weitere PR-Arbeit für Deutschland
Finnlands Repräsentant bei der Nordischen Verbindungsstelle
Deutscher „Sportdiplomat“ und Olympia-Attaché 1939
Eildienst-Mann und bezahlter Handelsattaché der Deutschen Botschaft 1939
Ein „Mädchen für Alles“
Das Archiv der Handelskammer
Das Büro der Handelskammer
Otto v. Zwehls Einkommen
Otto v. Zwehl als Vereinsmitglied
Finnisch-Deutsche Gesellschaft – Suomalais-Saksalainen Seura
Deutscher Schulverein
Deutsche Kolonie
Rotary Club Helsinki
Otto v. Zwehl am Schnittpunkt zwischen Deutschtum, Schwedentum, Finnentum, britischem Einfluss und Nationalsozialismus
Die Reibungen zwischen der finnischen und der schwedischen Sprachgruppe
Wirken gegen den britischen Einfluss
Kampf gegen Auswüchse nationalsozialistischer Propagandavorstöße
Die beschwerliche Stellung als „Mischling“
Die Großmutter als Belastung
Aktionen gegen v. Zwehl
Keine Sanktionen im Hinblick auf v. Zwehls Abstammung durch die Pressebehörden
Verweigerung der Annahme zum Dienst in der Wehrmacht
Otto v. Zwehls Verhältnis zur NSDAP
Als reichsdeutscher Freiwilliger im Winterkrieg 1940
Otto v. Zwehls Kündigung beim DNB im Dezember 1939
Eintritt in die finnische Armee
Ausbildungsdienst in Kruunupyy (Kronoby)
An der Front bei Summa
Der Eindruck eines Untergebenen Otto v. Zwehls
Das britische Flugblatt über München
Evakuierung der Familie nach Schweden
Finnische Staatsbürgerschaft und Ausbürgerung aus Deutschland
Ein Beispiel von Anständigkeit – v. d. Goltz‘ Meldung als Finnlandfreiwilliger
Otto v. Zwehls Isolierung
Finnischer Bürooffizier mit Sonderstatus
Der Umschwung und der deutsche Transitverkehr im Herbst 1940
Der nicht verwirklichte Plan für einen Nachrichtenauftrag in Washington
Die Villa auf Kuusisaari als Ort der sog. Januarverlobung 1940
Als finnischer Freiwilliger in der deutschen Armee 1941–1944
Rehabilitierung durch die Deutschen
Verbindungsoffizier der Abwehr bei der Einheit Korück 525
Evakuierung nach Deutschland im Herbst 1944
Flüchtlingsasyl in Schweden 1944–49
Der Entschluss, in Schweden zu bleiben
Hausmeister und Hühnerhofarbeiter
Attaché bei der Deutschen Handelsvertretung in Finnland
Rückkehr nach Finnland
Die sowjetische Forderung auf Überlassung des Eigentums der Familie v. Zwehl
Chef der Handelsabteilung an der Deutschen Handelsvertretung
Tod und Nachleben
Literatur über Otto v. Zwehl und seine Erinnerungen
Otto v. Zwehl (1894–1960) – sein Wirken und seine Bedeutung
Ausbau von Institutionen und Schaffung eines deutsch-schwedisch-finnischen Netzwerkes
Vermittler der Finnlandpolitik des nationalsozialistischen deutschen Regimes
Die Deutschen in Finnland: Lauer Nonkonformismus, aber keine aktive Opposition
Otto v. Zwehls Zenit 1940–41
Zweifel innerhalb der Wehrmacht
Von der Kriegsillusion zur Angst
Unauffälligkeit
Anhang 1.
Otto v. Zwehls deutsche Zeit und sein familiärer Hintergrund in München
Otto v. Zwehls Kindheit und Jugend
Militärische Ausbildung und Teilnahme am Weltkrieg an West-, Süd- und Ostfront 1914–1917
Militärische Auszeichnungen
Anhang 2.
Beate Sophie Sanmarks familiärer Hintergrund und der Gutshof Håkansböle
Der Gutshof Håkansböle
Die Geschwister
Quellen
Archivalien
Sonstiges ungedrucktes Material
Literatur
Zeitungsartikel
Ortsregister
Personenregister
Nachwort
Vorwort
Otto v. Zwehl (1894–1960) kam im Frühjahr 1918 als 24-jähriger deutscher Artillerieleutnant nach Helsinki (Helsingfors). Er gründete hier eine Familie und wirkte im Zeitraum 1924–1940 als Direktor der Deutschen Handelskammer in Finnland. Obgleich er das deutsche Regime auch nach 1933 unterstützte, strebte er danach, die nationalsozialistische Finnlandpolitik zu mäßigen und sie den besonderen finnischen Verhältnissen anzupassen. Otto v. Zwehls einigermaßen unkonformistisches Handeln zielte dahin, die deutschen Vorstöße für die Bürger Finnlands sowohl besser akzeptabel zu machen als auch deren Wirkung zu erhöhen.
Nach Ausbruch des Winterkrieges schloss er sich als Freiwilliger der finnischen Armee an und diente mit seiner Batterie an der Front bei Summa. Er war einer der nur 15 freiwilligen Reichsdeutschen im Winterkrieg und zog sich dadurch die äußerste Unzufriedenheit des deutschen Regimes zu. Nach dem Winterkrieg wurde er finnischer Staatsbürger. Vor Ausbruch des Fortsetzungskrieges nahm ihn die deutsche Regierung in Gnaden wieder auf. Er erhielt ohne eigenes Ansuchen die deutsche Staatsbürgerschaft zurück und wurde als finnischer freiwilliger Verbindungsoffizier im Stab des Kommandanten des rückwärtigen Armeegebiets (Korück 525) des Armeeoberkommandos (AOK) 20 (20. Gebirgsarmee), eingesetzt. Ab 1943 diente er in der Abwehr. Wie die meisten deutschen Militärpersonen in Südfinnland wurde er im September 1944 nach Deutschland evakuiert, erhielt jedoch in Schweden Aufenthaltsbewilligung. Er wohnte mit seiner Familie einige Jahre in der Gegend von Vallentuna und kehrte 1949 nach Helsinki zurück. Bei Gründung der westdeutschen Handelsvertretung wurde Otto v. Zwehl 1953 Handelsattaché. Er starb 1960.
Da Otto v. Zwehl seine Erinnerungen aufgeschrieben hat, sind große Teile seines Lebens dokumentiert. Diese Studie zeichnet seinen Lebenslauf nach und analysiert seine Rolle und Bedeutung in Finnland. Sie beleuchtet sowohl seine öffentliche Stellung als auch seine Familienverhältnisse. Otto v. Zwehl ist auch aus dem Grund von besonderem Interesse, dass er ein sog. „Mischling“, in seinem Fall ein Vierteljude, war, etwas, das während der nazistischen Vorstöße in den 1930er Jahren seine Stellung sehr erschwerte und einen wichtigen Hintergrund für sein Handeln im Winterkrieg bildet. Nachdem er damals auf eine unkonventionelle Weise handelte, wurde er in den Jahren 1940–41 innerhalb der tonangebenden deutschen Kreise in Finnland als jemand betrachtet, der die Sache des Dritten Reichs verraten hatte. Von den Bürgern Finnlands wurde er dagegen sehr geschätzt, wie insgeheim auch von einem Großteil der Finnlanddeutschen.
Redaktionelle Vorbemerkung
Orts- und Ländernamen sind in der finnischen Form wiedergegeben; die schwedische wird bei der jeweils ersten Erwähnung innerhalb eines Absatzes in Klammern nachgestellt. (Die schwedische Entsprechung zu Helsinki wird nur einmal angegeben, der Name des Gutes Håkansböle nur schwedisch.) Gibt es auch einen deutschen Ortsnamen, wird dieser durchgängig verwendet; finnische und schwedische Form stehen bei der ersten Erwähnung in Klammern. Bezeichnungen für allgemein bekannte geographische Begriffe außerhalb Finnlands stehen nur in deutscher Sprache; andernfalls folgt auf die deutsche und / oder finnische Bezeichnung (wenn vh.) die Benennung in der heutigen Staatssprache.
Personennamen sind bei der ersten Erwähnung in einem Oberabschnitt kursiv gesetzt.
Literaturangaben in Fußnoten werden nur mit Verfassernamen oder Kurztitel gemäß Literaturverzeichnis bezeichnet. Die Bezeichnungen von Archiveinheiten stehen in der im betreffenden Archiv üblicherweise verwendeten Sprache und werden nur bei der ersten Erwähnung übersetzt; beschreibende Archivalienbezeichnungen stehen auf Deutsch.
Folgende Abkürzungen werden durchgängig verwendet; andere sind in ihrem jeweiligen Zusammenhang aufgelöst:
KA= Kansallisarkisto
Finnlandkämpfer 1918
Otto v. Zwehl kam mit der deutschen Ostsee-Division, die mit dem Schiffstransport am 3.4.1918 Hanko (Hangö) anlief, nach Finnland. Am nächsten Tag, dem 4.4.1918, ging v. Zwehls Batterie als Teil des Vortrupps von Karabiniers, der entlang der Eisenbahn gegen Helsinki vorrückte, an Land. Die Division war mit einer schlagkräftigen Artillerie ausgestattet. Diese bestand aus 8 Batterien mit 34 Geschützen, 48 Offizieren, 1720 Unteroffizieren und Soldaten und 1470 Pferden. Ca. tausend Pferde wurden von der Bayerischen Gebirgsartillerie verwendet.1
v. Zwehls Batterie ging zwei Mal in Stellung, zuerst bei Karjaa (Karis) und dann bei Leppävaara (Alberga). Nach der Einschätzung von Otto v. Zwehl war die Wirkung des Feuers effektiv. Gut in Helsinki angekommen, ging eine Batterie beim Nationalmuseum in Stellung und beschoss aus kurzem Abstand die Turku (Åbo)-Kaserne, wo heute der Glaspalast steht. Otto v. Zwehls Batterie ging am 13.4.1918 bei der Zuckerfabrik Töölö (Tölö), in der Nähe der heutigen Nationaloper, gegen die Lange Brücke (Pitkäsilta / Långa bron) an der Töölö-Bucht, in Stellung. Sie beschoss das Haus des Helsinkier Arbeitervereins auf Siltasaari (Broholmen) aus 900m Entfernung. Es genügten nur 3 Granaten, um einen Brand auszulösen, der von der Feuerwehr rasch gelöscht wurde.2 Im A-Saal des Hauses befanden sich 200–300 Männer, die die Rote Garde zur Teilnahme gezwungen hatte und die sich nur widerwillig fügten. Obwohl die Granaten durch die Fenster einschlugen, wurde niemand verletzt, da die Männer rasch hinter der Fensterwand Schutz suchten.3 Die Batterie schoss auch die Spirituosenfabrik Maexmontan gleich südlich der Langen Brücke in Brand4, aber davon erwähnt Otto v. Zwehl nichts.
Bei der Eroberung der Langen Brücke, des Schwedischen Theaters und des Schwedischen Reallyzeums in der Elisabethstraße (Liisankatu /Elisabetsgatan) verwendete der deutsche Befehlshaber gut an die 200 gefangene Rote als menschliche Schutzschilde.5 Die Menschenverluste der Roten Garde in Helsinki und der nächsten Umgebung vom 12.-13.4.1918 wurden mit ca. 400 geschätzt, wogegen die Zahl der gefallenen deutschen Soldaten 58 betrug. Die Hauptursache für die fünffachen Verluste der Roten im Verhältnis zu denen der deutschen Armee war das Fehlen von kampferfahrenen Truppen. Die rote Führung war deshalb genötigt, unerfahrene und ältere Männer einzusetzen; ein Drittel der getöteten Rotgardisten bestand aus 40–70jährigen. Im Mai 1918 erreichte die Anzahl roter Gefangener in Suomenlinna (Sveaborg), Santahamina (Sandhamn) und Helsinki ca. 8000.6 Mindestens 1500 davon starben oder wurden später hingerichtet.7
360 deutsche Soldaten, die an den Kämpfen in Finnland im Frühjahr 1918 teilnahmen, fielen. Wenn davon ausgegangen wird, dass der Anteil der gefallenen Rotgardisten, die auf deutsche Truppen stießen, das Vierfache betrug, würde dies bedeuten, dass ca. 1500 Rotgardisten fielen. Da die totalen Kriegsverluste an Gefallenen der Roten Garde ca. 5700 Mann betrugen, scheint es, dass ein Viertel im Kampf mit Deutschen gefallen ist.8
Als die deutschen Truppen im April 1918 ihren Feldzug im finnischen Krieg antraten und nach einem neuntägigen Marsch Helsinki einnahmen, wankten bereits sämtliche Fronten der Roten unter der weißen Übermacht. Die Möglichkeiten der Roten Garde, auch noch die vorwärtsdrängenden deutschen Angriffsspitzen zu bekämpfen, waren deshalb gering, und sie erlitt aus diesem Grund eine totale Niederlage. Auch wenn der deutsche Einsatz für den Ausgang des Krieges eine große Rolle spielte, war er in militärischer Hinsicht nicht besonders bemerkenswert, da er sich gegen einen bereits unter Druck stehenden, im Rückzug befindlichen Gegner richtete.
Zeichnung einer deutschen Gebirgsartillerietruppe bei Grejus in Haaga / Haga auf dem Weg nach Helsinki / Helsingfors. Sie wurde von Alexander Federley angefertigt und lässt mit ihren weichen Konturen, der anheimelnden Farbgebung und dem romantisierenden Stil an Carl Larssons Gemälde mit kleinbürglich-intro-vertierten Idyllen denken. Sie illustriert die begeisterte Einstellung des schwedischsprachigen Establishments in Helsinki zur deutschen militärischen Intervention 1918.
Mit der Einnahme von Helsinki war die Teilnahme von Otto v. Zwehl an den aktiven Kriegshandlungen vorüber, da er den Befehl erhielt, einen neuen Artillerieverband, bestehend aus finnischen Freiwilligen und russischen Geschützen, aufzustellen. Deshalb verbrachte er die Zeit bis zum Jahresende bei Perkjärvi auf der Karelischen Landenge und in Lappeenranta (Villmanstrand). Als der Batteriechef, Oberstleutnant Ludwig Greim aus München am 28.4.1918 in Syrjäntaka fiel, wurde v. Zwehl zu dessen Nachfolger bei der Bayerischen Gebirgskanonenbatterie 12 ernannt. Ende Dezember 1918 kehrte die Ostsee-Division mit Pferden, Geschützen und Ausrüstung auf dem Frachtdampfer Worms nach Deutschland zurück. Aufgrund einer Havarie musste der Dampfer nach Karlskrona bugsiert werden, jedoch ertranken alle Pferde, als sich das Schiff mit Wasser füllte.9
1 Butz 1938, 222–227.
2 v. Zwehl: Erinnerungen 1940, 6.
3 Hoppu 2013, 319–320.
4 Ibid. 242.
5 Ibid. 195–196, 248–254, 316–317.
6 Ibid. 385.
7 Mäkelä / Saukkonen / Westerlund 2004, 117.
8 Roselius 2004, 167–176; Roselius 2006.
9 v. Zwehl: Erinnerungen 1940, 6.
Die Niederschlagung der bayerischen Arbeiterrepublik im Frühling 1919
Nach der Ankunft in Oberbayern in Deutschland zu Beginn des Jahres 1919 wurde die Mannschaft in die Heimat entlassen, v. Zwehl verblieb jedoch im Dienst. Eine Arbeiterrevolution hatte stattgefunden, und ein Arbeiterrat hatte im März, April und Mai 1919 in München die Macht inne. In dieser Zeit schloss sich v. Zwehl dem Freikorps Probstmayer unter Major Theodor Probstmayer in Ulm an. Er kommandierte zuerst eine Artillerieabteilung, bestehend aus Offizieren, und war später als Abteilungsordonanzoffizier in Augsburg und München. Die Einnahme dieser Städte und Abrechnung mit den Spartakisten bezeichnete v. Zwehl als blutiger als im Falle von Helsinki.10 Eine besonders große Rolle spielte das Freikorps Epp unter Oberst Ritter v. Epp, in dessen Reihen sich auch der damalige Hauptmann Eduard Dietl befand, der von 1942–1944 als Kommandeur des AOK 20 in Finnland wirkte.11
Ein Freikorps zieht im April 1919 nach München durch den Stadtteil Schwabing ein, in dem die Familie v. Zwehl wohnte.
Otto v. Zwehl nennt keine Details der Niederschlagung der Arbeiteraufstände in Finnland oder Deutschland, aber wahrscheinlich erlebte er zumindest die Folgen der Erschießungen aus der Nähe. Nachdem das Freikorps Probstmayer in den Übersichten über die Niederschlagung der Räteherrschaft in München jedoch nicht einmal erwähnt wird, kann man annehmen, dass dessen Einsatz recht gering war.
Gemäß einer vorsichtigen Berechnung wurden während der Niederschlagung der Arbeiterregierung in München im Frühling 1919 insgesamt 68 Angehörige der Freikorps und 1000 – 1200 Rote getötet. Die meisten der Letztgenannten wurden in den Straßen erschossen, während eine Anzahl von ca. 10 – 30 durch Standgerichte gefällten Todesurteilen hingerichtet wurden.12 In seinen Erinnerungen erwähnt v. Zwehl kurz, wie er Rote in Helsinki und Spartakisten in Deutschland bekämpft hat und beide Gruppen „aufrichtig hasste“. Offensichtlich ist auch, dass es eine direkte Verbindung zwischen dem intensiven Freikorpsgeist in München und der starken Durchschlagskraft der nationalsozialistischen Bewegung in der Region gibt.13 Unter den Gegnern, die vom roten Regime in München gefangen genommen wurden, befanden sich Rudolf Hess und Adolf Hitler, und einige Jahre später fand gerade dort am 8./9.11.1923 der sog. Bürgerbräu-Putsch statt.
Freikorpsleute mit einem Transport gefangener Spartakisten 1919.
10 Ibid. 7.
11 Oertzen 1936, 425; Jones 1987, 139–145; Heinemann 1995, 99.
12 Waite 1952, 90; Jones 1987, 144.
13 Oertzen 1936, 352–353.
Sozialwissenschaftliche Studien in Deutschland 1919–1921
Otto v. Zwehl hatte bereits nach seiner Rückkehr nach Deutschland Anfang 1919 ein sozialwissenschaftliches Studium aufgenommen und legte im Frühjahr 1921 sein doctor rerum politicarum-Examen an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg ab. Eine höhere Meinung über sein Examen hatte er jedoch nicht; er erzählte nämlich, dass er sein „inhalts- und wertloses“ Examen im Galopp abgelegt hat.14 In seinen Erinnerungen erwähnt v. Zwehl nicht einmal seine Abhandlung über das sozialpolitische Thema „Das Münchener Wohnungsamt in seinen Maßnahmen zur Bekämpfung der Wohnungsnot“.15 Die 116 Seiten lange Abhandlung wurde nicht gedruckt, sondern in Maschinenschrift vorgelegt. Nach der Geringschätzung seiner Dissertation durch v. Zwehl kann man annehmen, dass die Abhandlung nicht gut bewertet wurde; vielleicht waren seine akademischen Leistungen von der Art, dass er sich nicht mit Stolz daran erinnerte.
Sein älterer Bruder Hans Karl v. Zwehl (1884–1966) war ebenfalls Berufsoffizier und Forscher. Dieser veröffentlichte u.a. den Artikel „Der Dolchstoß in den Rücken des siegreichen Heeres“ in der Weihnachtsausgabe 1921 der Konservativen Monatsschrift.16 v. Zwehls Bruder war somit ein Anhänger der sog. Dolchstoßlegende, nach der die Novemberrevolution und die Sozialdemokraten in Berlin 1918 die Fortsetzung des Kampfes der unbesiegten Feldarmee sabotierten. Hitler war völlig überzeugt von der Dolchstoßlegende, die ein wichtiges agitatorisches Element in der populären Anziehungskraft des Nationalsozialismus wurde. Später, 1937, doktorierte Hans Karl mit einem militärpolitischen Thema mit Anknüpfung an die Napoleonischen Kriege, „Der Kampf um Bayern 1805. Der Abschluss der bayerischfranzösischen Allianz“.17
14 v. Zwehl: Erinnerungen 1940, 7.
15 v. Zwehl 1921.
16 Ibid.
17 v. Zwehl 1937.
Familiengründung und Wohnungen in Finnland 1921
Otto v. Zwehls neue Familie. Als v. Zwehl im April 1918 in Hanko (Hangö) eintraf, wurde seiner Batterie der Student Carl Sanmark (1894–1938) aus Helsinki, der auch als Amanuensis der Universitätsbibliothek tätig war, als Dolmetscher zugeteilt. Dieser war Jägeranwerber und hatte auch dem sog. Pellingekorps angehört, das im März 1918 die Ostsee über das Eis nach Estland überquerte und mit der Ostsee-Division über Danzig nach Finnland zurückkehrte.18 Er wohnte in dem Eigentumswohnungskomplex „Orion“, Bulevardi 13, auch Sanmarksches Haus genannt, das 1910 erbaut wurde.19 Otto v. Zwehl traf dort die Schwester seines Dolmetschers, Beate Sophie Sanmark (1897–1979) und die beiden fanden Gefallen aneinander. Am 7.1.1921 fand die Hochzeit statt, wonach in den 1920er Jahren 3 Töchter geboren wurden: Maria 1922, Helene 1924 und Beata 1927. Die Kosenamen der beiden letztgenannten waren „Lene“ und „Klein-Beati“.
Otto v. Zwehl und Beate Sophie Sanmark verlobten sich 1921 im Hofgarten in München, wo diese Aufnahme entstand.
Das Sanmarksche Haus am Bulevardi (Bulevarden). Beate Sophie erbte vermutlich mehrere Wohnungen im Haus „Orion“, die vermietet wurden und bedeutende Mieteinkünfte einbrachten. Die Familie v. Zwehl wohnte in einer großen Wohnung mit vielleicht zehn Zimmern, außer Schlafzimmer und Küche je ein Salon, Speisezimmer, Herrenzimmer und Dienstbotenzimmer. Am Bulevardi wohnte vor allem die sog. bessere Gesellschaft in schönen und technisch verhältnismäßig gut ausgestatteten Wohnungen in einer Gegend mit vielen Fachgeschäften und Dienstleistungen. Eine geschichtliche Übersicht der Häuser von Orion stand nicht zur Verfügung, aber im Nachbarhaus, Bulevardi Nr. 11, das ebenfalls ein stilreines Jugendstilhaus war, gehörte 1930 ein Anteil von 26% der Bewohner der höchsten sozialen Schicht an, 24% der Mittelklasse, während 35% Bedienstete und 6% Arbeiter waren.20 Ungefähr gleich sah es vermutlich im Sanmarkschen Haus aus.
Der Student Carl Sanmark trat in das Pellinge-Korps ein und schloss sich der Ostsee-Division auf ihrer Überfahrt von Danzig nach Hanko / Hangö an. Er war damals Dolmetscher bei der Gebirgsartillerie und konnte v. Zwehl mit seiner jüngeren Schwester Beate-Sophie bekanntmachen. Diese Begegnung band v. Zwehl für sein ganzes Leben an Finnland.
Die Villa in Kuusisaari (Granö). Die Familie bewohnte Bulevardi Nr. 13, bis v. Zwehl 1934 eine „Wintervilla“ im deutsch inspirierten Stil in Kuusisaari (Granö) in der Gemeinde Huopalahti (Hoplax), ca. 7km westlich des Zentrums von Helsinki, als Familienwohnung errichten ließ. Das Grundstück, das von einzelnen Parzellen steuerpflichtigen Grundeigentums in Munkkiniemi (Munksnäs) abgetrennt worden war, wurde 1932 gemeinsam von Beate Sophie, ihrer Schwester Emelie v. Wachter und ihrem Bruder Carl für 325.000 Mark gekauft – eine Summe, die heute fast 120.000 € entspricht. Es bestand aus 3 Liegenschaften, Beateberg I.1, I.2 und II.21
Das Einfamilienhaus erwies sich jedoch hinsichtlich der Verkehrsanbindung als nicht sonderlich zweckentsprechend. Mit 3 Töchtern im Schulalter musste v. Zwehl an jedem Arbeitstag dreimal mit dem Auto von Kuusisaari ins Zentrum und zurück fahren, was Fahrten von insg. 50km bedeutete. Otto v. Zwehl fuhr einen deutschen Adler 21, einen modernen Kleinwagen mit Viertaktmotor. Die Familie entschied sich deshalb im Juni 1939 zur Rückkehr in die Wohnung am Bulevardi, vor allem, da die Ernennung von Otto v. Zwehl zum Olympiaattaché zukünftig eine leichtere Erreichbarkeit als bis dahin voraussetzte.22
Auf den Gutshöfen Hakunila (Håkansböle) und Tjusterby. Beate Sophies Eltern ließen 1906 in Helsingin pitäjä (Helsinge) ein neues Herrenhaus auf dem Hof Hakunila erbauen, das im Anhang 2 erläutert wird. Mütterlicherseits stammte ihre Mutter vom Gutshof Tjusterby in Pernaja (Pernå). Die Familie v. Zwehl konnte diese Gutshöfe als Feriendomizil gemeinsam mit Beate Sophies nahen Verwandten nutzen, und im Dezember 1939 diente Hakunila als Reservewohnung der Familie, da die Wohnung am Bulevardi aufgrund der Bombenschäden für einige Zeit unbewohnbar war.
Familienbild am Eingang zum Gut Håkansböle im Sommer 1920. v. Zwehl zu Pferde, Beate Sophie in Rückenansicht. Auf der Treppe stehen v. Zwehls Mutter Maria – damals auf Besuch in Finnland – und Emilia Sanmark, Beate Sophies Mutter. Håkansböle hatte eines der wenigen Jugendstilherrenhäuser in Finnland.
Feriendomizile auf Kuusisaari (Granö) in der Bucht von Pernaja (Pernå). Das Ferienhaus der Familie v. Zwehl lag auf Kuusisaari in den Schären vor Pernaja. Neben der Villa in Kuusisaari in Huopalahti (Hoplax), die v. Zwehls in den 30er Jahren bewohnten, besaßen sie somit auch ein Feriendomizil auf einer Insel in Pernaja, die den Namen Granö hatte. Das Ferienhaus konnte Beate Sofie aufgrund ihres Verwandtschaftsverhältnisses zu den Eigentümern des Gutshofs Tjusterby erwerben, der 11 Liegenschaften mit einem Gesamtareal von 1500 Hektar umfasste. Die große Verwandtschaft mit Verbindung zum Gutshof Tjusterby, seit 1913 „Aktiengesellschaft Gut Tjusterby“ begann gegen Ende des 19. Jh, sich Ferienhäuser anzuschaffen. Zu den ältesten von diesen gehörte ein großes, gediegenes, rot gestrichenes, einstöckiges Ferienhaus, welches der Gutsherr, Senator und Prokurator Richard de Chapelle, von den Einheimischen „Attu-Pelle“ genannt, errichten ließ. Von der Zeit um die Jahrhundertwende an wurde das Haus von der Familie Sanmark benutzt. Das Gebäude befindet sich ca. 1km vom Gutshof Tjusterby entfernt und wurde wohl ungefähr zur gleichen Zeit gebaut wie der neue Ziegelbau des Hauptgebäudes des Gutshofs Tjusterby 1864–67.23 Das Ferienhaus grenzte an einen der Kleinpachthöfe des Gutes, der 1796 gegründet wurde. In v. Zwehls Zeit bewirtschaftete den seinerzeitigen Häuslerhof das ortsansässige Original Granö-Kalle, Karl Henriksson (1877–1958), den man manchmal auf dem Steg von „Sveelen“ beim Fischen sah.24 In der Nachkriegszeit wurde das Ferienhaus gemeinsam von der Familie v. Zwehl und Marias beiden Schwestern mit Familien genutzt. In den 1970er Jahren ließ Maria v. Zwehl ein kleineres Ferienhaus in der Nähe bauen. Dieses wird „Majas“ nach Maria genannt. Beide Häuser werden heutzutage von den Enkelkindern als Feriendomizil genutzt.
Freizeitinteressen





























