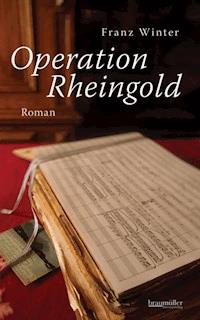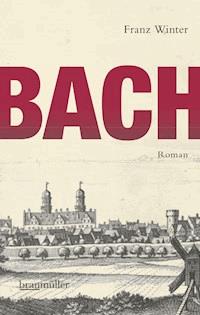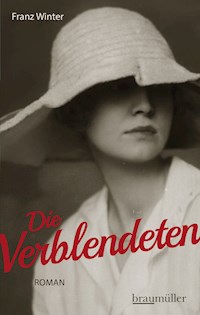16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1882, der Parsifal ist in Bayreuth uraufgeführt: Mitte September übersiedelt der fast 70-jährige Richard Wagner mit seiner Familie nach Venedig, in den Palazzo Vendramin am Canal Grande. Es sollen seine letzten Lebensmonate werden, am 13. Februar 1883 stirbt Wagner nach einem heftigen Streit mit Cosima an einer Herzattacke. Seine letzten notierten Worte sind: "Liebe - Tragik ..." Von diesem Streit an Wagners Todestag wissen wir nur durch seine geliebte erstgeborene Tochter Isolde. Anlass der Auseinandersetzung: die 23-jährige Sopranistin Caroline Mary "Carrie" Pringle, Wagners letzte Liebe, das "Blumenmädchen" aus dem Bayreuther Uraufführungs-Parsifal. Auf Bitten des Meisters hin kommt sie nach Venedig, um ihn heimlich zu treffen, sodass die letzte Lebenszeit des Komponisten auch zu einem typisch venezianischen Versteck- und Maskenspiel gerät. Franz Winters Novelle Palazzo Vendramin folgt den Spuren von Wagners Doppelleben in den letzten Wochen seines Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Franz Winter
Palazzo Vendramin
Richard Wagner – Abschied in Venedig
Novelle
F R A N Z W I N T E R
Palazzo Vendramin
Richard Wagner –Abschied in Venedig
Novelle
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind imInternet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2013
© 2013 by Braumüller GmbH
Servitengasse 5, A-1090 Wien
www.braumueller.at
Coverbild: grafissimo / istockphoto (Quelle: Unser Jahrhundert)ISBN der Printausgabe: 978-3-99200-091-3
ISBN E-Book: 978-3-99200-092-0
Moni gewidmet
Nachdem ich das unsichtbare Orchester geschaffen, möchte ich auch das unsichtbare Theater erfinden!
RICHARD WAGNER
1.
„Blau! Der Salon ist ganz in dieses Königsblau gekleidet, das Schlafzimmer wird ein Traum aus diesem Purpurgold! Die Wände, die Vorhänge, die Sitzmöbel, alles! – So übersetzen Sie doch schon, Joukowsky, worauf warten Sie?“, herrschte Wagner seinen ihm seit zwei Jahren unentbehrlichen Maler und Bühnenbildner des Parsifal an, strich über die devot präsentierten Stoffbahnen der Manufaktur Rubelli und entfernte sich ungeduldig in eines der gotischen Spitzbogenfenster im dritten Stockwerk des Hotel de l’Europe, um seinen Blick von der im Spiel der Winde auf ihrem goldenen Erdball tanzenden Schicksalsgöttin der Dogana zum rosenfarben aufleuchtenden Muschelpalast der Salute-Kirche wandern zu lassen.
„Aber das bedeutet eine Unterbrechung unseres Hotelbetriebs für mindestens drei, wenn nicht vier Wochen, und nicht nur dieser Suite, sondern auch aller um diese Suite gelegenen Zimmer!“, wandte der aufs Äußerste angespannte, kleine, permanent seinen schwarz gefärbten Schnurrbart mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger bürstende Hotelmanager ein. „Und wer, wenn ich mir die Frage erlauben darf, wird für diese Kosten, für diese Unkosten, um das wohl richtigere Wort zu gebrauchen, aufkommen? Der Maestro? Die Festspiele von Bayreuth? – Verstehen Sie mich bitte um Gottes willen nicht falsch: Unser Haus fühlt sich geehrt, dass der weltberühmte Maestro eine Suite nach seinen Vorstellungen gestalten und dann auch bewohnen will, aber die Finanzierung einer solchen Unternehmung bedarf wohl der Erwähnung und Fixierung genauerer Details, schon deshalb, um den Maestro vor den trostlosen Niederungen alltäglicher, profaner Geschäfte zu bewahren! – Sie verstehen doch, mein bester, mein verehrter Signor von Joukowsky! Und sowohl meine Wenigkeit als auch unser ganzes Haus ist Ihnen für Ihre selbstlose Verhandlungsführung mehr als dankbar, ja, wir wären untröstlich, würde sie nicht statthaben!“
Wagner schien die aufgeregte Rede hinter sich überhaupt nicht zu bemerken, er war ins Schlafzimmer gewechselt, nachdem er Paul von Joukowsky „Und einen Stutzflügel in den Salon!“ zugeraunt hatte.
„Selbstverständlich ist Bayreuth bereit, die Hälfte der Kosten für die Umgestaltung der Räume zu tragen“, begann Joukowsky seine Verhandlung in tadellosem Italienisch mit einem leicht rollenden russischen Akzent, „einschließlich der vom Meister gewünschten Materialien der von ihm überaus geschätzten venezianischen Firma Rubelli, ebenso die gesamte Miete der Zimmer vom Zeitpunkt ihrer Fertigstellung an. Die Zahlungsanweisungen werden von mir übernommen werden, der ich auch nominell als Mieter in Ihrer Buchhaltung aufscheinen werde. Der Meister wünscht die äußerste Diskretion, zum einen für sich, zum anderen für seinen Gast, der dieses Appartement nach seiner Fertigstellung bewohnen wird, so lange, bis der Meister Venedig wieder verlassen wird, von welchem Zeitpunkt an es in den Besitz des Hotel de l’Europe zurückfallen wird, bis der Meister etwa gedenkt, es erneut zu seiner Verfügung zu haben, denn der Meister schätzt, wie Sie vielleicht bemerkt haben werden, Ihre Stadt ungemein und plant, sich ihr in der Zukunft weitaus inniger zu verbinden, als ihm dies bisher aufgrund seiner wahren Titanenunternehmungen möglich gewesen ist.“
„Sie haben Klingsors Zaubergarten und die Gralsburg erfunden, Joukowsky, da wird es doch im Bereich Ihrer Fähigkeiten liegen, zwei Hotelzimmer in Venedig so zu gestalten, dass es mir möglich ist, diese auch aufzusuchen!“ Wagner hatte sich seinen grafitgrauen Kaschmirpaletot übergeworfen, „Ich erwarte Sie unten bei der Gondel!“, und verließ, begleitet von zahllosen Bücklingen des Hotelmanagers und der beiden Stoffhändler, das Zimmer.
Er hatte also beschlossen, zu bleiben. Vielmehr, „es“ hatte beschlossen, dass er bleibe. Es! Das Leben? Gar nichts war beschlossen worden, nicht von ihm, nicht von Cosima, seiner Frau, er war einfach da, wieder da, wie so oft in seinem Leben, und konnte nicht mehr weg. Dabei schien es ihm, als wolle er nicht mehr weg. „Wollen“, „Können“ – die Begriffe hatten sich aufgelöst in der samtenen Salzluft der Lagune, Tag um Tag, Nacht für Nacht waren sie weniger spürbar geworden, bis sie verschwunden waren wie die Gespenster eines Wachtraums.
Also bleiben. Bleiben, bis sich etwas Neues zeigte, für das es sich lohnte, aufzubrechen, zu gehen. Aufzu-brechen … Was lohnte es schon, es aufzubrechen? Bleiben, bis ihm die Fortuna dort drüben ihren Schleier zuwerfen würde, den er auffinge, wenn ihn der Schirokko über den Mündungstrichter des Kanals zu ihm wehte? Ein Griff in die Luft und das Schicksalsgewebe war wieder in seiner Hand. Wie die Tarnkappe des Alberich? Keine Tarnkappen mehr! Und der Sommer war noch fern, so fern! Und der zweite Parsifal war weit, so weit weg wie Bayreuth von Venedig. Bayreuth! Über allen Gipfeln ist Ruh’, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch … Und doch umtobten jetzt wohl Schneestürme das leere Geistertheater, sein leeres Geistertheater, Winterstürme …
Aber die Ruhe über den Gipfeln wird von keinem Sturm gestört, kaum ein Hauch, keine Winterstürme reichen dorthin. Er begann, den Vers des Verehrten zu begreifen; seit er in Venedig war, begann er, ihn zu verstehen, be-greifen konnte er ihn ja nicht, so wenig wie irgendetwas von dem, was ihm hier widerfuhr.
Wo Joukowsky bleibt, dachte er und ließ sich in die schwarzen Samtpolster der Gondel sinken. Er bedeutete dem Gondoliere mit einer kreisenden Handbewegung, ein wenig vor dem Hotel zu verweilen, in Erwartung des zweiten Passagiers, „In previsione di un secondo passeggero!“, was der Ruderer mit einem ehrerbietigen „Con piacere, maestro! È’ il mio grande onore, credete mi per favore!“ quittierte, indem er den kreisrunden Basthut mit großer Geste über seine Herzgegend führte.
Also doch eine Tarnkappe, dachte Wagner, zumindest eine Maske, eine Maskierung!, denn er wollte nicht auf Schritt und Tritt erkannt werden, wenn er das Hotel de l’Europe aufsuchte, um ihr in den neu gestalteten Räumen zu begegnen, ihr, diesem dreiundzwanzigjährigen Mädchen, einem Blumenmädchen aus dem Parsifal, das ihn so sehr an die junge Cosima erinnerte: schmal, fast knabenhaft schlank, offenen Gesichts; unsentimental und mutig, wie sie sich Levi auf den Proben widersetzt hatte, natürlich gestützt von seinem Wohlwollen, aber dennoch, mutig, kühn; und ihr Körper, so jung, so zart, so stark! Er hatte sie bei einer Kostümprobe nackt gesehen, war auf sie zugegangen und hatte sie umarmt, hatte diesen wunderbar jungen Frauenkörper an sich gedrückt und gespürt. Er hatte die Kraft und die Macht des Körpers einer jungen Frau, fast noch eines Mädchens, gefühlt, und in diesem Augenblick war ihm klar geworden, dass er das geworden war, was man „alt“ nennt. Er hatte ihre Jugend und ihr aufblühendes Leben gespürt und plötzlich gewusst, dass er nicht mehr Teil dessen war, dass jegliches Begehren hinter jener Schranke zurückbleiben musste, für die es nur ein Wort gab: das Alter. Noch niemals hatte er das so empfunden wie in diesem Moment, als er diesen reinen, jungen, nackten Frauenkörper in seinen Armen halten durfte; und er wusste, dass er fortan und für immer zu den anderen gehörte, zu jenen, von denen das Leben Abschied nimmt. Als er sich lösen wollte, hatte sie ihn gehalten, fest gehalten, hatte ihn angenommen in seinem Alter, hatte ihm, unendlich zart und bestimmt, bedeutet, dass sie bei ihm bleiben wolle, um ihm den Abschied leicht zu machen. „Diese Dinge haben mit Zeit und Raum nichts zu schaffen“, hatte sie halblaut, aber sehr bestimmt geflüstert, ehe sie sich Joukowsky zuwandte, der ihr ein Trikot entgegenstreckte, das mit blassblauen seidenen Blumengirlanden drapiert war.
Soeben hatte er also veranlasst, dass im Hotel für sie eine kleine Suite nach seinen Vorstellungen ausgestaltet und eingerichtet werden sollte, gewebte Samtstoffe mit den wunderbarsten Ornamenten hatten es zu sein! Er musste lächeln bei dem Gedanken, dass er noch immer nicht frei davon war, sich mit kostbaren Stoffen zu umgeben, seine Behausungen damit auszukleiden, um darin arbeiten zu können, Schutz zu suchen in warmen, beruhigenden Räumen, Höhlen, während der Zeiten der endlosen Tage und Nächte des Dichtens, des Erfindens von Musik, des Schreibens von Noten. Schutz zu suchen wie in einem Schoß?
Waggonweise waren die kostbaren Stoffballen von Judith Gautier aus Paris nach Bayreuth in die Villa Wahnfried geschickt worden, dorthin, wo sein Wähnen Frieden finden sollte, sein Wahn, sein Wahnsinn. Wahn, Wahn, überall Wahn, hatte er in den Meistersingern gedichtet. Judith Gautier, die letzte Liebe seines Lebens. Gott, wie hatte er diese sinnliche, blühende, junge, mondäne Frau aus Paris begehrt, damals in dem Probenchaos vor der ersten Aufführung des gesamten Rings im gerade fertig werdenden, noch mörtelfeuchten Festspielhaus auf dem Hügel. Ihr taubengurrendes Lachen, ihre Bewunderung, ihr Verstehen, ihr tiefes Erkennen dessen, was er geschaffen hatte! Und sie erkannten einander und waren einander Weib und Mann. Er musste an diese Stelle im Alten Testament denken. Ein Blitz hatte die Schöpfung erhellt. Unter der Obhut Cosimas noch einmal dieses Feuer, das ihn am Leben erhielt während einer Zeit, in der er das Menschenunmögliche zu leisten hatte. – Wie leicht es ihm damals fiel, sie zu küssen! Ihre Küsse! Ihr volles Haar auf den runden, alabasterfarbenen Schultern, wie es um ihre zitternde Brust floss, wie das Kleid von ihren weichen Hüften glitt. Winterstürme wichen dem Wonnemond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz …, übte irgendwo in einem Probenzimmer der Sänger des Siegmund – glücklicherweise weit genug entfernt. Die letzte Liebe seines Lebens! Judith war damals sechsundzwanzig, er dreiundsechzig. Damals wusste er noch nichts von letzter Liebe, heute, mit fast siebzig, wusste er es. Es war ihm, als wüsste er so viel mehr als vorher, vor diesem September des Jahres 1882, als er mit Sack und Pack, mit seiner ganzen Familie samt Hauslehrer, mit dem Pianisten Joseph Rubinstein, dem Malerfreund Paul von Joukowsky, dem Diener Georg und dem Hausmädchen Betty, nach Venedig übersiedelt war, in den weißen Seitenflügel des Palazzo Vendramin-Calergi, den er sich zusammen mit Cosima im April für die Zeit nach der Uraufführung des Parsifal ausersehen hatte, weil der Palast über eine der modernsten Heizungsanlagen Venedigs verfügte. Er wollte nicht frieren, er wollte nie mehr irgendwo frieren. Ließ er deshalb jeden seiner Wohnorte mit kostbaren Stoffen auskleiden, so wie auch jetzt die achtzehn gemieteten Zimmer im Palazzo Vendramin? Der alte Tapezierer aus dem Stadtteil Cannaregio arbeitete noch immer daran. In Venedig wollte er keinesfalls frieren, wo er schon damals, im Frühling vor dem Parsifal, länger zu bleiben gedachte, bis in den Winter hinein, über den Winter hinaus? – Wie lange, für wie lange?, hämmerte es in seinem Kopf, als er überrascht wahrnahm, dass sich Joukowsky, sichtlich erschöpft, ihm gegenüber niedergelassen hatte.
„Sie machen es, aber das Hotel will eine Anzahlung, die Hälfte der nicht unbeträchtlich geschätzten Kosten, ebenso die Firma Rubelli.“
„Sagen Sie ihm, er soll uns über den Rio di San Moisè und den Rio di San Luca zum Canal Grande fahren und von dort hinauf zum Vendramin.“
Joukowsky gab die Anweisung weiter, worauf der Gondoliere mit einem sonor verständigen „È’ il mio grande onore e un divertimento di scortare il maestro in sicurezza a casa sua!“ sein Schiff genau gegenüber der tanzenden Schicksalsgöttin in einen ruhigen Seitenkanal gleiten ließ, um die große Schleife des unteren Gran Canal zum Rialto hin abzuschneiden.
„Es ist ihm eine Große Ehre und ein Vergnügen, den Meister sicher zu seinem Haus zu geleiten.“
„Grazie tanto!“, erwiderte Wagner. „Kommen Sie mit hinauf, Joukowsky, ich werde Ihnen noch heute die Schecks ausstellen, außerdem brauchen wir Sie dringend zum abendlichen Whist!“
„È’ il mio sempre una grande onore e un divertimento, verehrter Meister!“, gab Paul von Joukowsky lächelnd mit einer angedeuteten Verbeugung seines Oberkörpers zurück.
„Wann werden die Zimmer bezugsfertig sein?“