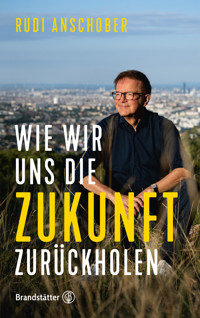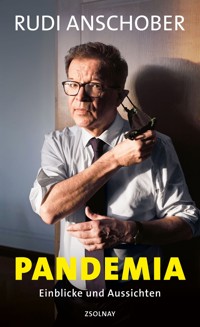
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die erste Innenansicht eines europäischen Gesundheitsministers in der Pandemie: Rudi Anschober schildert die Herausforderungen des Ausnahmezustandes unter Corona.
Der Ausbruch der Corona-Pandemie steht für den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Weltweit erkranken und sterben Millionen Menschen, ein Ende ist trotz Impfungen nicht abzusehen. Jetzt berichtet erstmals ein verantwortlicher Politiker aus dem Maschinenraum der Macht. Begeisterte Zustimmung von der einen, leidenschaftliche Kritik von der anderen Seite – als frisch angelobter grüner Gesundheitsminister Österreichs stand Rudi Anschober vor einer der größten Krisen des 21. Jahrhunderts.
Nun, einige Monate nach seinem aus Gesundheitsgründen erfolgten Rücktritt, schildert Anschober am Beispiel von fünf Personen – einer Intensivmedizinerin, einer Forschungskoordinatorin, einer Long-CovidPatientin, einer alleinerziehenden Buchhändlerin und eines Ministers –, die beispiellosen Herausforderungen durch die Pandemie. Die Innenansicht eines Ausnahmezustandes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Die erste Innenansicht eines europäischen Gesundheitsministers in der Pandemie: Rudi Anschober schildert die Herausforderungen des Ausnahmezustandes unter Corona.Der Ausbruch der Corona-Pandemie steht für den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Weltweit erkranken und sterben Millionen Menschen, ein Ende ist trotz Impfungen nicht abzusehen. Jetzt berichtet erstmals ein verantwortlicher Politiker aus dem Maschinenraum der Macht. Begeisterte Zustimmung von der einen, leidenschaftliche Kritik von der anderen Seite — als frisch angelobter grüner Gesundheitsminister Österreichs stand Rudi Anschober vor einer der größten Krisen des 21. Jahrhunderts.Nun, einige Monate nach seinem aus Gesundheitsgründen erfolgten Rücktritt, schildert Anschober am Beispiel von fünf Personen — einer Intensivmedizinerin, einer Forschungskoordinatorin, einer Long-CovidPatientin, einer alleinerziehenden Buchhändlerin und eines Ministers —, die beispiellosen Herausforderungen durch die Pandemie. Die Innenansicht eines Ausnahmezustandes.
Rudi Anschober
Pandemia
Einblicke und Aussichten
Paul Zsolnay Verlag
Vorbemerkung
Am 7. Jänner 2020 wurde ich zum Minister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz der Republik Österreich angelobt. Wenige Wochen später brach eine globale Krise aus, die von Fachleuten als die schwerste seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet wird. Covid-19 begann die Welt und Europa mit unglaublicher Wucht zu überrollen und bestimmt seither unser aller Leben. Hunderte Millionen Menschen wurden von dem neuartigen Virus infiziert, Millionen sind daran gestorben, Abermillionen leiden unter den Langzeitfolgen. Zur Eindämmung der Pandemie mussten Schutzmaßnahmen ergriffen werden, die in einer Demokratie zuvor in vielerlei Hinsicht absolut undenkbar gewesen wären: Lockdown, Ausgangsbeschränkungen, Impf- und Maskenpflicht …
Wir haben in dieser Zeit Hoffnung und Enttäuschung erlebt, Fehler gemacht und daraus gelernt. Die Wissenschaft musste Rückschläge hinnehmen und konnte bahnbrechende Erfolge feiern. Viele Bürgerinnen und Bürger haben großartiges Engagement an den Tag gelegt und Solidarität bewiesen, andere haben sich verzweifelt zurückgezogen oder sind in Zonen radikaler Irrationalität abgetaucht.
Pandemia ist die Summe meiner subjektiven Erfahrungen mit der Pandemie: eigene Erlebnisse, Geschichten von und über Betroffene sowie Sachinformationen, die ich in den vergangenen zwei Jahren gesammelt habe und hier auf mehreren Ebenen aufarbeite.
Da sind zunächst einmal die »Berichte aus dem Maschinenraum«: Sie beschreiben, chronologisch gereiht, wie Politik und Politiker in Österreich seit dem Ausbruch von Covid-19 Entscheidungen vorbereitet und getroffen haben und was abseits der medialen Berichterstattung hinter den Kulissen passiert ist.
Dazu kommen die Lebenswege von drei fiktiven Figuren, die ich aus Dutzenden Gesprächen mit Personen in Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammengefasst habe: Eine Oberärztin, eine Forscherin und eine Buchhändlerin führen durch ihre Arbeit und ihren Alltag während der Pandemie.
Die Schilderungen von Erkrankten und Hinterbliebenen, die anonymisiert zu Wort kommen, sollen über die fast zur Routine gewordenen, täglichen Statistiken hinaus spürbar machen, wie dramatisch und brutal das Virus das Leben vieler Menschen individuell verändert hat.
Schließlich beschäftigt sich das Buch ausführlich mit den Ursachen für die Pandemie und den Gründen, warum die Welt so schlecht auf das Virus vorbereitet war; mit dem Zusammenhang zwischen Pandemie und Klimawandel; mit der Frage, warum weltumspannende Krisen unser Denken und unsere Politik überfordern und wie wir dies ändern können.
Pandemia macht sichtbar, wie sich die Gesellschaft durch die Krise verändern wird und was wir daraus machen können. Und schließlich formuliere ich eine Strategie, wie wir diese Pandemie und jene, die in Zukunft auf uns zukommen, kontrollieren können.
Pandemia ist keine Abrechnung, sondern Beginn einer Aufarbeitung, die mir selbst gutgetan hat, die wir aber auch als Gesellschaft benötigen; ein Impuls für Veränderung, damit wir hinkünftig vorbereitet sind auf ähnliche Herausforderungen und Fehler nicht wiederholen.
Es ist da
10. März 2020
Andrea
Das ist keine Grippe
Nur ganz langsam kommt sie aus dem Tiefschlaf zu sich. Sie kann sich nicht sofort orientieren. Was ist mit mir? Der Kopf, die Füße, überall Schmerzen. Ein stechender Schmerz in der Brust. Sie öffnet die Augen. Dunkelheit. Langsam dreht sie den Kopf nach links zum Wecker: kurz nach vier Uhr. Jede Bewegung tut weh und strengt sie an.
Langsam erinnert sie sich, dass sie am Abend mit einem leichten Unwohlsein zu Bett gegangen ist. Es fröstelte sie wie vor einer sich anbahnenden Erkältung. Nichts Ungewöhnliches, ein Zustand wie schon oft zuvor. Sie hat sich früher hingelegt — mit einer Wärmflasche auf dem Bauch war sie rasch eingeschlafen. Morgen würde alles wieder gut sein. Wie so oft.
Langsam beginnt sie sich im Bett aufzurichten. Der Schmerz in der Brust ist stärker geworden. Als ob etwas Schweres auf ihrem Brustkorb liegen würde. Sie sinkt wieder zurück in den verschwitzten Polster, spürt den Pyjama auf der Haut kleben. Sie fröstelt, sie zittert.
Was ist los mit mir?
Und dann kommt der Husten, ein trockener, anstrengender Husten. Beim zweiten Versuch gelingt es ihr aufzustehen. Ein paar Schritte ins Wohnzimmer, die Schachtel mit den Medikamenten aus dem Kasten gezogen, das Fieberthermometer gesucht und gefunden.
Schweißnass vor Erschöpfung schleppt sie sich wieder ins Bett. Nach wenigen Augenblicken piepst das Fieberthermometer: knapp über 39 Grad. Für Andrea, die seit Jahren an leichter Untertemperatur leidet, ein Schock.
Wirre Gedanken gehen ihr durch den Kopf. Sie erinnert sich an die Fernsehbilder der Corona-Krise in Italien: überfüllte Intensivstationen in den Spitälern der Lombardei, Menschen hinter Schutzkleidung, Leichensäcke, abgesperrte Städte, eine Kolonne von Militärfahrzeugen, die anrückt und die Toten aus Bergamo abtransportiert. Die Medien berichten fast ohne Unterbrechung, die Leute sprechen nur mehr darüber.
Angst ist in ihr, Angst hält sie wach. Erst Stunden später, als es längst Tag ist, schläft sie ein. Nach dem Aufwachen ist ihr Zustand nicht besser. Sie erinnert sich an die Aufforderung, im Fall eines Verdachts auf Covid-19 bei der medizinischen Hotline anzurufen. Sie wählt die Nummer. Immer wieder. Stundenlang. Besetzt. Keine Chance durchzukommen. Dann erreicht sie endlich ihre Hausärztin. Sie erzählt von ihren Symptomen.
Andrea, warst du in Italien oder in Asien?
Nein, schon lange nicht mehr.
Dann mach dir keine Sorgen, ich glaube nicht, dass es Covid ist. Ruh dich aus, trink viel Salbeitee, Grippemedikamente hast du ja.
Aber was ist dann los? Sie fühlt sich elend. Als Sportlerin hat sie immer auf ihren Körper geachtet, war selten krank und wenn, dann niemals schwer. So vergehen die nächsten zwei Tage: Sie schluckt Hausmittel, schläft, trinkt Tee, schläft …
Drei Tage lang versucht sie bei der medizinischen Hotline jemanden zu erreichen. Dazwischen hört sie Radio, sieht fern: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht inzwischen von einer Pandemie, Todesfälle werden auch aus den Nachbarländern Italiens gemeldet, Reisewarnungen ausgesprochen, erste Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bürger erlassen. Zehntausende registrierte Infektionen in ganz Europa. Und das dürfte erst der Beginn sein.
Irgendwann wird sie dann doch zu einem Mitarbeiter der Hotline durchgestellt und kann ihm ihre Symptome schildern. Auch der vermutet letztlich Grippe. Doch damit will sie sich nicht abfinden, es ist etwas anderes, sie weiß es. Und ruft immer wieder an, in der Hoffnung, einen anderen Mitarbeiter zugeteilt zu bekommen. Viele Stunden lang, bis man ihr zusagt, einen Sanitäter für einen Covid-Test zu schicken. Endlich.
Während sie wartet, sitzt sie an ihrem Küchentisch, trinkt weiter Salbeitee. Er schmeckt anders, milder, eigentlich schmeckt er nach gar nichts mehr. Später an diesem Tag kommen zwei freundliche Sanitäter in Andreas Wohnung. Sie nehmen sich Zeit, fragen nach den Symptomen, ob sie in einer Risikoregion gewesen sei. Obwohl Andrea laut sämtlichen Berichten inzwischen selbst in einer Risikoregion lebt. Aber sie fühlt sich ernst genommen, fasst Vertrauen.
Das wird jetzt ein bisschen unangenehm, sagen die Sanitäter, aber langsam kriegen wir Übung. Sie nehmen einen Abstrich aus Rachen und Nase und kündigen das Ergebnis der Auswertung für die nächsten Tage an. Zehntausende wollen jetzt getestet werden, darauf sei man nicht vorbereitet. Wir werden überrollt. Es fehlt an Test-Kits, an Schutzmasken, an Laborkapazität. Aber wir geben alle unser Bestes. Den schwersten Job hätten die Telefonistinnen und Telefonisten an der Hotline. Bis vor kurzem gab es nur ein paar hundert Anrufe in der Woche. Jetzt sind es Zehntausende pro Tag.
Sie ist so erleichtert, dass sie getestet wird und sich endlich jemand um sie kümmert, dass ihr die Tränen in die Augen schießen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass es euch gibt. Und dann legt sie sich wieder hin, schläft.
Die nächsten Tage vergehen wie hinter einem Schleier: dahindämmern, Pressekonferenzen der Regierung im Fernsehen, schlafen, Telefonate mit ihrer Ärztin und mit Freunden, wieder wegdämmern. Hoffen, dass rasch ein Testergebnis kommt. Hoffen auf Klarheit. Denn eine Grippe ist das mit Sicherheit nicht.
Zwölf Tage nach den ersten Symptomen, zwölf Tage voller Angst und Schmerz, dann läutet endlich das Telefon: Covid-19-positiv, verpflichtende Quarantäne, teilt ihr die Amtsärztin selbst mit, sie ist zwar gestresst, aber freundlich.
Andrea ist beinahe erleichtert und hat zugleich Angst. Erleichtert, weil endlich Klarheit gegeben ist. Aber die Angst ist nicht weg, weil sie weiß, dass das Virus tödlich sein kann. Wieder schläft sie, jetzt aber anders, tiefer und ruhiger. Dann, in einer dieser kaum mehr unterscheidbaren Nächte, schreckt sie auf. Der Druck auf ihre Brust ist stärker geworden. Es ist, als würde ein Elefant auf ihr sitzen. Sie gerät in Panik, ruft den Ärztenotdienst. Als der Arzt die Wohnung betritt, trägt er einen Schutzanzug, Schutzschuhe, eine Schutzhaube, eine Schutzbrille. Immerhin sieht Andrea seine Augen hinter den Gläsern. Er stellt die ihr schon bekannten Fragen, prüft den Blutdruck (viel zu niedrig), die Sauerstoffsättigung des Blutes (viel zu gering), gibt ihr ein Schmerzmittel und bietet ihr an, sie ins Krankenhaus einzuliefern. Andrea lehnt ab. Wenn ich sterben muss, dann zuhause, denkt sie. Ich höre täglich, wie überfüllt die Spitäler sind. Ich will niemandem das Bett wegnehmen, der es womöglich dringender braucht, sagt sie.
Schlafen. Dahindämmern. Schlafen. Kein Fernsehen mehr, zu anstrengend.
So ziehen sich die Tage dahin, aber dann geht es ihr langsam besser. Tee, Schmerzmittel, Telefonate mit Freunden, darunter zwei Ärztinnen, Informationssuche auf Twitter, wieder Pressekonferenzen der Regierung im Fernsehen. Jemand scheint sich um das alles zu kümmern.
Andrea fühlt sich zwar weiterhin sehr krank, aber der unerträgliche Druck auf der Brust nimmt ab. Nach vier Wochen ist sie erstmals fieberfrei. Ein Glücksgefühl stellt sich ein: Sie ist nicht auf der Intensivstation gelandet, sie hat überlebt.
Voller Freude macht sie sich auf den Weg zum Supermarkt um die Ecke. Es ist warm, fast Frühling. Endlich unabhängig von der Lebensmittelzustellung, endlich wieder unter Menschen! Jede einzelne der Verkäuferinnen hätte sie gerne umarmt … die Heldinnen dieser Zeit. Doch die Euphorie verfliegt rasch. Der Rückweg erscheint ihr endlos, erschöpft lässt sie sich auf das senfgelbe Sofa in ihrem Wohnzimmer fallen und fällt in einen tiefen Schlaf — in Jeansjacke, Jogginghose und mit den Sneakers an ihren Füßen.
Ein Monat ist seit dem Beginn ihrer Infektion vergangen, aber vorbei ist sie nicht. Andrea spürt, dass es erst der Anfang ist.
6. März 2020
Bericht aus dem Maschinenraum
Vor zwei Monaten habe ich das Ministeramt übernommen. Die ersten Wochen haben gut funktioniert. Ich habe mein Ministerium, viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt und mit voller Kraft die Arbeit an vielen großen Reformen von der Armut bis zu den Pensionen, vom Tierschutz bis zum wichtigsten Thema, der Pflegereform, gestartet. Eine alternde Bevölkerung, wenig attraktive Ausbildungsformen, eine enorme Arbeitsbelastung, schlechte Bezahlung und vieles mehr haben dafür gesorgt, dass Österreich bis 2030 hunderttausend zusätzliche Mitarbeiterinnen braucht. Schon jetzt stehen ganze Abteilungen leer, weil Personal fehlt. In Deutschland und in der Schweiz ist die Lage ähnlich. Aber mit jeder Arbeitswoche wird dieses Thema stärker durch ein anderes verdrängt, das sich seit dem Jahreswechsel bedrohlich entwickelt.
Heute reise ich zu meiner zweiten EU-Gesundheitsministerkonferenz nach Brüssel, zum Außerordentlichen Rat EPSCO/Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit, Verbraucherschutz — eine Sonderkonferenz, die einberufen wurde, weil die Welt immer stärker in den Bann der Infektionskrankheit Covid-19 gerät. Der Tag beginnt mit starkem Sturm und schweren Regenschauern, meine Mitarbeiter und ich kämpfen uns durch Wind und Wetter zum Europa-Gebäude. Gleich hinter dem Eingang ein kurzer Doorstep vor der internationalen Presse. Allgemeine Fragen, ich versuche den Ernst der Lage anhand der Infektionszahlen in Österreich und Europa darzustellen, verweise auf exponentielle Zuwächse, appelliere an die notwendige Solidarität und die Vorsicht der Bevölkerung und umarme rhetorisch das so schwer getroffene Italien. Der Sitzungssaal muss aufgrund eines Covid-Falles kurzfristig verlegt werde. Ich nutze die Zeit, bis wir beginnen können, zum Kennenlernen der Kolleginnen und Kollegen und zu Gesprächen mit den Ressortkollegen aus Italien, Frankreich und Tschechien sowie mit dem Vorsitzenden Vili BeroŠ, dem kroatischen Gesundheitsminister.
Dann geht es los, in der Runde jeweils ein Minister samt einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin. Botschafter Gregor Schusterschitz an meiner Seite begleitet mich ruhig und kompetent durch die Sitzung. Die eher kalmierenden Einleitungsstatements überraschen mich. Vorsitzender BeroŠ verweist darauf, dass die Europäische Gesundheitskontrollbehörde (ECDC) die Infektionsgefahr in Europa von mittel auf mittel bis hoch angehoben hat. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hält sich sehr allgemein. Krisenkommissar Janez Lenarčič informiert über die Einsetzung eines Coronavirus-Response-Teams durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in dem fünf Kommissionsmitglieder eng zusammenarbeiten sollen. ECDC erstattet Bericht über die aktuelle epidemiologische Lage. Weltweit wurden bereits 98.000 Fälle gemeldet, darunter 3400 mit tödlichem Ausgang. In den vergangenen Tagen hat sich die Zahl der Infektionen verhundertfacht, von einem weiteren schnellen Anstieg ist auszugehen.
Der Europa-Chef der WHO, Hans Kluge, scheint bei seinem Statement zu versuchen, Panik zu vermeiden. Aber was er sagt, ist höchst besorgniserregend: Die Fallzahlen außerhalb Chinas übersteigen mittlerweile jene in China selbst, genannt werden der Iran, Südkorea, Japan und Taiwan.
Dann sind die Ministerinnen und Minister der Mitgliedsstaaten an der Reihe. Ich lege Zahlen über das rasche Wachstum der Infektionszahlen vor: Vor 14 Tagen gab es vierzig Fälle in der gesamten EU, heute wurden allein in Österreich 47 Neuinfektionen registriert. Neben einer engen europäischen Zusammenarbeit fordere ich Solidarität mit Italien und ein rasches gemeinsames Beschaffungsprogramm für Schutzkleidung. In einer Sitzungspause spreche ich beim deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn dagegen an, dass Deutschland ein Exportverbot für Schutzkleidung verhängt hat — auch nach Österreich. Am Grenzübergang Suben zwischen Bayern und Oberösterreich werden ganze Lkw-Ladungen mit bereits bezahlten Schutzmasken festgehalten, das ist unerträglich.
Spahn sagt zu, das zu besprechen; ich ersuche telefonisch zusätzlich Bundeskanzler Sebastian Kurz, bei Angela Merkel zu intervenieren. Wir benötigen mehr Schutzkleidung, dringend! Die Dinge kommen in Bewegung, es gelingt uns nach einigen Tagen, die Blockade aufzuheben.
Nach der großen Runde der Ministerinnen und Minister folgen mehrere Vieraugengespräche, unter anderem mit Krisenkommissar Lenarčič. Er lässt dabei kaum Zweifel daran, dass er Schlimmes befürchtet. Wir sprechen über mögliche Entwicklungen und Maßnahmen in den kommenden Wochen. Lenarčič ist kompetent und konkret. Wir wollen eng zusammenarbeiten.
Am Flughafen Schwechat begegne ich bei der Rückkehr zufällig Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Wir sprechen über Berichte, nach denen sich isländische Skitouristen in Ischgl mit Covid-19 infiziert hätten. Platter sagt, es gebe konkrete Hinweise dafür, dass die Ansteckungen nicht in Tirol, sondern erst auf dem Rückflug nach Island erfolgt seien.
14. März 2020
Bericht aus dem Maschinenraum
Der Tag der großen Entscheidung. Ein besonders wichtiger in meinem politischen Leben, aber auch eine Zäsur in der Geschichte der Zweiten Republik.
Wie eine Riesenwelle rollt die Pandemie nun seit wenigen Wochen über ganz Europa. Immer schneller, immer höher, immer gewaltiger. Tote in Altenheimen, Tote in Krankenhäusern — Gesundheitskrise in weiten Teilen Europas. Jetzt muss rasch und konsequent gehandelt werden. Wie weit soll, wie weit kann man dabei gehen? Das ist für mich die Schlüsselfrage.
Seit einem Sondertreffen Anfang Februar beraten sich die EU-Gesundheitsminister regelmäßig. Anfangs herrschte noch vorsichtige Zuversicht, dass Europa wie bei vielen Ausbrüchen der vergangenen Jahre auch von diesem neuartigen Virus weitgehend verschont bleiben würde, obwohl die WHO bereits warnte.
Das Gegenteil ist eingetreten. Zuerst hat es Italien erwischt, dann Frankreich, bald den ganzen Kontinent. Tag für Tag wurde die Entwicklung dramatischer, Sonderministertreffen und EU-Ratssitzungen folgen.
Jetzt rächt es sich, dass die EU keine oder kaum Kompetenzen in Gesundheitsfragen hat: Sie taumelt unvorbereitet und eingeschränkt handlungsfähig in die Krise. Das spürt man an der Unsicherheit, Nervosität und Sorge, die allgegenwärtig sind. Was intern mit schonungsloser Offenheit ausgesprochen wird, gerät gegenüber der Öffentlichkeit zum Balanceakt: ehrlich warnen und trotzdem Ruhe ausstrahlen, um Panik zu vermeiden.
Zwischen den Treffen telefoniere ich immer wieder mit Kollegen anderer EU-Staaten. Kein Nationalstaat ist gut vorbereitet — wir alle suchen nach den richtigen Antworten und schauen stark nach Südostasien, der Region mit den meisten Erfahrungen mit Epidemien. Unbestritten ist, dass direkte soziale Kontakte verringert und Ansteckungsketten durchbrochen werden müssen, um es dem Virus möglichst schwer zu machen, sich auszubreiten. Also keine Veranstaltungen mehr, schon gar keine Großevents.
Die Szenarien der Prognosen verändern sich beinahe täglich. Aus einer Epidemie in der chinesischen Provinz Hubei ist eine Pandemie geworden, wie sie die Menschheit seit einem Jahrhundert nicht gesehen hat. Darüber sind sich die Experten einig. Über die Dauer der Katastrophe und die Details der notwendigen Schutzmaßnahmen sind sie das derzeit nicht. Schleichend ist die Pandemie in den vergangenen Wochen in alle Kontinente gekommen und hat sich vor allem dort ausgebreitet, wo sich viele Menschen näherkommen — ohne Schutzmaßnahmen, weil sie nicht ahnen, dass die Gefahr bereits mitten unter ihnen ist.
Jetzt stehe ich als verantwortlicher Minister vor einer Frage, die sich in der demokratischen Geschichte meines Landes noch nie gestellt hat: Müssen wir zum Schutz der Bevölkerung so tief in ihre Grundrechte eingreifen, wie das in einer Demokratie bisher undenkbar war? Verhängen wir einen Lockdown mit Ausgangssperren über das Land?
Ich denke zurück an die Zeit, in der ich nicht einmal geahnt habe, dass es diese Frage überhaupt gibt — geschweige denn, dass ich es sein würde, der eine Antwort darauf finden muss. Eine Zeit, die erst wenige Wochen zuvor zu Ende gegangen ist und mir trotzdem scheint wie ferne Vergangenheit. Eine Zeit, in der das Virus still und unerkannt in Europa angekommen ist und sich dort rasend schnell verbreitet hat, wo es sich am wohlsten fühlt.
Das erste Jahr
20. Februar 2020
Karl
Ein Fußballfest
Karl, amico mio, schön, dich wiederzusehen. Bei jedem Besuch wirkst du ein Jahr jünger! Wie machst du das bloß? Das Match gestern war fantastisch!
Ciao, Antonio, danke noch einmal für die Karte, du bist ein Schatz! 4:1, was für ein Spektakel! Darauf stoßen wir jetzt an!
Karl Grieblinger liebt Italien seit seiner Kindheit, als er mit seinen Eltern zum ersten Mal in einer Pizzeria gegessen und am Strand von Lignano Sandburgen gebaut hat. Seit vierzig Jahren hält diese Zuneigung schon an und bestimmt gewissermaßen seinen Jahresrhythmus.
Im Herbst eine Woche nach Sizilien, im Frühling ein paar Tage nach Mailand, wo er Stammgast in Antonios Altstadttrattoria ist. Die beiden sind Freunde geworden.
Zu den Fixpunkten der Mailand-Besuche gehört ein Match in »La Scala del calcio«, der Oper des Fußballs, dem Guiseppe-Meazza-Stadion, unter Fußballfans San Siro genannt. Ein Fußballtempel im gleichnamigen Stadtteil: Heimstätte von Inter Mailand und AC Milan, die das Stadion 1925 mit einem Stadtderby eröffneten. Austragungsort der Weltmeisterschaften 1934 und 1990 sowie der Europameisterschaft 1980. Italiens größtes Fußballstadion.
Als vor kurzem feststand, dass das Champions-League-Spiel von Atalanta Bergamo aufgrund von Sanierungsarbeiten im eigenen Stadion nicht in Bergamo, sondern im fünfzig Kilometer entfernten Mailand ausgetragen werden würde, handelte Antonio unverzüglich und kaufte für Karl eine Eintrittskarte. Die ganze Region Bergamo steht wegen des erstmaligen Einzugs in ein Achtelfinale der Champions League Kopf. Gegner des Außenseiters ist das traditionsreiche Team des FC Valencia: ein Hochamt in der Kathedrale des Fußballs.
Für Karl ist es eine mitreißende Nacht, er liebt die Stimmung, das Fest vor und nach dem Match, die Gesänge und Sprechchöre, die Freude und das Leid während des Spiels. Und er selbst ist Teil des Spektakels und der Emotionen, er gehört dazu. Schon früh am Nachmittag fährt er mit der überfüllten Linie U5 nach San Siro — scheinbar ist ganz Bergamo unterwegs nach Milano, um ihre DEA, so nennen sie ihr Team, das eine Göttin mit wallendem Haar im Wappen führt, zu unterstützen. Im Stadion herrscht eine überwältigende Atmosphäre. Konkurrenz ja, aber keine Aggressionen zwischen den Fans der beiden Teams. So geht schöner Fußball. Und dann 94 Minuten Tempo und ein toller Sieg am Schluss.
44.236 Besucher liegen sich in den Armen. Die Bilder der sportlichen Höhepunkte und der Verbrüderung mit den 2500 angereisten Valencia-Fans gehen um die Welt. Ebenso wie die Bilder Zehntausender, die das Spiel dichtgedrängt in den Bars von Bergamo verfolgen und ihre DEA bis in die Morgenstunden feiern. DEA, per sempre!
Madonna! Die Spanier waren gut, aber unser Atalanta ist eine Sensation. Eines der schönsten Spiele meines Lebens, sagt Karl zu Antonio, du hast mir eine große Freude gemacht mit der Karte.
Und jetzt macht dir mein Küchenchef auch noch eine Freude, antwortet Antonio. Ein kleines Risotto alla Milanese und dann Cassoeula. Passt das? Und dazu einen sehr schönen Rosso aus dem Chianti. Den habe ich selbst erst vergangenes Jahr bei einem kleinen Winzer in der Toskana entdeckt. Und dann noch ein Panettone mit einem Macchiato samt Grappa. Ohne diese Genüsse darfst du Milano nicht verlassen!
Am nächsten Vormittag macht sich Karl Grieblinger auf den Weg nachhause. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich bald, denkt er sich.
Während Karl auf dem Heimweg ist, treten in einzelnen Gemeinden Norditaliens Covid-19-Fälle auf, vor allem in der Lombardei und im Veneto. Zwei Tage später wird der erste Todesfall gemeldet — ein 78-jähriger Mann aus Padua stirbt an dem Virus, knapp zwei Monate, nachdem die ersten beiden Infektionen in Italien festgestellt worden waren.
Alles nur Verdacht, niemand wird den Beweis erbringen, wie die Ansteckungsketten verlaufen sind, aber die Region um Bergamo wird in diesen Tagen zu einem Zentrum der Pandemie. 103 Infektionen sind es Ende Februar, 623 eine Woche später, 7000 am 21. März in einer Stadt mit 120.000 Einwohnern. Später meinen Experten, das Spiel könnte partita zero, Spiel null, gewesen sein.1 In Valencia werden eine Woche danach ein Drittel der Mitarbeiter des Vereins positiv auf Covid getestet. Kurze Zeit später hat Italien erstmals mehr Tote zu beklagen als China zu Beginn der Pandemie.2
Das Neujahrfest in Wuhan, Sportevents in New York, Après-Ski in Ischgl, Wintersport in den Alpen, Karnevalsveranstaltungen in Deutschland, Clubs in Berlin, Champions League in Mailand.3 Manche Großereignisse wirken wie Brandbeschleuniger der Pandemie. Es ist klar, dass sich das Virus besonders dort wohlfühlt, wo viele Menschen ohne Schutzmaßnahmen zusammenkommen. Karl Grieblinger wird wenige Tage nach der Rückkehr aus Italien mit Covid-Symptomen in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert. Der Test ist positiv. Wochenlang kämpft er in der Intensivstation gegen den Tod, fast zwei Monate muss er in Behandlung bleiben, bevor er entlassen werden kann — und eine langwierige Reha antreten muss, um wieder auf die Beine zu kommen. In seiner Heimatstadt ist ein Cluster entstanden, der Dutzende Fälle mit mehreren Generationen von Infektionen umfasst. Binnen 24 Tagen hat sich das Virus durch offizielle und soziale Veranstaltungen in geschlossenen Räumen auch im Großraum der Stadt verbreitet.
Fahrlässigkeit ist niemandem vorzuwerfen: Zu Beginn der Pandemie weiß noch niemand, wie das Virus mit der Fachbezeichung SARS-CoV-2 funktioniert. Das Virus bahnt sich seinen Weg von Mensch zu Mensch, bis diese nach und nach lernen, sich zu schützen.
15. Februar 2020
Dieter
Langbroich ist nicht der Karneval von Venedig
Für Dieter Müller bedeutet die Kappensitzung in seinem Dorf jedes Jahr einen Höhepunkt. Beruflich ist er viel unterwegs, aber an diesen Tagen richtet er es sich so ein, dass er zuhause sein kann.
Langbroich im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, nahe der niederländischen Grenze: Das ist zwar nicht der Karneval von Venedig, aber das sind wir. Da arbeiten alle mit, da war ich immer dabei, und da werde ich immer dabei sein. Aus dem Dorf, für das Dorf. Freunde treffen, Bier trinken und ein paar Tage feiern. Der schönste Urlaub für mich.
Er findet statt in einer Mehrzweckhalle, ausgelassene Stimmung, dreihundert Teilnehmer. Und zumindest einer von ihnen, so stellte sich später heraus, ist infiziert.
Natürlich haben wir darüber gesprochen, Witzchen darüber gerissen. Covid-19 ist ja das große Thema in den Medien. Aber niemand ist auf die Idee gekommen, die Kappensitzung abzusagen. Wuhan? Unendlich weit weg! Außerdem passiert ja andauernd etwas in der weiten Welt, das dann doch an uns vorbeigeht.
Es ist wie immer: Stundenlang wird gefeiert, gesungen, geschrien, getrunken, an Tagen wie diesen ist alles erlaubt, jeder umarmt jeden. In der Folge tummeln sich die Leute dann auf den Karnevalsumzügen. Einige Teilnehmer der Kappensitzung spüren bereits Symptome, denken sich aber nicht viel dabei: Husten, Schnupfen, Fieber — für Februar nichts Ungewöhnliches.
Zwölf Tage nach der Kappensitzung gibt es zwanzig bestätigte Covid-19-Fälle im Landkreis Heinsberg. Die Tests finden mit Verzögerung statt, wie überall auf der Welt ist man auch hier nicht auf eine Pandemie vorbereitet. Außerdem halten viele ihre Kopfschmerzen für Folgen des Feierns. Und denken bei sich: Am Aschermittwoch ordentlich ausschlafen, dann bist du wieder okay — war ja immer so. Ist es diesmal aber nicht.
Zehn Tage später folgt die Bestätigung, dass Gäste der Kappensitzung infiziert sind, zwei von ihnen sind sogar schwer erkrankt.4 Über die Region werden Quarantänemaßnahmen verhängt. Studien belegen später, dass sich fünfmal mehr Teilnehmer angesteckt haben, als durch offizielle Testergebnisse nachgewiesen wurde.5
Nein, Langbroich im Kreis Heinsberg ist tatsächlich nicht Venedig. Während der berühmte Karneval in der italienischen Lagunenstadt nach frühen Infektionsfällen nicht auf die gewohnte Weise stattfindet, will man an vielen anderen Orten nicht auf den Karneval verzichten. Auch weil man nicht ahnt, wie weit das Virus bereits vorgedrungen ist.
28. Februar 2020
Rick
Ein Superspreader-Event
Rick ist glücklich mit seinem Job bei einem internationalen Konzern in der Gesundheitsbranche. Es gibt viel zu tun, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt, wo das Unternehmen mittlerweile tätig ist. Großartig, denkt er manchmal, einen Beitrag leisten zu können, schwere Erkrankungen der Menschheit zu lindern. Oft dauert die Forschungsarbeit Jahre und Jahrzehnte, immer wieder scheitert sie auch, aber manchmal gelingt ein Durchbruch, dann entsteht ein Präparat, das Menschen helfen kann, die andernfalls keine Chance hätten. Ja, er verdient sehr gut, und das ist auch wichtig für ihn. Aber die Sinnhaftigkeit seiner täglichen Arbeit steht eindeutig im Vordergrund, und er hat den Eindruck, bei seinen Kolleginnen und Kollegen ist das nicht anders.
Einmal im Jahr trifft Rick alle Führungskräfte des Unternehmens bei einer Konferenz, die diesmal in Boston stattfindet. Leadership Conference nennt sich das, 175 von ihnen sind diesmal angereist: Konzernentwicklung, Forschungsergebnisse, Kommunikation, Workshops — das betriebsame Hin und Her solcher Meetings in großen Hotels. Der persönliche Kontakt innerhalb einer solchen Gemeinschaft gehört natürlich dazu, vom Abendessen bis zum Fitnesscenter.
Ja, sie haben darüber diskutiert, ob es klug ist, in Corona-Zeiten ein solches Treffen abzuhalten. Aber bestätigte Fälle gibt es in den USA nur sehr wenige, noch ist kein einziger Todesfall gemeldet. Und wer kennt schon das Risiko? Einer von ihnen, einer von den 175 Teilnehmern, ist mit Covid-19 infiziert.
Nach ersten Symptomen Einzelner werden 108 Personen positiv getestet.6 Ein Jahr später wird das Wissenschaftsjournal Science eine Studie7 präsentieren, die annimmt, dass sich ein Ast des Virus von hier aus in 18 US-Staaten und bis nach Australien und Europa verbreitet und mit bis zu 330.000 Fällen in Verbindung stehen dürfte. Niemand ahnt es, niemand will es, niemand ist fahrlässig. Aber einzelne Veranstaltungen auf der ganzen Welt werden in diesen Wochen zur Virenschleuder.
14. März 2020
Marc
Wut im Elsass
Marc ist Pfleger. Er macht seine Arbeit aus Überzeugung. Inzwischen muss er für seine Berufung so viel opfern, dass sie für ihn und viele seiner Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen beinahe nicht mehr zu schaffen ist. Seit er sich erinnern kann, besteht die Arbeit aus viel zu vielen Überstunden und zu wenig Gehalt. Und so haben sich Marc und andere Pflegerinnen und Pfleger bereits vor mehr als einem Jahr, im Herbst 2018, den gilets jaunes angeschlossen, den Gelbwesten, obwohl sie mit den meisten Forderungen der Protestbewegung nicht übereinstimmen. Es ist ein Akt der Verzweiflung.
So kann es nicht weitergehen. Wir müssen unsere Probleme sichtbar machen, jetzt!
Es gelingt ihnen tatsächlich. Medien berichten darüber, dass die Zahl der Intensivbetten in Frankreich im internationalen Vergleich besonders gering ist: 11,7 für 100.000 Einwohner, weniger sogar als in Italien. In Deutschland sind es mehr als 29, also fast dreimal so viel.
Dieses System wird mit einer Krise rasch überfordert. In zahlreichen Sendungen werden die Sorgen des Pflegepersonals wieder und wieder benannt. Doch wie so oft verläuft sich auch diesmal der Protest, das Gesundheitssystem gerät aus dem Fokus der Medien.
Und dann ist sie da, die schwerste Pandemie seit Jahrzehnten. Erinnert er sich daran, mit welcher Wucht sie von ihr überrollt wurden, beginnt es in Marcs Innerem zu kochen.
Mediziner vermuten, dass es bereits Mitte November und im Dezember 2019 erste Covid-Fälle in der Region gab, die jedoch nicht als solche erkannt wurden. Zur Eskalation der Lage trug offenbar eine Kirchenveranstaltung in Mulhouse bei, an der vom 17. bis 21. Februar 2020 an die zweitausend Gläubige teilnahmen. Adresslisten der Anwesenden wurden nicht geführt.
Ende Februar geht es ganz schnell, erzählt Marc. Die Infektionszahlen schnellen nach oben. Die Pflegerinnen und Pfleger haben der Infektion wenig entgegenzusetzen: zu wenige Schutzmasken, zu wenige Handschuhe, zu wenige Beatmungsgeräte, zu wenig Desinfektionsmittel. Und zu wenige Intensivbetten. Hunderte Schwerkranke müssen nach Paris, in die Militärspitäler von Toulon und Marseille, ja nach Baden-Württemberg, in die Schweiz, nach Luxemburg und Österreich ausgeflogen werden.
Marc und seine Kollegenschaft sind nicht einmal zwei Jahre nach ihren Warnungen und Protesten aufs Neue in den Medien — diesmal nicht mehr damit, sondern mit Szenen, die an den Beginn einer Apokalypse erinnern. In den Intensivstationen ist sie bereits Wirklichkeit geworden.
Ja, wir funktionieren, wir arbeiten, auch Infizierte arbeiten, wir geben alles, aber ich habe keine Ahnung, wie lange wir den Notbetrieb aufrechterhalten können. Und morgen finden Gemeinderatswahlen statt, das könnte ein nächster Beschleuniger der Infektionswelle sein.8
15. März 2020
Agnes und Chiara
Das Virus findet seinen Weg
An diesem Tag, dem zweiten der Stille, treffen sie sich wieder. Agnes scheint schon zu warten, und Chiara lacht lauthals, als sie das große, leere Kaffeehaus betritt. Sie kennt Ischgl nur mit Massen von Touristen und gestressten Angestellten. Als Ballermann des Wintertourismus. Seit gestern ist hier alles anders: menschenleere Lokale und menschenleere Pisten, verunsichertes Hotel- und Liftpersonal — eine völlig unbekannte Atmosphäre von Ruhe und Frieden.
Zwei Tage zuvor hat eine Pressekonferenz der österreichischen Bundesregierung Ischgl leergefegt. Um 14 Uhr wurde angekündigt, dass tags darauf aufgrund der vielen Covid-Infektionen das gesamte Paznauntal unter Quarantäne gestellt wird. Minuten später verlassen viele Urlauber fluchtartig den Ort, der zum Covid-Hotspot geworden ist. Nur weg, lautet die Devise. Wer weiß, wie lange wir sonst möglicherweise hier festsitzen.
Die Einzigen, die noch hierherkommen wollen, sind Journalisten internationaler Medien.
Geblieben sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebe, unter Quarantäne gestellte Infizierte und natürlich die Einheimischen. In ein paar Wochen wird man bei mehr als vierzig Prozent von ihnen Antikörper gegen das Virus nachweisen, und das heißt: Sie sind oder waren irgendwann mit Covid infiziert.
Ciao Agnes, so trifft man sich wieder. Sind wir die Letzten in diesem Wahnsinn?
Die beiden lachen und umarmen sich. Und schrecken inmitten der Berührung fast gleichzeitig voreinander zurück.
Das Angebot an Mehlspeisen ist unverändert reichhaltig. Gestern schon war den beiden aufgefallen, dass sie — so unterschiedlich sie auch sind — zumindest bei Süßspeisen denselben Geschmack haben. Sie wählen heiße Schokolade und dazu einen Apfelstrudel. Oder zwei.
Gestern hatten sie einander ihre Lebensgeschichten erzählt: Agnes, ruhig, freundlich und hochkompetent, stammt aus Ungarn und ist ausgebildete Heilmasseurin mit Zusatzqualifikationen von Shiatsu bis Akupressur. Seit zwölf Jahren arbeitet die 42-Jährige auf Saison, im Winter verdient sie sich in den Skigebieten der Alpen ihr Geld — sieben Jahre davon in Ischgl, wo der Trubel immer größer wurde und der Rubel immer schneller rollte, wie man sagt. Ruhiger war es in der anderen Jahreshälfte im Salzkammergut: Massagen für meist ältere Semester auf Sommerfrische.
Ischgl und Bad Ischl: zwei völlig verschiedene Welten des Tourismus, etwas mehr als dreihundert Kilometer voneinander entfernt. Beide inmitten prachtvoller Natur, aber völlig gegensätzlich. Dort wie da verdient sie gut, manchmal sogar außergewöhnlich gut. Zwischen den Saisonen gönnt sie sich einige Monate zuhause in einem Dorf an der ungarischen Donau und betreibt dort ein Fachgeschäft für wenige Kunden. Die Ruhe und Beschaulichkeit dort erdet sie. Es ist eine andere Welt — ihre Welt.
Chiara ist aus ganz anderem Holz geschnitzt. Die vor Lebensfreude sprühende 24-jährige Kellnerin aus Zürich ist zum ersten Mal in Ischgl auf Wintersaison und arbeitet im Sommer zuhause am See. Auch das sind zwei gegensätzliche Welten.
So verrückte Monate wie diese hab ich noch nie erlebt, sagt Chiara: Es ist toll und schrecklich zugleich, ich hab ein chronisches Schlafdefizit, hab supergut verdient, bin aus Arbeiten und Nachfeiern nicht mehr herausgekommen. Und jetzt soll das alles mit einem Schlag vorbei sein? Ich bin fix und fertig.
Die Saison wäre in ein paar Wochen sowieso ausgelaufen, erwidert Agnes. Ich find’s gut, dass jetzt Schluss ist, ich will nicht krank werden, und ich will möglichst schnell nachhause.
Aber was tun wir jetzt? Was wird mit uns? Niemand kennt sich im Augenblick aus. Und klar, krank werden will ich auch nicht. Ich hoffe, der Kelch geht an mir vorbei.
Ischgl, im engen Tal, umgeben von einer einzigartig schönen Bergwelt. 1600 Einwohner, vor tausend Jahren besiedelt von Rätoromanen aus dem Engadin, im 13. Jahrhundert von Walsern. 1673 vom Feuer zerstört, ein Ort, der über Jahrhunderte seinem Namen völlig gerecht wurde: Das rätoromanische Wort Yscia, von dem er sich ableitet, bedeutet Insel.
Knappe dreihundert Jahre später ändert sich alles: 1963 wird die erste Seilbahn eröffnet. Eine Zeitenwende für die Region. Die Bergwelt, die das Paznaun bisher von der Außenwelt abgeschirmt hat, soll nun die Welt ins Tal bringen — und mit ihr den Wohlstand. Und wie sie das tut! Aus einem der ärmsten Dörfer Österreichs wird ein Partymekka für Skifahrer, in das in den vergangenen zehn Jahren 300 Millionen Euro an Investitionen geflossen sind.
Ischgl 2020: 1600 Einwohner, 390 Hotels, fast 12.000 offizielle Gästebetten und sagenhafte 1,5 Millionen Nächtigungen, dazu unzählige Tagestouristen.
Aus einer Seilbahn werden 45 Personenbeförderungsanlagen und 239 grenzüberschreitende Pistenkilometer. Immer größer, immer mehr, immer schneller — in einem atemberaubenden Tempo. Die Tourismusverantwortlichen nennen das eine nachhaltige Entwicklung.
Chiara weiß einiges über Ischgl. Als sie in den letzten Novembertagen kurz vor dem Saison-Opening hier eintrifft, kommt sie jedoch aus dem Staunen nicht mehr heraus. Mit der Abenddämmerung und nach dem Skifahren geht es für viele erst so richtig los. Tausende auf den Straßen, Tausende dichtgedrängt in den Lokalen, Unmengen an Alkohol. Ischgl ist zum Ibiza der Alpen geworden, es zeigt, was Après-Ski im Massenbetrieb sein kann. Gedränge, Schweiß, Schwerstarbeit, ohrenbetäubende Musik, Geschrei, betrunkene Gäste aus der ganzen Welt, von denen manche alle Hemmungen verlieren.
»Relax — if you can«, ist der Slogan der Tourismuswirtschaft.
»Best place to work«, lautet der Satz für die Beschäftigten. Mehr als fünftausend Arbeitskräfte braucht das Tal in der Wintersaison, und sie kommen aus fünfzig Nationen.9
So etwas habe ich noch nicht erlebt, sagt Chiara. Als gebe es kein Morgen. Es ist, als wären Tausende auf der Flucht. Für mich ist es eine kleine Goldgrube, ein gutes Einkommen, viel Trinkgeld. Und nach der Sperrstunde die eigene Party bis in die Morgendämmerung. Schon um Mitternacht denke ich oft, ich kann nicht mehr. Aber bis vier Uhr früh bin ich dann fast immer wieder so fit, dass ich doch wieder zum Feiern aufgelegt bin. Aufgedreht wie die Gäste. Und das seit über drei Monaten. Wahnsinn!
Du bist jung, du hältst das noch aus, sagt Agnes. Ich brauche mehr Schlaf als die paar Stunden zwischen Nachtkoma und Morgenkater. Bei mir ist auch die Kundschaft ruhig und müde. Sie lacht: Bei der Massage rieche ich die Getränke sofort, manche schlafen auch gleich ein.
Chiara kann sich das gut vorstellen. Und an die Wäsche gehen sie dir nicht?
Nein, sagt Agnes, bei mir landen nur die Müden. Und die Ruhigen, die wirklich nur wegen des Skifahrens und der großartigen Natur kommen. Die gibt es auch hier.
Aber ich habe mich in den letzten Jahren oft gefragt: Warum wird das immer schlimmer? Was ist los mit den Menschen? Warum kommen so viele hierher in die unfassbare Schönheit, um sich in einen Ausnahmezustand zu trinken? Ist es die Einsamkeit, oder was treibt sie sonst an, sich selbst so bloßzustellen?
Die beiden schweigen. Einige Minuten vergehen, bevor Chiara sagt: Mich wundert das alles gar nicht. Besser kannst du das Virus ja nicht pushen als durch Geschrei, Gedränge und Bierkrüge, die im Kreis herumgereicht werden.
Glaubst du, es ist wirklich so schlimm mit dem Coronavirus, wie jetzt in den Zeitungen steht? Ich brauche diese Saison. Was glaubst du, was bei uns in Zürich die kleinste Wohnung kostet?
Chiara nimmt einen Schluck von der Trinkschokolade, die bereits kalt geworden ist. Agnes betrachtet die junge, sympathische Frau.
Letzte Woche hat mir meine Mutter eine SMS geschickt, ich solle heimkommen, es wäre zu gefährlich hier. Dafür ist es jetzt zu spät, Mama, wollte ich schon antworten, aber da wäre sie erst recht in Hysterie verfallen. Ich hab sie daher beruhigt: Es geht mir gut, Mama.
Am 3. März wird Österreich von isländischen Behörden über Ansteckungsfälle informiert, die nach Aufenthalten in italienischen und österreichischen Wintersportgebieten aufgetreten sind. Tags darauf ist klar, dass auch Ischgl betroffen ist. Am 5. März erklärt Island die Tiroler Gemeinde zum Risikogebiet. Die Verantwortlichen verharmlosen noch am 8. März per Presseaussendung: »Eine Übertragung des Corona-Virus auf Gäste der Bar ist auch in medizinischer Sicht eher unwahrscheinlich.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: